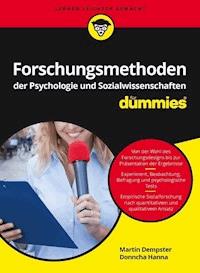Statistik und Forschungsmethoden für Psychologen und Sozialwissenschaftler für Dummies E-Book
Martin Dempster
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält alles, was Sie über Statistik wissen sollten. Regression, Korrelation und Varianzanalyse werden Ihnen bald sehr vertraut sein. Und die mathematischen Grundlagen dafür werden Ihnen gleich mitgeliefert. Sie brauchen also kein Vorwissen. Außerdem erhalten Sie eine kurze Einführung in SPSS und lernen die für Sie wichtigen Funktionen dieses umfangreichen Programms kennen. Und dann ist das Buch auch noch eine Einführung in Forschungsmethoden. Es begleitet Sie von der Wahl des Forschungsdesigns bis zur Präsentation der Ergebnisse. Mit dieser Rundum-Versorgung ist die nächste Prüfung fast ein Klacks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1036
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Schummelseite
Bei der Planung, Durchführung und Veröffentlichung einer Forschungsstudie gilt es, vieles zu bedenken. Diese Schummelseite soll Sie in kompakter Form an die wichtigsten Punkte erinnern, die Sie beachten müssen.
FORSCHUNGSETHIK IN DEN SOZIALWISSENSCHAFTEN
Für die Forschung im Bereich der Sozialwissenschaften gelten fünf ethische Prinzipien:
Wohltätigkeit und NichtschädigungVertrauen und VerantwortungIntegritätGerechtigkeitRespektDiese Grundsätze spiegeln sich in den fünf wesentlichen Elementen des Forschungsprozesses wider:
gültige Einwilligungserklärungen für die Teilnahme an der ForschungKenntnis des Rechts, die Studienteilnahme abzubrechenGewährleistung der Vertraulichkeit von Datenkeine Irreführung der Teilnehmer ohne gravierende Gründeausführliche Nachbesprechung am StudienendeVERSCHIEDENE ARTEN DER VALIDITÄT IN DER QUANTITATIVEN FORSCHUNG
In Tests der quantitativen sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es verschiedene Formen der Validität:
Augenscheinvalidität: Ein Test misst, was er zu messen vorgibt.Konvergente Validität: Ein Test liefert ähnliche Ergebnisse wie andere Tests, die dasselbe Konstrukt messen.Divergente Validität: Ein Test korreliert nicht mit Maßen, die in keinem theoretischen Zusammenhang mit dem Konstrukt stehen.Inhaltsvalidität: Ein Test misst jeden Aspekt des psychologischen Konstrukts, das zu messen er vorgibt.Konkurrente Validität: Ein Test korreliert wie vorhergesagt mit einem Kriterium oder Ergebnis, wobei beide Messungen gleichzeitig durchgeführt werden.Prädiktive Validität: Ein Test korreliert wie vorhergesagt mit einem Kriterium oder Ergebnis, wobei der Test jetzt durchgeführt und das Ergebnis erst später gemessen wird.Auch Studiendesigns können verschiedene Arten der Validität aufweisen:
Interne Validität: das Ausmaß, in dem das Studiendesign Schlussfolgerungen zu Ursache-Wirkungs-Beziehungen erlaubt.Externe Validität: das Ausmaß, in dem sich ein Studienergebnis auf eine größere Gruppe oder andere Bedingungen übertragen, also verallgemeinern lässt.QUALITÄT IN DER QUALITATIVEN FORSCHUNG GEWÄHRLEISTEN
Im Bereich der qualitativen Forschung sollten Sie besonders die folgenden Punkte bedenken:
Entscheiden Sie sich für eine geeignete Methode der Stichprobenauswahl.Beenden Sie die Aufnahme weiterer Teilnehmer, sobald Sie ausreichende Daten für eine aussagekräftige Auswertung erhoben haben.Bedenken Sie alle Faktoren, die sich auf die erhobenen Daten auswirken können.Planen Sie Zeit für das Transkribieren der Daten ein.Analysieren Sie Ihre Daten mit einem transparenten Prozess.Reflektieren Sie den Analyseprozess und dessen Beeinflussung durch Sie und andere äußere Umstände.Unterziehen Sie Ihre Analyse einer Glaubwürdigkeitsprüfung.Machen Sie sich mit den Daten vertraut. Eine gute qualitative Analyse beginnt immer mit dem Eintauchen in die Daten.Beziehen Sie Ihre Themen und Kategorien immer auf die Daten.Begründen Sie stets Ihre Interpretation.INHALTE FÜR EINEN FORSCHUNGSBERICHT ZUSAMMENSTELLEN
Wenn Sie einen Forschungsbericht erstellen, muss dieser folgende wesentliche Elemente umfassen:
Titel: maximal 15 WörterAbstract: kurze Zusammenfassung des Forschungsberichts (100 bis 230 Wörter)Einleitung: bestehend aus einem Überblick über das Thema, einer Literaturübersicht, einer Zielsetzung und einer HypotheseMethoden: beinhaltet Angaben zu Studiendesign, Teilnehmern und verwendeten Materialien, zur genauen Vorgehensweise und (meistens) zu den durchgeführten AnalysenErgebnisse: beantwortet die Forschungsfrage oder nennt das Prüfergebnis zu den Hypothesen samt den AnalyseergebnissenDiskussion: fasst die Ergebnisse zusammen und erörtert die Konsequenzen für frühere und zukünftige Forschungsarbeiten; benennt außerdem Einschränkungen der aktuellen ArbeitLiteraturverzeichnis: ist einheitlich formatiert (meist nach APA-Vorgaben) und enthält alle Arbeiten, auf die im Text Bezug genommen wirdGRUNDLEGENDE KONZEPTE DER STATISTIK
Wenn Sie Ihre Forschungsdaten veröffentlichen wollen und andere diese verstehen sollen, kommen Sie an Statistik nicht vorbei. Es folgen einige grundlegende Konzepte aus der Statistik.
DIE ROLLE VON VARIABLEN
Für Forschungsstudien, bei denen quantitative Daten gesammelt werden, müssen Sie diese Daten normalerweise in einem Tabellenkalkulationsblatt mit mehreren Variablen aufzeichnen. Ganz allgemein klassifizieren Sie Variablen in der Statistik als unabhängig, abhängig oder kovariant:
Eine unabhängige Variable ist eine Variable, die Sie manipulieren können, um zu untersuchen, wie sich ihre Veränderung auf die anderen Variablen auswirkt.Eine abhängige Variable ist eine Variable, für die Sie eine Änderung erwarten, wenn Sie die unabhängige Variable manipulieren. Mit anderen Worten: Die abhängige Variable ist die Variable, auf die sich die unabhängige Variable auswirkt.Als kovariante Variablen werden Variablen bezeichnet, bei denen es sich weder um eine unabhängige noch um eine abhängige Variable handelt. Bei bestimmten Studien können Sie eine kovariante Variable verwenden, um andere Faktoren zu berücksichtigen, die sich möglicherweise auf die Beziehung zwischen der unabhängigen und der abhängigen Variablen auswirken.MESSEIGENSCHAFTEN UND -NIVEAUS
Wenn Sie Variablen auf einem Datenblatt aufzeichnen, halten Sie diese in der Regel als Zahlen fest. Die Zahlen können jedoch unterschiedliche Messeigenschaften haben:
Größegleiche Intervalleechter absoluter NullpunktDas Messniveau einer Variablen ist ein Klassifizierungssystem, das Ihnen mitteilt, welche Messeigenschaften die Werte einer Variablen haben:
Nominal: Die Variable besitzt keine der drei Messeigenschaften. Sie messen eine Variable auf Nominalniveau, wenn Sie nur die Zahlen in der Variablen als Beschriftung verwenden.Ordinal: Die Werte in der Variablen haben nur die Messeigenschaft »Größe«. Sie messen eine Variable auf ordinalem Niveau, wenn die Werte in der Variablen sortierte Rangfolgen darstellen.Intervall: Die Variable hat die Messeigenschaften »Größe« und »gleiche Intervalle«.Skala: Die Variable hat alle drei Messeigenschaften.DAS RICHTIGE LAGEMAß
Wenn Sie eine Variable in einem Forschungsbericht beschreiben, müssen Sie wissen, welches der drei Lagemaße Sie verwenden sollten – Modalwert, Median oder Mittelwert. Das am besten geeignete Lagemaß einer Variablen hängt von zwei Faktoren maßgeblich ab: dem Messniveau und der Verteilung der Werte (gibt es Extremwerte? Ist die Verteilung der Werte schief?). Wenn Sie das Messniveau Ihrer Variablen bestimmt haben und wissen, ob eine Schiefe und/oder Extremwerte in Ihrer Datenmenge vorliegen, können Sie das am besten geeignete Lagemaß wie folgt bestimmen:
Daten werden auf nominaler Ebene gemessen: Von den drei Lagemaßen ist nur der Modalwert geeignet.Daten werden auf ordinaler Ebene gemessen: Der Modalwert und der Median sind geeignet. Der Median ist im Allgemeinen zu bevorzugen, weil er informativer als der Modalwert ist.Daten werden auf Intervall-/Skalenebene gemessen: Alle drei Lagemaße sind geeignet. Der Mittelwert ist im Allgemeinen zu bevorzugen. Wenn in Ihrer Datenmenge jedoch Extremwerte und/oder eine Schiefe vorliegen, ist der Medianwert besser geeignet.DAS RICHTIGE STREUUNGSMAß
Streuungsmaße zeigen die Variabilität der gemessenen Variablen. Die drei wichtigsten Streuungsmaße sind wie folgt definiert:
Der Bereich ist die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert innerhalb einer Variablen. (Dabei handelt es sich um die von den Teilnehmern angegebenen Werte und nicht unbedingt um die möglichen höchsten beziehungsweise niedrigsten Werte.)Der Interquartilabstand ist die Differenz zwischen der oberen und der unteren Quartile in einer Menge sortierter Werte. Quartile bilden Sie, indem Sie eine Menge sortierter Werte in vier gleichgroße Gruppen unterteilen.Die Standardabweichung für eine bestimmte Variable ist die durchschnittliche Abweichung ihrer Werte vom Mittelwert. (Der Mittelwert ist der Durchschnitt aller Werte für eine Variable.)In Abhängigkeit vom Messniveau Ihrer Variablen bestimmen Sie das am besten geeignete Streuungsmaß wie folgt:
Daten werden auf nominaler Ebene gemessen: Keines der drei Streuungsmaße ist geeignet.Daten werden auf ordinaler Ebene gemessen: Der Bereich und der Interquartilabstand sind geeignet. Der Interquartilabstand ist im Allgemeinen zu bevorzugen, weil er aussagekräftiger ist.Daten werden auf Intervall-/Skalenebene gemessen: Alle drei Streuungsmaße sind geeignet. Die Standardabweichung ist im Allgemeinen zu bevorzugen. Wenn in Ihrer Datenmenge jedoch Extremwerte oder eine Schiefe vorliegen, ist der Interquartilabstand besser geeignet.Statistik und Forschungsmethoden für Psychologen und Sozialwissenschaftler für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2019© 2019 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Original English language edition Research Methods in Psychology For Dummies © 2015 by John Wiley & Sons, Ltd., Original English language edition Psychology Statistics for Dummies © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Research Methods in Psychology For Dummies © 2015 by John Wiley & Sons, Ltd., Copyright der englischsprachigen Originalausgabe Psychology Statistics for Dummies © 2012 John Wiley & Sons, Ltd.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Diese Übersetzung wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Viele Abbildungen sind Screenshots von SPSS (IBM SPSS Statistics Software). Wir danken IBM für die Genehmigung, diese abzudrucken. Reprint Courtesy of International Business Machines Corporation © International Business Machines Corporation. IBM, the IBM logo, ibm.com, and SPSS are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation, registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the Web at IBM Copyright and trademark information at www.ibm.com/legal/copytrade.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © 123dartist – stock.adobe.comLektorat: Tobias SchwaiboldKorrektur: Ilona Hauser, Claudia Lötschert
Print ISBN: 978-3-527-71553-4ePub ISBN: 978-3-527-81908-9
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Einleitung
Über dieses Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Forschungsmethoden kennenlernen
Kapitel 1: Forschung und wozu sie dient
Was Forschung ist
Sinn der empirischen Forschung
Forschen in der Psychologie und den empirischen Sozialwissenschaften
Verschiedene Forschungsmethoden kennenlernen
Kapitel 2: Reliabilität und Validität
Die Validität von Studien beurteilen
Die Reliabilität von Studien
Reliabilität und Validität von Tests
Kapitel 3: Forschungsethik
Ethik verstehen
Keinen Schaden zufügen
Forschungsethik
bei Studien mit menschlichen Teilnehmern
Wahrung der wissenschaftlichen Integrität
Der Antrag bei der Ethikkommission
Teil II: Externe Validität verbessern
Kapitel 4: Erhebungsdesigns und -methoden
Erhebungsdesigns verstehen
Erhebungsmethoden
Möglichst natürliche Gestaltung von Studien
Kapitel 5: Methoden für die Stichprobenauswahl
Stichproben und Grundgesamtheiten
Verschiedene Möglichkeiten der Stichprobenauswahl
Auch gute Stichproben können »schlecht werden«
Kapitel 6: Fragebogen und psychometrische Tests
Messen psychologischer Variablen
Auswahl eines bereits vorhandenen Fragebogens
Entwickeln eines Fragebogens
Einzelbefragungen im Vergleich zu Gruppenbefragungen
Teil III: Interne Validität verbessern
Kapitel 7: Einfache Versuchsdesigns (Experimentaldesigns)
Versuchsdesigns verstehen
Einfache Versuchsdesigns
Gedanken zum Messwiederholungsdesign (oder: Warum man einen Prätest braucht)
Unabhängige-Gruppen-Designs
Das Beste aus beiden Welten: Prätest und Vergleichsgruppen kombinieren
Randomisierte kontrollierte Studien
Vorsicht bei quasi-experimentellen Versuchsdesigns
Kapitel 8: Komplexere Versuchsdesigns
Studien mit mehr als zwei Bedingungen durchführen
Realistische Hypothesen mit faktoriellen Versuchsdesigns prüfen
Kovariate verstehen
Gefahren, die beim Prätest lauern
Kapitel 9: Kleine experimentelle Studien
Versuche mit kleinen Stichproben durchführen
Designs mit unterbrochener Zeitreihe
Designs mit mehreren Ausgangswerten
Analyse von experimentellen Studien mit kleinen Stichproben
Kleine Studien, die keine Experimente sind
Teil IV: Qualitative Forschung
Kapitel 10: Qualität in der qualitativen Forschung
Qualitative Forschung verstehen
Stichprobenauswahl in der qualitativen Forschung
Qualitative Daten erheben
Qualitative Daten transkribieren
Kapitel 11: Qualitative Daten analysieren
Grundsätze der Analyse qualitativer Daten
Ein Beispiel: Die thematische Analyse
Kapitel 12: Theoretische Ansätze und Methodik in der qualitativen Forschung
Erfahrungsorientierte und diskursive Ansätze im Vergleich
Interpretierende phänomenologische Analyse
Die Grounded Theory verstehen
Teil V: Forschungsarbeiten dokumentieren und veröffentlichen
Kapitel 13: Einen Forschungsbericht schreiben
Titelfindung
Konzentration auf den Abstract
Aufbau der Einleitung
Beschreibung der Methoden
Darstellung der Ergebnisse
Durchdringen der Diskussion
Das Literaturverzeichnis
Ergänzende Informationen in Anhängen
Kapitel 14: Forschungsergebnisse präsentieren
Ein Poster ist kein Forschungsbericht
Posterpräsentationen
Packende Vorträge halten
Kapitel 15: APA-Richtlinien für Forschungsberichte
Den APA-Stil anwenden
Warum, was und wann zitieren?
Literatur in einem Forschungsbericht zitieren
Gestaltung des Literaturverzeichnisses
Zahlen richtig verwenden und formatieren
Teil VI: Das Exposé
Kapitel 16: Literaturrecherche
Wozu eine Literaturübersicht dient
Literatur für eine Übersicht finden
Gefundene Arbeiten beschaffen
Literaturdaten elektronisch speichern
Kapitel 17: Berechnung des Stichprobenumfangs
Effekte messen
Effektstärken schätzen
Studien mit geeigneter statistischer Teststärke durchführen
Den Stichprobenumfang schätzen
Kapitel 18: Ein Exposé erarbeiten
Ideen für ein Forschungsprojekt entwickeln
Die Machbarkeit einer Forschungsidee prüfen
Ein Exposé schreiben
Teil VII: Daten beschreiben
Kapitel 19: Statistik? Ich dachte, es geht um Psychologie!
Machen Sie sich ein Bild von Ihren Variablen
Was ist SPSS?
Deskriptive Statistik
Inferentielle oder analytische Statistik
Forschungsdesigns
Die ersten Schritte
Kapitel 20: Mit welchem Typ Daten haben wir es zu tun?
Diskrete und stetige Variablen
Verschiedene Messniveaus
Rollenbestimmung für Variablen
Kapitel 21: Alle Daten rein in SPSS
Die Variablenansicht
Das Datenansicht-Fenster
Ausgabefenster
Kapitel 22: Lagemaße
Grundlagen für das Lagemaß
Der Modalwert
Der Median
Der Mittelwert
Die Qual der Wahl: Modalwert, Median oder Mittelwert?
Kapitel 23: Streuungsmaße
Zur Definition der Streuung
Der Bereich
Interquartilabstand
Standardabweichung
Die freie Wahl zwischen Bereich, Interquartilabstand und Standardabweichung
Kapitel 24: Grafiken und Diagramme
Histogramme
Balkendiagramme
Kreisdiagramme
Boxplots
Teil VIII: Statistische Signifikanz
Kapitel 25: Wahrscheinlichkeit und Inferenz
Statistische Inferenz genauer betrachtet
Wahrscheinlichkeit verstehen
Kapitel 26: Hypothesen testen
Null- und Alternativhypothesen verstehen
Fehler bei der statistischen Inferenz
Ein- und zweiseitige Hypothesen
Konfidenzintervalle
Kapitel 27: Was ist bei der Normalverteilung eigentlich normal?
Die Normalverteilung verstehen
Bestimmung der Schiefe
Normalverteilung und inferentielle Statistik
Kapitel 28: Standardisierte Werte
Die Grundlagen der standardisierten Werte
Z
-Werte in der statistischen Analyse
Kapitel 29: Effektgröße und Teststärke
Zwischen Effektgröße und statistischer Signifikanz unterscheiden
Die Effektgröße für Korrelationen untersuchen
Die Effektgröße beim Vergleich der Unterschiede zwischen zwei Wertemengen
Die Effektgröße für Unterschiede zwischen mehr als zwei Wertemengen
Statistische Teststärke verstehen
Teil IX: Beziehungen zwischen Variablen
Kapitel 30: Korrelationen
Mit Streudiagrammen Beziehungen bewerten
Den Korrelationskoeffizienten verstehen
Gemeinsame Varianz untersuchen
Die Pearson-Korrelation
Die Spearman-Korrelation
Die Kendall-Korrelation
Partielle Korrelationen
Kapitel 31: Lineare Regression
Grundlagen der Regression
Einfache Regression
Regression mit mehreren Variablen
Die Voraussetzungen für die Regression überprüfen
Kapitel 32: Zusammenhänge zwischen diskreten Variablen
Eine Kontingenztabelle zur Zusammenfassung der Ergebnisse
Berechnung von Chi-Quadrat
Die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen messen
Der McNemar-Test
Teil X: Forschungsdesigns zur Analyse unabhängiger Gruppen
Kapitel 33: Unabhängige t-Tests und Mann-Whitney-Tests
Designs für unabhängige Gruppen
Der unabhängige
t
-Test
Mann-Whitney-Test
Kapitel 34: ANOVA zwischen Gruppen
Einfache ANOVA zwischen Gruppen
Zweifache ANOVA zwischen Gruppen
Kruskal-Wallis-Test
Kapitel 35: Post-hoc-Tests und geplante Vergleiche für Designs mit unabhängigen Gruppen
Post-hoc-Tests für Designs mit unabhängigen Gruppen
Teil XI: Analysen für Forschungsdesigns mit wiederholten Messungen
Kapitel 36: Abhängige t-Tests und Wilcoxon-Tests
Design mit wiederholten Messungen
Abhängiger
t
-Test
Der Wilcoxon-Test
Kapitel 37: ANOVA innerhalb von Gruppen
Einfache ANOVA innerhalb von Gruppen
Zweifache ANOVA innerhalb von Gruppen
Der Friedman-Test
Kapitel 38: Post-hoc-Tests und geplante Vergleiche für Designs mit wiederholten Messungen
Post-hoc-Tests für Designs mit wiederholten Messungen
Geplante Vergleiche für Designs innerhalb von Gruppen
Unterschiede zwischen Bedingungen untersuchen: Die Bonferroni-Korrektur
Kapitel 39: Gemischte ANOVA
Die gemischte ANOVA kennenlernen
Haupteffekte und Interaktionen
Durchführung der gemischten ANOVA in SPSS
Teil XII: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 40: Zehn Stolperfallen, die Sie bei der Stichprobenauswahl vermeiden sollten
Zufallsstichproben und zufällige Zuteilung sind nicht dasselbe
Zufällig bedeutet systematisch
In der quantitativen Forschung ist die Stichprobenauswahl immer wichtig
Die Zufallsstichprobe ist nicht alles
In der quantitativen Forschung ist die zufällige Stichprobenauswahl (fast) immer am besten
Forschung ist nicht immer schlecht, nur weil keine Zufallsstichprobe vorliegt
Zufallsstichproben müssen groß sein
Je größer die Stichprobe, desto besser – in Maßen
Keine Ausreden bei kleinen Stichproben
Vermeiden Sie es, Offenkundiges zu erklären
Kapitel 41: Zehn Tipps für Forschungsberichte
Für Einheitlichkeit sorgen
Die eigene Frage beantworten
Eine Geschichte erzählen
Wissen, mit wem man es zu tun hat
Den Text fließen lassen
Zusammenfassen will gekonnt sein
Kritisch, aber nicht fatalistisch sein
Redundanz ist redundant
Kleinigkeiten gründlich und mehrfach prüfen
Korrekturlesen muss sein
Kapitel 42: Zehn gute Ratschläge für inferentielles Testen
Statistische Statistik ist nicht dasselbe wie praktische Signifikanz
Ohne Vorbereitung ist der Fehler vorprogrammiert
Suchen Sie nicht nach einem beliebigen signifikanten Ergebnis
Überprüfen Sie Ihre Voraussetzungen
Mein
p
ist größer als dein
p
Unterschiede und Beziehungen sind keine entgegengesetzten Trends
Wo ist mein Post-hoc-Test hingekommen?
Stetige Daten kategorisieren
Seien Sie konsistent
Lassen Sie sich helfen!
Kapitel 43: Zehn Tipps für das Zitieren Ihrer Ergebnisse
Den
p
-Wert zitieren
Andere Zahlen zitieren
Vergessen Sie die deskriptiven Statistiken nicht
Verwenden Sie den Mittelwert nicht zu häufig
Zitieren von Effektgrößen und der Richtung der Effekte
Fehlende Teilnehmer
Seien Sie vorsichtig mit der Sprache
Trennen Sie Korrelationen und Kausalität
Beantworten Sie Ihre eigene Frage
Schaffen Sie Struktur
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Verteilung der Grundgesamtheit der Psychologiestudenten auf die interessierten Untergruppen
Tabelle 5.2: Verteilung der Stichprobe der Psychologiestudenten auf die interessierten Untergruppen
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Zusammenstellung von Angaben zur Reliabilität und Validität verschiedener Fragebogen zum Selbstwertgefühl
Tabelle 6.2: Zusätzliche Angaben zur Empfindlichkeit verschiedener Fragebogen zum Selbstwertgefühl
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Mittelwertbildung für die Werte aus Abbildung 9.2 zur Bestimmung des Niveaus
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Beschreibende Statistik für die Differential Emotions Scale-IV
Tabelle 13.2: Beschreibende Statistik für Männer und Frauen auf der Differential Emotions Scale-IV für Scham
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Hypothesen anhand statistischer Tests beurteilen
Kapitel 21
Tabelle 21.1: Sport bei Menschen mit Lebertransplantation
Kapitel 22
Tabelle 22.1: Depressionswerte für Männer und Frauen
Tabelle 22.2: Sortierte Depressionswerte für Männer und Frauen
Tabelle 22.3: Für Männer und Frauen separat sortierte Depressionswerte
Tabelle 22.4: Vor- und Nachteile des Modalwerts
Tabelle 22.5: Vor- und Nachteile des Medians
Tabelle 22.6: Vor- und Nachteile des Mittelwerts
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Vorteile und Nachteile des Bereichs
Tabelle 23.2: Vor- und Nachteile des Interquartilabstands
Tabelle 23.3: Depressionswerte und ihre Abweichung vom Mittelwert
Tabelle 23.4: Depressionswerte und ihre quadrierten Abweichungen vom Mittelwert
Tabelle 23.5: Vor- und Nachteile der Standardabweichung
Kapitel 24
Tabelle 24.1: Interessenwerte der Studenten an Werbebotschaften bezüglich Alkoholverzichts im Straßenverkehr
Tabelle 24.2: Interessenwerte der Studenten an Werbebotschaften bezüglich Alkoholverzichts im Straßenverkehr und normalerweise verwendete Transportmittel
Tabelle 24.3: Umwandlung von Häufigkeiten in relative Häufigkeiten
Kapitel 25
Tabelle 25.1: Reaktionszeit und Geschlecht von 100 Babys
Kapitel 26
Tabelle 26.1: Schlussfolgerungen aus inferentiellen statistischen Tests ableiten
Tabelle 26.2: Noten in der Statistikprüfung
Kapitel 27
Tabelle 27.1: Geschätzte Lebenserwartung von Rauchern (nach eigener Beurteilung)
Kapitel 29
Tabelle 29.1: Bewertungen für Männer und Frauen in einem Fahrtest
Tabelle 29.2: Bewertung der positiven Stimmung mit und ohne Schokolade
Kapitel 31
Tabelle 31.1: Regressionsmodell mit der Prüfungsnote als Kriteriumsvariable
Kapitel 32
Tabelle 32.1: Kontingenztabelle für Geschlecht und präzises Erinnern einer Telefonnummer
Tabelle 32.2: Berechnung der Prozentwerte basierend auf den Zeilensummen
Tabelle 32.3: Berechnung der Prozentwerte basierend auf den Spaltensummen
Tabelle 32.4: Kontingenztabelle mit den erwarteten Häufigkeiten (und beobachteten Häufigkeiten)
Tabelle 32.5: Kontingenztabelle mit beobachteten minus erwarteten Häufigkeiten
Tabelle 32.6: Kontingenztabelle mit beobachteten minus erwarteten Häufigkeiten, quadriert und durch die erwarteten Häufigkeiten dividiert
Tabelle 32.7: Kontingenztabelle mit Odds basierend auf Spalten
Tabelle 32.8: Diese Kontingenztabelle zeigt Änderungen der Absicht, einen Softdrink zu kaufen, bevor und nachdem eine Werbung angesehen wurde.
Kapitel 34
Tabelle 34.1: Bewertungen eines Intelligenztests
Tabelle 34.2: Quadrierte Abweichungen vom Gruppenmittelwert
Tabelle 34.3: Ergebnisse der zweifachen ANOVA zitieren
Kapitel 37
Tabelle 37.1: Schmerztherapiebewertungen für die drei Bedingungen
Tabelle 37.2: Quadrierte Abweichungen vom individuellen Mittelwert
Tabelle 37.3: Schreiben Sie sich auf, in welcher Reihenfolge Sie die Variablen benannt haben.
Tabelle 37.4: Das Ergebnis Ihrer zweifachen ANOVA zitieren
Kapitel 38
Tabelle 38.1: Interpretation der Tabelle PAARWEISE VERGLEICHE
Kapitel 39
Tabelle 39.1: Ihr zweifaches ANOVA-Ergebnis zitieren
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Beispiel für unabhängige und abhängige Variablen;
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Erhebungsdesigns;
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Verschiedene Methoden der Stichprobenauswahl;
Abbildung 5.2: Anlegen einer Liste von Personen in SPSS;
Abbildung 5.3: Der Befehl Fälle Auswählen in SPSS;
Abbildung 5.4: Auswahl der Schaltfläche Stichprobe im Befehlsfenster zu Fälle auswählen in SPSS;
Abbildung 5.5: Angeben des auszuwählenden Stichprobenumfangs in SPSS;
Abbildung 5.6: Kennzeichnung der ausgewählten Stichprobe in SPSS;
Abbildung 5.7: Anlegen einer Liste von Personen in Excel
Abbildung 5.8: Eingeben der Zufallszahlenfunktion im Funktionsfeld in Excel
Abbildung 5.9: Erstellen einer Serie zufällig erzeugter Zahlen in Excel
Abbildung 5.10: Sortieren von Werten in Excel
Abbildung 5.11: Zufällig geordnete Liste von Zahlen in Excel
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Offene und geschlossene Items;
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Modell eines Messwiederholungsdesigns;
Abbildung 7.2: Untersuchung von Techniken zur Verbesserung der Einstellung zur Arbeit mit Personen mit Zwangserkrankungen;
Abbildung 7.3: Ein leeres lateinisches Quadrat für drei Versuchsbedingungen;
Abbildung 7.4: Ein teilweise ausgefülltes lateinisches Quadrat;
Abbildung 7.5: Ein vollständiges lateinisches Quadrat;
Abbildung 7.6: Modell eines Unabhängige-Gruppen-Versuchsdesigns;
Abbildung 7.7: Modellhafte Darstellung einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT);
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Beispiel für einen Interaktionseffekt;
Abbildung 8.2: Interpretation von Haupteffekten und Interaktionseffekten;
Abbildung 8.3: Beispiel für ein Solomon-Vier-Gruppen-Design;
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Ein Design mit unterbrochener Zeitreihe;
Abbildung 9.2: Ein Design mit unterbrochener Zeitreihe mit einem Komparator (Vergleich);
Abbildung 9.3: Ein ABA-Design;
Abbildung 9.4: Ein ABAB-Design;
Abbildung 9.5: Ein Design mit mehreren Ausgangswerten bei verschiedenen Fällen;
Abbildung 9.6: Ein Design mit mehreren Ausgangswerten bei verschiedenen Zielgrößen;
Abbildung 9.7: Ein Design mit mehreren Ausgangswerten bei verschiedenen Settings;
Abbildung 9.8: Mithilfe von Trendlinien Daten in Diagrammen interpretieren;
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Wahl einer qualitativen Methodik;
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Typische Struktur für ein Poster;
Abbildung 14.2: Typische Struktur für ein Poster;
Kapitel 16
Abbildung 16.1: PsycNET-Suchmaske;
Abbildung 16.2: Thesaurus-Einträge in PsycNET, die dem Suchwort
diet
ähnlich sind;
Abbildung 16.3: Der ausgeklappte Oberbegriff
eating behavior
in PsycNET;
Abbildung 16.4: Die hierarchische Struktur des PsycNET- und PsycINFO-Thesaurus um den Oberbegriff
eating behavior
herum;
Abbildung 16.5: Startseite des Leibniz-Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) mit der Suchmaschine PsychSpider
Abbildung 16.6: Erweiterte Suche der ZPID-Suchmaschine PsychSpider
Abbildung 16.7: Eine einfache Suche in Web of Science durchführen;
Abbildung 16.8: Suchen in Web of Science kombinieren;
Abbildung 16.9: Suchen in Web of Science einschränken;
Abbildung 16.10: Suchen in Web of Science auf eine bestimmte Sprache begrenzen;
Abbildung 16.11: Eine Suche in Google Scholar durchführen;
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Ausarbeitung eines Exposés;
Kapitel 21
Abbildung 21.1: Die Variablenansicht in SPSS
Abbildung 21.2: Variablennamen in SPSS eingeben
Abbildung 21.3: Auswahl des Variablentyps
Abbildung 21.4: Variablenbeschriftungen in SPSS
Abbildung 21.5: Änderung der Wertbeschriftungen im Variablenansicht-Fenster
Abbildung 21.6: Wertbeschriftungen in SPSS hinzufügen
Abbildung 21.7: Änderung der Angabe für fehlende Werte in der Variablenansicht
Abbildung 21.8: Angabe für fehlende Daten in SPSS
Abbildung 21.9: Auswahl des Messniveaus für eine Variable
Abbildung 21.10: Das vollständig ausgefüllte Variablenansicht-Fenster
Abbildung 21.11: Das Datenansicht-Fenster in SPSS
Abbildung 21.12: Aufbau der Daten in SPSS
Abbildung 21.13: In SPSS eine Variable einfügen
Abbildung 21.14: Die Prozedur FÄLLE SORTIEREN
Abbildung 21.15: Auswahl einer Variablen, um nach Fällen zu sortieren
Abbildung 21.16: Nach der Zeit sortierte Daten
Abbildung 21.17: Der Befehl für das Umcodieren von Daten in SPSS
Abbildung 21.18: Auswahl der umzucodierenden Variablen
Abbildung 21.19: Die neue Variable erhält beim Umcodieren einen neuen Namen
Abbildung 21.20: Angabe der neuen und der alten Werte für die Prozedur zum Umcodieren
Abbildung 21.21: Die fertige Umcodierungsvorschrift
Abbildung 21.22: Die neue Variable, die mit dem Befehl zum Umcodieren erstellt wurde
Abbildung 21.23: Das Bearbeitungsfenster in einer SPSS-Ausgabedatei
Abbildung 21.24: Die Farbe oder das Muster eines Diagramms ändern
Abbildung 21.25: Einem Diagramm ein Muster hinzufügen
Kapitel 22
Abbildung 22.1: Wählen Sie den Befehl HÄUFIGKEITEN aus, um Lagemaße zu berechnen
Abbildung 22.2: Wählen Sie eine Variable aus, um ein Lagemaß zu erstellen
Abbildung 22.3: Auswahl des Modalwerts
Abbildung 22.4: Modalwert in SPSS
Abbildung 22.5: Der Befehl AUFGETEILTE DATEI in SPSS
Abbildung 22.6: Aufteilung der Datei nach dem Geschlecht
Abbildung 22.7: Der Modalwert in SPSS für aufgeteilte Gruppen
Abbildung 22.8: Bestimmung des Medianwerts in einer Menge sortierter Werte
Abbildung 22.9: Bestimmung des Medians für separate Gruppen
Abbildung 22.10: Der in SPSS ermittelte Medianwert
Abbildung 22.11: Der Medianwert in SPSS für separate Gruppen
Abbildung 22.12: Der in SPSS bestimmte Mittelwert
Abbildung 22.13: Anzeige des Mittelwerts in SPSS für separate Gruppen
Kapitel 23
Abbildung 23.1: Mit dem Befehl HÄUFIGKEITEN erzeugen Sie Streuungsmaße
Abbildung 23.2: Auswahl einer Variablen, für die Sie ein Streuungsmaß erzeugen
Abbildung 23.3: Auswahl des Bereichs
Abbildung 23.4: Der in SPSS gezeigte Bereich bzw. die Spannweite
Abbildung 23.5: Der Bereich in SPSS für aufgeteilte Gruppen
Abbildung 23.6: Bestimmung des unteren und oberen Quartils in einer Menge sortierter Werte
Abbildung 23.7: Bestimmung der oberen und unteren Quartile für separate Gruppen
Abbildung 23.8: Die in SPSS angezeigten Quartile
Abbildung 23.9: Die in SPSS für separate Gruppen angezeigten Quartile
Abbildung 23.10: Die Standardabweichung in SPSS
Abbildung 23.11: Die Standardabweichung in SPSS für separate Gruppen
Kapitel 24
Abbildung 24.1: Histogramme, die den möglichen Wertebereich (oberes Diagramm) und den tatsächlichen Wertebereich (unteres Diagramm) darstellen
Abbildung 24.2: Histogramm mit Balken, die jeweils einen einzelnen Wert statt eines Wertebereichs darstellen
Abbildung 24.3: Histogramm mit angepasster vertikaler Achse
Abbildung 24.4: Auswahl des Befehls HÄUFIGKEITEN, um Diagramme zu erstellen
Abbildung 24.5: Auswahl einer Variablen, um ein Diagramm zu erstellen
Abbildung 24.6: Auswahl des Diagrammtyps Histogramm
Abbildung 24.7: Ein Histogramm in SPSS
Abbildung 24.8: Balkendiagramm, das die Häufigkeit der Transportkategorien anzeigt
Abbildung 24.9: Ein Balkendiagramm in SPSS
Abbildung 24.10: Ein Kreisdiagramm
Abbildung 24.11: Ein Boxplot für die Interessenwerte
Abbildung 24.12: Ein Boxplot mit moderatem Ausreißer
Abbildung 24.13: Ein Boxplot mit einem extremen Ausreißer
Abbildung 24.14: Erstellen eines Boxplots in SPSS
Abbildung 24.15: Definition des Boxplot-Typs
Abbildung 24.16: Wählen Sie die Variable aus, für die Sie einen Boxplot erstellen wollen
Abbildung 24.17: Ein Boxplot in SPSS
Kapitel 26
Abbildung 26.1: Auswahl der explorativen Datenanalyse in SPSS
Abbildung 26.2: Auswahl einer Variablen für ein 95-%-Konfidenzintervall
Abbildung 26.3: Anforderung eines 95-%-Konfidenzintervalls in SPSS
Abbildung 26.4: 95-%-Konfidenzintervall in SPSS
Kapitel 27
Abbildung 27.1: Die Normalverteilung
Abbildung 27.2: Auswahl des Kolmogorow-Smirnow-Tests in SPSS
Abbildung 27.3: Auswahl einer Variablen für den Kolmogorow-Smirnow-Test
Abbildung 27.4: Der Kolmogorow-Smirnow-Test in SPSS
Abbildung 27.5: Schiefe aufgrund von Ausreißern (a) und inhärente Schiefe (b)
Abbildung 27.6: Moderate und schwere Schiefe in einem Histogramm
Abbildung 27.7: Moderate und schwere Schiefe, dargestellt in einem Box-Whisker-Plot
Abbildung 27.8: Der Befehl Häufigkeiten in SPSS
Abbildung 27.9: Auswahl einer Variablen, für die die Statistik für die Schiefe berechnet werden soll
Abbildung 27.10: Bestimmung der Schiefe-Statistik in SPSS
Abbildung 27.11: Anzeige der Schiefe in SPSS
Abbildung 27.12: Die Wahrscheinlichkeit unter einer Normalverteilung
Kapitel 28
Abbildung 28.1: Auswahl der deskriptiven Statistik in SPSS
Abbildung 28.2: Standardisierung von Werten in SPSS
Abbildung 28.3: Eine standardisierte Variable in SPSS
Abbildung 28.4: Die Standardnormalverteilung
Abbildung 28.5: Wahrscheinlichkeit für zwei t-Wert-Verteilungen
Kapitel 29
Abbildung 29.1: Vergleich der Mittelwerte für unabhängige Gruppen in SPSS
Abbildung 29.2: Auswahl der Variablen für die Berechnung von Eta-Quadrat
Abbildung 29.3: Auswahl für die Effektgröße in SPSS für mehr als zwei unabhängige Gruppen
Abbildung 29.4: Eta-Quadrat für unabhängige Gruppen in SPSS
Abbildung 29.5: Auswahl einer Analyse mit wiederholten Messungen in SPSS
Abbildung 29.6: Definition der zu analysierenden wiederholten Messungen
Abbildung 29.7: Auswahl der Variablen der wiederholten Messung für die Analyse
Abbildung 29.8: Auswahl der Effektgröße in SPSS für mehr als zwei wiederholte Messungen
Abbildung 29.9: Berechnung von Eta-Quadrat in SPSS
Kapitel 30
Abbildung 30.1: Ein Streudiagramm, das eine perfekte lineare Beziehung zeigt
Abbildung 30.2: Ein Streudiagramm mit einer starken positiven linearen Beziehung
Abbildung 30.3: Ein Streudiagramm mit einer starken negativen linearen Beziehung
Abbildung 30.4: Eine starke positive Beziehung in einer großen Datenmenge
Abbildung 30.5: Ein Diagramm, das eine starke positive Beziehung zeigt, wobei eine der Variablen ordinal ist
Abbildung 30.6: Ein Streudiagramm in SPSS zeichnen
Abbildung 30.7: Auswahl eines einfachen Streudiagramms in SPSS
Abbildung 30.8: Angabe der Variablen für ein Streudiagramm
Abbildung 30.9: Überprüfen Sie Ihr Streudiagramm immer auf Ausreißer!
Abbildung 30.10: Ein Streudiagramm für die Klausurbenotungen und die Übungsstunden
Abbildung 30.11: Eine bivariate Korrelation in SPSS ermitteln
Abbildung 30.12: Bestimmung einer Pearson-Korrelation
Abbildung 30.13: Die von SPSS erzeugte Pearson-Korrelationstabelle
Abbildung 30.14: Ein Streudiagramm für die Bewertungen des Therapieerfolgs und die Absicht, ein Verhalten fortzusetzen
Abbildung 30.15: Die von SPSS erzeugte Spearman-Korrelationstabelle
Abbildung 30.16: Ein Streudiagramm für die beiden Aussagen der IES-Umfrage
Abbildung 30.17: Eine bivariate Korrelation in SPSS berechnen
Abbildung 30.18: Auswahl der Kendall-Korrelation
Abbildung 30.19: Die von SPSS erzeugte Kendall-Korrelationstabelle
Abbildung 30.20: Berechnung einer partiellen Korrelation in SPSS
Abbildung 30.21: Eine partielle Korrelation spezifizieren
Abbildung 30.22: Die von SPSS erzeugte partielle Korrelationstabelle
Kapitel 31
Abbildung 31.1: Ein Streudiagramm für Übungsstunden und Prüfungsnoten
Abbildung 31.2: Ein Streudiagramm mit Regressionslinie für Übungsstunden und Prüfungsnoten
Abbildung 31.3: Darstellung von Residuen
Abbildung 31.4: Eine lineare Regression in SPSS ermitteln
Abbildung 31.5: Eine einfache lineare Regression bestimmen
Abbildung 31.6: Tabelle der eingegebenen Variablen
Abbildung 31.7: Tabelle Modellzusammenfassung
Abbildung 31.8: ANOVA-Tabelle
Abbildung 31.9: Die Koeffizienten-Tabelle
Abbildung 31.10: Ein Mehrfachregressionsmodell
Abbildung 31.11: Spezifikation einer Mehrfachregression
Abbildung 31.12: Tabelle mit den eingegebenen Variablen
Abbildung 31.13: Die Tabelle mit der Modellzusammenfassung
Abbildung 31.14: ANOVA-Tabelle
Abbildung 31.15: Die Koeffizienten-Tabelle
Abbildung 31.16: Ein Histogramm der Residuen erstellen
Abbildung 31.17: Das Histogramm der Residuen bewerten
Abbildung 31.18: Ein partielles Diagramm erzeugen
Abbildung 31.19: Partielle Diagramme bewerten, Teil 1
Abbildung 31.20: Partielle Diagramme bewerten, Teil 2
Abbildung 31.21: Beispiele für Distanz- und Einfluss-Ausreißer
Abbildung 31.22: Die Tabelle für die fallweise Diagnose erstellen
Abbildung 31.23: Tabelle für die fallweise Diagnose
Abbildung 31.24: Cook-Distanzen und Hebelwerte ermitteln
Abbildung 31.25: Tabelle für die Residuen-Statistik
Abbildung 31.26: Zahlen zur Kollinearität ermitteln
Abbildung 31.27: Interpretation von Kollinearitätswerten in der Koeffizienten-Tabelle
Abbildung 31.28: Ein Diagramm für die Bewertung der Homoskedastie erstellen
Abbildung 31.29: Beispiel für ein akzeptables Streudiagramm
Abbildung 31.30: Beispiel für ein inakzeptables Streudiagramm
Kapitel 32
Abbildung 32.1: Auswahl des Kreuztabellenverfahrens in SPSS
Abbildung 32.2: Auswahl der in der Kontingenztabelle darzustellenden Variablen
Abbildung 32.3: Auswahl der Methode für die Berechnung der Prozentwerte der Kontingenztabelle
Abbildung 32.4: Eine von SPSS angelegte Kontingenztabelle, wobei die Prozentsätze auf den Zeilensummen und auf den Spaltensummen basieren
Abbildung 32.5: Chi-Quadrat für eine Kontingenztabelle bestimmen
Abbildung 32.6: Chi-Quadrat-Ergebnisse in SPSS
Abbildung 32.7: Ergebnisse für Phi-Koeffizient und Cramer-V in SPSS
Abbildung 32.8: Das von SPSS angezeigte Odds-Verhältnis
Abbildung 32.9: Den McNemar-Test in SPSS auswählen
Abbildung 32.10: Auswahl der Variablen für den McNemar-Test
Abbildung 32.11: Ein von SPSS erzeugter McNemar-Test
Kapitel 33
Abbildung 33.1: Einen unabhängigen t-Test in SPSS durchführen
Abbildung 33.2: Die Variablen für einen unabhängigen t-Test angeben
Abbildung 33.3: Gruppen definieren
Abbildung 33.4: Die Tabelle GRUPPENSTATISTIKEN
Abbildung 33.5: Test bei unabhängigen Stichproben
Abbildung 33.6: Streudiagramm für zwei Gruppen mit unterschiedlichen Varianzen
Abbildung 33.7: Unterschiedliche Varianzen bedeuten, dass der t-Test nicht korrekt interpretiert werden kann.
Abbildung 33.8: Einen Mann-Whitney-Test in SPSS durchführen
Abbildung 33.9: Ein Ziel für den Mann-Whitney-Test festlegen
Abbildung 33.10: Die Variablen für einen Mann-Whitney-Test spezifizieren
Abbildung 33.11: Tabelle HYPOTHESENTESTÜBERSICHT
Abbildung 33.12: Häufigkeitsdiagramm und Mann-Whitney-U-Ergebnis
Kapitel 34
Abbildung 34.1: Auswahl einer einfachen ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 34.2: Auswahl der Variablen für die einfache ANOVA
Abbildung 34.3: Erstellung einer deskriptiven Statistik und eines Homogenitätstests als Teil der ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 34.4: Residuen für die ANOVA zwischen Gruppen in SPSS ermitteln
Abbildung 34.5: Ausgabe für die einfache ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 34.6: Ein Interaktionsdiagramm für eine zweifache ANOVA zwischen Gruppen in SPSS erstellen
Abbildung 34.7: Deskriptive Statistiken und Ausgabe des Levene-Tests bei einer zweifachen ANOVA zwischen Gruppen
Abbildung 34.8: ANOVA-Tabelle für die zweifache ANOVA in SPSS
Abbildung 34.9: Ein Interaktionsdiagramm für eine zweifache ANOVA zwischen Gruppen
Abbildung 34.10: Kruskal-Wallis-Test in SPSS
Abbildung 34.11: Auswahl der Variablen für den Kruskal-Wallis-Test
Abbildung 34.12: Definition des Bereichs der unabhängigen Variablen für den Kruskal-Wallis-Test in SPSS
Abbildung 34.13: Ausgabe des Kruskal-Wallis-Tests in SPSS
Kapitel 35
Abbildung 35.1: Auswahl der ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 35.2: Auswahl von Variablen für die ANOVA zwischen Gruppen
Abbildung 35.3: Auswahl des Post-hoc-Tests Tukey HSD in SPSS
Abbildung 35.4: Auswahl der Anzeige einer deskriptiven Statistik für die ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 35.5: ANOVA-Ausgabe für die einfache ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 35.6: Tukey Post-hoc-Test in SPSS
Abbildung 35.7: ANOVA-Ausgabe aus der ANOVA zwischen Gruppen in SPSS
Abbildung 35.8: Dunnett-Test in SPSS
Kapitel 36
Abbildung 36.1: Ein abhängiger t-Test in SPSS
Abbildung 36.2: Die Variablen für einen abhängigen t-Test eingeben
Abbildung 36.3: Statistik für Stichproben mit paarigen Werten
Abbildung 36.4: Korrelationen für Stichproben mit paarigen Werten
Abbildung 36.5: Test für Stichproben mit paarigen Werten
Abbildung 36.6: Eine neue Variable in SPSS berechnen
Abbildung 36.7: Den Wert der neuen Variablen in SPSS festlegen
Abbildung 36.8: Der Wilcoxon-Test in SPSS
Abbildung 36.9: Festlegen des Ziels für den Wilcoxon-Test in SPSS
Abbildung 36.10: Variablen für den Wilcoxon-Test angeben
Abbildung 36.11: Hypothesenübersichtstabelle
Abbildung 36.12: Häufigkeitsdiagramm und Ergebnis des Wilcoxon-Tests
Kapitel 37
Abbildung 37.1: Auswahl einer einfachen ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS
Abbildung 37.2: Definition Ihrer unabhängigen Variablen
Abbildung 37.3: Auswahl von Variablen für eine ANOVA innerhalb von Gruppen
Abbildung 37.4: Anforderung von deskriptiven Statistiken als Teil der ANOVA mit wiederholten Messungen in SPSS
Abbildung 37.5: Tabelle der Innersubjektfaktoren in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.6: Tabelle DESKRIPTIVE STATISTIKEN in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.7: Tabelle MULTIVARIATE TESTS in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.8: Tabelle MAUCHLY-TEST AUF SPHÄRIZITÄT in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.9: Tests der Innersubjekteffekte in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.10: Tabelle der Innersubjektkontraste in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.11: Tabelle der Zwischensubjekteffekte in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.12: Auswahl der Variablen für eine ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS
Abbildung 37.13: Definition der Variablen für eine ANOVA innerhalb von Gruppen
Abbildung 37.14: Auswahl von Variablen für eine zweifache ANOVA innerhalb von Gruppen
Abbildung 37.15: Ein Interaktionsdiagramm für eine einfache ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS erstellen
Abbildung 37.16: Die Tabelle der Innersubjektfaktoren aus der SPSS-Ausgabe
Abbildung 37.17: Tabelle mit deskriptiven Statistiken aus der SPSS-Ausgabe
Abbildung 37.18: Tabelle MULTIVARIATE TESTS aus der SPSS-Ausgabe
Abbildung 37.19: Tabelle für den Mauchly-Test auf Sphärizität
Abbildung 37.20: Tabelle mit den Tests für die Innersubjekteffekte in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 37.21: Tabelle für die Tests der Innersubjektkontraste in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.22: Tabelle für die Tests der Zwischensubjekteffekte in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 37.23: Interaktionsdiagramm in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 37.24: Auswahl eines Friedman-Tests in SPSS
Abbildung 37.25: Auswahl der Variablen für einen Friedman-Test
Abbildung 37.26: Tabelle der mittleren Ränge in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 37.27: Die Tabelle mit den Statistiken in der SPSS-Ausgabe
Kapitel 38
Abbildung 38.1: Einen Post-hoc-Test als Teil der ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS durchführen
Abbildung 38.2: Die Tabelle PAARWEISE VERGLEICHE mit den von SPSS ausgegebenen Post-hoc-Tests
Abbildung 38.4: Einen einfachen geplanten Kontrast als Teil der ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS bestimmen (1)
Abbildung 38.3: Die Tabelle INNERSUBJEKTFAKTOREN in der Ausgabe von SPSS
Abbildung 38.5: Einen einfachen geplanten Kontrast als Teil der ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS bestimmen (2)
Abbildung 38.6: Tabelle TESTS DER INNERSUBJEKTKONTRASTE für geplante Vergleiche in der SPSS-Ausgabe
Kapitel 39
Abbildung 39.1: Auswahl einer gemischten ANOVA in SPSS
Abbildung 39.2: Definition Ihrer unabhängigen Variablen
Abbildung 39.3: Angabe der Variablen zwischen und innerhalb von Gruppen für eine gemischte ANOVA
Abbildung 39.4: Deskriptive Statistiken und Homogenitätstests zusammen mit der ANOVA anfordern
Abbildung 39.5: Bestimmung von Standardresiduen als Teil der gemischten ANOVA
Abbildung 39.6: Anforderung eines Interaktionsdiagramms für eine zweifache ANOVA innerhalb von Gruppen in SPSS
Abbildung 39.7: Die Tabelle INNERSUBJEKTFAKTOREN in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.8: Die Tabelle ZWISCHENSUBJEKTFAKTOREN in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.9: Deskriptive Statistiken aus der gemischten ANOVA in SPSS
Abbildung 39.10: Box-Tests auf Gleichheit der Kovarianzmatrizen
Abbildung 39.11: Tabelle MULTIVARIATE TESTS in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.12: Mauchly-Test auf Sphärizität in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.13: Levene-Test für die Bewertung der Homogenität der Varianzen in einer gemischten ANOVA
Abbildung 39.14: Tests der Innersubjekteffekte in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.15: Tabelle mit den Tests der Innersubjektkontraste in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.16: Tabelle der Tests der Zwischensubjekteffekte in der SPSS-Ausgabe
Abbildung 39.17: Das Interaktionsdiagramm in der SPSS-Ausgabe
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Begin Reading
Pages
C1
1
2
3
4
5
9
10
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
711
712
713
714
715
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
E1
Einleitung
Uns ist durchaus bewusst, dass Forschungsmethoden nicht gerade ein Lieblingsthema unter den Studierenden der Psychologie und der Sozialwissenschaften sind. Wir kennen sogar etliche, die es als ein notwendiges Übel ansehen, im Studium eigene Forschungsarbeiten durchführen zu müssen. Warum ist das so? Ein Grund könnte sein, dass Menschen, die sich für ein Psychologie- oder sozialwissenschaftliches Studium entscheiden, an Gedanken, Verhaltensweisen und Gefühlen anderer Menschen interessiert sind. Weniger interessant finden sie es dagegen, sich zu überlegen, wie man ein Forschungsprojekt plant oder wie man Teilnehmer dafür gewinnt. Aber Sie müssen sich klarmachen: Jegliches sozialwissenschaftliches beziehungsweise psychologisches Fachwissen, das Sie an der Hochschule erwerben, stammt natürlich aus der Forschung, die auf diesen Gebieten durchgeführt wurde! Ohne Forschung gäbe es keine Sozialwissenschaften (oder andere wissenschaftliche Disziplinen), beziehungsweise es wären dann keine Wissenschaften, sondern lediglich wenig glaubwürdige Gedankengebäude aus Lehrmeinungen. Ohne robuste und stringente Forschungsarbeiten wüssten wir beispielsweise nicht, dass sich die Lebensqualität von Menschen verbessern lässt, indem man wirksame Wege findet, um ihre Denkweisen so zu verändern, dass sich daraus positive Änderungen ihrer Gefühle und Verhaltensweisen ergeben. Es ist also Forschung, die dazu beigetragen hat, im Laufe der Jahre das psychische Wohlergehen ungezählter Menschen zu verbessern!
Sie haben hoffentlich nicht überlesen, dass wir von »robuster und stringenter« Forschung sprachen. Anders ausgedrückt: von qualitativ hochwertiger Forschung. Andere Formen der Forschung würden die Wissenschaft nicht weiterbringen und womöglich sogar ethische Bedenken hervorrufen. Deshalb ist es für alle Studierenden wichtig, zu lernen, wie man gute Forschung betreibt. Und genau dazu soll dieses Buch beitragen.
Okay, nehmen wir einmal an, ein Psychologiestudent habe sich seinem Schicksal ergeben und akzeptiert, dass er um Forschung und deren Methodik nicht herumkommt. Erfahrungsgemäß wartet dann gleich noch eine weitere »bittere Pille« auf ihn: Für qualitativ hochwertige Forschung benötigt man Statistik! Vor einiger Zeit haben wir die Psychologiestudenten von 31 Universitäten nach ihrer Meinung zum Fach Statistik gefragt: 51 Prozent der Studenten war dabei überhaupt nicht bewusst, dass Statistik in ihrem Studiengang eine wichtige Rolle spielt. Generell äußerte sich die Mehrheit eher negativ zum Thema Statistik. Viele Studenten hatten beinahe Angst vor dieser Vorlesung. Wenn es Ihnen also ähnlich geht, seien Sie unbesorgt: Sie sind nicht allein!
Aber ob es Ihnen gefällt oder nicht: Statistik ist ein wichtiger und notwendiger Bestandteil aller Psychologie- und Sozialwissenschaftsstudiengänge. Schließlich handelt es sich dabei um empirische Disziplinen. Die quantitative Erfassung von Informationen ermöglicht es uns, die zugrunde liegenden Daten objektiv und vergleichbar darzustellen. All diese Informationen müssen dann sinnvoll zusammengefasst und analysiert werden, sonst können Sie keine Schlussfolgerungen ziehen und Entscheidungen treffen. Ein Grundverständnis in Statistik ist also nicht nur für Ihre eigene Forschungsarbeit wichtig, sondern wird auch gebraucht, um die Arbeiten anderer Forscher lesen und kritisch hinterfragen zu können. Aber selbst, wenn Sie nicht in der Forschung, sondern als Psychologe arbeiten, bestimmen Statistiken Ihren Alltag. Ein Psychologe, dessen Patient über Angstzustände klagt und ein selbstverletzendes Verhalten an den Tag legt, muss beispielsweise entscheiden können, welche Therapie unter den gegebenen Umständen am wirkungsvollsten ist. Wie stark sind die Angstzustände? Und stehen sie in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Selbstverletzungen oder nicht? Natürlich muss dies für jeden Patienten individuell beurteilt werden – aber Statistiken geben Ihnen wichtige Hinweise.
Statistisches Grundwissen ist für Sozialwissenschaftler und Psychologen also unabdingbar und darum Teil dieses Buchs. Aber keine Sorge: Dank moderner Computerprogramme wie SPSS müssen Sie fast nichts selbst berechnen oder die Statistik in ihrer vollen mathematischen Tiefe verstehen – vielmehr übernimmt der Computer alle komplizierten mathematischen Berechnungen für Sie! Sie müssen lediglich die grundsätzlichen Konzepte der Statistik sowie deren Anwendungsbeschränkungen kennen. Aber hey, wenn Sie in der Lage sind, die Theorien der kognitiven Psychologie zu verstehen und sich in den Wirren psycho-biologischer Modelle zurechtfinden, werden Sie ganz sicher auch damit klarkommen! Selbst für Menschen, die mit Mathematik auf Kriegsfuß stehen, ist es recht einfach möglich, sich das zum Bestehen des Studiums relevante Statistikwissen anzueignen. Und dieses Buch wird Ihnen dabei eine wertvolle Hilfe sein.
Wir haben dieses Buch übersichtlich und knapp geschrieben, um Sie darin zu unterstützen, hochwertige Forschungsarbeiten durchzuführen. Wir setzen kein Vorwissen über Forschung voraus. Wir hoffen, dass Ihnen das Buch Lust darauf macht, eigene Forschungsarbeiten in Angriff zu nehmen. Und dass Ihre Forschung wiederum dazu beitragen wird, die Wissenschaft zum Nutzen zukünftiger Generationen voranzubringen. Alle dazu notwendigen statistischen Methoden haben wir in der zweiten Hälfte dieses Buchs zusammengetragen. Auch hier setzen wir keinerlei Vorkenntnisse in Statistik voraus. Im Gegenzug bitten wir Sie, mit einer positiven Einstellung an die Sache heranzugehen.
Über dieses Buch
Ziel dieses Buchs ist es, Studierende dabei zu unterstützen, psychologische beziehungsweise sozialwissenschaftliche Forschung zu verstehen, durchzuführen, zu interpretieren und zu dokumentieren. Das Buch ist als leicht verständlicher Leitfaden gedacht und richtet sich in erster Linie an Studierende in den ersten Semestern. Aber wir hoffen, dass es einen möglichst breiten Personenkreis anspricht und vielleicht auch das Wissen derer auffrischt, die dem Studium schon länger entwachsen sind …
Das Buch ist grob in zwei Hälften geteilt: Die erste Hälfte (Teil I bis VI) widmet sich den grundsätzlichen Aspekten einer Forschungsarbeit, den verschiedenen Formen der Berichterstattung in den Wissenschaften sowie populären Forschungsdesigns. Die zweite Hälfte (Teil VII bis XI) gibt Ihnen einen leicht verständlichen Überblick über das Reich der Statistik. Da wir aus eigener Lehrerfahrung wissen, dass Statistik nicht unbedingt das Lieblingsfach der meisten Sozialwissenschafts- beziehungsweise Psychologiestudenten ist, haben wir versucht, auf komplizierte mathematische Formeln und überflüssige Techniken zu verzichten. Stattdessen halten wir alles so verständlich und kompakt wie möglich und geben zahlreiche bebilderte Beispiele.
Sie brauchen das Buch nicht von Anfang bis Ende in der vorgegebenen Reihenfolge zu lesen. Die einzelnen Kapitel sind in sich abgeschlossen und erfordern in der Regel kein besonderes Vorwissen. Der Statistikteil wurde ganz bewusst ans Ende des Buchs verlegt – gewissermaßen als Appendix, in dem Sie bei Bedarf alle wichtigen statistischen Grundbegriffe und Methoden nachlesen können. Wenn Sie schon mit den Grundzügen der Statistik vertraut sind, können Sie einfach das entsprechende Kapitel zu einer gewünschten Methode aufschlagen: Jedes statistische Verfahren in diesem Buch wird erst leicht verständlich erklärt, gefolgt von einem Beispiel (mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Umgang mit SPSS sowie Tipps zur Interpretation und Wiedergabe der Daten). Statistikneulingen legen wir indes nahe, die entsprechenden Kapitel 19 bis 39 sukzessive durchzuarbeiten, bevor sie sich ernsthaft mit der Idee einer Forschungsarbeit auseinandersetzen.
Was Sie nicht lesen müssen
Wir haben bewusst versucht, unsere Erklärungen möglichst kurz und verständlich zu halten. Dennoch enthält dieses Buch eine Menge Informationen, von denen einige für Sie möglicherweise überhaupt nicht von Bedeutung sind. Manchmal werden Sie beim Lesen über das Symbol des Technikers stolpern, das Sie auf Spezialwissen verweist. Es kennzeichnet (meist technische) Zusatzinformationen, die Sie gut und gerne überspringen können, falls Sie sich nicht dafür interessieren.
Außerdem werden Sie auch auf einige graue Textkästen stoßen. Dort werden Themen weiter ausgeführt, die wir für interessant halten. Allerdings sind wir vielleicht etwas voreingenommen – also zögern Sie nicht, diese Kästen zu überspringen.
Törichte Annahmen über den Leser
Beim Schreiben dieses Buchs gingen wir von einigen mehr oder weniger zutreffenden Annahmen über unsere Leser aus:
Sie studieren eine empirische Sozialwissenschaft, Psychologie oder ein ähnliches Fach.
Sie sind in der Forschung ein Neuling, haben also noch nie oder höchstens ein-, zweimal ein eigenes Forschungsprojekt bearbeitet.
Sie sind grob mit den gängigen statistischen Methoden vertraut (falls nicht: Sie schlagen bei Bedarf im hinteren Teil des Buchs nach, was es damit auf sich hat).
Sie wissen, dass SPSS ein Statistikprogramm und kein ominöser Tropenvirus ist. Im besten Fall haben Sie SPSS schon auf Ihrem Rechner installiert. Außerdem können Sie grundsätzlich einen Computer bedienen.
Sie sind kein Mathe-Genie, haben aber ein grundlegendes Zahlenverständnis und beherrschen die mathematischen Grundlagen – zum Beispiel das Quadrieren oder Wurzelziehen einer Zahl.
Sie möchten keine komplexen multivariaten Statistiken auswerten. Dieses Buch richtet sich an Anfänger. Wir begrenzen uns daher auf Methoden, die man als Einsteiger benötigt.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Buch ist in zwölf Teile gegliedert. Die ersten sechs Teile sind dem generellen Ablauf von Forschungsprojekten gewidmet:
In
Teil I
des Buchs bekommen Sie einen Überblick darüber, wie man in den empirischen Sozialwissenschaften und der Psychologie forscht. Sie erfahren, was die Ausdrücke »Reliabilität« und »Validität« bedeuten und warum sie so wichtig für Durchführung und Beurteilung von Forschungsarbeiten sind. Zudem lernen Sie fünf ethische Grundsätze für die Forschung kennen und erfahren, wie Sie dafür sorgen können, dass Ihre eigenen Studien diesen Ansprüchen genügen.
In
Teil II
erfahren Sie, wie Sie mit verschiedenen Erhebungsdesigns natürlich vorkommende Variablen erfassen und welche Arten von Erhebungen Sie durchführen können. Sie lernen, wie Sie eine repräsentative Stichprobe für Ihre Studie auswählen und Fehler bei der Stichprobenziehung vermeiden. Sie bekommen Tipps für das Erstellen eigener Fragebogen und erfahren, wann ein Fragebogen valide und reliabel ist.
In
Teil III
lernen Sie die beiden wichtigsten Versuchsdesigns (Experimentaldesigns) in der Psychologie und den empirischen Sozialwissenschaften kennen. Und Sie erfahren, welche Arten von komplexeren Versuchsdesigns möglich sind, wenn Sie mehr als zwei Gruppen untersuchen möchten.
In
Teil IV
finden Sie Richtlinien für das Erstellen eines grundsoliden qualitativen Forschungsprojekts, einschließlich Hinweisen zur Stichprobenauswahl, Datenerhebung und Transkription von Notizen. Zudem erfahren Sie, wie man bei der qualitativen Datenanalyse Muster erkennt.
In
Teil V
lernen Sie das schrittweise Vorgehen beim Schreiben von Forschungsberichten kennen. Sie erfahren, wie Sie einen herausragenden Vortrag vorbereiten, ein Poster beziehungsweise Folien gestalten und diese professionell vortragen. Auch finden Sie Hinweise für das Erstellen eines Literaturverzeichnisses und bekommen einen Überblick darüber, wie man richtig zitiert und Zahlen formatiert.
In
Teil VI
erfahren Sie, welche Literatur Sie in die Literaturübersicht Ihres Forschungsberichts aufnehmen müssen. Sie lernen, wie Sie die ideale Teilnehmeranzahl für Ihre quantitative Studie berechnen. Und Sie erfahren, wie ein durchdachtes Exposé Ihrer Forschung zu einem guten Start verhilft.
Ab Teil VII des Buchs wenden wir uns dann der Statistik in ihrer vollen Pracht zu:
In
Teil VII
geht es um die Beschreibung und Zusammenfassung von Daten. Zunächst werden die verschiedenen Arten von Variablen und die Skalenniveaus erklärt. In diesem Teil beginnen wir auch mit den Grundlagen der deskriptiven Statistik. Außerdem geben wir Ihnen eine erste Einführung in SPSS. Wenn Sie also noch nie SPSS benutzt haben oder eine kleine Auffrischung benötigen, sind Sie hier genau richtig!
Teil VIII
konzentriert sich auf zentrale Begriffe der Statistik. Sie wissen nicht, was der Unterschied zwischen einer Null- und einer Alternativhypothese ist? Sie fragen sich, was statistische Interferenz noch mal bedeutet und was der
p
-Wert mit der Effektstärke zu tun hat? Dann auf zu
Teil VIII
!
Teil IX
befasst sich mit der schließenden Statistik, beispielsweise Korrelation, Regression und Tests für kategoriale Daten. Wir erklären, wann und wofür jede Methode verwendet wird und wie man die entsprechende Analyse mit SPSS durchführt. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Ergebnisse richtig interpretieren und statistisch korrekt zusammenfassen.
Auch
Teil X
befasst sich mit der schließenden Statistik, nämlich den Unterschieden zwischen zwei oder mehreren unabhängigen Datengruppen. Dabei werfen wir ein besonderes Augenmerk auf den
t
-Test für unabhängige Stichproben, den Mann-Whitney-Test und die Varianzanalyse (ANOVA).
Teil XI
des Buchs beschäftigt sich noch einmal mit der schließenden Statistik, jetzt aber mit den Unterschieden zwischen zwei oder mehr wiederholten Messungen. Hier finden Sie den
t
-Test für abhängige Stichproben, den Wilcoxon-Test und die bereits erwähnte Varianzanalyse (ANOVA). Mit der gemischten ANOVA konzentrieren wir uns hier aber auf die Analyse von Forschungsdesigns, die sowohl unabhängige Stichproben als auch wiederholte Messungen umfassen.
Wie von den Dummies nicht anders zu erwarten, endet dieses Buch mit einem Top-Ten-Teil: Hier finden Sie 10 Stolperfallen, die Sie bei der Stichprobenauswahl lieber vermeiden sollten, 10 Tipps für Forschungsberichte, 10 gute Ratschläge für inferentielles Testen und 10 Tipps für das Zitieren Ihrer Ergebnisse.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie in allen Dummies-Büchern sind in diesem Buch manche Textstellen mit Symbolen markiert. Diese enthalten ganz besondere Informationen:
Dieses Icon gibt hilfreiche Tipps, mit denen Sie Zeit und Gehirnschmalz sparen können.
Diese Textstellen sind wirklich wichtig! Sie enthalten Infos, die Sie auch dann noch wissen sollten, wenn Sie das Buch wieder zugeklappt haben.
Dieses Symbol kennzeichnet Fallen, in die Anfänger oft tappen.
Hier finden Sie ausführlichere Informationen zu Themen, die im Text nur am Rande behandelt werden. Wenn Sie schnell vorankommen möchten, können Sie diese Textstellen auslassen.
Wie es weitergeht
Sie können das Buch von Anfang bis Ende durchlesen (und dabei hoffentlich auch Spaß haben), aber es ist kein Roman. Vielmehr ist das Buch so aufgebaut, dass Sie die gewünschten Informationen bequem finden können, ohne alle Details zum betreffenden Thema durchlesen oder sich durch unnötig viele SPSS-Schritte quälen zu müssen.
Wenn Sie ein Forschungs-Neuling sind, empfehlen wir Ihnen, mit Kapitel 1 anzufangen, das Ihnen einen groben Überblick über psychologische beziehungsweise sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden verschafft und einige wichtige Prinzipien vorstellt. Wenn Sie sich schon etwas mit Forschung auskennen, aber Informationen dazu brauchen, wie man ein Exposé oder einen Forschungsantrag schreibt, schlagen Sie bitte Teil VI