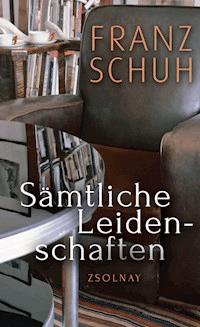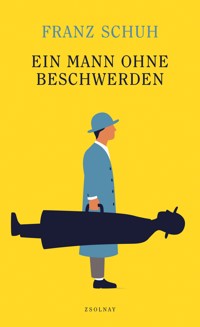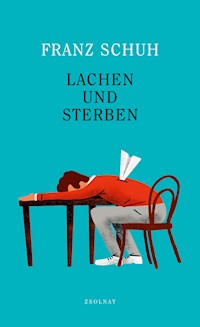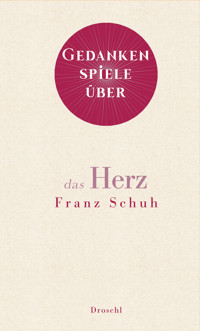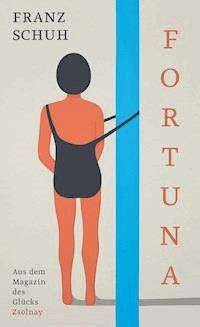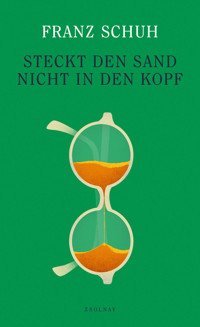
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Franz Schuhs neues Buch ist Kaffeehausliteratur par excellence. Es gilt, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken soll. Ebenso gilt, dass man den Sand, der einem in die Augen gestreut wird, nicht für Wahres oder Bares nehmen sollte. Franz Schuhs neues Buch ist der Versuch einer Orientierung in einer Zeit, in der Desorientierung unvermeidlich erscheint. Es ist ein Zeitbild und zugleich eine sehr subjektive Zeitzeugenschaft. Sie wird auf verschiedenen Ebenen auf die Probe gestellt: von der Banalität der tröstlichen Existenz eines Badeschwamms am Stiel bis zur Diskussion der Wahrheitsfrage, die auf Tendenzen reagiert, »Wahrheit« überhaupt abzuschaffen. Figuren wie der Wirecard-Großbetrüger Jan Marsalek, der gerüchteweise eine späte Karriere als Spion macht, werden nicht übersehen, und manchmal blitzt auch der Name René Benko auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Franz Schuhs neues Buch ist Kaffeehausliteratur par excellence.Es gilt, dass man den Kopf nicht in den Sand stecken soll. Ebenso gilt, dass man den Sand, der einem in die Augen gestreut wird, nicht für Wahres oder Bares nehmen sollte.Franz Schuhs neues Buch ist der Versuch einer Orientierung in einer Zeit, in der Desorientierung unvermeidlich erscheint. Es ist ein Zeitbild und zugleich eine sehr subjektive Zeitzeugenschaft. Sie wird auf verschiedenen Ebenen auf die Probe gestellt: von der Banalität der tröstlichen Existenz eines Badeschwamms am Stiel bis zur Diskussion der Wahrheitsfrage, die auf Tendenzen reagiert, »Wahrheit« überhaupt abzuschaffen. Figuren wie der Wirecard-Großbetrüger Jan Marsalek, der gerüchteweise eine späte Karriere als Spion macht, werden nicht übersehen, und manchmal blitzt auch der Name René Benko auf.
Franz Schuh
Steckt den Sand nicht in den Kopf
Paul Zsolnay Verlag
»Im Laufe der Ermittlungen wird Sauberes noch reiner und Dreckiges noch dreckiger.«
Medical Detectives
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Franz Schuh
Impressum
Inhalt
Sinngedicht
Goldener Herbst — Reden über das Leben
Philosophie im Gespräch
Philosophieren auf Sendung
Oleanna
Und Konfuzius sagt
Unterführung
Viel Feind, viel Ehr
Die grüne Mark
Wien
Dreams are my Reality — Über Kunst und Realität
Weite und Enge
Freundschaft
Die letzte Fechsung — Über Österreicher und Deutsche
Kein Ende der Geschichte — Österreich und der Nationalsozialismus
Haider, König der Herzen
Wie man eine schwere Krankheit übersteht
Immobilität
Heute ordiniert der Zerberus
Glaube, Liebe, Hoffnung
Schöne Welt, wo bist du? — Über Wahrheitsansprüche von Fiktionen
Pas de chance
Badeschwamm am Stiel
Ambros, ein arrivierter Sack!
Ode an Peter Kraus
My private Jandl
Hoffnung revisited
Abgesang
Eine respektvolle Notiz
Rotes Blut und weiße Nächte
Die Diktatur von Hunger und Durst
In der Marxergass’n
Das eigentliche Problem der Bildung
Danksagung an Thomas Mann
Viktor Böhm
Die große Kochshow — ist Kochen eine Kunst?
Dünne Luft
Freiheit!
Die glatte Null — Über Liebe
Wir Staatspreisträger
Rechtswissenschaft
From Russia with Love
Is this the End / Beautiful friend? — Über Krieg und Krisenbewusstsein im Oktober 2023
Wünsche
Ein Nachwort zur Einleitung
Sinngedicht
Wüsste ich die Richtung,
sähe ich auch eine Lichtung.
Gewiss, man scheut die Finsternis,
weil ihr alles finster ist.
Aber aus guten Gründen
will man sich auch im Dunkel finden.
Das Licht genießt den größeren Ruhm,
man treibt sich nicht im Finstern um.
Die Lichtung verspricht Klarheit,
bei Heidegger sogar »die Wahrheit«.
Im Lichte steht die Aufklärung,
der Menschen vornehmste Belehrung.
Im Dunkel bleibt die Lust,
offen hör ich nur vom Frust.
Die Verwirrung lichtet sich,
im Gewirr, da find ich mich
plötzlich aufgeklärt vom Sonnenlicht.
Aufs Gestrüpp verzicht ich nicht.
Die Vernunft wird mit dem Licht gepaart,
die Dunkelheit wird eingespart.
Das ist nur das halbe Leben,
ich will mir auch das andere geben.
Goldener Herbst — Reden über das Leben
Ich wundere mich oft darüber, dass Menschen so wenig kommunizieren, wie, auf welche Weise sie das Leben bewältigen. Na gut, die Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen, zeigen es schlau vor: Es gibt die »NDR Talk Show«, eine Show, in der Menschen einander für ihr geglücktes Leben beklatschen, und es gibt den SWR-Klassiker, die Sendereihe »Nachtcafé«, in der man mit seinem Unglück ein lehrreiches Beispiel für dessen Überwindung gibt.
Das ist eine kluge Arbeitsteilung, aber sie leidet unter dem Nachteil, dass die Gespräche über das Leben medial formatiert sein müssen. Dabei fällt die Spontaneität zu einem großen Teil weg, in der Menschen einander am besten mitteilen können, wie sie mit dem Leben fertigwerden.
Immerhin gibt es Annäherungen: Die Schauspielerin Brigitte Karner ist die Witwe nach Peter Simonischek, der im Leben ein berühmter Schauspieler war. Brigitte Karner schrieb ein Buch, ein Werk der Trauerarbeit mit dem Titel »Mein Leben ohne ihn«. Ich habe ein Radiointerview mit ihr gehört, in dem es ums Leben ging. Mir teilte sich ein erschrockenes Erstaunen mit, dass Menschen, sogar im medizinischen Bereich, Ärzte rücksichtslos gleichgültig sein können. Das kenne ich so sehr, dass es lange Zeit mein Thema war. Aber man könne, sagte Frau Karner, auch gute Ärzte finden (»gute Ärzte« nenne ich die, die nicht nur sachliche Autorität, sondern auch moralische Integrität besitzen). Es sei ihr gelungen, solche Ärzte zu finden, die nicht gleichgültig dem Leid gegenüberstehen, zu dessen Heilung oder wenigstens Linderung oder wenigstens Begleitung sie bestellt sind.
Die letzten Tage, so habe ich Frau Karner verstanden, habe sie ihren Mann vor zudringlichen und neugierigen Blicken beschützt. Seine Krankheit nennt sie bis heute nicht beim Namen (sie ist im Internet rücksichtslos genannt), aber sie möchte, so meine Interpretation, dass der Tod überhaupt »persönlich« verstanden wird, als das unausbleibliche (da steckt leiblich drin) Ende eines Individuums, als das endgültige Einzelschicksal. Man solle nicht zuletzt das Augenmerk auf die Hospizbewegung richten. Es geht ums Sterben in Würde, um eine alte, so fürchterlich oft verratene Utopie.
Was gilt im Leben absolut? Umsonst ist nur der Tod, heißt es im wienerischen Jargon, und der kostet das Leben. Das Absolute ist die theologisch-philosophische Überhöhung dessen, was man in der irdischen Gesellschaft »das Unverhandelbare« nennen kann. Das Absolute für uns Menschen — als Einzelne und im Kollektiv — ist die Endlichkeit des Lebens, die schlichte Tatsache, dass das Leben des Einzelnen vorübergeht.
Ein einziges Mal wurde ich in meiner auf der Hand liegenden These über das Absolute unsicher. Das war bei einem Symposion über das Werk von Elias Canetti. Da sprang Vilém Flusser auf, der 1991 verstorbene Medienphilosoph, ein Technikfreak, und wies alles, was im Sinne Canettis über den Tod zu sagen ist, weit von sich. Je mehr, sagte Flusser, ich hier zuhöre, desto unsympathischer wird mir dieser Canetti, und er stellte in Aussicht, der Tod wäre nichts Absolutes, sondern die Menschheit würde schließlich eine technische Lösung finden, um ihn zu überwinden. Die Unsterblichkeit jenseits der Transzendenz, das nenne ich technikaffin: unsterblich im Leben, was für eine Dr.-Frankenstein-Innovation.
Meine These lautet, dass der Tod das einzig Absolute ist. Das rückt das Sterben und seine zu erreichende Würde an die Spitze der Bestenliste unserer Existenz: Wir müssen was tun, wir müssen handeln, um das Sterben, zum Beispiel wie im Krieg, nicht empathielos zu einer Routine, zum Alltag werden zu lassen. Wir sollten Hospize einrichten und keine Abschussrampen bauen.
Aber so ein »Wir« gibt es nicht. Irgendetwas müsste mit den Ersatzformen des Absoluten passieren, was sicher nicht passiert: Der Nationalismus, der religiöse Fundamentalismus, die Gier nach Macht, die Habgier, die (selbst)mörderische Leidenschaftsliebe, der Hass auf den Nachbarn und so weiter — diese beliebten, scheinlebendig machenden, überwertigen Motivationen werden das Leben der Vielen (und ihrer Institutionen) ad infinitum ausfüllen.
Die Schwäche des Konzepts vom Tod als dem einzig Absoluten ist offenkundig. Erstens weil der Tod selbst zu einer der Ersatzformen des Absoluten werden kann, siehe das »Viva la muerte« der Faschisten, die schon im Leben den Heldentod genießen wollen. Zweitens weil das Konzept das Absolute auf eine Zäsur einschränkt: Auf einmal ist für das Individuum alles aus, und das soll auf einmal »das Absolute« sein?
Es gab Philosophen, die schlauer waren. Sie dachten das Absolute als Prozess, der die Un(an)greifbarkeit, vom endlichen Menschen mit einzelnen Worten, mit einzelnen Sätzen gar nicht möglich macht. Das »wahre« Absolute ist überkomplex. Was ich mit meiner Vereinfachung sagen will, ist unterkomplex: dass Menschen nur in der Relativität ihrer Endlichkeit existieren, der phantasierte Rest ist jenseitig.
Berühmte Zeilen, letzte Worte aus einem Brecht-Gedicht lauten: »Wenn die Irrtümer verbraucht sind / sitzt als letzter Gesellschafter / uns das Nichts gegenüber.« Anschauungsunterricht dafür bietet eine Fernsehsendung des ORF. Sie heißt »Goldener Herbst — Legenden reden übers Leben«. Das könnte die schlimmste mediale Formatierung sein: Legenden, also sogenannten Prominenten das letzte Wort »übers Leben« zu überlassen. Es ist die totale Selbstbespiegelung des Mediums, das ja entscheidet, wer prominent ist und wer nicht.
Wie im Leben gibt der ehemalige Staatsoperndirektor Ioan Holender gleich zu Anfang der Sendung den Ton an. »Goldener Herbst«, das sei ein schöner Titel, es könnte ja auch heißen »früher Winter«, aber, sagt Holender, »nach dem Herbst kommt noch was, nach dem Winter kommt nichts.« Das ist — nach meiner Meinung — die tröstliche, aber auch vertröstende, melancholisch-ironische Variante, den Tod durch eine Redeweise ins Leben mit einzubeziehen.
Eine andere Redeweise ist erstaunlich, sie stammt von Ernst Bloch und lautet, aus dem Gedächtnis zitiert: »Der Tod — eine Erfahrung, die ich auch noch machen möchte.« Bloch war ein Atheist, ans ewige Leben, an irgendeine Art von Leben nach dem Tod, hat er nicht geglaubt. Er hat mit der willkommenen Erfahrung schlicht das Sterben selbst gemeint, auf das er neugierig ist. Ich glaube, diese Reaktion einer zustimmenden, einverstandenen Neugier ist die einzige Möglichkeit (auch die einzig lebensbejahende), dem Tod seine gnadenlose Absolutheit zu nehmen. Ob das in den entscheidenden Augenblicken funktioniert — na, schau ma mal.
Philosophie im Gespräch
Unbedingt wollte ich ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Thomas Macho haben — eben haben, nicht führen. Thomas Macho kenne ich aus seiner frühesten Zeit, da er an der Universität Klagenfurt als Philosoph arbeitete. Ich hatte das Glück, in einem seiner ersten Seminare dabei gewesen zu sein. Er, der Professor in Berlin wurde, hatte damals wenige Hörer. Während der Hörsaal bedrohlich groß war, war das Publikum lächerlich klein. Ich erinnere mich, dass ich, selbst hoffnungslos jung, mit dem jungen Lehrenden ins Gespräch kam. Ich lieferte ihm die Frage: Warum denn die Menschheit Jesus Christus, den Leidenden und allerdings dann Auferstandenen, zum Leitstern erkoren hat und nicht Sokrates, den ewigen Diskutanten.
Durch all die Jahre hatte ich mir ein Schema zurechtgelegt, wen ich denn eine Philosophin, einen Philosophen nennen möchte. Ich selbst bin kein Philosoph, sondern ein ewiger Student, der hinter der Philosophie her ist: Philosophie heißt »Liebe zur Weisheit«, und ich darf für mich nur beanspruchen, diejenigen zu lieben, die die Weisheit lieben. Dazu gehören zunächst alle Menschen, denn alle Menschen wenden sich im Notfall, nämlich dann, wenn das Schicksal Schläge austeilt, entweder der Religion zu, oder sie beginnen zu philosophieren. Man wird halt nachdenklich.
Philosophen nenne ich auch gerne Akademiker, also Menschen, die im Fachbereich Philosophie angestellt sind und zum Beispiel »eine Professur haben«. Das ist das Schöne an diesem Fach: Es schwankt zwischen allgemeiner Betroffenheit und spezialisierter Ausbildung.
Das Schema war für mich zufriedenstellend, auch wenn es große Unsicherheiten bereithält. Zwei davon nenne ich: Ein Freund des Theologen (und von der katholischen Kirche vom Priesteramt suspendierten) Adolf Holl, ein Freund auch von mir, war gestorben. Der Freund hatte ein Doktorat aus Philosophie, und wir baten Rudolf Burger, der für uns der beste Philosoph im Land war, sich mit Adolf Holl — zum Gedenken an den Freund — ans Podium zu setzen. Burger war selbstverständlich brillant, aber Holl murmelte Vergebliches in seinen Bart. Jahre später kam mir in den Sinn, dass vielleicht die eigentliche philosophische Haltung Holls Vergeblichkeit gewesen war.
Die zweite Unsicherheit bereitet mir Richard David Precht. Ich habe sein Erwachen zur Prominenz miterlebt: Seine ersten Essays in der der deutschen Wochenzeitung Die Zeit waren beachtlich wie alles, wofür er später noch berühmter wurde. Ich verehre den klugen Menschen Precht, aber, weiß der Teufel, ein Philosoph ist er für mich nicht. Er kommt mir unerschütterlich vor und — neben dem Herrgott — alles wissend. Was Precht heute nicht weiß, das hat er morgen sicher in petto. Er hat viel zu wenig vom Charme der alten (manchmal zur Attitüde ausgebauten) Philosophenregel: Ich weiß, dass ich nicht weiß.
Walter Benjamins »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« habe ich in einem Zug gelesen von Irnfritz bis zum Wiener Franz-Josefs-Bahnhof. Das war vor Jahrzehnten, und als ich den Text jüngst wieder las, erschrak ich. Ich hatte wegen der Autorität von Benjamins Thesen überlesen, dass dieser Mensch um sein Leben schrieb. Walter Benjamin war so, dass er sich niemals das Private hätte anmerken lassen. Das Subjektive, die Befindlichkeit mit ihren eingerosteten Denkfiguren, ersparte er sich und seinen Lesern peinlichst. Aber die These, dass der Ästhetisierung der Politik die Politisierung der Ästhetik entgegenzusetzen sei, könnte die fromme Hoffnung eines Menschen gewesen sein, der im Jahr 1935 schon rettungslos verloren war. Eine gegensätzliche Politik zu der, die da kommen musste, wäre die einzige Rettung gewesen.
Es ist das Existentielle, das manchmal sogar Unwissenschaftliche und gleichwohl Unvermeidliche, es ist auch das Spielerische — gegen die begriffsbürokratischen Auslassungen Hochgebildeter —, dafür kaufe ich teure philosophische Bücher ein, obwohl man auch mit Reclamheften allein meinem Laster nachgehen könnte. Aber es soll schon was hermachen. Und was ist nun mit Professor Thomas Macho?
Mit ihm wollte ich unbedingt ein Gespräch haben. Warum denn? Er hatte im Radio gesagt, so etwas wie »die Lust am Untergang« käme von der demokratischen Natur des Untergehens her: Es ist das Gemeinschaftserlebnis, das der Untergeher beschwört. Was ein echter Untergang ist, bei dem gehen alle gemeinschaftlich unter — keine Einzelschicksale mehr, endlich ein Aus für alle zusammen. Das Schrecklichste also wird zu einer Variante falscher Hoffnung.
Das Theorem liegt auf der Hand, aber mir wäre es nie eingefallen. Ich muss mein Schema über die Philosophie erweitern: Eine Philosophin, ein Philosoph ist ein Mensch, der Denkgewohnheiten eine Pointe abgewinnen kann, die die Richtung des Verständnisses ändert und dabei den Sachverhalt klärend ausleuchtet. Das kann theoretisch jeder Mensch, aber in der Praxis wäre das bei den meisten ein Zufall. Es bedarf einer eingeübten Disziplin, um so ein Denken mehr als einmal und schließlich auch routiniert zusammenzubringen.
An diesem Gelingen erkennt man die Philosophin, den Philosophen. Und daran, dass man von der (wie man es früher nannte) »Persönlichkeit«, also von einer nicht leicht erworbenen Subjektivität, zwingend etwas merkt. Sie ist unüberhörbar und unübersehbar und unverzichtbar ein Teil der Philosophie, die ein Mensch hat. Das Subjektive ergibt sich als eine fürs Erste nicht zerlegbare Zusammenfassung von dem, was ein Mensch getan, erfahren und erlitten hat. Das Subjektive kann man im Diskurs ausblenden (oder minimieren), aber die Art, in der das passiert, ist immer noch von der Subjektivität bestimmt. Aus Fichtes produktiv machender Falle kommt man im Philosophieren nicht heraus: »Was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist.«
Philosophieren auf Sendung
Peter Kampits, Professor für Philosophie in Wien, hatte vor kurzem seinen achtzigsten Geburtstag. Egal, ob es ihm recht ist, leider egal auch, ob es mir recht ist, als er jung war, als er seine akademische Karriere begann, hat er meinen Glauben an die Philosophie verfestigt. Verfestigt, nicht bloß bestärkt.
Es sei dahingestellt, ob die in allen Fugen zitternde Welt einen gefestigten Philosophen braucht. Aber im Lebenslauf und weil man nur ein Leben hat, ein Gemeinplatz, ist einem alles Offenstehende und Feststehende von hohem Wert. Hans Blumenberg, der große deutsche Philosoph, war vom Philosophieren bis an die Grenze persönlicher, sagen wir, Paranormalität fasziniert. Dennoch stammt von ihm die Maxime: »Wer sagt, er könne ohne Philosophie nicht leben, versteht nichts von Philosophie.«
Philosophieren, und das wissen die Leute, ist eine fragwürdige Beschäftigung, weshalb ausgerechnet Philosophieren die Distanz zur Philosophie verlangt. Das ist wie in der Religion, in der ein Glaube ohne Zweifel, ein niemals angezweifelter Glaube, nicht sehr viel wert sein kann. Ist halt eine Gewohnheit, eine Routine, wie sonst auch vieles, das man in seine Geborgenheit und in soziale Selbstverständlichkeiten gut investieren kann. Der brennende Zweifel entzündet »von außen«, als das Andere des Glaubens, die Leidenschaft und damit den Wert der Sache, um die es jeweils geht.
Anders die Wissenschaft: Sie hat den Zweifel in ihre Methoden integriert, sie besteht daraus, dass sie immer etwas zu beweisen oder zu widerlegen hat. Sie muss ihre Thesen anzweifeln können, um sie von Fall zu Fall zu falsifizieren. Ob ein Wissenschaftler die Falsifikation einer Erkenntnis bedauert oder nicht, ist wurscht, tut nichts zur Sache.
Im Gegensatz dazu schau ich mir an, wie man einen Menschen, der zum Beispiel dem pessimistischen Philosophen Schopenhauer anhängt, von seiner Weltverachtung abbringt. Die Verachtung gab ihm eine Form, die das Chaos des Daseins »einordnete«. Wenn aber einer dieser Pessimisten sich tatsächlich falsifiziert findet, geht das nicht ohne Erschütterung ab, die aus der neuen Desorientierung resultiert — und es braucht Zeit, bis der eines Besseren Belehrte endlich wieder weiß, was los ist.
Am 29. Juni 2024, in der Radiosendung »Punkt eins« des ORF, erzählte das Geburtstagskind Peter Kampits — er ist vier Jahre älter als ich — eine Geschichte. Er sei jung Professor geworden, und bei einem Zusammentreffen seiner Standesgenossen habe ihn ein älterer Kollege gefragt: »Was unterrichten Sie denn?« Darauf antwortete der frischgebackene Professor nicht ohne Stolz: »Philosophie!« Den älteren Herrn beeindruckte das wenig. Er fragte: »Und — hüft’s?«
Ob es hilft oder nicht, abgewöhnen können sich manche Menschen das Philosophieren nicht — darunter solche, bei denen es sogar ein Glück ist, dass sie’s nicht können. »Punkt eins«, der Titel der Sendereihe, ist immerhin schon lange nach fünf vor zwölf, dem entscheidenden Zeitpunkt, an dem man die Gefahr noch abwenden kann. Das Ö1-Programm zeigt aber täglich außer Sonntag, dass es bereits fünf vor zwölf zu spät war: Um zwölf beginnt nämlich das »Mittagsjournal« und posaunt sein ewiges zu spät, zu spät aus, alles, was vorkommt, ist schon geschehen. Erst danach — in »Punkt eins« — kommt der Philosoph.
Und hilft sie, die Philosophie? Peter Kampits sagte nicht nein. Die Philosophie hilft nicht — das sagte er nicht. Er sagte aber auch nicht: Mir hat sie sehr geholfen! Was er sagte, war vom Nachlassen des Glaubens an eine hilfreiche Philosophie diktiert: Früher hätte sie eher geholfen, aber heute sei er zurückhaltend, fast schon skeptisch, was den Beitrag der Philosophie zur Lebenskunst betrifft. Die schöne Kunst — viel mehr sie sei ein »Allheilmittel«, falls es überhaupt so eines gäbe. Ich zeige auf und zitiere Nietzsche wie im Seminar. Allein die Kunst vermag, so Nietzsche, »jene Ekelgedanken über das Entsetzliche und Absurde des Daseins in Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben lässt«.
Peter Kampits soll hochleben, auch der besonderen Erinnerungen wegen, die ich von ihm habe: Ich saß lesend im Institutshörsaal, und einmal kam er herein und fragte mich professionell gleichgültig, was ich denn da lese. Lesen tun an Ort und Stelle ja alle irgendwas. »Hegel«, sagte ich, »ich lese Hegel.« Und er darauf: Hegel, den hätte er immer schon hinter sich gelassen.
Das ist so mit Meinungsphilosophen, sie ersparen sich die Mühe, die — wie immer auch gescheiterten — Entwürfe Andersdenkender nachzudenken. Meinungsphilosophen nenne ich solche, die in erster Linie zur Unterstützung eigener Meinungen sich die Mühe des Philosophierens antun. Alles andere haben sie immer schon hinter sich gelassen, und sollten sie es sich wieder vornehmen, dann nur um ihre Ablehnung zu zelebrieren und auszukosten. Ich bin — seit dem Ende meiner Jugend und meiner Jugendlichkeit — mehr hermeneutisch gestimmt und lege am liebsten die Werke aus, mit denen Denker versuch(t)en, das Gewicht der Welt, inklusive einer bejahten oder verneinten Transzendenz, zu stemmen.
Meine schönste Erinnerung an Peter Kampits stammt aus der Zeit, als er von einem Lehrauftrag, ich glaube, aus Kanada zurückgekehrt war. Er hatte einen prächtigen Pelzmantel mitgebracht, den er bei Zimmertemperatur am Gang des II. Philosophischen Instituts auf und ab stolzierend trug. Als er noch kein Professor war, als er eine großartige Dissertation über Camus geschrieben hatte und Vorlesungen zum französischen Existentialismus hielt, war es ein Glück, mein Glück, ihn zu hören. Er hatte eine dunkle Stimme, und das Französische machte sich sehr gut in seinen Ausführungen. Er war cool zu einer Zeit, da es das Wort im heutigen Sinn noch gar nicht gab.
Dass davon nichts, nichts von dieser bedächtigen Literarizität geblieben sein sollte als ein Staatsbeamter mit Meinungen, kann ich nicht glauben. Aber ich habe Glaubenszweifel, wenn der Professor auf Sendung erzählt, dass er ein Treffen mit Sartre vor allem damit quittiert, dass ihn, Kampits, Sartres Marxismus »nicht interessiert« hätte. Sartres Marxismus (ohne dass man ein Parteigänger davon sein müsste) bietet sich der Auslegekunst, der hermeneutischen Anstrengung geradezu aufdringlich an. Der junge Lehrbeauftragte Peter Kampits, es tut mir leid für ihn, war einer meiner wichtigsten Lehrer. Die philosophischen Ideen teilte ich selten mit dem späteren Professor, aber ich teile mit ihm halbwegs das Alter. Und: Dass ich anders denken kann, sogar als er, verdanke ich nicht zuletzt ihm. Mehr kann einem ein Philosoph nicht helfen.
Oleanna
Vor vielen Jahren ging ich ins Theater, einmal sogar ins Akademietheater. Dort spielten sie ein Stück, dessen Verfasser eines meiner Idole ist: David Mamet. Das Stück hieß »Oleanna«. Warum denn Oleanna?
Das Stück beginnt mit der Musik von Ole Bull, einem norwegischen Violinvirtuosen, der 1852 in Pennsylvania eine Siedlung gründete, von der er die Vision einer Utopie hatte. In diesem Sinn, im Sinn einer idyllischen Lebensform, nannte Ole Bull den Ort »Oleanna« — eine Kombination aus seinem Vornamen und dem Namen seiner Frau Anna.
Mamets Stück hat eine sonderbare Qualität. Die Handlung ist ein Machtspiel eines Professors mit einer Studentin, also etwas Übliches, aber unüblich ist, dass aus dem Drama kein Schluss gezogen werden kann, wer von den beiden recht hat. Man ist Augenzeuge, und doch weiß man das Wesentliche nicht, Vermutungen können nur zum Streit führen. Im Akademietheater spielten die Rollen ein Ehepaar: Susanne Lothar und Ulrich Mühe. Für Susanne Lothar hatte ich einmal Texte zum Liebesmythos ausgesucht, die sie zusammen mit August Zirner und mir vortrug. Eitel! Es gibt noch ein anderes Oleanna: Pete Seeger hat die Idylle vom wunderbaren Ort gedichtet und gesungen. In meiner Übersetzung habe ich aus Seegers Oleanna das schöne Hartberg gemacht.
Oje, Oja, O, Hartberg
Oh, to be in Oleanna!
That’s where I’d like to be
Than be bound in Norway
And drag the chains of slavery.
Mei Gott — in Hartberg
wü i sei,
in Hartberg
im Steirerland,
im Joglland,
im schönen Österreich,
wo an vom Sklavensein
die Ketten abifolln.
Hartberg, Hartberg,
du gibst mir Freiheit
und mein Glück — noch Hartberg
gibt’s für mich ka Zurück.
Das Land is frei,
die Erd und auch der Boden
g’hert kan Menschen,
a kan in Loden,
g’hert ollen auf da Wöd.
Mei Hartberg, mei Hartberg.
Hartberg, Hartberg,
du gibst mir Freiheit
und mein Glück — noch Hartberg
gibt’s für mich ka Zurück.
Das Korn wochst meterhoch.
Es sät sich selbst
in Hartberg, in Hartberg,
dem sanften Hügelland.
Am Sofa schnorcheln
der Säer und der Schnitter,
nur für’n Pforrer is des bitter.
Hartberg, Hartberg,
du gibst mir Freiheit
und mein Glück — noch Hartberg
gibt’s für mich ka Zurück.
Bier, so super
wia am Oktoberfest,
besteht am Gaumen
jeden Test.
Die Kiah,
daham in Hartberg,
tuan sie söba melkn,
und die Hendln
legen ihre Eier
zehn Mal am Tag.
Es sauft der Bauer
no an Liter.
Hartberg, Hartberg,
du gibst mir Freiheit
und mein Glück — noch Hartberg
gibt’s für mich ka Zurück.
Der Herr Doktor Glehr
ist der beste Diagnostiker.
Er hat kan Patientenschwund,
es san jo olle g’sund.
In Hartberg, in Hartberg.
A paar gegrillte Schweinderl
laufen durch die Stadt
und bitten höflich,
ob ma net a Stückerl
Schinken mag.
So fongt das Leben
von an jedn au,
in Hartberg, in Hartberg,
wo der ärgste Sandler
in an Jor (oder an halbm)
zum Grafen Bamsti wird.
Jo, Hartberg, Hartberg,
du gibst mir Freiheit
und mein Glück — noch Hartberg
gibt’s für mich ka Zurück.
Und Konfuzius sagt
»Und Konfuzius sagt: Wenn er in Reichtum und Ehren lebt, handelt er, wie es sich in Reichtum und Ehren geziemt. Wenn er in Armut und Niedrigkeit lebt, handelt er, wie es sich in Armut und Niedrigkeit geziemt. Wenn er unter Barbaren lebt, handelt er, wie es sich unter Barbaren geziemt. Wenn er in Leid und Schwierigkeiten lebt, handelt er, wie es sich in Leid und Schwierigkeiten geziemt. Der Edle gerät nie in eine Lage, in der er nicht er selber ist.« — Na gut, Herr Konfuzius, so widerspruchsfrei daherkommen geht nur auf Papier. Der Edle kann unter Barbaren nur einer sein, der selbst keiner der Barbaren ist. Die Angleichung in diesem Fall unterstützt den Edlen nicht in seinem edlen Er-selbst-Sein. Es löscht ihn darin aus, so wie die Spießer, die bei der SS ihre Harmlosigkeit auslöschten, weil sie unter Barbaren handelten, wie es sich unter Barbaren geziemt.
Wos hob i?
I hätt so gern
a Rolex
und a Yacht
im Mittelmeer,
a Suite
in New York,
der sterbenden Stadt,
a klane Bleibe
an da Côte d’Azur,
in Juan-les-Pins,
durt is ma
in der Mitt’n drin
und do no
am Raund.
I hätt so gern
a gescheit’s Gwand,
damit ma
die inneren Werte
mia a von außen
ausiecht. Oba
wos hob i?
I hob’s
I hätt gern a Kistn
Lux-Saf,
a Paradox-Zahnpasta,
na, Paradontax-Zahnpasta
gegen’s bluatige Zahnfleisch
und gegen die Caritas,
na, gegen die Karies,
und vom »Rausch«,
der Firma,
hätt i gern
das Haarshampoo Weidenrinden
gegen Schuppen.
Mehr brauch i net
für mein Luxus.
»Und Konfuzius sagt: So weilt der Edle in Ruhe und Gelassenheit und erträgt sein Schicksal gefasst. Der Gemeine aber beschreitet gefährliche Wege, um ein unverdientes Glück zu erjagen.«
Unterführung
Beim Ströck
In der Unterführung
Vom Stephansplatz
Zwei Buttersemmeln
Zwa frische Buttersemmeln
Im Pflegeheim
Wien-Meidling
An einem Sonntag
Aus alter Zeit
Zwa Buttersemmeln.
Viel Feind, viel Ehr
1
Die Menschen besprechen gerne ihre großen Fragen. Man muss das Bedürfnis nach Pathos, nach Erhabenheit der eigenen Person und nach der eigenen Wichtigkeit als Feind oder als Freund ausleben, während der Gleichgültigkeit, mit der Menschen einander zumeist begegnen, etwas Lebloses, Nicht-Vitales anhaftet. Und ich scheue daher nicht, nur ein wenig, vor einem Thema zurück, das schlicht heißen könnte: Feindschaft.
Die Versuche, so etwas Problematisches wie Feindschaft auszublenden, zu tabuisieren, halte ich für vergeblich. Dass man Andersdenkende lieb finden soll, finde ich natürlich auch, aber denke ich an einen meiner Feinde, denke ich gleich ganz anders. Eine Anekdote: 2024 gewann ich in »Best of Böse«, einer Beilage der Zeitschrift Falter zum Jahreswechsel, den 61. Platz. »Best of Böse« ist eine Liste mit den Namen der verächtlichsten Österreicher des Jahres. Da stand — gedruckt neben einem Porträtfoto von mir — zu lesen: »Der Mann nennt sich Philosoph. Merket, bei Hegel kennt sich der Volkskanzler aus, und sonst niemand! Schuh redet Stiefel. Es wundert dennoch, dass es immer wieder Verirrte aus der grün-marxistischen Blase gibt, die dem Gemurmel des feisten Greises andächtig lauschen.«
Wie soll man gegen so einen Feind Feindesliebe üben, ohne sich dabei zu erniedrigen? Dass jemand, der Schuh heißt, einen Stiefel redet, ist zugegeben eine beachtliche satirische Leistung. Solche Feinde wünscht man sich. Hegel als Bindeglied zwischen mir und dem »Volkskanzler« Kickl anzugeben, stimmt zwar. Merket, der Feind weiß, wo mein Auto steht, ich wohne nämlich in der Hegelgasse.
Übrigens habe ich mich selbst nie »Philosoph« genannt. Meine aktenkundige Selbstbezeichnung war stets mit der Floskel erledigt: »Literat mit philosophischen Interessen«. Aber es gehört zur Feindschaft, von so feinen Unterschieden nichts wissen zu müssen. Die eigene Geschäftsgrundlage, die grün-rote Blase, wirft der Feind mir als verwerflich vor, und der Ärger darüber, dass ich gelegentlich Aufmerksamkeit bekomme, ist ihm anzumerken. Vielleicht hat er davon zu wenig. Bei »marxistisch« lausche ich verwirrt, aber andächtig, bei »grün« halte ich die schlechte Luft an.
Na klar, mein Gewicht ist für so einen Feind ein großes Fressen. Aber als Altersdiskriminierung (»feister Greis«) ist es mir, wie vom Feind ja gewollt, wirklich unangenehm. Es trifft mich ins Herz. Der wünscht mir ja den Tod! Auf einen Greis mehr oder weniger kommt es ihm nicht an, geschweige denn auf einen feisten. »Feister Greis«: Das signalisiert den Übergang von einer Gegnerschaft in die Feindschaft, und ich habe das beängstigende Gefühl, hier kann einer seinen Hass nicht mehr kontrollieren, und er scheitert daran, ihn — wie den Rest — gerade noch witzig zu formulieren. Immerhin ist die Bloßstellung des Offensichtlichen, des Alters und der Verfettung, die unterste Stufe der schönen Kunst der Polemik. »Best of Böse« ist ja ein Pranger, der dadurch erträglich wird, dass er die auserwählten Feinde nicht ohne Witz skizziert.
Empfindlich darf man — auch im Eigeninteresse — nicht sein, zumal es zum Job meiner Art und zum Berufserfolg in diesem Job gehört, auch den Hass von Konkurrenten hervorzurufen, die noch unbegabter sind als man selbst. Die schlimmsten Feinde sind allerdings die, die man nicht kennt, weil sie aus der Anonymität angreifen. Ach, wäre das schön für mich, die Heckenschützen beschreiben zu können, um sie durch Einordnung ihrer Physiognomie in die Ausstellungsobjekte der Feindesliebe liebevoll einbeziehen zu können
2
Klar, zum »Schwurbler« soll ich nicht Schwurbler sagen, denn das minimiert die Hoffnung auf ein gepflegtes Gespräch, das ich allerdings ohnedies nicht möchte, weil zum Beispiel so ein Impfgegner mir nur dann halbwegs zustimmen würde, wenn ich ganz seiner Meinung wäre.
Es gibt Gegensätze, in denen die Bewertung, auch die Verurteilung eines anderen gar nicht ausbleiben darf. Sehr schön der österreichische Gesundheitsminister, der in Amt und Würden eine Pressekonferenz fluchtartig verließ, weil er der Schwurbelei über das Ausmaß von Impfschäden eines »Gesundheitslandesrats« nicht die Räuberleiter machen wollte: »Für den mache ich doch keine Kulisse«, war das Motto des Ministers: »Da bin ich nicht dabei, und ich dokumentiere es sogar körperlich — mit meinem physischen Verschwinden.«
Es heißt, mit anderen Menschen möge man in sachlichem Meinungsaustausch stehen. Meinungen sind aber naturgemäß nicht sachlich. An einer Meinung hängt bekanntlich zu viel Persönliches, man kann sie nicht neutralisieren um des lieben Friedens willen. Moralisch hochstehende Menschen können die Leidenschaft dämpfen, mit der sie ihre Meinungen vertreten. Dafür bin ich auch — für das Herunterkochen der Feindschaft zur Gegnerschaft. Gegner sind Menschen, die zur Aufrechterhaltung und Betonung der eigenen Identität gut zu gebrauchen sind. Nicht zuletzt in einer Gegnerschaft kommt man zu sich. Zu Feinden macht man (sich) seine Gegner, indem man sie zu vernichten wünscht. Ich habe Folgendes tatsächlich gehört, beim Zappen durch die Programme. Da sagte ein österreichischer Innenminister, wer bei uns das Kalifat ausruft, für den gäbe es nur zweierlei: erstens Einsperren und zweitens Abschießen.
Für den Versprecher entschuldigte er sich: Er habe Abschieben gemeint. Das ministrable Beispiel zeigt, was die Feindschaft mit sich bringen kann, nämlich Unbeherrschtheit: Man hat sich nicht mehr in der Hand. Deshalb wirft man, während man selbst cool erscheinen möchte, dem Feind »Hasstiraden« vor. Man propagiert, dass der Feind nicht edel ist, sondern dass ihn der Hass verzehrt, und damit lässt sich auch der eigene Hass mehr oder weniger bequem verdrängen. Besser ist es, sich den eigenen Hass einzugestehen und mit ihm diätetisch umzugehen.
Es kann beim Wunsch bleiben, bei der Phantasie der Vernichtung der Feinde. Zumindest zur Drohung, sie zu vernichten, kann es werden. Putin droht mit seinen Atomwaffen, was der sprachlich überforderte Journalismus gerne »Säbelrasseln mit dem Atomkrieg« nennt. Der Säbel unterstellt der Atomwaffe eine Harmlosigkeit, die den technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Weltvernichtung zum Ritterlichen verkleinert. Feindschaften haben es auch an sich, dass sie zu Gewaltausbrüchen, zu spontanen oder zu geplanten führen. Das weiß man, man muss es berücksichtigen, aber das Wissen gibt keine Sicherheit über die reale Gefahr. Gewaltphantasien können als Dampfablassen funktionieren, also den Ausbruch realer Gewalt geradezu verhindern. Wenn man Glück hat!
Selbstverständlich darf man den Rechtsextremisten nicht nachsagen, sie wären Rechtsextremisten, bloß weil sie Rechtsextremisten sind. Interessant, wie eine Parteigängerin des parlamentarischen Arms des Rechtsextremismus, der FPÖ, sich dagegen verwahrte, ihre Partei würde herumhetzen. Die Hetzer wären die anderen, die »pausenlos« ihre Partei »rechtsextremistisch« nennen, wo doch Extremisten ausschließlich Leute wären, die ihre Ziele mit Gewalt durchsetzen wollten. Aber nein, Extremisten sind auch Leute, die mit Gewalt drohen, mit Fahndungslisten und mit dem »Ausputzen bis in die letzten Enden in dieser Republik«.
3
Michael Corleone wird in Francis Ford Coppolas Film »Der Pate« gefragt, ob er denn »alle umbringen« will. Er antwortet, von »alle umbringen« sei keine Rede, »nur meine Feinde«. Die Feindschaften stehen heute an der Kippe. Feinde leben in ihrer eigenen Welt, aber eng nebeneinander. Ich kann auswendig aufsagen, was ein jeder von der derzeitigen Weltpolitik weiß: der Trumpismus, der Putinismus, der chinesische Kapitalismus-Kommunismus, der nordkoreanische kommunistische Brutalismus, die iranisch-islamistische »Kopf ab den Ungläubigen«-Bewegung. Die Politisierung der Religion und schließlich ihre gewaltförmigen, kreuzzugartigen Auswüchse, einschließlich des iranischen Staatsterrors — sie alle zusammen bilden die unschöne neue Welt der Feindschaften.
Die ganze Szene riecht nach Gewalt. Gewalt existiert nicht nur in Form ihrer Androhung. Die Einzelfälle ihrer Anwendung häufen sich, und zwar dermaßen, dass man von Einzelfällen nicht mehr reden kann: Es ist Krieg, und es gibt eine Rhetorik, die darauf setzt, die Menschen würden vor sich selbst erschrecken und schon morgen der Gewalt abschwören. Man pflegt die Sehnsucht nach Gewaltfreiheit, auch nach verbaler, ohne in der Sache, in den Streitfragen im Geringsten nachgeben zu müssen. Ich rate von dem Glauben ab, das Feindbewusstsein ließe sich durch Pädagogisierung, durch eine Besserungsrhetorik abschaffen — das sind leere Kilometer des Moralisierens. Die Feindlichkeit unter Menschen muss man einschränken, strafrechtlich, je nach ihren Folgen, verfolgen, jedenfalls bewusstmachen. Man kann sie auch kompensieren, zum Beispiel durch Nationalmannschaften, die auf dem Fußballfeld sogar unentschieden spielen dürfen. Die wahre Feindschaft verträgt nur den Sieg oder die verhasste Kapitulation in der Niederlage.
Einen Abklatsch davon geben die kompensatorischen Spiele. Schon im Stadion lauern oft die Hooligans auf ihre Chance zur Gewalt, nicht zu reden von den Ersatzkriegen, die in Analogie zu den realen Kriegen stattfinden: »Amsterdam: Israel-Hasser jagen Tel-Aviv-Anhänger bei Spiel Ajax gegen Maccabi.« Das Kompensatorische, der Sport, der in der Zeitung als »Wettkampf« verherrlicht wird, das ununterbrochene Sportstück, findet im wechselseitigen Hinhauen ein Ende.
Eine Fernsehserie heißt wunderschön »Fürchte Deinen Nächsten!« Besser wäre: Fürchte ihn wie dich selbst. Furchtbar ist immer nur der andere, für den man wiederum selbst furchtbar ist. Die Verbrechen verschwinden im Zeitalter der Verfilmung, im Zeitalter der dokumentarischen Möglichkeiten nicht mehr in einem gestaltlosen Gewesensein, das man Geschichte nennt. Vieles ist abrufbar wie die Bilder von der Mutter aus dem Warschauer Ghetto, die, selbst gerade noch nicht verhungert, in einem maßlosen Schmerz ihr totes Kind im Arm trägt. Es ist eine Spielart des Grundsatzes homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf.
All das eröffnet die Möglichkeit für zwei Arten der Verblendung: Verblendet ist, wer sich ins Wölfische verbeißt, dass Menschen ausschließlich Monster sind, die man zur Verträglichkeit zwingen muss — was unter anderem zu einer schrecklichen Ideologie führen kann, zu einer Herrschaftsform, die die Menschen, um sie angeblich vor ihrer Bestialität zu bewahren, einer gewaltförmigen Erziehungsdiktatur unterwirft.
Was Menschen alles an Gutem zusammenbringen, muss man nicht paranoid verdrängen. Die Solidaritäts- und Kooperationsleistungen der Menschheit sind durch keine üble Nachrede zu schmälern. Ob allerdings sie das Leben der Menschen im Großen und Ganzen stärker bestimmen als die mörderischen Attacken, auf die man jederzeit gefasst sein darf, scheint mir unentschieden. Die Lage der Menschheit ist verzwickt: Verblendet ist schließlich auch der, der übersieht, dass sogar die Demokratie ihre Feinde hat, die man übrigens auch an der Propaganda erkennt, sie allein würden uns die wahre Demokratie, die wahre Freiheit bringen.
4
Eine der zivilisatorischen Errungenschaften, die in Theorie und Praxis gelten sollten, ist also die Unterscheidung zwischen Gegnern und Feinden. Der Politiker Herbert Kickl, der darauf spekuliert, als zweiter Volkskanzler in die Geschichte einzugehen, feierte Donald Trumps Wiederwahl mit den Worten: »Die Amerikaner haben die selbstverliebte Politik der eiskalten Eliten davongejagt.«
Das ist die hitzige Propaganda einer Feindschaft, sie wurzelt und verrät sich im »davongejagt«, zumal in Österreich, wo es zum Hausgebrauch gehört, dass an manchen Jägern etwas Todbringendes haftet, und das nicht nur für Tiere. Ich neige nicht dazu, die Gegnerschaft zu idealisieren. Kein Wort von Respekt, mit dem man den Gegnern entgegentritt. Gegnerschaft, die nicht in Feindschaft abgleitet, hat für mich zwei Voraussetzungen: erstens, dass die Kombattanten wenigstens ähnliche Ziele haben, dass aber zweitens die Wege, sie zu realisieren, unterschiedlich sind, ja sogar unvereinbar. Man kann das ein gleiches Bezugssystem nennen, innerhalb dessen man streitet und sogar den Gegner gut gebrauchen, von ihm etwas lernen kann. Lernen können auch Feinde voneinander: Die Nationalsozialisten von einst haben den Kommunisten von damals für die Ästhetik der Aufmärsche einiges abgeschaut. Die Neonazis von heute arbeiten nicht zuletzt mit einem Aufmerksamkeit erregenden Aktivismus, den die 68er-Bewegung erfunden hat.
Als Tugend (nun doch idealisierend) ist es unter Gegnern möglich, wenigstens den Verdacht zu haben, wenigstens eine Ahnung davon zu spüren, der andere könnte vielleicht doch in einigem recht haben. Das ist bei Feinden nur im Unbewussten möglich, offen kommuniziert man als Feind das Gegenteil. »Eiskalte Eliten« jagt man am besten davon. So wie die schon zitierten antisemitischen Schlägertruppen, die israelische Fußballanhänger in Amsterdam durch die Stadt jagten.
Zur Kultur der Gegnerschaft gehört Gewaltvermeidung, in Feindschaften wird (wenigstens) verbal mit Vernichtung, (wenigstens) mit Rache gedroht. Gegnerschaft ermöglicht Ironie, Feindschaft höchstens Häme, als ein rhetorisches Niedermachen, im Zusammenklang mit dem Gefühl, gegen die gemeinen, hinterhältigen Idioten absolut im Recht zu sein. Sie, die Gegner, sind am Untergang schuld, wir bringen »die Veränderung«, die Rettung im letzten Augenblick.
Ich bin kein Gegner der Rechten dieser Tage, ich bin ihr Feind. Ich bin aber zivilisiert, was immer das bedeutet. Ich möchte meinen Feind nicht vernichten, ich möchte ihn nur von dort weghaben, wo er die Macht ergreift. Es würde mir genügen, dass er über mich keine Macht hat. Ich wünsche mir auch den sozialen Tod der politischen Feinde nicht, auch aus dem Grund, dass sie als Ventil für den real existierenden Hass unverzichtbar sind.
Es gehört zur dialektischen Spiegelung, dass die Aggression der einander feindselig Hassenden ihren echten Gegnern die Feindschaft aufzwingt. Das ist ein Teil des Erfolgs ihrer Strategien. Es ist das Toxische, mit dem sie die Atmosphäre vergiften. So entsteht im Kleinen der berüchtigte Kreislauf, der auch das Leben der Großen im Kampf um die geopolitische Vorherrschaft bestimmt. Wie aus dem Hin und Her von Angriff und der berechtigten Gegenwehr aussteigen? Dass das ungeheuerlich schwierig ist, sagt mir eine mythische Phantasie aus der Antike: Man benötigt zumindest einen Gottobersten, der eine Göttin der Weisheit zur Verfügung hat und sie ausschicken kann, um einen Dauerkrieg zu beenden. Auf Befehl von Zeus erschien seinerzeit die Göttin Athene in Ithaka. Sie rief dem Volk zu: »Halt! Hört auf mit dem brudermordenden Kampf! Vergießt nicht unnütz weiteres Blut und beendet die Feindschaft.«
Hätte Odysseus die Freier an seinem Hof, wo ihm Penelope die Treue gehalten hat, abgekragelt, das Morden und Schlachten wäre weitergegangen. Odysseus stürzte zuerst einmal hinter den Feinden her, doch da: Ein feuriger Blitz schlug vor ihm in die Erde, und die Göttin befahl, den blutigen Kampf auf ewig zu beenden. Schluss aus dem Grund, dass Zeus nicht zornig werde!
Die begütigende Rede, man möge doch die Anliegen verstehen und auch seinen Feinden zuhören, spielt sich für mich nicht. Solche Sprüche im Guten sind nur der Art von Liberalen möglich, die sich verständnisvoll aus der Konfliktzone herausnehmen können. Es ist das alte Dilemma, dass man Menschen, Parteien, die ihre Machtansprüche hauptsächlich über Feindschaften realisieren, die also »intolerant« sind, keineswegs mit Toleranz entgegenkommen soll. Toleranz gegenüber den Intoleranten hieße, ihnen kampflos das Feld zu überlassen.