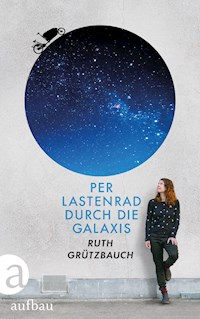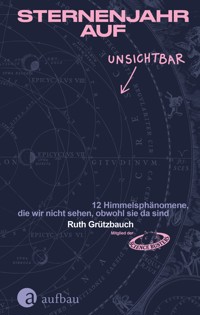
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der etwas andere Guide durch das Himmelsjahr.
Mondphasen, Sternbilder oder Planetentreffen – das Himmelsjahr hält so einiges für uns bereit. Doch die spektakulärsten Himmelsphänomene sind die, die wir nicht sehen können. Zum Beispiel die etwa 40 Milliarden potenziell bewohnbaren Exoplaneten in unserer Milchstraße oder die mysteriöse Dunkle Materie, aus der der Großteil unseres Universums zu bestehen scheint. Die Astronomin Ruth Grützbauch, Mitglied der Science Busters, hat einen vollkommen anderen Führer durch das Himmelsjahr geschrieben. Monat für Monat lässt sie uns den Kosmos mit neuen Augen sehen, etwa mit denen des James-Webb-Weltraumteleskops oder der wenigen Menschen, die die Rückseite des Mondes gesehen haben. Sie wirft einen Röntgenblick auf das Spektrum des unsichtbaren Lichts, auf Bilder aus Neutrinos und auf Sterne, die es womöglich gar nicht mehr gibt. Lehrreich, unterhaltsam, augenöffnend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Die spannendsten Geschichten über das Universum erzählen die Dinge am Himmel, die wir nicht sehen können! Von Alien Earths über Dunkle Materie bis zur Rückseite des Mondes –Ruth Grützbauch blickt auf der Suche nach den faszinierenden unsichtbaren Phänomen durch die Augen des James-Webb-Weltraumteleskops, wirft einen Röntgenblick auf das Spektrum des unsichtbaren Lichts, auf Bilder aus Neutrinos und auf Sterne, die es womöglich gar nicht mehr gibt. Ihr Buch ist ein origineller Führer durch das astronomische Jahr, das uns Monat für Monat der Lösung der größten Rätsel des Kosmos näherbringt. Lehrreich, unterhaltsam, augenöffnend.
Über Ruth Grützbauch
Ruth Grützbauch ist Astronomin und hat zu Zwerggalaxien promoviert. Seit 2017 ist sie mit ihrem Pop-up-Planetarium unterwegs, um den Menschen die unendlichen Weiten des Weltraums näherzubringen. Seit Anfang 2020 gestaltet sie zusammen mit Florian Freistetter den Podcast »Das Universum«, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Wissenschaftspodcasts gehört. Sie ist Mitglied der Science Busters. Bei Aufbau erschien von ihr »Per Lastenrad durch die Galaxis« (2021). Die Autorin lebt in Wien.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ruth Grützbauch
Sternenjahr auf Unsichtbar
12 Himmelsphänomene, die wir nicht sehen, obwohl sie da sind
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Einleitung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Danksagung
Endnoten
Bildquellen
Erläuterungen
Impressum
Denn von allen Gedanken schätz ich doch am meisten die interessanten
— Die Sterne
Einleitung
Das Sehen mit den eigenen Augen ist total überschätzt. Es verleiht den Dingen trügerische Realität, obwohl wir wissen, dass unsere Augen alles andere als verlässliche Messinstrumente sind.
Unsere visuelle Realität entsteht erst in unserem Kopf und bildet dabei nur einen winzigen Teil dessen ab, was um uns herum vor sich geht, und noch dazu schlecht. Das wusste auch der Schriftsteller und Pilot Antoine de Saint-Exupéry, als er seinen kleinen Prinz sinngemäß sagen ließ: Man sieht nur mit dem Fernrohr gut, das Wesentliche ist für unsere Augen unsichtbar.
Natürlich ist es großartig, Himmelsobjekte mit eigenen Augen zu sehen. Der funkelnde Sternenhimmel in einer klaren, dunklen Nacht, fern jeglicher Zivilisation ist ein spektakulärer Anblick. Das erste Mal einen anderen Planeten durch ein Fernrohr als eigenständige andere Welt wahrzunehmen, mehr als nur einen Punkt zu sehen, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Etwas zu sehen, gibt uns einen Bezug zu den Dingen und hilft uns dabei, sie zu verstehen – aber nicht immer. Oft steht uns unsere optische Fixiertheit sogar im Weg, wenn wir glauben, uns etwas bildlich vorstellen können zu müssen, um es zu verstehen.
Wenn wir die Dinge immer nur mit unseren eigenen Augen sehen, verpassen wir eine Fülle an unvorstellbaren und absurden Phänomenen, die sehr erfrischend und im wahrsten Sinne horizonterweiternd sein können. Die überwältigende Mehrheit und vor allem die richtig argen und spannenden Dinge da draußen sind für unsere Augen komplett unsichtbar. In den folgenden zwölf Kapiteln werden wir darum Monat für Monat versuchen, den Himmel mit etwas anderen Augen zu sehen – und uns anschauen, wie das Unsichtbare unseren Blick auf die Welt verändern kann.
Doch bevor wir uns in die Aufreger des Monats hineinstürzen, die wir dieses und auch jedes andere Jahr wieder nicht zu Gesicht bekommen werden: Was genau ist mit »Unsichtbar« gemeint? Unsichtbare Dinge decken ja ein breites Spektrum ab. Es gibt im Grunde vier Möglichkeiten, warum Dinge unsichtbar sind. Werfen wir einen schnellen Blick darauf in meiner persönlichen Reihenfolge von eher weniger bis sehr spannend.
1. Dinge, die es nicht gibt
Das ist zwar ziemlich selbsterklärend, aber der Vollständigkeit halber kommen sie hier vor. Dazu gehören zum Beispiel außerirdische Lichtwesen, wie Plejadier oder Aldebaraner oder wie sie alle heißen mögen – mal ganz abgesehen davon, dass das bescheuerte Namen sind, denn wir Menschen heißen ja auch nicht nach unserem Stern Sonner oder Solarer. In diese Kategorie fallen auch fliegende Untertassen oder Teekannen im Weltraum und andere nicht widerlegbare Dinge und Geschöpfe, leider auch Einhörner – es sei denn, sie sind ein Sternbild. Diese Kategorie werden wir weitgehend ausklammern.
2. Dinge, die zu weit weg und deshalb zu klein und schwach sind, um sie zu sehen
Unsere Augen sind sehr klein, können nur wenig Licht sammeln und haben ein sehr begrenztes Auflösungsvermögen. Wir haben einfach zu kleine Gesichter. Dieses Problem lösen wir seit gut 400 Jahren mit Teleskopen. Je größer ein Teleskop, desto mehr Licht kann es sammeln und umso größer ist die Auflösung. Die Dinge dieser Kategorie könnten wir also auch sehen, wenn unsere Augen ein paar Meter groß wären und stundenlange Langzeitbelichtungen machen könnten. Dazu gehören eigentlich fast alle klassischen Himmelsobjekte, abgesehen von Sonne, Mond, Planeten und den 6000 Sternen in unserer Nachbarschaft, die wir mit freiem Auge am Himmel sehen können. Die entferntesten dieser Sterne sind einige Tausend Lichtjahre[1] weit weg. Ihr Licht hat also Tausende Jahre bis zu uns gebraucht. Wie weit können wir genau blicken? Einen Stern wie die Sonne würden wir in bis zu 60 Lichtjahren Entfernung sehen können. Das Leuchten der riesigen Monstersterne sehen wir aber noch von wesentlich weiter weg. Einer der entferntesten Sterne, die man noch mit freiem Auge sehen kann, ist Eta Carinae, eigentlich ein Doppelstern, in etwa 7500 Lichtjahren Entfernung. Teilweise noch weiter entfernt und trotzdem gut sichtbar ist die Scheibe der Milchstraße, das kollektive Licht von Milliarden von Sternen unserer Galaxie, das wir als milchiges Band am Himmel sehen können. Doch das am weitesten entfernte und trotzdem noch ohne Teleskop sichtbare Ding am Himmel ist unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, in gut zweieinhalb Millionen Lichtjahren Entfernung. Alles, was mehr als 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, ist aber für unsere Augen definitiv unsichtbar.
3. Dinge die wir auch mit Riesenaugen nicht sehen könnten, weil sie eine unsichtbare Farbe haben
Der Regenbogen, den wir sehen, ist ja nur ein winziger Teil des gesamten Regenbogens des Lichts, des sogenannten elektromagnetischen Spektrums. Die Farben, die wir sehen, liegen ziemlich in der Mitte, das heißt, es geht auf beiden Seiten nach rot und vor violett noch mit jeder Menge anderer unsichtbarer Farben weiter. Farben sind nichts anderes als die Länge der Lichtwellen. Und die Wellenlänge wiederum bedeutet die Energie, die das Licht mit sich trägt. Was wir sehen, ist eigentlich fast nur Sternenlicht. Darauf sind unsere Augen aus gutem Grund optimiert, denn um uns herum wird fast alles von Sternenlicht beleuchtet: vom Licht unseres Sterns, der Sonne. Die Farben, die wir sehen, kommen von Dingen, die so heiß sind wie Sterne. Auch wenn kühlere Dinge um uns herum diese Farben reflektieren, kommt das Licht und kommen somit auch die Farben ursprünglich von der Sonne. Kühlere Dinge leuchten in röteren Farben, Infrarot und Radiowellen, wie zum Beispiel Planeten oder interstellare Gas- und Staubwolken. Heißere Dinge strahlen in violetteren Farben, Ultraviolett und Röntgenstrahlung, wie etwa heiße Riesensterne, oder extrem heißes Gas, das um Schwarze Löcher herumwirbelt. Und dann gibt es noch das Licht mit der höchsten Energie: Gammastrahlung. Die wird nicht mehr durch die Temperatur, also chaotische Bewegung der Teilchen, erzeugt, sondern durch andere, ärgere Prozesse. Meistens sind dabei auf extreme Geschwindigkeiten beschleunigte Teilchen involviert, relativistische Elektronen in horrenden Magnetfeldern, wie z. B. in Pulsaren, bei Supernova-Explosionen, oder in aktiven Galaxienkernen.
Und dann gibt es noch:
4. Die wirklich unsichtbaren Dinge
Sie wären unsichtbar, auch wenn ich sie direkt vor meiner Nase hätte. Dunkle Materie zum Beispiel, die gar nicht dunkel ist, sondern durchsichtig, oder eben unsichtbar. Kurioserweise besteht ja der überwältigende Großteil des Universums aus komplett unsichtbaren Dingen, von denen wir dementsprechend auch noch nicht wissen, was sie sind. Darunter fallen die Dunkle Materie und die Dunkle Energie, die gemeinsam etwa 95 Prozent des Universums ausmachen. Schwarze Löcher könnte man auch zu dieser Kategorie zählen. Nur wenn ein Schwarzes Loch gerade Material verschluckt oder man sehr nahe dran ist, kann man es sehen: als gähnende, licht-verschluckende Leere, deren unendlich konzentriertes Gewicht ein Loch in den Raum gerissen hat.
All die wirklich unsichtbaren Dinge und auch einige Farben des unsichtbaren Regenbogens werden in unserem Abenteuer mit dabei sein. Packen Sie die Augenklappen aus, klappen Sie das Visier runter. Kommen Sie mit mir auf die dunkle Seite. Es wird Zeit, dass wir uns dem aufregenden unsichtbaren Universum widmen.
1
Der 8. Januar 2022 war ein ganz besonderer Tag für die Wissenschaft. Es grenzt beinahe an ein Wunder, dass die riesigen Steine, die all den Astronominnen und Astronomen auf der ganzen Welt von ihren Herzen gefallen sind, keine Verschiebung der Erdbahn bewirkt oder zumindest Tausende kleine Krater erzeugt haben. Ich war mir ja sicher, dass bei dem verrückten Vorhaben, das man mit wissenschaftlichem Understatement als »ambitioniert« bezeichnen würde, irgendetwas schiefgehen musste. Aber nein, es lief alles sogar viel besser als erwartet, was ausnahmsweise mal nicht an der bekannten Überschwänglichkeit der NASA-Kommunikationsabteilung lag. Auch bei den anderen, normalerweise zurückhaltenderen Projektpartnern war die Aufregung spürbar.
Es war der Tag, an dem sich das James Webb Space Telescope (JWST)erfolgreich auseinandergefaltet hatte. Während einer 14-tägigen Tortur des Wartens für alle Beteiligten hatten sich nach und nach alle Strukturen und Mechanismen des riesigen Weltraumteleskops vollautomatisch in Position gebracht. Die 18 Spiegelsegmente des sechs Meter großen Hauptspiegels waren wie ein Flügelaltar in drei Teile gefaltet. Die Halterung des Sekundärspiegels war nach oben und hinten eingeklappt. Die einzelnen Schichten des Tennisplatz-großen, fünflagigen Sonnenschirms, dessen dickste Schicht mit fünf hundertstel Millimetern Dicke dünner als ein menschliches Haar ist, mussten aus ihrer Hülle geschält, ausgefahren und aufgespannt werden. Die Entfaltung des Teleskops[2] bot mit 344 Single Points of Failure, also unabhängigen Fehlerquellen, wirklich immense Möglichkeiten des Scheiterns. Jeder kleine Schieber, jede Klappe, jede Abdeckung, jede ausgefahrene Stange und Fixierung musste fehlerfrei funktionieren und hochpräzise in Position gebracht werden, um nicht das ganze Gerät in ein riesiges Stück Weltraumschrott zu verwandeln. Und das nachdem das Teil in einem Raketenstart ordentlich durchgeschüttelt worden war. Der war übrigens einer der schönsten Starts, die die Ariane 5 jemals hingelegt hat. Der Raketenstart war so perfekt, dass das Teleskop danach kaum mehr Treibstoff brauchte, um seine Bahn Richtung Outer Space zu korrigieren. Die Ariane 5 hatte das Teleskop so präzise in den Weltraum hinausgeschleudert, dass es sich die anderthalb Millionen Kilometer bis zu seinem Ziel, dem Lagrangepunkt L2 (einem Punkt der Balance zwischen den Anziehungskräften von Erde und Sonne), dahintreiben lassen konnte. Nur zwei kurze und sowieso geplante Manöver waren notwendig. Den gesparten Treibstoff kann das Teleskop im Laufe seines Betriebs gut brauchen, da es seine Umlaufbahn im Weltraum immer wieder ein wenig korrigieren muss. So konnte die Lebensdauer des JWST weit über die geplanten 5–10 Jahre hinaus verlängert und vermutlich sogar verdoppelt werden. Ein Abschiedsgeschenk der europäischen Rakete, die im Juni 2023 nach 27 Arbeitsjahren in Pension ging.
Ende Januar 2022 war das JWST dann in seinem Orbit um L2 angekommen, in dem es sich seitdem befindet. Für Ambitionierte ist es sogar möglich, das Teleskop am Himmel zu erblicken. Am besten jetzt gerade, denn im Januar steht es hoch am Himmel und ist jede Nacht zu sehen. Der Lagrangepunkt L2 liegt nämlich genau gegenüber der Sonne, im Januar in etwa dort, wo im Juli die Sonne wäre. Durch seine Umlaufbahn um L2 kreist das JWST mehr oder weniger in 30° Abstand um diesen Punkt, also drei Fäuste der ausgestreckten Hand am Himmel davon entfernt. Im Januar 2022 konnte man es knapp neben dem Orion im Sternbild Einhorn sehen, im Januar 2025 ist es in der Region zwischen den Sternbildern Einhorn, Orion und den Zwillingen unterwegs[3] . Aber erwarten Sie nicht, das Ding mit bloßem Auge am Himmel zu sehen wie die Internationale Raumstation1. Es ist ja doch wesentlich weiter von uns entfernt und hat eine Helligkeit von nur etwa 15 Magnituden. Wenn Ihnen das etwas sagt, haben Sie vermutlich auch ein Teleskop zu Hause, das groß genug ist, um das JWST tatsächlich zu beobachten. Sein Sonnensegel reflektiert zwar viel Sonnenlicht, doch es ist trotzdem mehr als tausend Mal schwächer als die schwächsten Sterne, die man bei dunkelstem Himmel noch sehen kann. Mit einem guten Amateurteleskop eine Herausforderung, aber durchaus möglich.
Das eigentlich Interessante ist jedoch nicht, das JWST zu beobachten, sondern durch das JWST zu beobachten. Jetzt wissen die Eingeweihten, dass man in der professionellen Astronomie nicht wirklich durch Teleskope schaut, vor allem natürlich nicht, wenn sie Millionen von Kilometern von der Erde entfernt sind. Doch auch die großen erdgebundenen Teleskope haben keine Okulare; da ist kein Ende, durch das man durchschauen könnte. Das direkte Beobachten ist von sehr geringem wissenschaftlichem Wert, denn unser Auge ist zwar ein tolles Instrument, aber es kann keine Langzeitbelichtungen machen und vor allem nicht messen und aufzeichnen, was es sieht. Statt der Linsen des Okulars, die uns das vergrößerte Bild zeigen, sind bei modernen Teleskopen Instrumente angebracht, die das Licht entweder als Bild aufzeichnen (Kameras) oder gleich in seine Einzelteile zerlegen, um es genauer zu untersuchen (Spektrographen).
Diese Instrumente machen also die Bilder, die wir uns nachher ansehen können. Bilder, die natürlich echt sind, aber selten »wirklich« so aussehen würden. Bei vielen großen Teleskopen werden die gleichen Farben beobachtet, die auch wir sehen können. Allerdings wird das Licht immer über einen langen Zeitraum gesammelt. Und so werden die Dinge sichtbar gemacht, die wir wegen der mangelnden Sensitivität unserer Augen nicht sehen können. Die Farben in den Bildern sind schon die echten Farben, aber sie würden für uns nie so aussehen, weil sie für unsere Augen nicht hell genug sind. In der Nacht sind alle Katzen grau. Doch das James Webb ist anders. Die Katzen des JWST sind unsichtbar. Seine Kameras und Spektrographen sammeln ausschließlich unsichtbares Licht, nämlich Infrarotlicht. Wir haben auch Sensoren, die Infrarotlicht wahrnehmen können: in unserer Haut, als Wärme, aber damit kann man leider keine Bilder machen.
Das JWST sieht also ausschließlich Dinge, die wir nicht sehen können. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist infrarot. Aber was sind das für Dinge? Eigentlich lässt sich mit dem JWST so gut wie alles besser beobachten, aber es gibt drei Schwerpunkte, drei Bereiche, die man im Infrarotlicht besonders gut sehen kann. Erstens: Dinge, die sehr, sehr weit von uns weg sind. Durch die Expansion des Universums kommt es zur Dehnung des Lichts, das uns von weit entfernten Galaxien erreicht: der sogenannten Rotverschiebung. Die erste Milliarde von Jahren in der Lebenszeit des Universums ist für unsere Augen überhaupt komplett unsichtbar. Das Licht ist so stark rotverschoben, dass sämtliches Licht, das uns erreicht, infrarot ist. Eine Milliarde Jahre entspricht etwa einem Vierzehntel der bisherigen Lebenszeit des Universums und entspräche bei einem durchschnittlichen Menschenleben den ersten sechs Lebensjahren. Die Vorschulzeit des Universums kann man also nur mit Infrarotteleskopen untersuchen. So beobachtet das JWST die Entstehung der ersten Sterne in den ersten Galaxien und wie sich die Galaxien in ihrer Kindheit entwickelt haben.
Das Zweite sind Dinge, die von Staub verborgen sind. Staub bedeutet in der Astronomie einfache chemische Verbindungen, also grob gesagt alles außer Wasserstoff und Helium, die beiden einfachsten Elemente, die sich schon kurz nach dem Urknall gebildet haben. Staub ist also das Material, aus dem alles andere, alles Interessante besteht. Überall, wo Staub ist, sind entweder schon spannende Dinge passiert, oder sie passieren gerade. Wie zum Beispiel die Entstehung von Sternen, die in dichten Staubwolken geschieht, oder die Explosion von Sternen, die den ganzen Staub in den Weltraum hinausschleudert. Im sichtbaren Licht ist dieser Staub dicht und undurchsichtig, doch nicht so im Infrarotlicht. Die längeren Wellen des Infrarot können leichter an den Staubkörnern vorbeifliegen, so wie man mit großen Rädern leichter über Schlaglöcher fahren kann. Das JWST eignet sich also perfekt, um das staubige Entstehen und Vergehen, also den Lebenszyklus, von Sternen zu beobachten.
Und drittens sind es alle Dinge, die weniger heiß sind als Sterne. Die Farbe entspricht ja der Temperatur des leuchtenden Dings. Und unsere Augen sind auf die Farbe von Sternenlicht spezialisiert, aus gutem Grund, denn es wird ja alles um uns herum von einem Stern beleuchtet. Mit Infrarotlicht kann man Dinge leuchten sehen, die weniger heiß sind als Sterne, wie zum Beispiel kleine Nagetiere nachts im Garten, ohne dass sie von irgendwas beleuchtet werden. Diesen Effekt machen sich z. B. Schlangen oder Nachtsichtgeräte zunutze, die Infrarotlicht detektieren können. Das Universum ist voll mit Dingen, die nicht sternenheiß sind, die interessantesten davon vielleicht: Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sterne kreisen, und ihre potentiellen Bewohner.
Der erste Exoplanet wurde im Jahr 1995 von Michel Mayor und Didier Queloz um einen Stern im Sternbild Pegasus entdeckt. Der Stern ist mit freiem Auge gerade noch zu sehen, Sie können ihn im Januar am Abendhimmel im Westen erspähen, seinen Planeten natürlich nicht. Zu Ehren der beiden Schweizer Astronomen wurde der Stern Helvetios getauft. Sein Planet bekam den Namen Dimidium, der Halbe. Es handelt sich dabei natürlich nicht um einen halben, sondern um einen ganzen Planeten, aber er hat etwa die halbe Masse des Jupiter, daher der Name. Es ist also ein großer Gasplanet, der vermutlich in Ermangelung einer festen Oberfläche auch keine Bewohner beherbergt. Außerdem ist Dimidium irrsinnig nah an seinem Stern dran. Er umkreist Helvetios mit einer Umlaufzeit von unglaublichen vier Tagen und einem Abstand von einem Zwanzigstel der Entfernung Erde–Sonne. Auf seiner (gasförmigen) Oberfläche hat es etwa 1000°C. Es ist also ein Planet, der ganz anders ist als die Planeten in unserem Sonnensystem. Sogar Merkur ist noch gut ein Drittel des Erdbahnradius von der Sonne entfernt und braucht etwa drei Monate um die Sonne. Das ist auch schon das Problem mit den meisten bisher gefundenen Planeten. Wir finden sie nur, wenn sie sich in sehr großer Nähe zu ihrem Stern befinden, da sie sich in größerer Entfernung auch weniger bemerkbar machen. Je weiter sie von ihrem Stern entfernt sind, desto langsamer bewegen sie sich und desto länger muss man warten, bis man einen ganzen Umlauf, oder idealerweise mehrere, beobachten kann. Es ist also sehr schwierig und sehr zeitaufwendig einen erdähnlichen Planeten zu finden.
Die auf eine Art und Weise erdähnlichsten Planeten wurden kurioserweise sogar vor Dimidium detektiert. Denn Dimidium war der erste Planet, der um einen lebenden Stern gefunden wurde. 1992 wurden bereits Planeten um den Pulsar PSR 1257+12 entdeckt.
Ein Pulsar ist eine Art von Neutronenstern, also das, was übrig bleibt, wenn sehr massereiche Sterne am Ende ihres kurzen Lebens explodieren. So ein Pulsar hat etwa 1–2 Mal die Masse der Sonne, aber zusammengepresst auf einen Durchmesser von 20–30 Kilometern. Also ein Stern von der Größe einer Stadt. Und weil sie so kompakt sind, drehen sie sich irrsinnig schnell. Im Fall von PSR 1257+12 sind es 160 Umdrehungen pro Sekunde. Die Pulsare erzeugen Radiostrahlung, die an den magnetischen Polen der Sternleichen gebündelt wird und wie der Lichtstrahl eines Leuchtturms mit jeder Drehung durch den Weltraum fegt. Wenn die Geometrie stimmt, trifft der Pulsarstrahl die Erde und ist als super-schnelles Blinken bei uns zu beobachten. Diese Strahlungspulse sind so exakt, dass schon eine winzige Verzögerung, die durch die Anwesenheit eines Planeten erzeugt wird, messbar ist. So wurden um den Pulsar drei erdähnliche Planeten mit 0,1 bis 4 Erdmassen und Umlaufbahnen zwischen 0,2 und 0,5 Erdbahnradien gefunden. Warum gelten die drei nicht als die ersten entdeckten Planeten? Weil sie erst nach dem Tod des Sterns aus seinen Eingeweiden entstanden sind. Nach der Sternexplosion bildet sich aus den Sternresten eine Art Trümmerscheibe um den Pulsar, die den protoplanetaren Scheiben um ganz junge Sterne ähnelt, und in der dann auch Planeten entstehen können. Sie sind zwar in ihrer Masse und Umlaufbahn der Erde nicht unähnlich, haben aber sonst sicher nichts mit ihr gemeinsam. Als Geisterplaneten um einen toten Stern wurden sie dementsprechend Draugr, Poltergeist und Phobetor getauft.
Viele Exoplaneten sind anscheinend wirklich sehr »alien«, also uns fremd in ihren Eigenschaften. Aber gibt es nicht doch Planeten, die ein wenig erdähnlicher sind? Unter den insgesamt 5500 Planeten, die wir bisher entdeckt haben2, sind ein paar Dutzend potentiell erdähnliche Planeten, aber noch kein Erdzwilling. Was macht einen Planeten erdähnlich? Er sollte etwa so groß und schwer wie die Erde sein und in der habitablen Zone seines Sterns liegen, also in der richtigen Entfernung, damit es flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche geben kann. Je nachdem, wie streng man in der Auslegung dieser Kriterien ist, gibt es im Moment an die 30 Kandidaten für potentiell bewohnbare Planeten da draußen3.
Wie kann uns das JWST hier helfen? Genau für die Detektion von Wasser eignet es sich sehr gut. Schon eines seiner berühmten fünf ersten Bilder4 war ein Spektrum des Exoplaneten WASP-96b mit eindeutiger Detektion von Wasserdampf in seiner Atmosphäre. Das war weder unerwartet noch besonders revolutionär, denn Wasser finden wir auch in den riesigen Interstellaren Wolken, aus denen sich Sterne und in weiterer Folge ihre Planeten bilden. Dass wir nun aber tatsächlich die Atmosphäre eines Exoplaneten so durchleuchten können, um ihre Zusammensetzung zu bestimmen, das ist sehr wohl erstaunlich. Dabei wird das Sternenlicht durch die dünne Atmosphäre des Planeten gefiltert, während dieser vor seinem Stern vorbeifliegt und so bestimmt, was in der Atmosphäre drin ist. Die Beobachtungen von WASP-96b waren eine Art technology demonstration, also der Beweis, dass es geht.
Trotz des Wasserdampfs ist WASP-96b aber bestimmt kein erdähnlicher, sondern ein großer, heißer Gasplanet. Das Besondere an der Erde ist ja nicht nur die Anwesenheit von Wasser per se, sondern von flüssigem Wasser an ihrer Oberfläche. Könnte das JWST auch flüssiges Wasser nachweisen? Das ist möglicherweise 2023 gelungen, als das Weltraumteleskop den Planeten K2–18b beobachtet hat. K2–18b ist eine spannende Welt. Der Planet liegt in der habitablen Zone seines Sterns, von seiner Masse her zwischen der Erde und dem kleinsten Gasplaneten Neptun, ist also eine sogenannte Supererde, und jetzt kommt das Beste: möglicherweise ein sogenannter hycean planet. Was bitte ist hycean, oder hyzean? Das ist ein Kunstwort, gebildet aus dem englischen hydrogen, Wasserstoff, und ocean, Ozean. Es ist ein Planet, der einen flüssigen Wasserozean unter einer wasserstoffreichen Atmosphäre, wie der eines Gasplaneten, haben könnte. Das JWST hat den Wasserozean zwar nicht direkt nachgewiesen, aber dafür einen verräterischen Mangel an Ammoniak in der Atmosphäre von K2–18b entdeckt5. Ammoniak ist in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre eigentlich immer mit dabei. Wo ist es also geblieben? Haben die Aliens das gesamte Ammoniak für Putzmittel oder Kühlaggregate verbraucht? Eine etwas plausiblere Erklärung für den Ammoniakmangel wäre eben, dass sich das Ammoniak im Wasser eines riesigen Ozeans gelöst hat, der den Planeten bedeckt.
Und da war noch etwas anderes Hochinteressantes in den Daten von K2–18b: ein sehr vorsichtig formulierter Hinweis auf eine Detektion von Dimethylsulfid (DMS). Dieses ominöse DMS wird auf der Erde ausschließlich von Phytoplankton in den Ozeanen produziert: Algen. Es könnte auf K2–18b Algen geben, und zwar jede Menge davon. Damit das JWST das DMS in der Entfernung überhaupt detektieren könnte, müsste etwa 20 Mal so viel davon produziert werden wie in den Ozeanen der Erde. Das ist viel, aber durchaus möglich für den gigantischen, algenüberwucherten Wasserozean einer Supererde. Keine attraktive Urlaubsdestination also mit kristallklarem Wasser, sondern eher die Adria zu ihren übelsten Zeiten – und leider auch ohne einen einzigen Strand. Trotzdem wäre die Detektion von DMS ein sensationelles Ergebnis, denn es wäre das erste Anzeichen für außerirdische Lebensformen. Nicht gerade die grünen Männchen, die manche sich vielleicht gewünscht hätten, aber trotzdem Aliens.
Doch außerordentliche Behauptungen erfordern außerordentliche Beweise – und die sind wie so oft leider auch in diesem Fall noch ausgeblieben. Im Mai 2024 hat eine neue Studie6 die Daten noch mal genau analysiert und gefunden, dass das DMS mit der Signatur des Methans so überlagert ist, dass es nicht eindeutig detektierbar ist – zumindest nicht in den vorliegenden Beobachtungen. Ein weiteres Forschungsteam7 weist außerdem darauf hin, dass sich Ammoniak genauso in anderen Flüssigkeiten lösen könnte, zum Beispiel in flüssigem Gestein. Der Ozean auf K2–18b könnte also genauso ein Magmaozean sein. Da wäre Ihnen die Algenpest lieber, oder? Es bleibt also spannend um K2–18b, und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir von ihm gehört haben.
Was hat das JWST sonst noch für spannende Bedingungen auf anderen Planeten ausgemacht? Da gibt es die Klasse der fluffigen oder flauschigen Planeten, manchmal auch Zuckerwatte-Planeten genannt. Durch die Nähe zu ihrem Stern sind diese Gasplaneten aufgepufft, also wesentlich weniger dicht als die kalten Gasplaneten in unserem Sonnensystem. Doch bei näherer Betrachtung stellen sich die Flauschplaneten als ziemlich unflauschig heraus. Zum Beispiel Wasp 107b, in dessen Atmosphäre das JWST Silikatpartikel nachgewiesen hat, also Sand. Diese Silikatpartikel werden in tieferen Schichten der Atmosphäre erzeugt und steigen als Sand-Dampf in die obere Atmosphäre, wo sie Sandwolken bilden. Ist das Material dann genug abgekühlt, regnet es den Sand wieder in tiefere Schichten hinab. Der Planet hat also Wetter wie die Erde, das aber nicht auf einem Wasserkreislauf, sondern auf einem Sandkreislauf basiert.
Ganz spezielles Wetter gibt es auch auf HD 189733b. Der jupiterähnliche Planet hat eine verheißungsvolle, azurblaue Farbe. Doch das Himmelblau entsteht nicht durch einen klaren Himmel wie auf der Erde, sondern durch Streuung an Silikat-Tropfen. Dort regnet es Glas. Der Planet hat ähnlich wie Dimidium eine Temperatur von knapp 1000°C, gepaart mit Windgeschwindigkeiten von etwa 7000 km/h. Die Glassplitter rasen dort also horizontal mit etwa fünffacher Schallgeschwindigkeit durch die Atmosphäre.
Doch auch das ist noch nicht das ärgste Wetter auf einem Exoplaneten. Den Vogel abgeschossen hat da wohl Wasp 43b, ein extrem heißer Planet, der so nah an seinem Stern dran ist, dass er ihn nicht in Tagen, sondern in nur 19 Stunden umrundet. Das JWST hat sich kürzlich an einer Wettervorhersage des Planeten versucht und Variationen in der Atmosphäre des Planeten gefunden, die von ganz besonderen Wolken herrühren: Es sind Wolken aus geschmolzenem Gestein. Auf Wasp 43b regnet es Lava.
Aber was ist mit den tatsächlich erdähnlichen Planeten da draußen? Das JWST ist gerade dabei, einige der Kandidaten und ihre potentiell lebensfreundliche Atmosphäre zu durchleuchten. Doch einen winzigen Gesteinsplaneten und seine noch winzigere Luftschicht vor dem gleißenden Licht seines Sterns zu isolieren, ist auch für ein phänomenales Weltraumteleskop keine Kinderjause. Es ist aber möglich, und wenn wir Glück haben, können wir in den nächsten Jahren auch die Signatur seiner potentiellen Bewohner in der Atmosphäre ausmachen. Wie reizvoll wäre es, eine außerirdische Biosphäre zu finden, lange bevor die Bewohner in der Lage sind, mit uns zu kommunizieren? Wir könnten das Schaffen außerirdischen Lebens und die Veränderungen, die dieses Leben in der Atmosphäre seines Planeten verursacht, beobachten, ohne dass die Außerirdischen es wüssten. Obwohl, wer weiß, vielleicht würden sie es auch wissen. Vielleicht hätten sie uns auch schon gefunden und beobachten uns gerade dabei, wie wir die Möglichkeiten entwickeln, sie zu beobachten. Wäre eine andere Zivilisation, die ähnliche Methoden entwickelt hat wie wir, in der Lage, das Leben auf der Erde zu detektieren? Oder anders gefragt: Aus welcher Entfernung könnten wir uns quasi selbst finden? Die Astronomin Lisa Kaltenegger hat ausgerechnet, dass es in einem Umkreis von etwa 300 Lichtjahren an die 2000 Sterne gibt, die in der richtigen Position wären, um die Erde vor der Sonne vorbeifliegen zu sehen8. Wenn es um einen dieser Sterne auch einen Planeten mit einer technisch ebenso begabten Zivilisation wie der menschlichen gibt, könnten die Außerirdischen unsere Atmosphäre durchleuchten und das Leben auf der Erde nachweisen. Und das schon seit etwa zwei Milliarden Jahren, als sich Sauerstoff und Methan in der Atmosphäre anzureichern begannen.