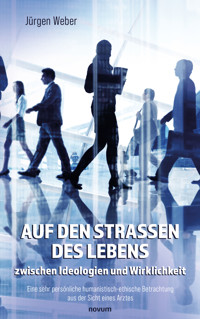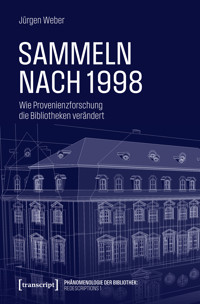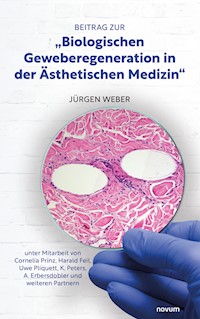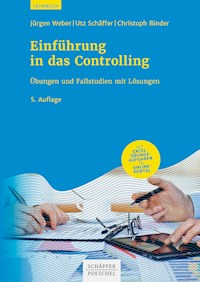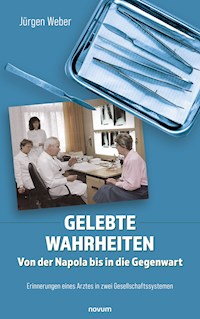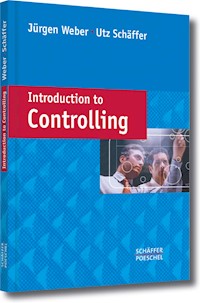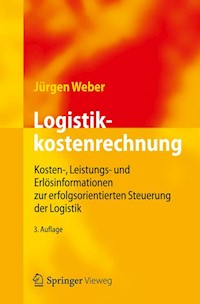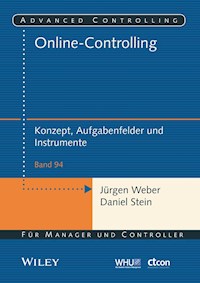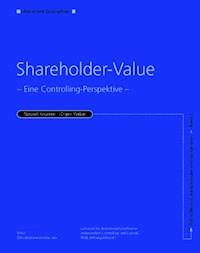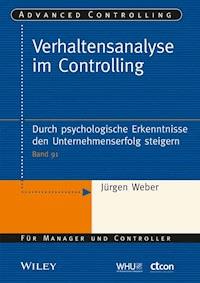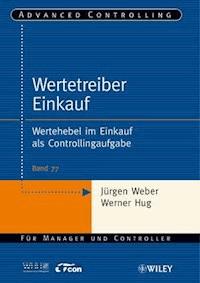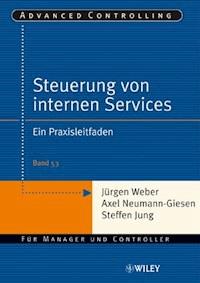
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Advanced Controlling
- Sprache: Deutsch
Interne Services rücken in den letzten Jahren stärker in den Betrachtungsfokus bezüglich Wirtschaftlichkeit und strategischer Ausrichtung. Schlagworte wie Shared Service Center, Service Level Agreements, Outsourcing und Drittmarktakquisition prägen die Debatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1 Interne Dienstleistungen im Blickpunkt – die zweite Welle des Reengineering?
2 Charakterisierung und Typisierung interner Dienstleistungen als Entscheidungsgrundlage
3 >Make or buy< – Strategien für den Umgang mit internen Dienstleistungen
4 Interne Steuerung der Servicebereiche
Führungs- und Organisationsmodelle für interne Servicebereiche
Führungsmodelle zur Steuerung interner Servicebereiche
KPI-Steuerung von internen Servicebereichen
5 Zusammenspiel der Serviceeinheiten und der internen Abnehmer
Organisatorische Eigenständigkeit der Services
Koordinationsaufgaben bei organisatorischer Eigenständigkeit der Services
Service Level Agreements als Instrument zur Koordination organisatorisch eigenständiger Services
Verrechnung von Serviceleistungen
6 Rolle des Controlling bei der Neugestaltung der Steuerung interner Dienstleistungen
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis
In eigener Sache
Professor Dr. Jürgen Weber lehrt Controlling an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Seine Devise ist: »Nichts ist so gut für die Praxis wie eine gute Theorie.« Jürgen Weber ist Herausgeber der Zeitschrift für Controlling & Management. Er ist Autor vieler Bücher, z. B. Einführung in das Controlling, und darüber hinaus einer der Gründungspartner der Managementberatung CTcon.
Axel Neumann-Giesen ist Senior-Projektleiter bei CTcon im Büro Bonn. Mit Schwerpunkten in Controllingkonzeption und -prozessen sowie in den Bereichen Personalcontrolling, Bildungscontrolling, Prozessoptimierung und Profit Center-Steuerung unterstützt er seit vielen Jahren internationale Großunternehmen und öffentliche Organisationen bei der Verbesserung ihrer Management- und Controllingsysteme.
Dr. Steffen Jung ist Senior-Projektleiter beim Managementberatungs- und Trainingsunternehmen CTcon im Büro Vallendar. Er unterstützt seit vielen Jahren internationale Konzerne und öffentliche Organisationen bei der Steuerung interner Servicebereiche, der Gestaltung von Transferpreisen, der Overheadverrechnung, dem Aufbau und der Nutzung von Controllingsystemen und -prozessen sowie in Regulierungsfragen.
1. Auflage 2006
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Gedruckt auf säurefreiem Papier.
Satz Kühn & Weyh, Freiburg
Druck und Bindung Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Umschlaggestaltung init GmbH, Bielefeld
ISBN-13: 978-3-527-50262-2
ISBN-10: 3-527-50262-2
mobi ISBN: 978-3-527-66644-7
ePub ISBN: 978-3-527-66645-4
Vorwort
Liebe Leser,
fragt man die Anbieter von Controlling-Seminaren, was es denn an neuen »Hype-Themen« im Controlling gibt, bekommt man zumeist ein Achselzucken als Antwort. Nach der Balanced Scorecard oder dem Beyond Budgeting erscheinen keine Innovationen am Horizont, sehr zum Leidwesen der Seminarindustrie, die von Modewellen immer profitiert. Was man im Markt beobachten kann, ist vielmehr die Renaissance »klassischer Themen«. Hierzu gehört zum Beispiel der Klassiker Verrechnungspreise, aber auch das Thema, das wir in diesem AC-Band diskutieren wollen: die Steuerung interner Servicebereiche.
Einem Kostenrechner begegnet dieses Thema in Form von interner Leistungsverrechnung, in der solche Servicebereiche durch den Dienstleistungscharakter ihrer Leistungen stets Probleme bereitet haben. Der Controller hat sich in den letzten Jahren mit dem Thema eher projektbezogen auseinandersetzen müssen, wenn es um die Frage »Make or buy?« oder – trendiger formuliert – »Outsourcing oder nicht?« ging. Das aktuellste »Buzzword« ist das des »offshoring«, das Leistungsverlagerungen beschreibt.
Trotz aller Modernität dieser Begriffe ist die Steuerung der internen Servicebereiche ein Controllingfeld, das immer wieder einmal intensiv beleuchtet werden sollte. Zu komplex sind die relevanten Motive und Einflussgrößen, zu dynamisch ihre zeitliche Entwicklung, um einmal gefundene Lösungen lange Zeit konstant halten zu können. Das Aufkommen von Modeworten deutet darauf hin, dass solche Änderungen wieder einmal eingetreten sind. Sie sollten Grund für eine intensive Auseinandersetzung mit dem Steuerungsthema sein, keinesfalls aber das eigene Denken ersetzen.
In diesem Sinne haben wir im vorliegenden AC-Band die wichtigsten Aspekte einer Steuerung interner Servicebereiche zusammengestellt und in ihrer Beziehung zueinander diskutiert. Sie finden eine belastbare Analysestruktur vor, die nicht nur theoretischen Erkenntnissen folgt, sondern sich auch im täglichen Beratungsgeschäft bewährt hat. Insofern: Viel Spass beim Lesen!
Ihr Jürgen Weber
1
Interne Dienstleistungen im Blickpunkt – die zweite Welle des Reengineering?
Vielfach wird in der Presse davon geschrieben, dass sich Industriegesellschaften zu Informations- und Dienstleistungsgesellschaften wandeln. Dies gilt zum einen für die zunehmende Anzahl neuer Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten. Zum anderen gilt es aber auch für »traditionelle« Industrieunternehmen, die mehr und mehr die große Bedeutung entdecken, die die zusätzlich zu den physischen Produkten bereitgestellten Serviceleistungen für die Kundenzufriedenheit haben (vergleiche Beer (1997), S. 1).
Serviceleistungen werden jedoch nicht nur für externe Kunden erbracht, sondern auch im Rahmen unternehmensinterner Prozesse für interne Abnehmer bereitgestellt (vergleiche Weber (2002), S. 1). Beispiele für diese unternehmensinternen Dienstleistungen sind unter anderem Rechenzentren und IT-Helpdesks eines Unternehmens, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Personalmanagement, das Reisemanagement, Accounting und Reporting, das Controlling, die interne Revision, das Beschaffungsmanagement beziehungsweise der Einkauf, die strategische Unternehmensplanung und -entwicklung, das Facility Management sowie die interne Rechtsberatung.
Diese internen Serviceleistungen werden nicht im gleichen Atemzug und mit gleich großer Intensität wie die Dienstleistungen an unternehmensexterne Kunden in der Literatur (wie der Praxis) genannt. Sie wurden lange Zeit eher als Bestandteil von Administration oder Overhead wahrgenommen und als gegeben und unveränderbar hingenommen. Das in der Vergangenheit eher als produzenten- denn nachfrageorientiert zu charakterisierende Gebaren dieser internen Dienstleistungseinheiten verstärkte diese Wahrnehmung. Reorganisationswellen wie die Konzentration auf Kernkompetenzen und Kerngeschäftsfelder engten den Betrachtungsfokus auf die marktnahen Prozesse in Unternehmen ein. Die nicht zu den Kernkompetenzen gehörenden, »nur« eine interne Serviceleistung erbringenden internen Dienstleistungsbereiche gerieten dadurch allzu leicht ins Abseits (vergleiche ähnlich Schimank/Strobl (2002), S. 286).
Auch (Mode-)Wellen wie Lean Management oder Reengineering, die auf eine Straffung von Prozessen und eine Reduktion von Gemeinkosten abzielen, haben die internen Servicebereiche nur in Teilen und tendenziell in geringerem Umfang betroffen.
Da die Suche nach Effizienzsteigerungsmöglichkeiten lange Zeit auf die Kerngeschäftsfelder der Unternehmen konzentriert war, wurden in den unterstützenden Serviceeinheiten vergleichbare Einsparungspotenziale nicht erkannt und realisiert (vergleiche ähnlich Berger (2005), S. 4). Zusätzlich dienten interne Dienstleistungsbereiche als Auffangbecken für überzählige Mitarbeiter, die in den Kerngeschäftsprozessen freigesetzt wurden. Insgesamt führen diese Entwicklungen dazu, dass beispielsweise in der deutschen Maschinenbauindustrie langfristig fallenden Fertigungsgemeinkosten deutlich steigende Kosten für administrative Bereiche gegenüberstehen (vergleiche Beinhauer (1996), S. 13).
In den letzten Jahren hat sich der Fokus der Aufmerksamkeit allerdings erweitert. Abnehmende Grenzerträge weiterer Effizienzsteigerungsmaßnahmen in den Kernprozessen veranlassen inzwischen Großunternehmen zur Überprüfung auch der unterstützenden Einheiten auf mögliche Kostenreduktionspotenziale (vergleiche ähnlich Beer (1997), S. 1). Gleichzeitig erhöht die verstärkte Kunden- und Marktorientierung der Unternehmen die Anforderungen an Qualität, Geschwindigkeit und Flexibilität der internen Serviceleistungen wie auch deren Effizienz (vergleiche ähnlich Beer (1997), S. 1). Schließlich verlangen interne Abnehmer von Dienstleistungen von ihren Anbietern mittlerweile immer mehr die auch von externen Lieferanten gewohnte Kundenorientierung und Effizienz.
Diese Erweiterung des Betrachtungsfokus bei der Suche nach Effizienzsteigerungspotenzialen hat einen Trend zum Kampf gegen das »Parkinson’sche Gesetz« vom unaufhaltsamen Wachstum der Verwaltungen in den vergangenen Jahren ausgelöst. Einer solchen Welle entsprechend werden von unterschiedlichen Seiten aus die mannigfaltigsten Handlungsempfehlungen zum Umgang mit den internen Dienstleistungseinheiten gegeben. Die Empfehlung, die internen Serviceeinheiten auszulagern (Outsourcing), findet sich dabei ebenso wie die Forderung, die administrativen Bereiche, wie von Kerngeschäftsfeldern schon bekannt, als Costoder Profit-Center zu führen. Für alle diese Vorschläge werden jeweils Praxisbeispiele angeführt, die mit diesen Ansätzen (angeblich) große Erfolge erzielt haben und große Summen an Kosten eingespart haben. Gleichzeitig finden sich jedoch auch warnende Worte und Fälle von Unternehmen, die zum Beispiel an Unternehmensexterne ausgelagerte ehemalige interne Serviceleistungen inzwischen wieder »ins Unternehmen zurückgeholt« haben.
Wir möchten Ihnen mit diesem Band eine Handlungsleitlinie geben, die Ihnen bei der Auswahl der für Ihre einzelnen Serviceeinheiten geeigneten Strategie sowie der dazu passenden Führungs-, Organisations- und Steuerungskonzepte behilflich sein soll.
2
Charakterisierung und Typisierung interner Dienstleistungen als Entscheidungsgrundlage
Obwohl oft die Rede von Serviceleistungen oder Dienstleistungen ist, erweist sich die präzise Abgrenzung dieser Begriffe als schwierig (vergleiche Steinle (2004), S. 447). Häufig werden als konstitutive Eigenschaften einer Dienstleistung die Immaterialität sowie die Existenz und Integration eines externen Faktors genannt (vergleiche beispielsweise Aust (1999), S. 43). Praktisch gesprochen geht es bei internen Serviceleistungen um Unterstützungsprozesse für das Kerngeschäft. Der Prozess der Leistungserstellung und das »Produkt« sind in der Regel nicht trennbar. Kunden der unterstützenden Dienstleister sind die Manager der Kerngeschäfts-Einheiten.
Serviceleistungen sind in der Praxis angesichts der Immaterialität und damit verbundener Messbarkeitsprobleme durch ein gewisses Maß an Wissensdefiziten auf Seiten des Kunden charakterisiert. Dies betrifft sowohl den Prozess als auch das Ergebnis der Leistungserstellung. Welcher Manager weiß schon genau, was sein Controller zum Aufbau eines Reports unternimmt oder ob das erreichte Verhandlungsergebnis in einem Rechtsstreit optimal ist? Andererseits ist in der Regel ein Grundwissen bezüglich Buchungsprozessen oder Personalaktenverwaltung auch beim Management vorhanden.
Interne Dienstleistungen lassen sich also auf einem Kontinuum von niedrigen bis sehr hohen Wissensdefiziten seitens des Managements einordnen und dabei zwei idealtypischen Varianten zuordnen (vergleiche Abbildung 1; vergleiche ähnlich Schäffer/Weber (2002), S. 6 f.). Mittels dieser Einteilung lassen sich schon erste Hinweise zur Steuerung geben.
Abbildung 1: Typologie interner Dienstleistungen anhand der Wissensdefizite
Dienstleistungen vom Typ A:
Hier herrschen geringe Wissensdefizite des Managements bezüglich Aufgabenstruktur, der benötigten personellen Ressourcen oder sachlichen Inputfaktoren, des Prozesses der Dienstleistungsdurchführung und des Ergebnisses beziehungsweise der Qualitätscharakteristika des Outputs. Beispiele sind betriebswirtschaftliche Basisleistungen wie Belegbuchungen und Lohnabrechnung oder Leistungen des Facility Management wie Hausmeister- und Handwerkerleistungen. Bei diesen Dienstleistungen können Anforderungen an den Dienstleister klar beschrieben und die Qualität und Menge der Leistung gut überprüft werden. Dies öffnet zum einen die Möglichkeit des aussagekräftigen Vergleichs sowohl unternehmensintern als auch mit externen Dienstleistern als Basis der »Make-or-buy«-Entscheidung. Zum anderen ist die Steuerung des Zusammenspiels von Kunde und Dienstleister mittels so genannter Service Level Agreements möglich.
Dienstleistungen vom Typ B:
Bei diesen Dienstleistungen existieren in der Regel hohe Wissensdefizite des Managements bezüglich Problemstruktur, notwendiger Inputfaktoren, Prozess und Output. Außerdem besitzen die diese Leistungen erbringenden Mitarbeiter hohes implizites Wissen. Aus dieser Informationsasymmetrie resultieren Bewertungs- und Beurteilungsprobleme bei diesen Dienstleistungen durch das Management und damit ein Machtdefizit gegenüber dem (internen oder externen) Anbieter der Leistung. Positiver ausgedrückt ist ein hohes Maß an Vertrauen in den Erbringer der Leistung notwendig. Auch impliziert der hohe Wissensbedarf zur adäquaten Durchführung der Serviceleistung, dass sich Arbeitspakete bei Dienstleistungen vom Typ B nur begrenzt zwischen Personen austauschen beziehungsweise auf andere Mitarbeiter verteilen lassen (vergleiche ähnlich
Beinhauer (1996)
, S. 19). Beispiele sind Rechtsund Controllingabteilungen, interne oder externe Berater sowie zum Teil IT-Entwicklungsleistungen. Das Wissensdefizit auf Seiten des Managements kann hier nur durch längere Zusammenarbeit bezüglich der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit des Bereiches reduziert werden, bei neuartigen Einzelproblemen besteht das Wissensdefizit jedoch nach wie vor.
In den meisten Unternehmen lassen sich Dienstleistungen identifizieren, die in diese zwei idealisierten Typen fallen. Viele der bekannten Steuerungs- und Controllingansätze aus dem Sachleistungsbereich lassen sich auch gut auf Dienstleistungen vom Typ A übertragen. Zum Beispiel sind bei sich wiederholenden Prozessen wie Belegbuchungen Produktivitäts- und Qualitätskennzahlen aus der Fertigungssteuerung übertragbar, wenn man Stückzahlen durch die Anzahl der Prozessdurchläufe und fehlerhafte Produkte durch nicht den Anforderungen der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entsprechende Buchungen ersetzt (vergleiche auch die weiteren Beispiele in Kapitel 3).