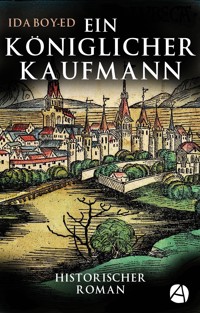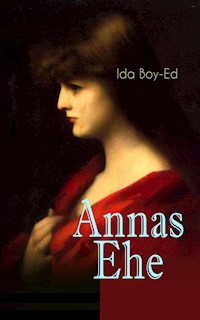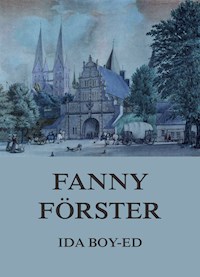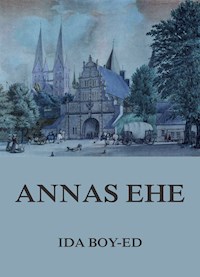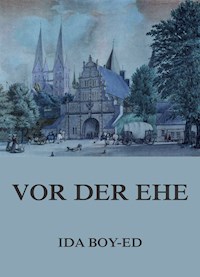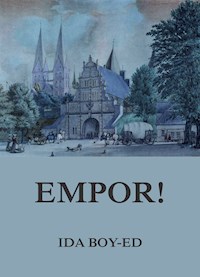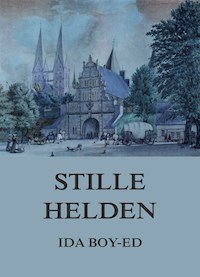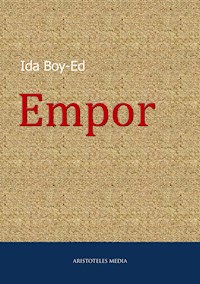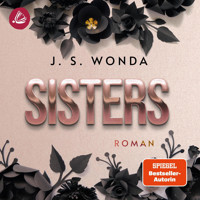0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
Ida Boy-Eds Werk 'Stille Helden' ist eine fesselnde Darstellung des Lebens und der Leiden deutscher Adelskreise während des 19. Jahrhunderts. Boy-Eds Schreibstil zeichnet sich durch seine detaillierte Beschreibung der Charaktere und ihrer psychologischen Entwicklung aus, wodurch der Leser tief in die Welt der Protagonisten eintauchen kann. Das Buch reflektiert auch die gesellschaftlichen Normen und Konflikte dieser Zeit. Boy-Eds feinfühlige Erzählweise verleiht der Geschichte eine subtile und nuancierte Atmosphäre, die den Leser in ihren Bann zieht. 'Stille Helden' ist ein Meisterwerk des deutscher Realismus und ein bedeutendes Werk in der Literatur des Fin de Siècle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Stille Helden
Inhaltsverzeichnis
1
Eine Frühlingsnacht endete, und das neue Tagewerk begann. Droben im sehr geräumigen Erker ließ sich der alte Herr in seinen Stuhl helfen. Er lag jetzt die Nächte oft wachend und verzehrte sich voll Ungeduld, bis zwischen den Spalten der Vorhänge ein grauer Schein bemerkbar wurde. Diesen grauen Schein der Morgendämmerung nannte er schon »Tag«, und damit gestand er sich das Recht zu, seinen Dienern zu klingeln. Denn sein treuer Leupold konnte den mächtigen Körper nicht mehr allein regieren; ein zweiter Diener hatte angenommen werden müssen. Und so zwang sich der alte Herr mit ingrimmiger Selbstbeherrschung, noch ein neues Gesicht in seiner Nähe zu ertragen.
Stöhnend und durch das vergebliche Bemühen, selbsttätig sich zu bewegen, seinen Helfern die Handhabungen noch erschwerend, kam er in die rechte Lage. Nun saß er leidlich behaglich im gewaltigen, mit Rindleder bezogenen Stuhl, der sich durch allerlei ausgetiftelte und glatt arbeitende Mechanik mit leisem Fingerdruck in verschiedene Schräg- und Steilstellungen bringen ließ. Auch eine breite Tischplatte kam von der Erkerwand geräuschlos nahe und zog sich wieder dahin zurück, je nachdem ein kaum bemerkbarer Knopf an der äußeren rechten Armlehne berührt wurde. Auf ähnliche Weise konnten von der gegenüberliegenden Wand ein Bücherregal und eine Schreibgelegenheit herangeholt werden. Diese Beweglichkeit all der toten Dinge gab ihnen etwas von dem Leben treuer, aufmerksamer und stumm wartender Tiere. Sie machte den seit einigen Monaten halbseitig Gelähmten unabhängiger von seiner Bedienung und gewährte ihm, was seit langen Jahren sein höchstes Bedürfnis gewesen war: Stunden ungestörter Einsamkeit. In ihr konnte sein Kopf am raschesten und gesammeltsten arbeiten. Jetzt in dieser frühen Stunde mußte der bewegliche Tisch das erste Frühstück tragen. Mit nie erlöschendem Zorn aß der alte Herr diesen Haferbrei und den Hühnerflügel oder was die ärztliche Verordnung ihm sonst noch an leichter Kost gestattete.
»Das hast du nicht gedacht, Leupold, daß du mich mal päppeln müßtest wie ’ne Wöchnerin,« sagte er.
»Es ist ja nur vorübergehend, Herr Geheimrat,« tröstete Leupold und schob noch handlicher Teller und Löffel zurecht.
»Wenn er wüßte, wie er seinen Ton gegen mich verändert hat!« dachte der Geheimrat erbittert. »Na ja – wie denn nicht! Früher war ich sein Herr, jetzt ist er im Grunde der meine.«
Aber in Leupolds etwas bräunlichem Gesicht und in seinen klugen dunkeln Augen war wirklich nichts von Überhebung zu lesen. Sorgsam, mit dem freundlich-gleichmäßigen Ausdruck, den er sich in mehr als fünfundzwanzig Jahren angewöhnt hatte, schnitt er das weiße Fleisch von dem Brustknochen des jungen Huhnes herab. Wenn man einem mächtigen, übermäßig beschäftigten großen Herrn dient, dem das Blut rascher durch die Adern läuft als durchschnittlichen Menschen, dann lernt man Gleichmut. Den Leupolds hatte das Haus nur einmal erschüttert gesehen – an jenem Abend, als unten im Speisesaal ein festlicher Tisch für ein Herrendiner schon fertiggedeckt stand und die Gäste jeden Augenblick eintreffen konnten. Da, gerade als Leupold den Frack bereithielt, als der Herr schon den Arm ausstreckte, um hineinzufahren, da wurde der Riese jäh blaurot im Gesicht – stieß einen rauhen Laut aus – taumelte und fiel. ... In der Dienerschaftsstube flüsterte man davon, Leupold habe nachher geweint. Aber niemand erlaubte sich, ihn hierauf anzureden.
Jetzt war alles auf dem Frühstückstisch so zurechtgestellt und vorbereitet, daß der Halbgelähmte ohne weitere Hilfe sein Mahl verzehren konnte, und Leupold zog sich zurück.
Wie er so in seiner schlichten dunkelblauen Livree durch das große Zimmer der Ausgangstür zu schritt, sah sein Herr ihm nach. Eine Aufwallung von Rührung stieg in ihm empor.
»Weil ich nicht mehr recht schlafen kann, hetz’ ich ihn aus dem Bett! Was ist das für ein brutaler Unsinn. Mißbrauch der Herrengewalt? ... Und er muckt nicht mal auf ... Anhänglichkeit oder Sklavensinn!?...«
Aber sein Herz sagte ihm: Anhänglichkeit! Denn auch er dachte manchmal an jenen Augenblick, wo er von den dunkeln Grenzen noch einmal zurückerwacht war zum Leben – auch eine Art von Wiedergeburt –– wie ihm das Bewußtsein kam – wie er die Lider öffnete – da sah er in ein treues, angstvolles Auge, in dem Freude aufleuchtete, als er zu sprechen begann.
Nur das Auge des Dieners – eines ergebenen Menschen – nicht das Auge seines Sohnes!–
Ah – dieser Sohn ... wo war der in jener Stunde! ... »Na, er wird ja mal mit meinem Testament nicht unzufrieden sein!« dachte er noch in bezug auf Leupold.
Er versuchte zu essen. Wie sollte es schmecken! Ein so mächtiger Körper muß Bewegung haben, wenn sein Haushalt in Ordnung bleiben soll...
Bewegung! Er wußte wohl: die kam ihm nie wieder. Jeder Tag, diese nächste Minute, noch ehe er den Haferbrei bezwungen, konnte ihn die unsichtbare Faust zum zweiten Male treffen. Und ein großes, furchtbares und dennoch seltsam feierliches Vorgefühl sagte ihm: dann traf sie so gut, daß es das Ende ward...
In solcher Lage schließt man ab! Aber wie kann man, wenn der einzige Sohn dasteht gleich einem Wurzellosen, gegen Lebensfreude gleichgültig – ein Mensch, der am Ende scheint, wo er am Anfang sein sollte? Da schließe mal einer ab! Zu einem letzten Willen gehören zwei. Einer, der ihn ausspricht, und einer, der ihn ausführt.
Er sah hinaus. Es war immer noch sehr früh. Aber was war Tag, was Nacht für das Hüttenwerk! Da brauste die Arbeit und legte sich niemals schlafen. Die Hochöfen erloschen nie. Für ihre schwelende Glut gab es keine Feierstunde und keinen Alltag. Sie waren wie das Symbol der ewigen Hitze, die in geheimnisvollen Tiefen am Herde der Mutter Erde brodelt.
Im hellen Morgenlicht breitete sich vor den Augen des Herrn das Stück Welt hin, darüber er der Gebieter war.
Die gewellte Ebene, vom eingebetteten Fluß durchschnitten, der im ruhigen, viel gebogenen Lauf der nahen Ostsee zustrebte, hatte die kräftigen und ruhevollen Farben einer Landschaft, darin sonst allein der Bauer sein Reich findet. Ferne Wälder umgrenzten sie.
Aber mitten in diesen grünen Geländen und auf stillen, abgetönten Weiten hatte sich das Feuer eine gewaltige und beherrschte Stätte gesucht und Erze und Kohlen ihre düsteren Farben hineingetragen.
Wenn der alte Herr den Blick nach links wandte, sah er die drei Hochöfen gleich drohenden, gedrungenen Burgen ragen. Steil hinan zu ihnen zog sich das Eisengestänge der Schrägaufzüge, an denen die kleinen Wagen emporkletterten, die mit ihrem Inhalt an Erz, Koks und Kalksteinen unaufhörlich die Öfen beschickten, das heißt in ihren Rachen das Material schütteten. Und schwarz, in den Formen von Riesenzylindern, hielten neben ihnen in Reih und Glied die aufrechten Eisenungeheuer Wache, in denen der Wind erhitzt wurde, der ihrem Feuer als Gebläse diente. Helle Schornsteine, gleich gelblichen, schlanken Säulen erhoben sich frei und leicht, scheinbar ganz ohne Zusammenhang mit den verschiedenen langgestreckten Dächern und den aufgetürmten Bauten, in denen man Maschinen oder Wasserreservoire oder Koksöfen vermuten konnte. Ein Gasometer, rund und klobig, in der Gestalt an das Grabmal der Cäcilia Metella fern drunten in der Sonnenglut der Appischen Straße erinnernd, stand etwas einsamer. Die dunkeln Linien der Drahtseilbahnen und Ausladebrücken durchschnitten die Luft. Sie waren wie Körper, die nur ein Skelett haben und gar keine Muskulatur. Zwischen ihrem Gerippe bewegten sich die Förderwagen, emsig und doch gelassen, die von den Schiffen das Erz und die Kohlen holten und mit dumpfem Prasseln an den rechten Lagerplätzen ausschütteten. All diese Dinge ragten gleich Gipfeln hoch aus dem Arbeitsfeld heraus. Und ein Dunst, bläulich, oft von steigendem weißen oder schwarzgrauen Gewölk durchzogen, umhüllte all diese phantastischen Formen, die bedrohlich und bizarr wirkten, weil sie andere waren, als die Natur sie schafft.
Das Gelände selbst, auf dem die Betriebe der Eisenhütte »Severin Lohmann« angesiedelt worden waren, verbarg sich vom Erker aus dem Blick. Eine große gärtnerische Anlage lag dem Hause gegenüber, von ihm durch die vorbeiziehende Landstraße geschieden. Diese Anlage nahm links, wo sie breit war, den Palisadenzaun des Werkes als Grenze; sie zog sich zum Fluß hinab, wurde nach rechts schmäler und schmäler und verlor sich im Uferstreifen, der flußauf endlich an einer Hochbrücke endete, auf welche die dem Fluß sich immer mehr nähernde Landstraße dort traf.
Diese Silberpappeln und Kastanien, die so rasch emporgewachsen waren und dichte Kronen bekommen hatten; diese Rasen und Gebüschpartien; diese Blumenrabatten, die doch bei östlichem Winde immer grauschwarz bestäubt wurden; diese Sandsteintreppe, die durch die Anlagen dem Hause gerade gegenüber schnitt und zum Flußufer hinabführte, wo früher an einer Brücke eine Lustjacht lag, jetzt aber eine Fähre ihren Platz hatte – das alles war die »Anlage der gnädigen Frau«.
Die gnädige Frau sah einst nicht gern auf die Welt der Kohlen, Erze und Schlacken...
Drüben am andern Ufer erhob sich über weißsandigem, schroff abfallendem Abhang eine kleine Stadt. Rote Dächer drängten sich um den Kirchturm, dessen spitzes Dach, frisch gedeckt, dunkel vor dem lichten Himmel stand. Der Hahn und die Kugel oben auf der scharfen Spitze flimmerten lustig und neu im Morgenglanze. Aber auch drüben kam zwischen den Dächern heraus Rauch. Aus merkwürdigen breiten, kurzhalsigen kleinen Essen blies er hinauf, stetig quellend. Man räucherte Fische in Schlutup, und einst lebte das ganze Städtchen von Ackerbau und Fischhandel. Nun aber hallte nicht nur der Arbeitslärm über den Fluß hinüber in die Straßen hinein – auch das Geld, das »Severin Lohmann« in Bewegung setzte, rollte hindurch, und neue Werte waren geschaffen, stärkeres Leben pulsierte.
Der alte Herr sah gern hinüber – es tat ihm wohl, zu sehen, wie das da wuchs – wie sich mehr und mehr Industrien ansiedelten, die durch sein Werk und dessen Nebenprodukte hier vorteilhafte Bedingungen fanden.
Und im Grunde genommen durfte er sich wie der ungekrönte König auch des andern Ufers fühlen.
Unten auf dem Fluß, unterhalb der hoch über ihnen sich in die Luft hineinstreckenden Eisengerippe der Ausladebrücken, ankerten ein paar Dampfer. Aus den Tiefen ihres Bauches herauf tauchten die Förderwagen wieder empor, die sich, schwebend an Drahtseilen, voll koketter Grazie leer hinabgelassen hatten – Dampfer aus Schweden – aus Griechenland – Spanien. Erhebend und quälend zugleich war das, den Blick auf seine Welt zu haben und nicht mehr in ihr herumregieren zu können.
Nun saß er hier in seinem palastartigen Haus, das durch ein kunstvolles, hohes Schmiedeisengitter von der Landstraße geschieden war und, inmitten von Vorgärten und anschließendem Park, wie ein fürstlicher Ruhesitz anzusehen war.
Er dankte für Ruhe...
Die qualvolle Ungeduld, die in ihm kochte, suchte er nun schon seit Monaten zu bezwingen. Er hielt wortlose Monologe über die Größe, die im Entsagenkönnen liegt ... Er forderte von sich Haltung. Daß er sie andern Menschen gegenüber aufzubringen vermochte, gewährte ihm eine kleine Genugtuung. Aber allein mit der Qual, knirschte er mit den Zähnen gegen sie.
Alles wäre wahrscheinlich würdevoll und gefaßt zu ertragen, ohne dieses Elend mit Wynfried...
Er dachte plötzlich: »Ich verstehe die Prometheussage – ja, weiß Gott, ich weiß, was das ist ... wie’s gemeint ist mit dem Adler, der kommt, dem Gefesselten die Leber auszufressen ... Der Kopf ist klar, der Wille ist stark, aber die Kraft, die man nicht betätigen kann, frißt an einem...«
Nun merkte er auf – ein heller, schneidender, von dumpfen Untertönen getragener Klang schien heranzukommen. Das riß ihn aus seinen Gedanken. Ja richtig – was für ein bezwingender Rhythmus in dem Volkslied lag, das die Querpfeifen bliesen und die Trommeln schlugen.
Das war das halbe Bataillon Infanterie, das drüben im Städtchen lag. Im Schritt und Tritt marschierte es heran durch die Morgenfrische; voran mit seinem Adjutanten der Major im Stabe, der den beiden Kompanien zur Führung beigegeben war – der eine auf einem hellen Fuchs, der andere auf einem Rappen. Die Soldaten sangen das Lied mit, das ihnen vorgepfiffen und getrommelt ward. Über die Hochbrücke waren sie gekommen und zogen zu einer Gefechtsübung aus – vielleicht um am Meeresstrand anderthalb Stunden ostwärts die Landung eines markierten Feindes zu verhindern.
Nun kamen sie am Hause vorbei, das Gitterwerk überschnitt die marschierenden Gestalten.
Die Offiziere grüßten fast alle hinauf. Sie waren in diesem Hause oft gastlich aufgenommen worden. Jeden Gruß beantwortete mit freundlichem Nicken das weißhaarige, bedeutende Haupt. Die Augen blitzten. Nichts von Krankheit und Alter war in ihnen–
Der Geheimrat redete in seinen Gedanken zu den grüßenden Herren.
»Ja, lieber Schönstedten – bin schon auf – kein Schlaf des Nachts – Was, Likowski? Einen neuen Gaul? Den Rappen natürlich mit Vorteil verkauft – famos zugeritten, wie er war...«
Und zwei neue Erscheinungen? Das war wohl Leutnant Hornmarck – Herrgott wie klein und zart und jung, und sollte Kerls kommandieren und imponieren, die vielleicht schon mehr vom Leben wußten als er – und der da, der schlanke mit der stolzen Haltung, das mußte der Oberleutnant Stephan Freiherr von Marning sein. Vor ein paar Tagen hatte Leupold seine Karte hereingebracht.
Der Sohn alter Freunde, was man so »Freunde« nennt. Angenehme Bekannte, mit denen er manchen Herbst bei den Neuhofer Marnings zur Jagd als Gast gewesen war. Er entsann sich wohl: der junge Stephan hatte ihm immer gut gefallen, in seine besondere Unterhaltung hatte er ihn oft gezogen, er, der alternde Großindustrielle den jungen Leutnant, die scheinbar keine Interessen zusammen haben konnten. Aber der Geheimrat wußte, mit welcher schmalen Zulage Stephan sich ohne Schulden vornehm behauptete, denn dieser Zweig der Marnings war fast arm. Und wenn er so die schlichte, ernste Haltung des jungen Leutnants beobachtete, die voll Charakter war, dachte er an seinen Sohn...
Seine Gedanken sagten dem gleichfalls heraufgrüßenden Freiherrn von Marning: »Wie gern, lieber Marning, antwortete ich sofort auf Ihren Besuch mit einer Einladung, bei mir zu essen – bin ja kein menschenfeindlicher Querkopf – aber da sitz’ ich nun – vorbei ist’s mit dem Gastlichsein...«
Und es tat ihm seltsam dringlich leid, daß er dem jungen Marning keine Freundlichkeit erweisen konnte.
Nun war die Truppe vorbei. Er konnte ihr ein paar Minuten nachsehen – da zog sie hin, Mann wie Offizier, um in zäher, täglich neu aufgenommener Arbeit, mit einer moralischen Geduldskraft ohnegleichen, die unerhört opfervolle Mühe des Kriegshandwerks im Frieden zu üben – dazu gehört Mannhaftigkeit, die nicht an Ruhm und Heldenrausch, sondern nur an Pflicht denkt.
Auch stille Helden – wie die Tausend und Tausend, die arbeiten und sich bezwingen, und deren Namen und deren Kampf niemals jemand nennt und preist.
Ja, die gibt’s auf allen Gebieten.
So dachte der alte Herr. Und da all seine Gedankenwege jetzt auf den einen Menschen zuführten, so war er schon wieder bei seinem Sohn.
»Ich hätte Wynfried doch vielleicht Offizier werden lassen sollen! Der Junge hatte es einmal gewünscht.«
Aber er hatte so oft mit seinen Wünschen gewechselt; sie waren immer nur lau gewesen.
Und der einzige Sohn und Erbe! Ihn zum künftigen Mitbesitzer und späteren alleinigen Herrn von »Severin Lohmann« zu bestimmen, war das Selbstverständliche. Er hatte sich ja auch nie dagegen erhoben. Den ganzen Bildungsgang durchlief er ohne Widerspruch, aber auch freilich ohne jemals Aufsehen durch Fleiß oder Leistungen zu erregen – was sicher nicht von einem Mangel an Begabung, sondern von dem Überfluß an Beziehungen zum weiblichen Geschlecht herkam...
Hier übermannte den alten Herrn wieder der Zorn, und er unterbrach sich, um den dienstwilligen Tisch fast gegen die Wand fliegen zu lassen.
Nun war ihm freier, nun hatte er nicht die Barriere von Tischplatte mit all den Schüsseln und Speisen vor sich.
Und mit der rechten Faust machte er eine Bewegung – durchschlug die Luft, als wolle er jemanden treffen...
Aber die, der es galt, die war lange tot. Aus ihrem Grabe hätte er sie wieder holen mögen, um sie haßvoll zu fragen: Was hast du aus unserm Sohn gemacht? Einen Schwächling! Einen, der am Weibe scheiterte, weil du ihn weibisch erzogst...
Er sah ihr kühles, ablehnendes Lächeln – er sah ihr schönes Gesicht, auf dem nichts geschrieben stand als Wohlgefallen an sich selbst.
In einem seiner stürmischen Entschlüsse klingelte er plötzlich. Alsbald erschien eine schlichte blaue Livree in der Tür. Aber es war nicht Leupold, sondern der neu engagierte blonde Georg, dessen saubere Gewaschenheit den alten Herrn immer irgendwie und ganz unlogisch ärgerlich reizte.
»Leupold!« sagte er befehlshaberisch.
»Leupold ist nach Schlutup hinüber, um die von Herrn Geheimrat gestern abend angeordneten Besorgungen zu machen,« sagte Georg in militärischer Haltung, als habe er noch immer seinen Hauptmann von Likowski vor sich.
»Ist mein Sohn schon aufgestanden?«
»Der junge gnädige Herr haben noch nicht das Klingelzeichen zum Bad gegeben.«
Der alte gnädige Herr gab nur einen Laut von sich, der für Georgs Ohr etwas Ungeformtes behielt. Daß aber beinahe Verachtung darin klang, spürte der junge Mensch wohl, und er dachte aufsässig: »Na, wir können doch nicht alle immer Glock fünf aufstehen...«
Er war es ja zum Glück von seiner Militär- und Burschenzeit her gewöhnt. Aber wenn er der junge Herr gewesen wäre, würde er auch bis zehne schlafen. Und viel frohe Stunden schien der junge Herr seit seiner Ankunft gestern morgen auch nicht mit seinem Vater gehabt zu haben. Das ganze Haus stand unter dem dumpfen Wissen, daß zwischen Vater und Sohn »was los« sei – was, wußte kein Mensch, wenn nicht etwa Leupold. Aber der würde es auch nicht verraten...
Nun war der Geheimrat wieder allein. Nun mußte er sich von neuem in Geduld fassen. Er hatte doch ein Gefühl dafür, daß er seinen Sohn nicht wie einen Schuljungen aus dem Bett holen lassen könne...
Geduld – wenn eine so große, so schwere Frage zu beantworten ist – die bitterste, die das Leben bisher an ihn gestellt hatte...
Was sollte mit seinem Sohn werden?
Äußerlich gesehen, konnte ja alles, wie von jeher bestimmt gewesen, nun geschehen. Wynfried hatte alle Stadien der Vorschulung für die auf ihn wartende Stellung durchlaufen. Er war auf der Hochschule gewesen; auf befreundeten Hüttenwerken hatte er als Volontär in die Betriebe hineingesehen; er war ein Jahr auf einer Bank gewesen und ein Jahr im Auslande. Nirgends hatte er Anlaß zu Klage oder Lob gegeben. Ob er überhaupt gearbeitet hatte, war unklar.
Das prickelte und grämte den Vater! So eine glatte Null – sein Sohn! Lieber mit Härten, Ecken und Kanten sich herumstoßen! Die Neutralen hatte der Alte immer gehaßt.
Und das einzige Gebiet, wo Wynfried von der unauffälligen Bahn des eben Zureichenden gewichen war, das war gerade das verhängnisvollste von allen...
Ein Weib hatte ihn zerbrochen – er hatte sich zerbrechen lassen–––
Das kam, weil ein Weib ihn verzogen und schwächlich genommen hatte.
Er, der Vater, er konnte nicht den Erzieher spielen. Er, ein Mann, für dessen Pflichtenfülle der Tag immer um viele Stunden zu kurz war. Erziehung – das galt ihm auch als Frauen-, als Mutterwerk! Frauen, die Söhne gebären, sollen sie auch erziehen können. Das war sein Anspruch gewesen.
Aber seine Frau mochte sich das Leben so einrichten, daß nichts ihre Gemütsruhe, ihr Luxusdasein und ihre Schönheit störte. Erzieherpflichten können unbequem sein.
Auch gehört Liebe dazu – und seine Frau hatte wohl, außer zu sich selbst, keine Liebe gehabt. Nicht einmal zu Wynfried, obschon es so aussah, als vergöttere sie den Sohn. Solche mütterliche Affenliebe ist bloß eine etwas verwickeltere Form von Selbstsucht – das wußte der alte Herr längst, obschon er keine Neigung zu Betrachtungen gehabt hatte – früher, denn jetzt kam ihn, gegen seinen Willen, oft genug das Philosophieren an...
Er dachte an eine Antwort, die sein Sohn ihm gestern bei einer vorläufigen Aussprache gegeben hatte: »Ja, Vater, du bist eben einer von den Männern, die nur denken und arbeiten. Du weißt nicht, was das ist: Lieben und Leiden...«
Wie sich ihm da das Gesicht dunkel gefärbt hatte, wie rauh sein Ton, wie schroff sein Ausdruck gewesen war – das wußte er selbst nicht.
Grollend und in so schwerer Düsterheit, daß sein Sohn verstummte, sprach er: »Was weißt denn du von mir!«
Ja, was hatte sein Weib von ihm gewußt! Was wußte sein Sohn von ihm! Einsam! Einsam!
Und die eine Hand, deren sanfter Druck schon ihm Glück und Frieden bedeutete, die hatte er nicht festhalten dürfen...
Lieben und Leiden?
Als ob es das Teil der Müßigen, Schwachen, Zärtlichen, Durchschnittlichen sei.
Wehe, wenn es die großen Arbeiter packt und die Ehernen, die sich nicht zerbrechen lassen dürfen, wenn sie vor sich selbst voll Würde bleiben wollen...
Helden müssen sie sein – aber in der Stille – denn es ziemt ihnen nicht, ihren Jammer zu zeigen, ihn laut auszurufen.
Ihre Leiden tragen die Maske der Rauheit oder Bitterkeit; der Gram ihrer Nächte bleibt ihr Geheimnis.
Erinnerungen kamen, und aus dem Groll glitt langsam seine Seele in weichere Stimmungen hinüber. Er sah das Weib, das er geliebt hatte, mit einer starken Deutlichkeit vor sich, die ihn beglückte und erschütterte. Für die, die groß lieben, ganz und mit der heißen Kraft der Hoffnungslosigkeit, gibt es keine Entfernungen und keine Gräber. Nie Besessenes bleibt unverloren und ewig nah ... So war Klara nie für ihn gestorben und nie von seinem Gemüt entfernt.
Ihre dunkelgrauen Augen, von einer leisen Traurigkeit immer vertieft, richteten sich mit innigem Blick auf ihn, ihre mädchenhafte Gestalt, mittelgroß und schlank, drückte in der ganzen Haltung so viel Ergebenheit und Keuschheit aus – es war, als wehe der Hauch von Tempelluft aus ihren Kleidern. In der ganzen stillen sanften Weiblichkeit ihres Wesens war dies unnahbar Feste gewesen, was ihm, dem stürmisch Leidenden half – und wenn ihr feines, kluges Gesicht einmal von einem Lächeln erhellt wurde, dann, wenn sie zu ihrem Töchterchen sprach, dann war es rührend schön, zum Weinen schön ... Er sah ihr braunes, fast glanzloses lockeres Haar, er sah ihre edlen Hände, deren Ausdruck so merkwürdig wechselnd war – beredte Hände.
Solch ein Weib hätte seinem Sohn begegnen müssen. Eine, die den Mann zu Höhen emporführt, die er allein niemals erreichen kann.
Aber auf Wynfrieds Wegen waren ihm offenbar nur Weiber begegnet, oder er hatte das Talent, jedes Weib herabzuziehen – solche Männer gibt es. Es gibt aber auch Frauen, sonst ganz unschädlich, scheinbar fast gut, wenn sie in Ungestörtheit bleiben; die ziehen den Mann herab, wenn sie nur mit ihm in Berührung kommen – Frauen, die man isolieren sollte; wie Bakterien unschädlich bleiben, wenn sie nicht in Blutbahnen überführt werden. Wunderlich – wer könnte je ergründen, von was für Bedingungen die schädlichen oder segensreichen Wirkungen abhängen.
Gott mochte wissen, wie es mit Wynfried bestellt war.
»Ich kenn’ meinen Sohn nicht,« das gestand er sich ein, »weiß bloß seine undeutlichen, äußeren Abgeschliffenheiten – die äußeren Daten seiner Liebesgeschichten. Was sonst in ihm steckt? Viel? – Nichts? – Ich weiß es nicht.
»Und nun soll ich davon, und diesem unbekannten jungen Mann, bloß weil er mein Sohn ist, mein Leben vermachen? Er soll sich auf meinen Thron setzen? Und vielleicht alsbald in Grund und Boden regieren, was ich in vierzig Jahren zur Blüte gebracht? Zum Kuckuck auch, das geht doch nicht allein um mich und meinen Herrn Filius, es geht ja um das Wohl von Tausenden. Alles, was von mir und meinen Unternehmungen sein Dasein hat, will weiter existieren – volkswirtschaftliche Werte und die Zukunft Vieler dürfen nicht in lässige Hände gelegt werden werden–«
Ein Niedergang von »Severin Lohmann« würde einen Niedergang der Gegend bedeuten. Lebten denn nicht drüben in Schlutup die Gewerbetreibenden, die Handwerker, die Ladeninhaber zum großen Teil von der Beamten- und Arbeiterschaft seines Werkes? Und dann: Kräfte werden mal abgenutzt, Beamte müssen gehen, um neuen Persönlichkeiten Platz zu machen. Hatte Wynfried die Gabe, rechte Männer zu wählen? Eine der größten Begabungen für die Beherrscher so großer Unternehmungen, ja einer jeglichen; nicht der kleinste Krämer kann gedeihen, wenn sein Gehilfe unfähig und treulos ist. Und was für Männer brauchte dieses Werk! Mit Genugtuung dachte der Geheimrat an seine klügste geschäftliche Tat: an den Mut, den er besaß, indem er seinen Generaldirektor Thürauf mit einem Ministergehalt engagierte, weil diese erlesene Kraft nicht billiger zu haben war ... Und mit Thürauf kam eine noch größere Blüte. – Ja, solche Männer muß man erkennen, erfühlen können, das ist die Begabung.
»Thürauf wird nicht bleiben, wenn ich sterbe; nur als Direktor einer Aktiengesellschaft bliebe er,« das sagte sich der Geheimrat. »Einen andern Chef als mich ertrüge er nicht. Er fühlt, daß ich ihn einschätze bis in seine subtilsten Fähigkeiten hinein...«
»Severin Lohmann« sollte nicht in der dritten Generation Privateigentum bleiben? Das tat weh nur zu denken––
Immer leidenschaftlicher überdachte er sein Lebenswerk, seinen Besitz, all die zahlreichen Existenzen, die daran hingen und mit dem Hinwelken der Geschäftsblüte auch zum Absterben bestimmt wären...
Und aus diesem Grübeln rang sich ein geradezu dämonischer Wille empor, noch zu leben! Er konnte, er durfte noch nicht davon, ehe er noch nicht wußte: Wer und was ist mein Sohn? Was wird aus meinem Werk, meinem Reichtum?
Ein beinahe abergläubischer Gedanke fiel wie ein Blitz in seine glühende Unruhe.
»Durch die Weiber, seine Mutter eingeschlossen, ist er ja zerbrochen worden. Ein Weib soll aus ihm den rechten Mann machen, denn er muß doch auch schließlich einen Tropfen von meinem Blut in seinen Adern haben.«
Aber wo die Rechte finden?
Hier waren keine. Die fröhliche Mimi, seines ersten Chemikers Einzige – ach, die war ja gänzlich eine angenehmere höhere Tochter und nichts mehr. Und die drei seines Generaldirektors Thürauf? Trefflich erzogene nette Mädchen, mal passend für sparsame, strebsame Beamte. Oder der rothaarige Backfisch des Großindustriellen Stuhr, der vor drei Jahren drüben in Schlutup eine große Sensenfabrik gegründet hatte? Vielleicht die Witwe des Barons Hegemeister, die auf ihrem Schloß Lammen saß und von der man sagte, sie seufze von ihrer Kemenate übers Meer hinaus, ob nicht ein zweiter Gatte dahergefahren käme? Alle nicht für Wynfried passend.
Keine – weit und breit. Und der Vater hatte doch das starke Gefühl, er müsse für den Sohn wählen. Daß Wynfried kein Urteil über weiblichen Wert oder Unwert besaß, war ja erwiesen.–
Keine? Er fühlte plötzlich, daß er sich all diese Figuren vor sein Auge gerufen hatte, nur um an der einen vorbeizusehen, die seines Sohnes guter Engel werden konnte – denn sie war die eine, von der er vorher wußte: ihr entlockte Reichtum und Stellung kein rasches Ja! Sie würde nur einwilligen, wenn ihr Herz und Verstand Aufgaben sahen.
Einen ganz roten Kopf hatte er bekommen. Er strich sich mit der Rechten über die Stirn, als könne er Hitze und Röte wegwischen. Er sollte sich doch nicht aufregen ... und ganz plötzlich war er von einer ängstlichen Folgsamkeit erfüllt – hatte den nicht gerade klar zum Bewußtsein kommenden, aber doch dringlichen Vorsatz, allen ärztlichen Anordnungen fortan mit Lammesgeduld zu folgen. Denn er wollte leben – leben!
Er sah nach der Uhr. Halb acht! In einer Viertelstunde mußte sie sichtbar werden. Dann tauchte ihre Gestalt auf – die Sandsteintreppe zwischen den Anlagen kam sie herauf, denn sie wohnte drüben bei der alten Witwe des früheren Hüttenarztes. Und die Doktorin Lamprecht liebte das Mädchen wie ein eigenes Kind. Jeden Morgen und Nachmittag, in Wind und Wetter, an lachenden Sommertagen und wenn Schnee durch die Luft trieb, kam sie über die Fähre her, auf ihrem Berufsweg, der sie ins Schulhaus führte. Das lag weiter hinauf an der Landstraße. Man mußte an der ganzen Front des Werkes vorbei und noch ein paar Minuten weiter, dann kam man an das fröhlich aussehende weiße Haus mit grünen Läden und rotem Dach, das der Geheimrat für den Schulunterricht all der Kinder von Severinshof gebaut hatte.
Diese Kolonie zog sich in einem Viertelkreis nördlich des Werkes hin. Das Schulhaus an der Landstraße war ihr Abschluß. Auf das Schulhaus folgte dann mit ihrem großen Garten die stattliche Villa des Generaldirektors Thürauf und die Doppelhäuser für all die meist verheirateten Herren Chemiker, Ingenieure und kaufmännischen Abteilungsvorstände des Werkes. In Severinshof hatte der Geheimrat den Stamm der Arbeiter in freundlichen Häuschen mit Gärten angesiedelt, die sich dem Werk auf immer verbunden fühlten und von ihm Pension für ihre Feierabendruhe erwarteten.
Sie unterrichtete in der Schule seit zwei Jahren oder dreien – dem Geheimrat kam es vor, als müsse es schon immer so gewesen sein.
Jeden Morgen, seit er das Bett mit diesem Stuhlungeheuer hatte vertauschen dürfen, war es seine Unterhaltung, aufzupassen, ob sie pünktlich zwischen den Hainbuchenwänden auftauche, die die Sandsteintreppe bis zum Fluß hinab begleiteten, und ihr Gruß war ihm sein bißchen Poesie. – Und jeden Sonntagmorgen, manchmal auch Sonntags nachmittags kam sie zu ihm ins Haus zum Tee, eine schöne reiche Stunde lang.
Sie verstanden sich gut, der alte viel-vielfache Millionär, der starke Herrscher und stolze Arbeiter, und die arme Volksschullehrerin.
»Wenn sie meine Tochter werden wollte!« Der Gedanke an diese Möglichkeit erschütterte ihn beseligend.
Er sah der teuren Toten in die Augen, die unsichtbar in den Stunden, wo er sich mit sich selbst beschäftigen konnte, immer bei ihm war. – Ihr Segen wäre über den Kindern––
Aber würden sie wollen? Dieser Sohn, der zu müde und freudlos erschien, um noch einen Entschluß zu fassen? Dies Mädchen, das mit einer so entschlossenen Gefaßtheit, verschlossen ohne Kälte, zufrieden, wunschlos in bescheidenen Verhältnissen dahinlebte, obgleich ihre frühe Kindheit von Luxus umgeben gewesen war?
Reue erfaßte ihn. Er hätte das Kind, als es verwaist und mittellos dastand, in sein eigenes Haus aufnehmen sollen, dann hätte Wynfried die Heranwachsende oft gesehen, vielleicht würdigen und lieben gelernt, und alles wäre von selbst einer glücklichen Wendung entgegengewachsen, was man nun gewaltsam einzubiegen und einzurenken versuchen mußte.
Aber damals lebte ja seine Frau noch ... Daß er das auch nur einen Augenblick vergessen konnte. Seine Frau, die das Mädchen mißbildet oder mißhandelt hätte, auf diese feine Weise, wie sie zu mißhandeln verstand, durch Hochmut und Kälte, die so versteckt waren, daß sie sich immer ableugnen ließen, und doch so spürbar, daß man sich darunter bog wie unter Peitschenhieben.
Nun war es zehn Minuten vor acht, gleich mußte sie kommen.
Die Anlegebrücken hüben und drüben konnte er nicht von seinem Platz aus sehen; auch jene Stelle des Flusses, über die der Fährmann seinen Kahn ruderte, verbarg ihm ein Baumwipfel.
Jetzt erschien ihr Haupt. – Der Körper wuchs auf der Treppe, nun stand sie auf der obersten Stufe und hob das Gesicht zu ihm. Eigentlich konnte er von seinem hohen Sitz aus nicht jeden Zug deutlich erkennen. Aber mit den Augen der Seele sah er sie, als stehe sie dicht vor ihm. Ihm schien ihr einfaches dunkles Kleid wie eine vornehme Tracht; ihre Kleidung war so sorgsam – am schlanken Halse glänzte der weiße Kragen, auf dem lockeren Haar saß ein einfacher gefälliger Hut. – Unter dem Arm trug sie Bücher. Was für eine stolze und sichere Haltung sie hatte, und wie schön sie sich bewegte. Diese feinen klugen Züge, den etwas herben Mund, die tiefen grauen Augen – er kannte sie seit vielen, vielen Jahren.
»Klara!« sagte er lautlos zu ihr hinab. Und er meinte eigentlich doch eine andere Klara. Die, die längst von den Enttäuschungen ihres Lebens ausruhte, in jener Ruhe, die nichts mehr von sich weiß, nicht einmal die Wohltat fühlt, daß alle Not zu Ende ist...
Ihre Tochter! Die Tochter der Frau, die er geliebt und nie besessen hatte.–
Zuweilen dachte er: Wenn die Welt das wüßte! Lachen würde sie, lachen darüber, daß Severin Lohmann das Andenken an eine entsagungsvolle Liebe heilig hielt.
Er aber fühlte tief: auch der Rauheste, auch der Größte, auch der Arbeitsriese – er verliert alle Fäden zum Verständnis der Menschen, verliert sich selber in Unbarmherzigkeit und Kälte, wird zur Maschine, wenn er nicht tief in sich ein leises kleines Feuer lebendig hält; und das Verlangen zur Liebe und zum Gedankenspiel mit einer Liebe, das ihm wie allen Sterblichen eingeboren war, hatte ihm sein Weib nicht sättigen können. – Als er acht Tage mit ihr verheiratet gewesen war, wußte er schon, daß eine schöne Larve ihn getäuscht hatte.
In den schweren und bitteren Erwägungen der heutigen Morgenstunde war das alles wieder zu starkem Leben erwacht, das Leiden und die Entsagung von einst...
Klara grüßte herauf – und seltsam: anstatt wieder zu grüßen, streckte er nur die Rechte gegen das Fenster. Wie eine verlangende Geste war das: komm!
Und sie lächelte, er sah es genau. Sie nickte, wie ein unbefangenes fröhliches Mädchen tut, das in gesunder Freudigkeit an seine Pflicht geht.
Ja sie – sie! Sie war die Gesundheit, sie war die Kraft. Sie war die Jugend, sie war die Schönheit. Die Liebe, das Glück.
In der Stärke seines Wunsches, in der Herrengewohnheit, Wunsch und Wille sich untrennbar rasch vermählen zu lassen, in der grandiosen Selbstsucht des Verantwortlichen, der nur seine heiligen Zwecke bedenkt, in all diesen großzügigen Gewohnheiten seines geistigen Lebens kam ihm gar nicht die Erwägung, ob er auch Schicksal spielen wollte, vielleicht zum Unheil anderer Menschen.
Er war wie benommen von dieser Autosuggestion: sie ist zur Retterin meines Sohnes vorbestimmt, zur Erhalterin meines Lebenswerkes. – In ihr kommt ihre Mutter zurück und will durch sie erfüllen, was uns versagt bleiben mußte.
Als die rasch Dahinschreitende seinen Blicken entschwunden war, setzte er die Klingel in Bewegung, mit einem so heftigen Druck, daß das schrille Geläute drüben im Dienerzimmer gar kein Ende nahm, und dem atemlos herbeilaufenden Georg ward der Befehl: »Ich lasse den jungen Herrn bitten, sich zu mir zu bemühen. Um neun Uhr kommt aber Sylvester und malträtiert mich – also bitte noch vorher.«
»Sofort!« sagte Georg verängstigt. Denn er sollte eine Bitte überbringen und hatte doch einen Befehl gehört, hinter dem sich das Donnergrollen fürchterlichen Unwetters barg, falls der Befehl nicht augenblicklich befolgt werde ... Und wie sollte er das dem jungen Herrn beibringen? Der auf jede Bestellung nur ein lässiges, zweifelhaftes »So–o?« als Antwort hatte.
Aber es mußte ihm doch gelungen sein, das Dringliche und Bedrohliche des Auftrages fühlbar zu machen. Denn einige Minuten später trat Wynfried Severin Lohmann bei seinem Vater ein.
Der Sohn war von stattlicher Höhe, wenn er auch den Riesenwuchs des Vaters nicht erreichte, den wohlgeformten Schädel bedeckte hüsches welliges Blondhaar. Vielleicht hatten es zarte Frauenfinger so oft gestreichelt, daß davon eine Lichtung auf der Scheitelhöhe entstanden war. Das Gesicht erschien bei aller Regelmäßigkeit der Züge unauffällig – sagte wenig. Die blauen Augen, die unter schön geschwungenen Brauen standen, blickten leer in die Welt – ob aus Müdigkeit oder Gleichgültigkeit, wer konnte das sagen.
Und dennoch, so verschieden Vater und Sohn waren, – eine Familienähnlichkeit konnte dem schärfer Zuschauenden doch nicht entgehen. Das war dieselbe Kopfform, dieselbe etwas abgestumpfte Nase, das gleiche Wangenprofil, und wer aufmerksam in Wynfrieds Gesicht hineinsah, konnte darin auch eine Linie bitterer Verachtung entdecken, leidvoller Verachtung vielleicht, die zuweilen den rechten Mundwinkel ein wenig verzerrte.–
Er war im Morgenanzug – das gesteppte lila Seidenjackett, das weiß und lila gestreifte Seidenhemd kleideten ihn sehr gut, gaben seiner Erscheinung aber doch einen verzärtelten Charakter.
»Guten Morgen, Vater – verzeih, daß ich so komme – aber es schien eilig. Darf ich fragen: hast du gut geschlafen?«
»Mag nicht gefragt sein, hab’ mich auch alle die Monate, seit dem Zufall, ohne deine Nachfrage beholfen,« sprach er mürrisch.
Ja, das wurmte immer wieder, daß der Sohn nicht kam – mit Extrazügen hätte er hereilen müssen. Aber da gerade fing er ja an zu zittern, daß seine Geliebte ihn verlassen könne, und das war wichtiger gewesen, das hatte ihn in Paris, oder wo er grad’ gewesen war, mit eisernen Zangen festgehalten.
Aber Ruhe! Fassung! Alles vergessen! Zudecken – neu anfangen.
Der alte Herr sah ihn an. Wie höflich die Frage gewesen war: »hast du gut geschlafen?« Als werde sie an einen Fremden gerichtet, ohne daß einen die Antwort im mindesten interessiere ... Jetzt bemerkte er auch den kostbaren Morgenanzug des Sohnes.
»Höre,« sagte er offen, »ich bin kein kleinlicher Mensch. Wenn du Schulden gemacht hast, und ich in meiner Jugend keine, denk’ ich: na ja, du bist der Sohn eines Millionärs, und ich war der eines hart kämpfenden Anfängers. Und wenn du dich morgens fast wie’n Frauenzimmer in seidene Frühstücksroben hüllst, wozu ich nie Zeit und Geschmack gehabt habe, denk’ ich: andere Generationen, andere Gewohnheiten. Aber so mal ganz unbefangen: die Schulden stoßen mir weniger vor’n Kopf als dieses lila seidene Morgenraffinement. Daß es ohne Schulden und Lehrgeld nicht abgehe, darauf war ich nach der Erziehung gefaßt. Aber daß mein Sohn sich mal so von mir weg entwickeln würde, daß er weibisch tut, das ist mir was Fremdartiges. Nun – Randglosse. Überhör sie, wenn du willst. Und nu setz dich mal da...«
Wynfried nahm in dem kleinen Klubsessel Platz, der auf der Grenze zwischen Erker und Zimmer, gegen die Mauerecke geschoben, für die Besucher des Geheimrats dastand.
»Ich will gewiß niemals etwas überhören von dem, was du mir zu sagen wünschest,« sprach der Sohn höflich.
Er saß da, etwa als habe er bei einem Minister Audienz. Aber seine Haltung war doch nicht mehr ganz so gleichgültig, wie sie noch gestern gewesen war. Dieses furchtbar grollende, schwere: »Was weißt du von mir?«, das ihm sein Vater gestern entgegengeschleudert, hatte ihn die ganze Nacht beschäftigt.
»Unsere Aussprache gestern ist resultatlos verlaufen, weil wir planlos, ziellos drauflos redeten – wie man so bei der ersten Gelegenheit zur Entladung tut – aber nie tun sollte. Wir wollen heute kürzer, aber praktischer sein,« begann der Vater.
Wynfried, die Ellbogenspitzen auf den Lehnen des weiten Stuhls, hatte die Finger wagrecht ineinandergeschoben. Dabei kam ein goldenes Kettenarmband zu Gesicht, das sich um das linke Handgelenk schlang.
»Ähnliches habe ich auch gedacht,« antwortete der Sohn. »Und meine Schulden betreffend, so wollte ich dir erklären, daß ich bereit bin, sie mit meinem mütterlichen Erbteil zu bezahlen.«
Eine energisch abwehrende Kopfbewegung schnitt diesem Vorschlag den Faden der Weiterentwicklung ab.
»Du hast noch kein Geld verdient und auch noch keins verdienen können. Die Zinsen deines Muttererbes reichen zwar nicht halb für deine Bedürfnisse – falls du diese nicht sehr einschränken willst. – Aber es ist ja nun mal dein einziges Einkommen, das dich von mir unabhängig machen könnte,« schloß er langsam mit Bedeutung.
War das eine Drohung? Oder war vielmehr der verborgene Sinn so: mein Sohn soll sich nicht als mein Sklave fühlen? Kaum erhoben sich diese Fragen in Wynfried, als er auch schon den Vater weitersprechen hörte.
»Dieser bescheidenen Unabhängigkeit will ich dich nicht berauben. Ich werde unserm Anwalt in Hamburg schreiben – Koppen ist diskret und ein zuverlässiger Mann. Er soll alles in die Hand nehmen. Schicke ihm eine Liste deiner Schulden, oder fahr hin und sprich alles mündlich mit ihm durch. Es wird bis auf den letzten Heller bezahlt werden. Und Koppen soll mir Details ersparen ... du verstehst...«
Wynfried errötete. Er fühlte es. Und es war ihm demütigend. Die Großmut des Vaters rührte ihn weniger, als daß sie ihn beschämte. Zugleich erleichterte es ihn, daß sein Vater sich das genaue Studium der Schulden und ihrer Art ersparen wollte – nicht die Rechnungen von Juwelieren, Pariser Damenschneidern, Automobilfabrikanten einsehen, nicht die Forderungen dunkler Geldmänner selbst prüfen mochte.
Und wie sanft sein Vater dies alles aussprach! Als sei gütige Geduld sein eigentlichster Wesenszug...
Wynfried hatte ein unklares Gefühl, als sei diese vornehme Milde ein Vorspiel, das ihn gefügig machen solle...
Ach, gefügig ... dazu bedurfte es keiner klugen Vorbereitungen.
Er war so angeekelt vom Leben, von den Frauen, von Freundschaft, von allem – allem. Ihm war es ganz gleichgültig, was man von ihm fordern würde – er war bereit zu allem, weil er zu nichts mehr bereit war. Er ließ sich schieben. Die einzige lebhaftere Regung in ihm war vielleicht noch eine ferne leise Dankbarkeit, daß jemand ihn schieben wolle. Aber Neugier, wohin er geschoben werden solle, empfand er kaum.
Seine Mutter fiel ihm ein. Die sagte manchmal scherzend – er wußte jetzt, zurückhorchend in seine Jugend, daß in ihrem Ton Haß mitgeschwungen – sie sagte scherzend: »Er fabriziert phosphorfreies Roheisen – davon ist seinem Wesen was angeflogen.« Und seltsam hörte er zugleich wieder dies düstere: »Was weißt du von mir?« Es schien, als wolle ihn dies Wort verfolgen.
Er sah seinen Vater an und begegnete einem großen, durchdringenden Blick, der unter den buschigen Brauen her aus diesen gewaltigen Augen kam – als Kind hatte er sich vor den Augen gefürchtet...
Ihm war, als säße er armselig, nackend da. Ein Nichts vor diesem Überragenden.
Ein nervöses Frösteln lief ihm über die Haut. War das wieder die Furcht wie in Kindertagen? Nein, ein neues, unerklärliches Gefühl – wie ein leise aufzuckendes Elend – darüber, daß er ein Nichts sei – sich jäh als solches fühlte – zum erstenmal.
Er biß sich auf die Lippen ... Ein langes Schweigen stand zwischen Vater und Sohn.
Endlich besann sich Wynfried, daß er etwas sagen müsse.
»Ich danke dir für deine Großmut.«
»Hast du dir Pläne für dein nächstes Leben gemacht?« fragte der Geheimrat.
Wynfried hatte eigentlich nichts Deutliches gedacht. Vielleicht eine Reise um die Welt. Oder einen größeren Jagdausflug nach Südamerika. Oder ein stumpfes Vegetieren in einer Einsiedelei, irgendwo an der englischen Küste ... Aber er mochte nichts davon aussprechen.
»Nein!«
»Du bist nun achtundzwanzig Jahre alt. Du solltest an das einzige denken, was einem Mannesleben rechten Inhalt gibt: an Arbeit.«
»Aber ich habe doch...«
»Deine sogenannten Studienjahre sind von anderen Dingen mehr ausgefüllt gewesen als von gründlicher Arbeit, und da nie und nirgend Examen oder bezahlte Leistungen von dir gefordert wurden, dürfte dir selbst das Urteil fehlen, wie viel oder wie wenig du weißt und kannst. Eine große Stellung und ungemeine Aufgaben und Verantwortungen warten auf dich. Noch bin ich da, und mein Wille ist, mich noch viele Jahre zu behaupten...«
Er atmete tief auf. Der Sohn sah mit Staunen, welch ein wunderbarer Ausdruck über dieses Antlitz flog – es schien nicht mehr das eines gewöhnlichen Sterblichen – monumentale Größe war darin – Kraft von übermenschlicher Art. Und ihm war, als könne sein Vater selbst dem Tode trotzen, wenn er wolle...
Nach dieser inhaltsschweren Pause fuhr der Vater fort: »Aber du bist doch einmal mein Nachfolger – du mußt dich darauf vorbereiten – dich einarbeiten. Ich werde es schon verstehen, dir, trotz deiner vorausgesetzten Unzulänglichkeit, bei den Abteilungsvorständen die rechte Stellung zu machen, daß du in keine schiefe Lage kommst. Freilich, wie du dich zu Thürauf stellst, das wird deine Sache sein, und ist die allerwichtigste für dich. Dieser Mann ist mein bedeutendster Mitarbeiter – geschäftlich mein anderes Ich – trotz der völlig verschiedenen Individualität. Ich verdanke ihm viel – er mir auch – Geben und Nehmen ist unter gemeinsam Schaffenden das nicht mehr auseinander zu sondernde Bindemittel. Du wirst noch viele Jahre nichts sein ohne ihn – du hast schon aus allem herausgehört: es ist mein Wunsch, daß du jetzt hier bleibst und dich in den Betrieb einlebst. Bist du einverstanden?«
»Ich will es versuchen,« sprach Wynfried tonlos.
Diese mutlose Ergebenheit, die aus den Worten sprach, diese erschreckende Blässe, die sein Gesicht entfärbte, ließ in dem Vater eine Furcht aufblitzen...
Wie, wenn Wynfried trotz allem noch nicht mit jener Frau fertig war? Wenn ihm sein Bleiben hier so etwas wie Gefangenschaft bedeutete, die ihn von ihr absperrte?
»Ein Vater darf fragen, wenn er den Sohn so wiederbekommt, wie ich dich – gestehst du mir das zu?«
»Ja.«
»Drei Jahre hat dich die Frau festgehalten. Früher dacht’ ich, wenn ich so von ewig wechselnden Liebschaften hörte: wenn er doch mal eine fände, die ihm das Sichverzetteln abgewöhnt. Na – der Wunsch wurde mir erfüllt. Wie das so manchmal mit Wünschen geht – man bekreuzigt sich, daß man sie gehabt hat ... Donnerwetter! Die eine hat dich ein Vermögen, Nerven, ein paar schöne Jugendjahre gekostet – und mich – mich hat sie auch was gekostet. Glaub nur – es war ein harter Augenblick, als man mir dein Telegramm gab – ›Unabkömmlich – hoffe auf deine rasche Genesung‹– Unabkömmlich! – Wenn der Tod an des Vaters Lager steht! Und warum unabkömmlich? Weil du rasend warst aus Eifersucht und Angst, eine – Dirne zu verlieren...«
Die Faust ballte sich – die Worte waren schwer von Schmerz.
»Verzeih – ich war von Sinnen,« sagte der Sohn mit schwacher Stimme.
»Und endlich mußtest du doch begreifen! Grad saßest du auch so fest in Schulden, daß nichts mehr blieb als die Flucht zu mir. Da verließ dich die edle Dame – weil sich ein dummer Kerl von exotischem Adel fand, der ihr standesamtlich ’ne Neunzackige aufsetzen wollte. Aber nu sage mal, Wynfried – so Mann den Mann gefragt: bist du kuriert von der Leidenschaft? Liebst du das Weib noch? Haßt du sie? Was dasselbe wäre. Wie ist es mit deinem Herzen bestellt?«
»Herz?« sagte Wynfried, und der verächtliche Zug erschien in seinem Mundwinkel. »Das wird einem totgeschlagen durch solche Erfahrungen. Ich verachte diese Frau und alle Frauen.«
»Nun, nun,« meinte der Geheimrat, und ein Lächeln, tiefsinnig und fast zärtlich, spielte über sein Gesicht, »es gibt noch edle Frauen. Und ein Herz ist gottlob wie die Natur: es blüht wieder auf–«
Wieder war der Sohn von Staunen wie benommen.
Er verspürte Weichheiten. Sie waren ihm etwas nie Geahntes bei seinem Vater. Woher kamen sie? Waren sie früher nur tiefer verborgen gewesen? Oder hatte die Brüchigkeit und der Gedanke an den doch vielleicht nahen Tod ihn verändert?
»Und kurz und gut,« sprach der Alte aus seinem mächtigen Sessel heraus, wo er sich so oft als Prometheus fühlte, »kurz und gut: ich denke, du heiratest. Ein liebes edles Weib wird deinem Dasein höheren Inhalt geben. Ohne Familie hält es sich hier auch wohl schwer aus. – Die scharfe Arbeit braucht ein mildes Gegengewicht. – Nur durch eine Frau kann dein Gemüt wieder ins Gleichgewicht kommen. Du bist nun mal aufs Weib gestellt. – Jetzt aber soll es eine sein, vor der du den Hut abnimmst.«
»Kurz und gut« hatte der Vater gesagt. Als schließe sein Vorschlag lange Verhandlungen über die Werte des Familienlebens ab. Und doch fiel das seinem Sohn sozusagen auf den Kopf.–
Er lächelte. So überrascht war er. Aber das Lächeln losch gleich hin. Er begriff auf der Stelle, daß es seines Vaters fester Wille war.
Das elende Gefühl, vor ihm ein Nichts zu sein, kam ihm wieder. Zugleich das dunkle noch andrängende, rasch aber klarer werdende Erkennen, daß vielleicht in diesem entscheidenden Augenblick seines Sohneslebens Gehorsam das einzige Mittel sei, das Wohlwollen und Vertrauen des Vaters zu erringen – das Verlangen danach wallte in ihm auf – zum erstenmal, seit er denken konnte.
»Aber deshalb heiratet man doch nicht!« dachte er. Er dachte es ohne heftige Abwehr. Nur in einer matten Regung des Eigenwillens. Er fühlte sich zu zerbrochen zum Kampf.
Jahrelang war er in wahnsinniger Leidenschaft der Sklave eines Weibes gewesen. Sie hatte ihn verraten und verlassen. Der Rest war Widerwillen gegen Welt und Weib.
»Nun!« mahnte der Vater in aufkochender Ungeduld. Irgend etwas wollte er doch auf seinen Vorschlag hören.
»Und du hast dir gewiß auch schon ausgedacht: welche,« sagte Wynfried ausweichend.
»Ah – ob! Du wirst dir Mühe geben müssen, angenommen zu werden.«
Wie das Wynfried peinigte. Seine ganze Seele war wund. Sein Vater, in der Naivität, die geniale Menschen haben können, wenn es sich um ihre heimlichen Poesien und Herzenswünsche handelt, schien nicht zu ahnen, daß er vielleicht unzart vorgehe...
»Wer ist es denn?« fragte er gleichgültig, höflich – nur um den Vater nicht zu reizen.
»Klara Hildebrandt.«
»Die Tochter von deinem früheren Generaldirektor – der sich erschoß – wegen verfehlter und verbotener Spekulationen – du hast dich des Kindes angenommen – die–?«
»Ja – die.«
»Ich weiß noch, wie Hildebrandt mit seiner Frau und seiner ganz kleinen Tochter ankam. – Es gibt so Dinge – man behält sie, obschon sie eigentlich nebensächlich sind und nichts mit einem selbst zu tun haben – aber zeitlich mit irgendwas verknüpft sind, was damals einem wichtig war. – Ja, ich weiß noch – Mama bestimmte die Bepflanzung der Anlage, deren Erdarbeiten gerade fertig geworden waren – ich hatte so viel Kummer davon gehabt, weil ich gern mitgegraben und gekarrt hätte und nicht durfte. – Da kamen Hildebrandts und mußten aussteigen, weil der Weg versperrt war – und Mama sagte gleich, daß sie sie nicht leiden möge. – Die Frau war sehr schön – ich begriff damals nicht und auch in den folgenden Jahren nicht, weshalb sie mir immer so schön und so ganz anders vorkam. – Jetzt weiß ich: sie hatte wohl einen seltenen Zauber reiner Weiblichkeit – wenn ich mich recht erinnere...«
»Ja, du erinnerst dich recht,« sprach der alte Mann langsam, »in ihr waren Schönheiten ... ein Wunder war sie...«
Und sein Gesicht bekam einen Schein, als läge Andacht darauf.
Sein Sohn sah ihn an – ihre Blicke begegneten sich, ruhten lange ineinander. Und wieder war dem Sohn, als höre er den Vater sagen: »Was weißt du von mir!«
Ihm fiel ein, wie der Vater damals voll Großmut alles vertuschte, was dem ungetreuen Beamten noch im Grabe den Schein der Ehre hätte nehmen können ... Wie er der Frau beigestanden, die nicht lange danach hinstarb – wie er für das Kind gesorgt.–
Und unverwandt sahen sie sich an, Vater und Sohn–
Bis der Vater, wie in einem stolzen Bekennen der Reinheit für sich und eine Tote, hoch und frei sein Haupt erhob...
Da war es Wynfried, als habe er an Pforten gestanden, hinter denen unantastbare Heiligtümer verschlossen gehalten würden...
»Ich habe Klara Hildebrandt seit vielen Jahren nicht mehr gesehen,« sprach er langsam.
Sein Vater reichte ihm die Rechte hin. – Obgleich Wynfried wußte, der junge Doktor Sylvester werde jeden Augenblick erwartet, um die Behandlung mit Massage und Elektrizität zu beginnen, die täglich zweimal vorgenommen wurde, fühlte er doch, daß diese Verabschiedung aus einer seelischen Aufwallung heraus erfolgte. Aber er spürte auch einen festen Druck der Hand – war das Versöhnung? eine stumme Überredung? ein neues Bündnis zwischen zweien, die von der Natur aufs engste verbunden waren, sich aber nicht gekannt hatten bis zu dieser Stunde?
Kannten sie sich denn jetzt?
Und es war dem Sohne, als dürfe er das Wort des Vaters auch für sich in Anspruch nehmen und gegen ihn kehren und auch fragen: »Was weißt du von mir?«
Da durchschauerte es ihn: was weiß ich denn selbst von mir? Und das elende Gefühl der Lebensleere, der Nichtigkeit kam abermals über ihn.
Er ging in sein Zimmer und warf sich wieder auf sein Bett.
Er starrte ins Unbestimmte.
»Eine Kugel durch den Kopf – das wäre das richtigste...«
Aber vor diesem Gedanken erschrak er. Denn ihm war, als sähe er seines Vaters Angesicht. – Er hatte eine Vision. – Sein Vater stand an seiner Leiche, aber der alte Mann weinte nicht – Verachtung war in seinen Zügen, die furchtbar schienen.
Und die Angst vor dieser Verachtung zwang ihn zum Leben zurück – das fühlte er.
Aber wie leben? Unter welchen Möglichkeiten?
Ah – gleichviel unter welchen – wenn sie ihm nur Inhalt für sein Dasein vortäuschten.
Diese Leere trieb ihn sonst doch noch zu dem, was sein Vater verachten würde.
2
Nun war es Sonntag. Aber Leupold fühlte, daß sein Herr sich nicht in der beruhigten Stimmung befand, wie sonst, wenn Fräulein Hildebrandt erwartet wurde.
Vor dem Klubsessel, dem Audienzstuhl, deckte er den Teetisch. Sonst paßte der Geheimrat sogar auf, ob auch schöne Blumen aus den Treibhäusern heraufgeholt worden waren, denn die Blumen durfte Fräulein Hildebrandt nachher mitnehmen. Ja, er hatte sich wohl schon den Teller mit Kuchen zeigen lassen, um nachzusehen, ob die Cremetörtchen vorhanden seien, die Fräulein Hildebrandt gern zu essen scheine. Leupold machte sich manchmal Gedanken über das starke Interesse seines Herrn an Klara Hildebrandt. Er wußte: die Hildebrandts hatten damals schon ihre zweijährige Tochter mitgebracht – wenn also böswillige Menschen davon munkelten, Klara solle die natürliche Tochter des Geheimrats sein, so war das nur böswilliger Klatsch. Anderseits, wenn er so völlig von ihr umsponnen war, weshalb hatte er sie denn nicht schlankweg zu seiner Frau gemacht? Vor einem Jahr noch war der Geheimrat eine wunderbare, stattliche, fürstliche Erscheinung, und es wäre doch nicht das erste Mal gewesen, daß ein fünfundsechzigjähriger Millionär sich das Vergnügen machte, eine zweiundzwanzigjährige junge Dame zu heiraten.
Leupold beschloß aber solche Betrachtungen immer mit dem bestimmten Wort: Dazu ist er zu klug! Und er war natürlich mit solcher Klugheit sehr zufrieden, denn er sah, ohne sich dessen bewußt zu sein, seinen Herrn einfach als sein Eigentum an. Durch eine Wiederheirat wäre er in den Hintergrund gedrängt worden. Er war seinem Herrn unentbehrlich, und das wollte er bleiben. Diese Empfindung war sein eigentlicher Lebensinhalt.
Heute nun kümmerte der Geheimrat sich um nichts, sah kaum die Rosen an, die Leupold vorwies, und wehrte unwillig ab, als der Kuchenteller zur Begutachtung gezeigt wurde.
»Was er wohl hat,« dachte der Diener. Das Leben seines Herrn lag so durchsichtig vor ihm hingebreitet, daß er sich trotz aller ihm wirklich eigenen Diskretion nicht enthalten konnte, sogleich zu begrübeln, was er gelegentlich an einer Stimmung nicht verstehen konnte.
Die heutige Undurchdringlichkeit der Herrenlaune schien besonders rätselhaft.
Der Geheimrat hatte freilich so viele schwere Gedanken, daß sie ihm wie zyklopische Blöcke im Gemüt lagen. Seine Intelligenz, seine Lebenserfahrung, sein starkes Gefühl versuchten sich an diesen schweren Dingen. Aber ihnen war nicht beizukommen.
Zum erstenmal geschah es ihm, daß er einfach keine Antwort wußte auf die Frage: Wie fang’ ich das an?
Wynfried war noch am Tage jener Unterredung nach Hamburg gereist und hatte mit dem Rechtsanwalt Koppen alle diese trüben Finanzangelegenheiten durchgesprochen. Damit war das erledigt. Es galt nur noch, sobald Koppen alle Forderungen auf Recht und Reinlichkeit geprüft haben würde, einen Scheck mit einer wahrscheinlich sehr großen Zahl auszuschreiben. Heute mittag war er schon wieder zurückgekommen. Der Vater mochte keinen Zeugen beim Essen haben, denn es war ihm peinvoll, wenn er mit einer Hand Vorgeschnittenes aufgabeln mußte. So aß jeder für sich. Wynfried unten im Speisesaal voll schön stilisiertem Prunk. Der Geheimrat in seinem Sessel, der seine Gruft und sein Thron zugleich war. Bei der Begrüßung erschien es aber dem Vater, als sei der Ausdruck seines Sohnes noch nicht ein bißchen heller und freundlicher. Die gleiche vornehme Apathie, die so empörend auf den kraftvollen Riesen wirkte, der sich noch wie ein Koloß an Willen vorkam, trotz der halbseitigen Lähmung, gegen diesen gleichgültigen jungen Mann...
Er hatte gebeten, was nach des Geheimrats Einbildung »bitten« hieß, in der Tat aber einfach immer wie ein Kommando klang, daß Wynfried doch um fünf Uhr zum Tee heraufkommen möge.
»Dann kann ich dich ihr vorstellen.«
Wynfried wußte von selbst, daß damit Klara Hildebrandt gemeint sei. Er verbeugte sich nur gehorsam zustimmend. Seine Gedanken verschwieg er. Sie lauteten ungefähr: Sie werden sagen, der Vater hat ihn mit dem ersten besten Mädchen verheiratet, bloß damit er in Ordnung kommt. »Sie« – seine Genossen der letzten tollen Lebemannsjahre, all diese jungen Männer, die in ihren Vätern vor allem nur die Geldquellen sahen – und andere »Freunde«, die auf seiner Freigebigkeit und Sorglosigkeit schmarotzten. Und all die »Freundinnen«, die ihn zu trösten und anzupumpen suchten und ihn betäuben halfen – – Ja, all diese würden sich totlachen und es sich zuschreien: Wißt ihr, Winni hat man zum Standesamt geschleppt ... Aber es war egal, was diese spotteten – alles war egal–
Nun saß der Geheimrat da, wuchtig und groß, in der Umrahmung der gelbgrauen Lederlehne, und versuchte vergebens die Frage vom Fleck zu wälzen: Wie fang’ ich das an?
Er fühlte, daß er des Gehorsams Wynfrieds sicher sein konnte und daß dieser pünktlich gegen fünf Uhr eintreten würde.
Sollte er die Zeit vorher benutzen, um Klara vorzubereiten auf seinen Plan und Wunsch? Sollte er hoffen, daß Wynfried, von ihr bezaubert, mit neu erwachendem männlichen Mut darauf ausgehen würde, sich das Mädchen zu erobern? Lag nicht die Gefahr nahe, daß er mit zu offenem Wort das feine herbe Kind kopfscheu machen würde, wie ein scheues Wild von einem ungewohnten Laut vergrämt wird? – War es klüger, zu schweigen oder zu reden? den Dingen ihren Lauf lassen?
Aber wer verbürgte ihm denn, daß ihm Zeit blieb, den Lauf der Dinge abzuwarten? Wußte er so gewiß, daß sein Wille zum Leben siegreicher war als der Dunkle, der neben ihm lauerte?
Und war Wynfried in seiner Schlappheit und blassen Unlust wohl der Mann, dem ein Mädchenherz schnell zufliegen konnte?
Ganz tief in seinem Unterbewußtsein war ja das Gefühl: Sie wird es meinetwegen tun...
Aber dem Gefühl verbot er die Deutlichkeit. – Es sollte doch für sie kein Opfer werden! Sie sollte Aufgaben, Reichtum, Achtung, Zuneigung finden, und damit das Glück...
»Wie fang’ ich es an?«
Er fand keine Antwort.
Und so beschloß er, der sonst die Dinge mit klaren Vorsätzen und starken Händen lenkte, sich zunächst von ihnen lenken zu lassen. Er wollte abwarten, wie weit Gespräch und Stimmung und jenes unwägbare Gefühl für die Gunst oder Ungunst des Augenblicks ihm erlauben würden zu gehen.
Er kam durch diesen Entschluß ein wenig innerlich zur Ruhe. Wunderbar wohl und frisch war ihm zumut, so daß es ihm selbst erstaunlich schien – bei seinem Zustand!
Der Sonntagsfrieden draußen und drinnen hatte für ihn etwas Pastorales. Früher war er nie dazu gekommen, ihn überhaupt zu bemerken.