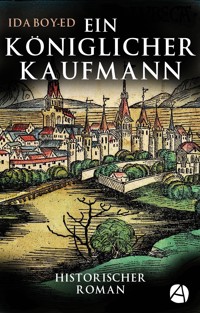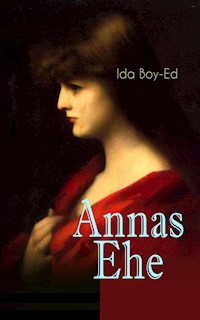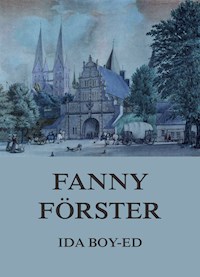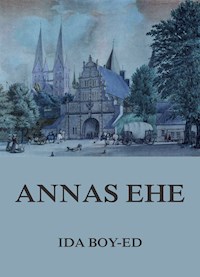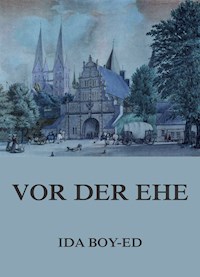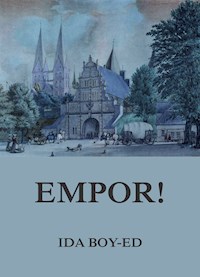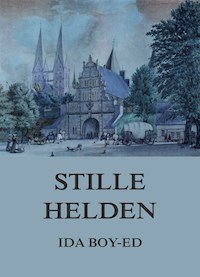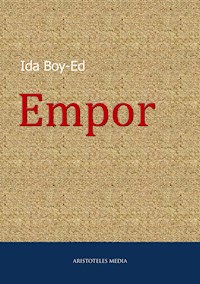
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die gebildete junge Adlige Irene von Meltzow ist aus wohlhabenden Verhältnissen. Als ihr Vater nach dem Tod der Mutter wieder heiratet, verlässt sie ihr behütendes Elternhaus und wird angestellte Gesellschafterin. Sie erfährt Demütigungen und Herausforderungen. Die Begegnung mit Signe, der schwedischen Schwiegertochter der Hausherrin bringt ihr die unheilvollste und tiefste Erfahrung, denn die Eingeheiratete ist eine zutiefst unglückliche Fremde im eigenen Haus, das von Gesellschaftskonvention beherrscht ist. Welche Wege bieten sich einer Frau in den 1890er Jahren, emporgehoben zu werden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ida Boy-Ed
Empor
1.
Es klopfte hart und kurz an die Tür. Obgleich Irene seit vielen Stunden bald wach, bald in unruhvollem Halbschlummer gelegen hatte, in Erwartung dieses Weckrufes, fuhr sie nun doch erschreckt zusammen. Die ganze Nacht hatte sie keinen rechten Schlaf finden können, und nun schien es ihr, als wären ihre Glieder bleischwer von Müdigkeit.
Sie kam indessen in die Höhe und machte Licht. Schmerzhaft schlossen sich ihre Lider zunächst; der blinkende Strahl der offenen Kerzenflamme tat dem Auge weh, nach der Dunkelheit der Nacht.
Ein Kälteschauer rann ihr durch die Glieder.
Sie sah nach der Taschenuhr, welche auf dem Marmortischchen neben ihrem Bett lag.
»Halb fünf.«
Schon der bloße Gedanke an diese winterliche Morgenfrühe machte frieren.
Aber mit einem Seufzer, kurz und entschlossen, stand Irene auf. Sie ging mit nackten Füßen auf dem Teppich, welcher den ganzen Boden bedeckte, bis an das Fenster und zog die Gardinen zurück.
Das Glas glich einer verschrammten und zernarbten Milchscheibe, so war es von rauhweißen Eisblumen bedeckt.
Nur an dem Mangel von Transparenz sah man, daß hinter dem Fenster schwarze Nacht gähnte.
Im Zimmer war es sehr ausgekältet; man hatte am Abend vergessen die Ofentüren zuzuschrauben und so hatte sich die letzte Spur von Wärme aus den Kacheln verflüchtigt.
Unerquickt, mit brennenden Lidern und schwerfälligen Bewegungen machte Irene sich an die Mühe des Ankleidens.
Die Bewegungen in dem nicht sehr großen Zimmer waren ihr erschwert, denn zwei Koffer, schon geschlossen, standen vor den ihres Inhalts beraubten Möbeln; ein größerer Handkoffer lag aufgeklappt am Boden. Ab und an tat Irene einen Gegenstand hinein, dessen sie nun nicht mehr bedurfte und förderte so zugleich Gepäck und Anzug.
Allmählich wurde ihr Kopf freier, ihre Bewegungen munterer.
Als sie vor dem Spiegel saß, nachdem sie an demselben zwei Kerzen auf dessen Armleuchter entzündet, klopfte es wieder.
»Herein.«
Ein Mädchen, mit weißer Haube auf dem noch ungeordneten Haar, mit weißer Schürze vor dem schlechtesten Arbeitskleid, guckte in die Türöffnung und fragte, ob das gnädige Fräulein den Tee im Speisezimmer wünsche.
»Nein, hier,« befahl Irene hastig.
Sie eilte nun, ihr dunkles Haar zu ordnen, das sie in einen Knoten im Hinterkopf locker zusammenwand und mit einer Schildpattnadel befestigte. Noch hatte sie ihr schwarzes Kleid nicht ganz geschlossen, als das Mädchen mit dem Teebrett kam.
Es blieb kein Plätzchen, dies niederzusetzen, als der Marmortisch am Bett.
Irene setzte sich auf die Kante ihres ungemachten Bettes und goß sich Tee ein.
»Die Frau Doktor Ebermann ist schon gekommen und fragt, ob sie herauf darf,« meldete das Mädchen.
»Aber bitte.«
Irenens Gesicht, das gleichsam in Ausdruckslosigkeit versteinert gewesen, belebte sich plötzlich. Es zuckte etwas darüber hin – eine schmerzliche Rührung – und in dem dunkeln, großen Auge schimmerte es, wie von einer aufsteigenden Träne.
Irene nahm sich zusammen. »Ich will nicht!« dachte sie und kämpfte nieder, was sich so weichmütig in ihr regte. Vielleicht fühlte sie, daß sie sich in einer jener Stimmungen befand, wo ein Atemzug, ein Hauch, das ganze stolze Gebäude von Mut und langbedachten Entschlüssen umwehen kann. Ein Orkan kann die Widerstandskraft einer Seele wachrufen, ein weicher West alle Kraft in weinende Wehmut auflösen.
»Ich muß und ich will,« sagte Irene sich noch einmal und lächelte der Eintretenden entgegen.
Diese war eine Frau von vierzig und einigen Jahren, mit einem Gesicht, das, lebhaft und angenehm, jetzt auch noch die brennende Nöte zeigte, welche Erregung und der frühe Gang in schneidender Kälte darauf hervorgerufen. Frau Doktor Ebermann trug einen pelzgefütterten Abendmantel und einen kleinen runden Filzhut, über den sie, um die Ohren zu schützen, einen weißen, gestrickten Schal gebunden hatte.
Sie setzte sich ohne weiteres zu Irenen auf die Bettkante und umarmte das junge Mädchen, wobei ihr der dicke Mantel und die vielen Tücher – sie hatte unter dem Mantel auch noch ein gehäkeltes Umschlagetuch – sehr hinderlich waren.
»Ich will ein bißchen ablegen und dir helfen. Es ist noch Zeit. Trinke du nur ruhig. Es ist ja nicht das erstemal, daß ich deinen Koffer packe,« sagte die Frau eifrig.
Sie hatte eine rasche und gewandte Art, die bezeugte, daß sie gewohnt war, anzugreifen und was zu schaffen.
»Das waren freilich andere Reisen,« meinte Irene mit einem kleinen Lächeln.
»Ja,« sagte Frau Ebermann anzüglich, »da fuhren wir mit leichterem Gepäck und leichterem Herzen.«
Wie um abzulenken von dem Gegenstand, auf welchen Frau Obermann anspielte, sprach Irene:
»Und du Gute, Treue! Um halb fünf bist du aufgestanden und hast deinen arbeitsreichen Tag noch zwei Stunden früher als sonst begonnen, nur um deiner alten Irene das Geleit zu geben!«
Frau Edelmann neigte ihren blonden, glatten Kopf etwas tiefer, als gerade nötig tat, über den Handkoffer, vor welchem sie kniete.
»Du bist und bleibst mein ›Kind‹, solange du lebst, wenn ich dir auch leider Gottes nichts mehr zu befehlen habe,« sagte sie mit etwas unsicherer Stimme, »denn sonst unterbliebe diese Reise, und dieser abenteuerliche Entschluß wäre nicht gefaßt worden.«
Frau Ebermann ließ ihren kummervollen Unwillen an Irenens Schlafpantoffeln aus, die sie allzu kräftig in den Grund des Koffers stieß.
»Siehst du, Johanne,« begann Irene, »das kann ich nun nicht begreifen. Du vor allen Menschen müßtest mich kennen, denn du hast mich von meinem sechsten bis zu meinem achtzehnten Lebensjahre keinen Tag verlassen. Du hast mich erzogen; was ich weiß, ich verdanke es dir, dein Werk ist es, daß mein heftiger Charakter Selbstbeherrschung gelernt hat, dein Verdienst ist es, daß ich über mich selbst und über andere tiefer nachdenke, als sonst junge Mädchen pflegen. Du vor allen Menschen mußt längst wissen, daß mir mein Dasein schon fast zwecklos schien, als ich es nur dazu anwenden konnte, meinem Vater die wenigen Freistunden zu erheitern, welche ihm sein Amt läßt, daß es mir aber völlig inhaltslos werden muß von dem Augenblicke an, wo eine andere diese liebe, beglückende Pflicht übernehmen darf.«
»Deshalb läuft man nicht so in die Welt hinaus und macht sich aus freien Stücken zur Sklavin der Launen irgendeiner Madame X., Y. oder Z. Eine junge Dame von Vermögen und Stellung! Als ob du nicht auch hier dir hättest einen Wirkungskreis schaffen können,« stritt Frau Ebermann.
»Du bist heftig, Johanne,« sagte Irene sanft, »weil du fühlst, daß du mir mit treffenden Gründen nicht widersprechen kannst. Sollte ich einem Volksküchen- oder Frauenverein beitreten? Für Arme kochen, nähen, ihnen aus der Bibel vorlesen? Oder mehr in der Gesellschaft leben? Meine Tage ausfüllen mit Sorgen darüber, was ich am Tage anziehen werde? Du weißt recht gut, daß ich dazu nicht gemacht bin. Vielleicht ist meine Seele nicht resigniert und einfältig genug, um mir in der Armenpflege einen Beruf zu suchen. Ich fühle in mir nicht die Fähigkeit, mich fremder Not zu widmen und würde immer hin und her schwanken zwischen dem Unglauben an die Not und dem Unglauben an die Hilfe. Bettelnde lügen so viel und Helfende tun so oft weh. – Und die Gesellschaft? Weißt du, ich will Menschen! Ich will Inhalt!«
»Und nun gehst du in die Dienstbarkeit, um Menschen zu studieren,« schloß Frau Ebermann. »Mein Herr und Gebieter sagt zwar, es sei Charakter darin, aber mir tut's weh.«
»Siehst du,« sprach Irene und griff nach Hut und Mantel, »dein Ebermann versteht mich diesmal besser als du. Ich will dir sagen, was dir weh tut. Nicht allein mein Fortgehen an und für sich, sondern die ganze große Veränderung, welche hier vorgegangen und in welcher meine Abreise nur den Schlußakt bildet. – Aber wir wollen doch lieber klingeln, daß man das Gepäck hinunterschafft.«
Frau Edelmann rüstete sich auch.
»Ja, ja,« sagte sie, während sie sich mit ihrem Schal abquälte, der sich in den Mantelknöpfen festgesetzt hatte, »wenn ich so denke, daß man hier wie zu Hause war.«
»O, du wirst es bleiben,« rief Irene warm, »du bist meinem Vater, was du ihm immer warst: die Erzieherin seines mutterlosen Kindes, der er nie genug Dankbarkeit und Verehrung zeigen kann. Glaubst du, daß er dies je vergißt, wie du deinen Ebermann vier Jahre warten ließest, weil du mich nicht verlassen wolltest, ehe ich geistig auf eigenen Füßen stehen konnte, wie du das nanntest! Nein, mein Vater ist und bleibt dein und deines Mannes treuer Freund.«
»Nun,« sagte Frau Ebermann, »ich würde ein Aufhören seines Interesses an uns schmerzlich empfinden, aber ein Vorwurf würde ihm in meinem Herzen nicht daraus erwachsen. Er hat mehr als zu viel für uns getan. Daß unsere Pension stets besetzt ist, von Söhnen der angesehensten Familien aus der Provinz, ist seine Fürsorge. Daß Ebermann als Oberlehrer gleich ans Gymnasium kam und nun schon zum Professor steht, ist sein Werk.«
»Er wußte, wen er empfahl,« rief Irene und fiel ihrer Erzieherin um den Hals.
»Leb' wohl – die Leute kommen.«
»Ich fahre mit an den Bahnhof,« bestimmte Frau Ebermann.
Während ein Diener in rotweißer Weste und leinener Morgenjacke mit dem Mädchen die Koffer nacheinander davonschleppte, schwiegen die Frauen.
Irenens Blick ging langsam durch das Zimmer. Sie schien einen Augenblick zögernd besonders auf die Tür zu schauen, die nach nebenan führte. Aber sie überwand das Verlangen, noch einen letzten Blick in ihr Wohnzimmer zu werfen.
»Komm,« sagte sie. Ihre Stimme klang tonlos. Sie ging voran.
Auf dem Korridor und im Treppenhause brannte Gas. –
Die roten, dicken Läuferstoffe dämpften jeden Schritt.
Auf dem Korridore der ersten Etage erhob sich aus zwei Gruppen grüner Koniferen eine Ehrenpforte, gerade über der Treppenhöhe.
Frau Ebermann ging unter dieser Ehrenpforte mit geducktem Kopf hindurch, wandte sich rasch um und las ein großes »Willkommen« in roten Buchstaben. An den Wänden des Treppenhauses hingen einige schöne Decken und Schilde, die dort früher nicht gehangen hatten. Die ganze Treppe war rechts und links stufenweise mit blühenden und grünen Gewächsen besetzt.
Das Gaslicht zitterte durch den schönen und von Luftheizung erwärmten Raum, so daß man sich an einen festlichen Abend versetzt glauben konnte.
Unten im Vestibüle stand außer dem Mädchen noch eine alte Köchin; der Diener hantierte draußen mit dem Kutscher an dem Handgepäck.
Irene ging festen Schrittes, ihr Antlitz war bleich. Sie sah die alte Köchin nicht an und duldete deren Tränen und Handküsse. Vielleicht bedurfte sie erst einiger Sekunden der Sammlung, vielleicht mußte sie sich abermals eisern sagen: Ich will nicht, ich will nicht!
»Weine nicht, Dorchen,« sprach sie endlich leise. »Du bekommst eine neue, gütige Herrin, welche deine Treue ebenso ehren wird, wie wir es bisher taten. Pflege meinen lieben Papa mit deiner berühmten Kochkunst wie bisher. Schreibe mir auch einmal, Dorchen, du weißt, ich bin der einzige Mensch, welcher deine Zahlen und Buchstaben enträtseln kann. Und Sie, Marie, pflegen Sie mir mein altes Dorchen gut. Vergessen Sie auch nicht, in meinen beiden Zimmern oben alles stets in Ordnung zu halten und zu lüften. Und daß heute abend das ganze Haus warm und hell ist, wenn die Herrschaft kommt. So – nun adieu – adieu.«
Sie entzog ihre Hand den weinenden Dienstboten und ging hinaus.
Die eisige Morgenluft schnitt ihr ins Gesicht, es war fast schmerzhaft zu atmen.
»Bei solch einer Kälte zu reisen,« sprach Frau Edelmann vor sich hin.
»Hätte ein schwüler Sommerabend diesen Abschied leichter gemacht?« fragte Irene, als sie einstiegen.
»Nein, im Grunde nicht. Aber äußere Begleitumstände können einer Tatsache einen grausameren Charakter geben,« sprach die Lehrersfrau, die gewohnt war, ›Randbemerkungen‹ zu machen. »Tod bleibt auch Tod, ob man ihn durch Erschießen oder Vierteilen herbeiführt.«
Irene lächelte.
»Solch fürchterliche Vergleiche sind hier doch wohl nicht angebracht.«
Nach einigen Minuten des Schweigens, während welcher sie an Dorchen und Marie gedacht, sagte Irene plötzlich:
»Merkwürdig – die Dienstboten lieben mich.« Sie betonte das Wort ›Dienstboten‹ ganz besonders.
»Dich liebt jeder, der dich kennt,« sagte Frau Ebermann und nahm Irenens Hand.
»Du bist nun heute morgen in der Stimmung, dir und mir und all unserer lang erkannten Einsicht zu widersprechen,« antwortete Irene ungeduldig; »weißt du nicht so gut wie ich selbst, daß ich selten den Leuten gefalle, daß man mich für anspruchsvoll, unverbindlich, hochmütig, herbe hält? Und sie haben ja auch recht, die Leute, ich bin unverbindlich und ich bin herbe, denn ich kann nicht aus mir herausgehen, ehe ich weiß, wes Geistes Kind der andere ist. In mir ist etwas wie Mißtrauen. Ich wage mich nicht vor, weil ich immer fürchte, es lohnt doch nicht der Mühe.«
Frau Ebermann schwieg. Sie hätte sagen können, was sie ihrem Mann tagtäglich sagte, seit sie Irenens Entschluß kannte:
»Mit dem Stolz, mit den Anforderungen an Menschen, mit der innersten Verschlossenheit, die niemanden an sich heranläßt, – das kann nur ein Zusammenstoßen und Anprallen und Zerkrachen geben.«
Und wenn sie dachte, daß ihre Irene in der Fremde Schiffbruch leiden könne, fühlte Frau Ebermann einen großen Zorn gegen die ganze Menschheit in sich aufsteigen.
Sie näherten sich dem Bahnhof. In der fahlen Helle, welche der Schnee und der leise tagende Morgen verbreiteten, fuhren an ihnen Hotel- und Postwagen vorüber. Die Gaslaternen an den Rändern des Fahrdammes flimmerten, und ihr vom Frühlicht schon beschränkter Strahlenkreis hatte einen Messingglanz.
An den Promenaden, welche sich zwischen Bahnhof und Stadt hinzogen, trugen die Bäume den Schmuck des Rauhreifes, die weißen Zweigverschränkungen standen gespenstisch vor der nebelgrauen Luft.
Der Pfiff der Lokomotive gellte lang durch die Morgenstille.
Irene fühlte eine schaudernde Kälte in allen Gliedern. Ihr war sehr elend zumute. Doch bemühte sie sich vor der mütterlichen Freundin ihr tapferes Benehmen aufrechtzuhalten. Sie kaufte sich selbst ein Billett und überwachte mit Ruhe und Umsicht ihr Gepäck.
Es fand sich, daß die Frauen viel zu früh gekommen waren und nun im Wartesaal noch eine halbe Stunde sitzen mußten.
In dem großen Saal brannten nur einige Gasflammen, die ihn kaum erhellten. Auf den ringsum laufenden Bänken saß irgendwo neben einem aufgestapelten Haufen Handgepäck ein junges Mädchen mit einem verweinten, elenden Gesicht. Zwischen den kahlen Tischen, an die je eine Menge Stühle gerückt waren, ging ein langer Herr im Reiseulster mit einer Tuchmütze auf dem Kopf hin und her. Hinter dem Büfett wischte ein Fräulein Kaffeetassen aus und ein Kellner lehnte verschlafen vorn daran; die Faust hatte er in die Hosentasche gesteckt, die Serviette hing als schmaler Strick traurig daneben herab.
Niemand sprach, und dies verschlafene, halb und halb wartende Schweigen legte sich so bänglich um die Herzen der beiden Frauen, daß auch sie nur miteinander zu flüstern wagten. Dazu kam der immer näherrückende Augenblick des Abschieds, der in ihnen beiden ein Angstgefühl erregte. Frau Ebermann saß ganz dicht neben Irene und hielt ihre Hand fest.
Trotz alledem hatte in dem Kopf der guten Frau noch ein neugieriger Gedanke Raum. Obgleich ihr Denken meist immer auf das Wesentliche gerichtet war, mochte sie aber doch auch gern alles Nebensächliche wissen.
»Mir fällt ein, euer Treppenflur und der Korridor waren ja so großartig dekoriert,« sagte sie, »hat dein Vater das machen lassen?«
Irene mußte nun wirklich lächeln. Gewiß hatte diese Sache ihre gute Ebermann die ganze Zeit her beschäftigt und inmitten alles Kummers hatte sie über diese Frage gegrübelt.
»Eine Aufmerksamkeit von mir für Papa und seine Gattin,« sprach sie. »Die Wohnräume waren so völlig und so überreich ausgestattet, daß mir nichts blieb, als ihnen den Eingang zu schmücken; ich fand darin sogar etwas Symbolisches, das mir wohltat.«
Beruhigt in ihrer Neugier, wandte sich Frau Ebermann gleich wieder einer tiefinnerlichen Sorge zu.
»Du gönnst deinem Vater das Glück?«
»So sehr,« sagte Irene mit zagender Stimme, »wie man nur einem geliebten Menschen den Reichtum gönnen kann, der einem selbst genommen ist. Bei aller Großmut der Empfindungen bleibt doch ein Bodensatz von Schmerz.«
»Und du hast das Vertrauen, daß er glücklich werden wird, der herrliche Mann?« fragte Frau Ebermann mit einem Seufzer.
In ihrem klaren, gefaßten und maßvollen Herzen war doch einst ein kleiner Sturm gewesen, um dieses Mannes willen, damals, als sie, selbst noch jung, so in gleichen Pflichten mit dem jungen Witwer dahinlebte. Das war verwunden und in ihres Ebermanns Liebe vergessen. Aber dennoch traute sie keiner Frau auf Erden recht die Fähigkeit zu, diesen Mann ganz glücklich zu machen.
Irene preßte ihr die Hand.
»Völlig. So sehr, daß dies Bewußtsein allein mir jetzt Halt gibt. Albertine ist ein ungewöhnlicher Charakter.«
»Und doch, mein Kind, Charaktere müssen sich immer erst aneinander abschleifen in dem engen Nebeneinander der Ehe. Je härter und strahlender und vielkantiger zwei Diamanten sind, um so länger wird es dauern, bis sie sich aneinander glatt gerieben haben. Dein Vater ist ein Mann von fünfzig Jahren. Albertine steht in deinem Alter. Diese Jahre haben nicht gleichen Schritt. Die einen gehen mit Bedacht, die andern stürmen.«
»Albertine ist reif und ihren Jahren voraus. Ich darf wohl sagen, wie ich,« versetzte Irene etwas ärgerlich; »stürme ich etwa noch?«
»Nennst du diese Fahrt in die Dienstbarkeit zu fremden Leuten keine Sturm- und Drangtat?« fragte Frau Ebermann. »Das ist ja gerade, was mich so ängstigt: Deine Überlegenheit auf der einen Seite und deine Unfertigkeit auf der anderen.«
Auf Irenens Gesicht erschien ein schmerzlicher Zug.
»Du weißt – es gab für mich nur diesen Ausweg. Vielleicht ist meine Tat mehr eine des Taktes, als der Überspanntheit. Papa war mit siebenundzwanzig Jahren Witwer. Ich bin gewiß, daß er die ersten Jahre nach Mamas Tod aus Trauer um sie nicht sein Herz für eine neue Liebe öffnete. Dann, obschon sein Leben in der Welt und seine Stellung ihn fast dazu drängten, blieb er weiter unvermählt – meinetwegen! Er wollte der einzigen, heranwachsenden Tochter keine Stiefmutter geben. Ich weiß, daß er einmal lebhaft mit sich kämpfte und daß er heiße Wünsche meinetwegen bezwang. Vielleicht hoffte er, daß ich mich verheiraten würde und daß er dann wieder Recht und Freiheit haben dürfe, an eigenes Glück zu denken. Aber ich« – und hier lächelte Irene wehmütig – »ich wiederum konnte Papa den Gefallen nicht tun, denn ich habe leider den Mann nicht gefunden, der mir genügend imponiert hätte. Nun endlich, als Papa sieht, daß ich alle Anstalten mache, eine alte Jungfer zu werden, begreift er, daß er mir nicht auch den Rest seines Lebens opfern darf, wie er mir seine Jugend und Mannheit geopfert. Er lernt Albertine kennen, er ist loyal genug, mich vorher zu fragen, ob ich eine Feindin seiner Ehe und seines Glückes werden würde, und ich – nun ich bin ihm in Tränen um den Hals gefallen und habe ihm gesagt, daß meine Liebe dieselbe bleibt, und daß ich alles ehre, was er tut. Ich kenne Albertine nur wenig, aber jedesmal, wenn wir uns begegneten, habe ich das Gefühl gehabt, sie heiratet nicht den Regierungspräsidenten von Meltzow, sondern den Mann, den sie unaussprechlich liebt und verehrt – sie hätte Papa auch genommen, wenn er keine Stellung, keinen Namen gehabt hätte.«
Über Irenens Gesicht rollten langsam zwei große Tränen.
Lächelnd trocknete sie dieselben.
»Eines fühlte ich aber,« fuhr sie fort, »daß es für meinen Vater, für Albertine und mich gleich peinlich sein müßte, in diesen neuen Verhältnissen von vornherein zusammenzuleben. Eine Tochter, die im gleichen Alter mit der Gattin ist, als stete Zeugin für ein junges Eheglück zu haben, muß schrecklich sein. Wie du richtig sagst: Charaktere müssen sich erst aneinander abschleifen. Sollte das in meiner Gegenwart geschehen? Jedes kleine Mißverständnis, jede kleine kriegerische Aufwallung mußte einen wichtigen und peinlichen Anstrich bekommen, wäre ich zugegen. Ein Verstehen, ein seelisches Zusammenleben wäre so erschwert worden, weil ein Dritter, noch dazu ein Dritter, der Partei nehmen würde, zugegen war. So fand ich, daß es taktvoll sei, zu gehen. Verwandte haben wir wenig und sie sind mir so fern, daß es noch bequemer schien, zu ganz Fremden zu gehen. Das Glück war mir günstig. Ich habe eine Stellung als Gesellschafterin gefunden. Das ist ein Anfang, um zu lernen, mich in andere Menschen zu fügen, denn ich bin ein wenig selbstherrisch aufgewachsen. Geht es gut, so kann ich mir schon zutrauen, später im Vaterhause mich glatt in die veränderten Verhältnisse einzufügen. Geht es nicht gut, werde ich um so eher einsehen, wieviel leichter es ist, sich im eigenen Daheim als Nummer Zwei betrachten lernen, denn bei Fremden Sklavin sein.« –
Frau Ebermann stand auf und umarmte ihre Pflegetochter. Ihr Herz war voll Stolz auf sie, und sie freute sich schon darauf, ihrem Ebermann Wort für Wort Irenens Rede zu wiederholen, denn ein Gedächtnis hatte Frau Ebermann – dagegen kam schon gar nichts auf.
»Einsteigen, Richtung Berlin!« rief der Portier jetzt mit schnarrender Stimme in den Raum.
»Der ist gewiß Unteroffizier gewesen,« bemerkte Frau Ebermann und griff nach Irenens Handtäschchen.
Auf dem asphaltierten Stieg in der Bahnhofshalle ging der Diener mit Irenens Pelz und Fußsack hin und her.
Eben fuhr der Schnellzug ein, der von Wien kommend, die Provinzhauptstadt im Fluge berührte.
»Eine Dame nach Berlin, Schaffner,« rief Frau Ebermann, deren mütterliche Fürsorge für ihr doch so selbständiges Pflegekind angstvoll erwachte.
Der Schaffner riß eine Tür auf und rannte weiter. Ein betäubender Lärm füllte die Halle; die Lokomotive prustete, aus den Achsen der Wagenräder drang ein traniger Fettgeruch. Ein Mann ging am Zuge entlang, bückte sich da und dort und schlug mit seinem Hammer prüfend an die Achsen, daß es einen klingenden Ton gab.
Der verschlafene Kellner ging mit langbeinigen Schritten unter den Kupeefenstern entlang und rief mit heller Stimme, in eintönigem Silbenfall:
»Kaffee, Bier, Butterbrot, warme Würstchen.« Dabei hielt er die gespreizten fünf Finger unter das auf seiner Schulter ruhende Tablett.
Und während der Diener die Pelze hineinlegte und sich dann verabschiedete, flüsterte Irene noch eine letzte Bitte ihrer treuen Ebermann ins Ohr:
»Gehe morgen zu Papa. Laß dich von ihm mit Albertine bekannt machen. Sage ihnen beiden, daß ich mit Liebe im Herzen für sie gegangen sei. Papa hat erst vorgestern auf der letzten Station seiner Hochzeitsreise davon erfahren. Vielleicht war mein Brief nicht beredt genug. Du hast immer Worte – so rechte, eindringliche, liebevolle. Sage ihnen, daß ihr Haus immer mein Heim und meine Zuflucht bleiben soll.«
Das war Frau Ebermann nun ganz neu. Sie hatte gedacht, daß Herr von Meltzow von Irenens Plan und Vorhaben wisse.
Aber jetzt war keine Zeit zu Erörterungen. Sie umarmten sich, und Irene stieg ein. Sie waren beide stumm vor Schmerz.
Und dabei froren Frau Ebermann die Füße sehr, und in all ihrem Gram dachte sie:
»Ebermann hatte doch wieder recht – ich hätte meine gefütterten Galoschen überziehen sollen.«
Gerade, als der Schaffner die Tür schließen wollte, kamen zwei Herren angestürzt, und der Schaffner ließ sie bei Irenen einsteigen.
»Aber das ist ja Damenkupee!« schrie Frau Ebermann dem schon davoneilenden Manne nach. Zugleich sah sie aber, daß an der Tür stand: »Nichtraucher«.
Drinnen versuchte Irene noch, die gefrorene Scheibe niederzulassen, umsonst.
Die Lokomotive pfiff, es läutete. Schwerfällig und dumpf rollte der Zug davon.
Die Frau lief noch nebenher und winkte und winkte und streckte vergebens ihre Hände aus.
Von drinnen lehnte eine Stirn gegen die Scheibe und zwei weinende Augen suchten umsonst, noch einen letzten Blick zu erhaschen und zu geben.
Eine Wand von Eisblumen stand zwischen ihnen.
Weißer Dampf, von den Flanken der Lokomotive auspfeifend, hüllte nun den ganzen Zug ein. Und so raste er hinaus in die weiten, weißen Schneegefilde.
Irene sank in die Ecke und drückte ihr Gesicht gegen die Polster, wieder ging jene Entschlußkraft des Willens durch ihre Seele, mit der sie sich schon seit Tagen gegen jede Rührung wappnete.
Sie brauchte Festigkeit, und es sollte ihr nicht daran fehlen.
Sie trocknete sich die Augen, hielt sich ein Weilchen das kühle Taschentuch an das Gesicht und rückte ihren Hut wieder zurecht. Dann verpackte sie sich in ihre Decken und Pelze und saß still, die Hände in dem Muff. Sie versuchte, an allerlei praktische Dinge zu denken. Sie ging noch einmal alle Anordnungen durch, welche sie den Dienstboten hinterlassen, ordnete im Geist noch einmal Albertinens reiche Aussteuer mit der vorhandenen Einrichtung ihres Vaters zusammen zu einem Ganzen. Sie hoffte, Albertine würde überall die liebevoll sorgende Hand erkennen.
Dann dachte sie noch an das unerquickliche Gespräch mit dem Rechtsanwalt ihres Vaters. Das Gesetz hatte es so gewollt, daß ihr das Vermögen ihrer Mutter ausgehändigt wurde. Sie war majorenn, und ihr Vater ging eine zweite Ehe ein. Ihr Verstand sagte, daß es nur ordnungsmäßig sei; aber ihr Herz litt dabei. In dieser kleinen äußerlichen Form hatte sie ein Symbol erblickt. Sie fühlte, daß sie vom Schutz ihres Vaters losgelöst und selbständig geworden war. Die Zinsen dieses Vermögens waren bisher ihrem Vater zugute gekommen.
Aber der würde den Ausfall nicht bemerken, denn Albertine brachte ihm ein weit, weit größeres Vermögen zu.
Von Geld hatte Irene nach recht wenig Begriff, und sie wußte nicht, ob sie mit ihren viertausend Mark Zinsen für sich allein hätte leben können oder nicht. Darüber hatte sie so wenig nachgedacht, daß ihr nie der Gedanke gekommen war, sich eine Wohnung mit einer Ehrendame zu nehmen und allein zu leben. In dieser Form der Entfernung aus dem Vaterhause hätte sie auch zweifelsohne etwas Feindseliges gefunden, wenn man sie ihr vorgeschlagen haben würde.
In der Stellung, welche sie jetzt antreten wollte, verdiente sie Geld. Das war ihr ein merkwürdiger Gedanke.
Ihre Unterwürfigkeit unter die Laune einer fremden Person sollte bezahlt werden.
Hierüber dachte sie lange und tief nach, wie bitter müßte solcher Gedanke für ein armes Mädchen sein, welches von der Not gezwungen war, sich in Dienstbarkeit zu begeben.
Daß es Dienstverhältnisse gibt, wo Fleiß, wissen, Handgeschicklichkeit bezahlt werden, wußte Irene ja, sie sah es an ihrem eigenen Vater und an ihren Dienstboten. Das Wissen des einen bezahlte der Staat, den Fleiß der andern ihr Vater.
Aber daß man moralische Eigenschaften, wie Geduld, Fügsamkeit und Liebenswürdigkeit bezahle, fand sie plötzlich entwürdigend, mehr noch für den, der bezahlte, als für den, der seine Freiheit verkaufte.
Wahrscheinlich, so sagte sie sich, waren diese Betrachtungen der Niederschlag eines hochfliegenden Gesprächs, welches sie vor einigen Tagen mit dem stets philosophierenden Ebermann gehabt. –
Während Irene saß und still in ihre Gedanken versunken war, ahnte sie nicht, daß auf ihrem Antlitz ein steter Wechsel des Ausdrucks vor sich ging. Ihre lebhaften Züge waren immer ein Spiegel ihrer Seele, jede Empfindung huschte wie Schatten oder Licht darüber hin. In ihren grauen Augen, die geradeaus auf die Wand gegenüber gerichtet schienen, aber in der Tat nichts von dieser Wand sahen, blitzte es bald wie in zorniger Energie auf, bald verschleierte sich der Blick in Wehmut; ihre Nasenflügel, die fein und nervös aussahen, bebten zuweilen.
Noch weniger aber ahnte Irene, daß sie scharf beobachtet wurde.
Die Gegenwart jener beiden Herren im Kupee war ihr so gleichgültig, daß sie ihrer ganz vergessen hatte.
Die beiden sprachen anfangs auch gar nicht zusammen. Jeder hatte sich verschlafen in seine Ecke gedrückt, aber als es allmählich draußen heller Tag geworden, sahen sie sich die mitreisende junge Dame genauer an. Aus dem bloßen Umstand, daß sie allein in einem Nichtraucherkupee fuhr, entnahmen sie schon die Berechtigung zur Neugier.
Durch einen Blick verständigten sie sich darüber, daß ihre Reisegenossin sehr anziehend und ungemein interessant aussah.
Der eine von ihnen war ein schlanker, sehr vornehm gekleideter Herr, der auf den ersten Blick jünger aussah, als er war, und in dessen ganzem Gebaren eine gewisse absichtliche, jugendliche Elastizität ausgedrückt lag, ohne daß diese im mindesten den Eindruck des Geschmacklosen oder Lächerlichen hervorgerufen hätte. Der Herr hatte sehr regelmäßige Züge, ein kaltes, helles Auge und einen sorgfältig gehaltenen blonden Vollbart.
Er begann zuerst eine leise Unterhaltung mit seinem Gegenüber.
»Offenbar Theater,« flüsterte er, sich vorbeugend.
»Glauben Sie?« fragte der andere zurück und sah mit größter Unbefangenheit auf Irene.
Dieser andere war ein kleiner, zur Fülle neigender Herr, mit einem lebhaft karierten Reisemantel und einem zerdrückten grünlichen Filzhut von unenträtselbaren Formen. Aber die weiße, sehr sorgsam gepflegte Hand, mit welcher er den ergrauenden Bart strich, und das freiblickende Auge, sowie ein Zug von unzerstörbarem Selbstbewußtsein im Gesicht ließen keinen Zweifel aufkommen, daß er zur guten Gesellschaft gehöre.
»Aber ich bitte Sie,« raunte der erste wieder, der sich vermöge seiner Erfahrungen für einen unfehlbaren Frauenkenner hielt, »ein Sealskinmantel – diese Pelze, das ist ein kleines Vermögen. Und dann das lebhafte Gesicht, diese feine Nase, der volle Mund und das ungewöhnliche Auge. Dies alles aber allein im Nichtraucherkupee. Theater – wahrscheinlich aber vornehmes Theater.«
Der Kleine im karierten Reisemantel begann darauf sofort ein lautes Gespräch über Berliner Theater und nannte eine Unmenge Namen bekannter Schauspielerinnen, mit einer Redeleichtigkeit, die bei seinem Begleiter ein hochmütig-mitleidiges Lächeln hervorrief. Er fand seinen Freund Gräditz manchmal unglaublich plump.
Bei der nächsten Station, wo der Bahnsteig sich neben Irenens Seite befand, erhob sich der Blonde und trat an das Fenster. Dabei bat er zugleich durch eine kleine und vollendet höfliche Verbeugung um Verzeihung.
Als er sich wieder setzte, geschah es nicht mehr in die fernste Ecke hinein, sondern mehr der Mitte zu.
Von hier aus unterhielt er sich mit etwas gelangweilten und hochmütigen Mienen mit Gräditz.
Aus dem Gespräch entnahm man, daß sie zusammen bei der silbernen Hochzeit eines Regimentskommandeurs gewesen waren, der ihnen befreundet war von jener Zeit her, als er in ihrer Stadt gestanden hatte. Sie berieten auch, ob sie in Berlin bleiben oder gleich weiterfahren wollten. Das »Gleich« bedeutete immerhin drei Stunden Aufenthalt. Und das war das einzige, was aus ihrem Gespräch an Irenens Ohr schlug. Auch sie hatte drei Stunden Aufenthalt in Berlin, und diese drei Stunden waren ihr der Schreckenspunkt der Reise.
Daß ihr nichts übrigbleiben werde, als so lange in der Bahnhofsrestauration zu sitzen, war ihr gewiß. Höchstens konnte sie eine Spazierfahrt machen. Im klaren Glanz der Wintersonne, die vom blauen Himmel auf weißen Schnee niederstrahlte, mußte das sehr schön sein.
»Halten Sie das, wie Sie wollen, mein lieber Kugler, ich bringe es keinesfalls über das Herz, so durch Berlin zu jagen. Ich bleibe,« sagte Gräditz. »Und Sie, meine Gnädigste, fahren auch nach Berlin?« fragte er mit einer Unverfrorenheit, die seinen Begleiter wieder entsetzte.
Irene sah ihn an. Diese zudringliche Frage erschien ihr sehr drollig. Sie unterdrückte mühsam ein Lächeln und sagte:
»Nein.«
Gräditz merkte aber nicht, daß es das Lächeln der vornehmen Überlegenheit über Unmanier war; er sah eben nur ein Lächeln, das heißt, ein Entgegenkommen.
»Gnädigste haben sich einen kalten Reisetag ausgesucht. Wen die Pflicht nicht zwingt, der soll daheim bleiben.«
Vielleicht erwartete er, daß Irene sagen würde, sie ihrerseits sei allerdings von einer Pflicht gerufen worden. Aber da Irene nichts sagte, fuhr er fort:
»Wenn mein Freund da, Konsul Kugler, nicht solche Eile gehabt hätte, wäre ich nicht gefahren, gewiß nicht.«
»Ich finde es nicht so schlimm,« sprach Irene und wandte ihr Gesicht dem Fenster zu.
Sie hatte von ihrem Vater sagen hören, daß es Leute gibt, die in den Klassen der Eisenbahn von einer unüberwindlichen Plaudersucht befallen werden, die förmlich unter dem Drang leiden, ihren Mitreisenden zu erzählen, woher sie kommen, wohin sie gehen, wer sie sind und wiederum die Mitreisenden auszufragen trachten. Und oft hatte sie ihren Vater solchen Schwätzern mit einer vollendet höflichen Art eine Abweisung zuteil werden lassen hören. »Denn,« sagte er, »es ist in jedem Fall ebenso verkehrt, grob zu sein, wie intim zu werden. Unsere Welt ist, seit die Eisenbahn existiert, so klein geworden. Man kann nie wissen, wo man sich wiedersieht. Der, mit dem ich intim würde, kann der Gehilfe meines Barbiers sein, und der, welchem ich grob begegnete, kann mein Chef werden.«
Irene glaubte richtig zu handeln, wenn sie knapp und gleichgültig antwortete und sich abwandte.
Dem Konsul Kugler machte ihr Benehmen auch Eindruck. »Eine verwöhnte Person mit guten Manieren,« dachte er.
Als der Zug in Frankfurt an der Oder hielt und der Schaffner fünf Minuten Aufenthalt ausrief, wandte Konsul Kugler sich an Irene und sagte:
»Gnädige Frau werden mich nicht für unbescheiden halten – aber, darf ich meine Dienste anbieten – den Kellner rufen? Kaffee beordern?«
Die zurückhaltende Art und die vollendete Höflichkeit des Mannes im Ton und in der ritterlichen Haltung berührten Irene sehr angenehm.
»Ich danke sehr. Nein, ich nehme nichts,« sagte sie mit freundlichem Aufblick.
Die Herren stiegen aus.
»Frau? Wieso Frau? Glauben Sie, daß die Dame verheiratet ist?« fragte Gräditz, der sich gern belehren ließ und Gehörtes dann als eigene Beobachtung ausgab.
»Künstlerinnen rede ich immer mit ,Frau' an,« erklärte ihm der andere.
Als sie nun wieder einstiegen, erschien es selbstverständlich, daß Kugler mit Irenen einige Worte wechselte. Sie antwortete sehr artig. Seine Bemerkungen waren ganz allgemein und zeichneten sich nur durch die gewandte Form aus. Gräditz fühlte seine Neugier, wie seine Mitteilsamkeit doch ein wenig gedämpft dadurch und dachte nur immer:
»Der Kugler ist ein verflixter Mensch, der fängt es fein an, das muß man ihm lassen.«
Dennoch aber ermunterten die »Fortschritte« seines Freundes ihn so, daß er einmal mit der Frage herausplatzte:
»Werden Gnädigste in Berlin erwartet? Dürfen wir unsere Dienste anbieten?«
»Danke sehr,« sagte Irene sehr kühl, »ich werde nicht erwartet, aber ich brauche niemanden, denn ich reise alsbald weiter.«
Wie mühsam hielt Gräditz die Frage zurück: wohin?
Kugler war längst mit sich einig geworden, daß auf ein Bekanntwerden mit der Dame nicht zu rechnen sei. Aber, da er der Überzeugung blieb, es mit einer reisenden Künstlerin zu tun zu haben, sorgte er dafür, einen besonders günstigen Eindruck zu machen, für mögliche spätere Begegnung. Denn mit allem, was in seine Vaterstadt zu gastieren kam, sei es mit Gesang, Klavier, Geige oder Drama, suchte er protektorhafte Beziehungen.
Man kam an die ersten Stationen von Berlin. Zwischen dem Alexanderplatz und der Friedrichstraße begann Irene, ihre Pelze zusammenzulegen.
Und als der Zug hielt, verabschiedete sie sich mit einer höflichen kleinen Kopfneigung. Natürlich kam es ihr nicht in den Sinn, daß ihre Reisegefährten sie vorerst noch im Auge behielten, um zu sehen, wo sie bleibe und ob sich nicht Gelegenheit biete, dennoch Ritterdienste aufzudrängen.
Plötzlich wurde ihr Name gerufen, unmittelbar hinter ihr. Erschreckt drehte sie sich um.
Ein junger, hochaufgeschossener Mensch stand vor ihr. Sein rötliches, weiches Gesicht glänzte von einem verbindlichen Lächeln. Er stand vor ihr, den Zylinder gelüftet und hoch in der Hand haltend. Seiner ganzen Art und seinem militärisch verschnittenen Blondhaar sah man sofort den preußischen Leutnant im Urlaubszivil an. Irene kannte ihn eine Sekunde lang nicht, denn sie hatte ihn nur im Glanz des Waffenrocks gesehen.
»Fritz!« rief sie überrascht. »O, wie angenehm. Woher wußten Sie, daß ich komme? Ich glaubte Sie nicht mehr in Berlin.«
»Ich bekam heute früh ein Telegramm von Albertine und Meltzow, daß Sie passieren würden und daß ich mich zur Verfügung stellen solle,« meldete Fritz.
Albertinens junger und einziger Bruder hatte Irenen bei den Hochzeitsfeierlichkeiten keinen anderen Eindruck gemacht, als etwa den eines grenzenlos unbedeutenden, aber herzensguten Jungen. Albertine schien zu wünschen, daß ihr Bruder bei den Meltzows auch seine Heimat und Familie finde, denn die Geschwister waren elternlos. So war Irene denn dem jungen Manne gütig begegnet und hatte sich gewöhnt, ihn beim Vornamen zu nennen.
Fritz fühlte sich sehr wichtig und sehr beglückt durch seine Mission. Er war so beflissen und sorglich, daß es fast lästig wurde.
Er ließ Irenens Handgepäck deponieren und erschöpfte sich in Vorschlägen, Irene die drei Stunden hindurch zu unterhalten.
Sie erklärte, daß sie vor allen Dingen essen müsse, wenn möglich warm und möglichst gut.
Fritz war zum erstenmal als Leutnant in Berlin auf Urlaub gewesen und kannte natürlich nur die elegantesten Restaurationen. Er schlug vor, zu Dressel zu fahren. Irene erinnerte sich dieses Namens, dort war sie einmal mit ihrem Vater und Johanne Ebermann gewesen. Es war ihr also angenehm.
Als sie mit Fritz in eine Droschke stieg, sahen ihre beiden Reisegenossen ihr nach. Diese gingen nämlich gerade zu Fuß nach dem Kontinentalhotel hinüber.