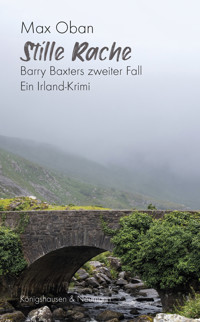
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Königshausen & Neumann
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Barry Baxter, Sergeant im verschlafenen Dorf Doughmore an der irischen Atlantikküste, hat viel zu tun. Eine mysteriöse Diebstahlserie im County Clare beunruhigt die Menschen, in der örtlichen Schule werden bei einem nächtlichen Einbruch Computer gestohlen. Auch Barrys Partnerin Myrna hat Angst vor einem Überfall auf ihre Postfiliale und lässt vorsorglich eine Alarmanlage einbauen. Der Albtraum beginnt, als Daniel Roche, Lehrer an der örtlichen Grundschule, spurlos verschwindet. Doch es kommt noch schlimmer: Ein zweiter Lehrer liegt tot im verlassenen Seaview Hotel in Doughmore – brutal ermordet. Hängen die Fälle miteinander zusammen? Hat es jemand auf die Schule im Dorf und deren Lehrer abgesehen? Das Leben in Doughmore gerät in Aufruhr. Bei seinen Nachforschungen stößt Barry Baxter auf den gewaltbereiten Schafzüchter Jacob Doyle und einen mysteriösen Insassen des Dubliner Staatsgefängnisses. Barry steht vor einem Rätsel. Dann kommt er einem dunklen Geheimnis auf die Spur, er durchschaut die mörderischen Zusammenhänge – und bringt sich damit selbst in höchste Lebensgefahr…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Oban studierte in Wien und Karlsruhe. Er schlug eine Karriere als Manager ein, arbeitete für einen internationalen Konzern in Deutschland, den USA und Teheran, bevor er sich seiner Tätigkeit als Schriftsteller widmete. Max Oban ist erfolgreicher Autor zahlreicher Romane, unter anderem den Südtirol-Krimis um Detektiv Tiberio Tanner sowie der Paul-Peck-Krimireihe, von der demnächst der zehnte Band erscheint.
Neben Österreich ist seit Jahren Irland zu seiner zweiten Heimat geworden, in der er die Hälfte des Jahres lebt. Max Obans Liebe gehört den Berg- und Küstenregionen Irlands, dem besten Schauplatz für spannende, humorvolle Krimis um den sympathischen Polizisten Sergeant Baxter aus der Grafschaft Clare.
Max Oban
Stille Rache
Barry Baxters zweiter Fall
Ein Irland-Krimi
Königshausen & Neumann
Inhalt
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erste Auflage 2025
© Verlag Königshausen & Neumann Würzburg 2025
Leistenstraße 7, D-97082 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelne Teile.
Kein Teil darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Markus Heinlein Umschlagabbildung: Shannonfieldsphoto: Steinbrücke an einem nebligen Tag in der irischen Landschaft © envato.com
ISBN 978-3-8260-9238-1
eISBN 978-3-8260-9239-8
www.koenigshausen-neumann.de
www.ebook.de
www.buchhandel.de
www.buchkatalog.de
Dieser Roman beruht nicht auf Tatsachen. Namen, Personen, Orte und Handlungen sind frei erfunden. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten, Orten oder Personen, seien sie lebend oder tot, sind rein zufällig.
Zum besseren Verständnis und um Missdeutungen auszuschließen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass der Autor die Meinungen und Sichtweisen seines Protagonisten Barry Baxter in wesentlichen Punkten teilt.
Prolog
Es war kalt innerhalb der Steinmauern des Gefängnisses. Er lag auf einer der beiden Holzpritschen und starrte durch das kleine vergitterte Fenster auf den grau verhangenen Himmel. Es sah nach Regen aus. Egal. Hier herinnen war alles egal. Der Betonboden war rissig und fleckig. Und unbequem hart. Egal. Er erinnerte sich an den beigen Teppichboden in seiner Wohnung. Warm und weich. Er hatte die Wohnung seit zehn Monaten nicht mehr betreten.
Seufzend legte er sich wieder auf die harte Pritsche und starrte an die Decke. »Warum nennen dich die Leute Dullahan?«, fragte er.
»Das geht auf ein altes Märchen zurück«, antwortete der Andere. »Die Geschichte von Dullahan, dem kopflosen Reiter. Sie kommt irgendwo aus Donegal.« Er lachte. »Meine Mutter hat mich schon so genannt. Und mein Vater meinte immer, dass ich ganz sicher keinen Schädel habe, weil ich so unüberlegt und kopflos durch die Welt stolpere.«
»Dullahan. Das Märchen kenne ich nicht. »Ich glaube aber, du bist eher ein irischer Dickschädel. Und kein Kopfloser.«
Der Andere lachte. »Du wirst mir fehlen.«
»Drei Tage noch. Dann weiß ich wieder, wie sich Freiheit anfühlt.«
»Was wirst du als erstes machen, wenn du aus der Anstalt heraus bist? Hast du darüber nachgedacht?«
»Ich denke an nichts Anderes.«
»Und? Hast du Rachegelüste?«
»Ich denke an nichts Anderes.«
»Was wirst du tun?«
»Was meinst du?«
»Was du mit ihm anstellen wirst.«
»Ihm eins über die Rübe geben. Solange bis er sich nicht mehr rührt.«
»Weißt du, wo er sich aufhält?«
»Er hat sich verkrochen.«
»Ist er noch in Shannon?«
»Wahrscheinlich hat er sich vor Angst in die Hose geschissen und ist abgehauen. Versteckt sich irgendwo.« Er lachte. »Aber ich weiß, wen ich fragen muss. Und ich werde ihn finden.«
»Und dann?«
»Dann? Gnade ihm Gott.«
Eins
Den Tag begann Barry stets mit einem Rundgang durch den Ort. Sich den Leuten zeigen und freundlich grüßen. Subjektive Sicherheit vermitteln. So nannte er das. Von den meisten, die ihm begegneten, wusste er die Vornamen, von den Alten wie den Jungen, den Frauen wie den Männern, den Menschen, die schon immer im Dorf wohnten oder jenen, die hierhergezogen waren, weil sie bei einem der örtlichen Firmen Arbeit gefunden hatten. Barry fühlte sich wohl in Doughmore. Die Menschen verließen sich auf ihn. Im Ort waren ihm die Straßen und Gassen genauso vertraut, wie die umliegenden Dörfer, Weiler und Farmen im westlichen County Clare, für das er als Sergeant bei der Garda Síochána nun schon fast acht Jahre zuständig war.
Langsam durch Doughmore schlendern. Subjektive Sicherheit vermitteln. Der Begriff gefiel ihm. Danach führte ihn der gewohnte Weg in sein Büro, wo die Morgenpost und die in der Zwischenzeit eingetroffenen dienstlichen Mails auf ihn warteten. Wahrscheinlich einige uninteressante Berichte aus der Zentrale. Das entsprach seiner Morgenroutine, die sich im Laufe der Zeit ergeben hatte. Barry liebte die Routine, die ständig wiederkehrenden Dinge des Alltags, die ritualisierten Abläufe, weniger einer Strategie folgend, sondern eher einem inneren Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität.
Sein Büro bestand aus zwei kleinen Zimmern, dem Dienstraum mit einem wackeligen Schreibtisch, auf dem neben dem antiken Computer meist eine dampfende Teetasse stand. Der noch kleinere Raum dahinter beherbergte eine durchgesessene Couch und einen Tresor, in dem er einige polizeiliche Akten und seine Pistole aufbewahrte. Barry Baxter war froh, dass irische Polizisten im Dienst keine Waffe trugen. Außer die Situation erfordert es. So lauteten die Vorschriften.
Durch die beiden Fenster drangen die fernen Geräusche des Dorfalltags und mischten sich mit dem Gekreische der Möwen. Er warf einen Blick auf den Wandkalender. Der Spruch des Tages lautete: Drei Arten von Männern versagen im Verstehen der Frauen: junge Männer, Männer mittleren Alters und alte Männer.
Er dachte noch über den Sinn des Spruchs nach als das Telefon klingelte. Eine aufgeregte Frauenstimme. »Bei mir wurde eingebrochen.«
»Was heißt ›bei mir‹ und von wo rufen Sie an?«
»Aus Doonbeg. Hören Sie … mir geht es schlecht.« Ihre Stimme zitterte. »Ich bin verletzt und habe mich gerade notdürftig versorgt.«
»Um Gottes willen! Haben Sie einen Arzt gerufen?«
»Die Rettung ist bereits unterwegs. Es war schrecklich …« Die Stimme der Frau versagte und Barry hörte, dass sie den Tränen nahe war.
»Sagen Sie mir Ihren Namen und wo ich Sie finde.«
»Ich bin Enya Hughes und leite die Postfiliale in Doonbeg. Dort war auch der Einbruch.«
Durch das Telefon hörte man die Sirene des Rettungswagens. »Ich bin schon unterwegs«, rief Barry und rannte aus dem Haus. Bei seinem Wagen angekommen, tastete er seine Taschen ab, rief »Mist«, als er merkte, dass er sein Handy am Schreibtisch liegengelassen hatte und rannte ins Büro zurück. Wieder beim Auto angekommen, ließ er sich auf den Fahrersitz fallen, startete den Motor und gab Gas.
Barry verließ Doughmore auf der N 67. Als er die Sunnyside Heights passierte, rief er Myrna an.
Zwei
Im Radio liefen alte Schlager. Dusty Springfield sang das nachdenkliche Lied vom Sohn des Predigers. Myrna mochte den Song, der fast sechzig Jahre alt war.
The only one who could ever reach me was the son of a preacher man.
Sie bekam nicht die ganze Textzeile mit, weil Roddy im Hintergrund des Ladens Kisten sortierte und dabei einen Heidenlärm verursachte.
Der Septembermorgen fühlte sich an wie Winter. Draußen blies ein kalter Wind vom Meer her und ließ die Fensterscheiben klirren. Myrna mochte den Herbst nicht. Wegen der Kälte und wegen der Dunkelheit, die sich ihr aufs Gemüt schlug. Am Morgen, wenn sie aus dem Bett kroch, gemeinsam mit Barry frühstückte und sich für die Arbeit zurechtmachte, war es noch finster. Dann kamen ein paar Stunden, in denen manchmal die Sonne schien, doch die konnte man an den Fingern einer Hand abzählen. Anschließend begann wieder der Abend, der sich traurig und dunkel dahinzog. Jetzt schon war der Tag dämmrig und die dicke Wolkendecke versprach für die nächsten Stunden keine Besserung.
The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man.
»Was hörst du für uncoole Musik«, rief Roddy von der anderen Seite herüber.
»Für diese Sorte Schlager bist du zu jung. Außerdem ist das ein Lied mit Hirn«, sagte Myrna.
Die Tür sprang auf und ein Mann stürmte herein, den sie vom Sehen her kannte. Sie griff zum Radio und drehte Dusty Springfield leiser.
»Ich habe die falsche Tür erwischt.« Der Mann lachte verlegen. »Ich wollte nicht in die Post, sondern Zigaretten kaufen.«
Myrna zeigte auf die andere Seite des Raumes hinüber und rief: »Roddy! Zigaretten!«
Wieder lachte der Mann und drehte sich hastig in die gezeigte Richtung, wie ein Kind, das sich verlaufen hatte.
Myrnas Postfiliale am Ende der Gratten Street bestand aus einem großen Zimmer, das durch eine Theke in zwei Bereiche getrennt wurde, eigentlich nur ein schmales Holzbrett mit einer nach oben zu öffnenden Klappe. Im hinteren Teil des für den Postdienst vorgesehenen Raumes befand sich ihr Schreibtisch, auf dem die üblichen Geräte standen, PC, Bildschirm, ein schwarzes Telefon und ein Faxgerät, das auch als Drucker verwendet werden konnte. Der größere Teil auf der anderen Seite beherbergte den Krämerladen, den sie vorwiegend Roddy Waters, ihrem neunzehnjährigen Gehilfen, überließ. Roddy war zwar nicht der Schnellste, weder beim Denken, noch bei der Bedienung der altertümlichen Registrierkasse, doch die Kunden waren zufrieden. Meist jedenfalls.
Der Gesang und die Musik hatten aufgehört und waren von einer Nachrichtensendung abgelöst worden.
»Darf ich hereinkommen?« Die Tür war aufgegangen und Roxanne Dunne stand auf der Schwelle.
»Meine liebe Tante Roxanne«, flötete Myrna. »Du störst doch nie. Außerdem ist es im Moment sehr ruhig, was Kunden betrifft.«
Tante Roxanne legte den Schal ab, der zwei Mal um ihren Hals geschlungen war. »Dieses verdammte irische Seeklima bekommt mir überhaupt nicht.«
»Ich fühle mich heut schon den ganzen Tag schlapp«, antwortete Myrna. »Was gibt es Neues in unserem Ort?«
»Also …«, sagte die Tante gedehnt und ließ sich auf einen der Sessel neben dem Postschalter fallen. »Faye Grady hat sich gestern den Fuß gebrochen. Sie hält eben nichts mehr aus in ihrem Alter.«
Myrna kicherte. »Wie recht du hast. Faye hat sich vor zwei oder drei Tagen bei mir im Laden eine Wärmflasche gekauft. In Luxusausführung. Mit flauschigem Stoff überzogen. Für ihre zarte Haut, hat sie gesagt.«
Myrnas Telefon läutete. »Aha«, sagte sie nach einem Blick auf das Display und nahm den Anruf entgegen.
Neugierig beobachtete Roxanne, wie Myrna das Handy ans Ohr presste, bis nach wenigen Augenblicken das Gespräch beendet war. »Das war nur Barry.« Myrna machte plötzlich einen betroffenen Eindruck als sie ihr Handy zur Seite legte.
»Was ist los? Schlechte Nachricht?«
»Er ist unterwegs nach Doonbeg. Einbruch in die dortige Postfiliale. Er sagt, es kann spät werden. Wegen des Abendessens. Und wegen des Überfalls.«
Roxanne schüttelte den Kopf. »Einbruch! Schon wieder.«
»Diesmal ist eine Post ausgeraubt worden. Die Einschläge kommen immer dichter.« Sie hielt sich die Hand vor den Mund. »Irgendwann bin ich dran.«
»Du bist blass im Gesicht«, sagte Roxanne.
»Ich kenne Enya gut. Das ist die Kollegin in Doonbeg. Eine tüchtige Frau. Und jetzt ist bei ihr eingebrochen worden. Furchtbar!«
»Irgendjemand hat die beiden Söhne eines unserer Gemeinderäte verdächtigt.«
»Welcher Gemeinderat? Ich kenne fast alle. Zumindest dem Namen nach.«
»Jacob Doyle. Im Hauptberuf gehört ihm eine Schaffarm. Weit draußen auf der Loop Head Halbinsel. Aidan und Finn heißen die Burschen. Der eine soll nichtsnutziger sein als der andere. Ist aber nur ein Gerücht.«
Myrna lächelte. »Das ist eines der wenigen Gerüchte, die ich nicht kenne.«
»Du bist wirklich blass«, wiederholte Tante Roxanne. Man sah ihr an, dass sie über etwas nachdachte. »Sag mal … ich hätte Lust auf einen kleinen Whiskey. Was meinst du dazu? Das stärkt und lenkt dich ab.«
Myrna deutete zum Fenster. »Murphy’s Pub hat gerade aufgemacht. Aber gibt’s da um diese Zeit schon Alkoholisches?«
»Für uns immer.« Roxanne wandte sich zum Gehen und winkte Myrna zu. »Komm endlich. Du fühlst dich schlapp, hast du gesagt. Ein kleiner Whiskey wird dich entschlaffen und aufmuntern.«
Murphy’s Pub lag genauso praktisch wie zeitsparend in einer Nebenstraße und nur einen Steinwurf von Myrnas Post-Laden entfernt. Sie überquerten den kleinen Platz vor dem Seaview Hotel als ihnen ein Mann entgegenkam, der einen beigefarbenen Mantel mit auffälligen metallenen Knöpfen trug und eine dickbauchige Aktentasche vor und zurück schwenkte. Beim Vorbeigehen fiel Myrna auf, dass ihre Tante den Mann anstarrte. Sie blieb sogar stehen, drehte sich kurz um und sah dem Mann nach, bis er in der Ballalley Lane verschwand.
Als erste tauchte Myrna in die Dämmerung des Pubs ein, das fast leer war. Nur an einem der Tische im Hintergrund saßen ein Mann und eine Frau, beide konzentriert mit ihren Smartphones beschäftigt.
Myrna liebte das Lokal. Altes Holz, die Bänke mit grünem Leder bezogen, Spiegel hinter der Theke und durch hohe Trennwände abgeteilte Nischen, die von Messinglampen notdürftig erhellt wurden. Auf allen Plätzen lag als Tischtuch-Ersatz ein breiter Streifen Papier und neben dem Schild mit der Aufschrift PLEASE WAIT TO BE SEATED steckten unzählige Säckchen Ketchup und Mayonnaise in blauen Kunststoffhaltern. Sie setzten sich an einen der Tische am Fenster, durch das man einen verwaschenen Blick auf die Straße hatte.
»Kannst du dich noch erinnern, als Frauen nur in männlicher Begleitung ein Pub betreten durften?«
Myrna schüttelte den Kopf. »Das war vor meiner Zeit.«
»Du hast eine charmante Art, auf mein Alter anzuspielen. Frauen mussten damals am Tisch sitzen bleiben und geduldig warten, bis ihnen ihr Begleiter ein Getränk brachte. Gar nicht so lange her.«
»Wer war der Mann da draußen? Dem du so entgeistert hinterher geschaut hast.«
»Ich kenne ihn vom Sehen her. Das heißt, kennen ist fast übertrieben. Einer meiner früheren Kollegen an der Schule hat mir den Mann mal vorgestellt. Daniel heißt er … ich weiß nur seinen Vornamen. Er ist seit einiger Zeit Lehrer im Ort. Ich selber habe ihn aber als Kollege nicht mehr erlebt.«
»Seit wann bist du in Pension?«
Roxanne richtete stolz ihren Oberkörper auf. »Fast dreißig Jahre habe ich in Doughmore Mathematik unterrichtet. Und seit Jahreswende bin ich im Ruhestand. Aber ich habe noch gute Kontakte zu meinen früheren Lehrer-Kollegen. Deshalb kenne ich auch die Gerüchte über diesen Daniel, der uns draußen über den Weg gelaufen ist.«
Der junge Robin, der um diese Zeit hinter der Theke nicht ausgelastet war, brachte ihnen die Getränke.
»Ich liebe Gerüchte«, sagte Myrna und nahm einen kleinen Schluck von ihrem Whiskey.
»Roche … jetzt ist mir sein Name eingefallen. Daniel Roche. Er soll eines der Mädchen aus der letzten Klasse der Primary begrapscht haben. Angeblich ist es Julia Mahoney …«
»Die Tochter von dem Verkäufer im Supervalu?«
Roxanne nickte. »Lucas, genau. Seine Tochter ist fast dreizehn und hat schon eine gut entwickelte Figur.« Sie machte mit beiden Händen eine entsprechende Geste. »Aber wie gesagt … es ist nur ein Gerücht. Vielleicht hat sich das Mädchen das auch nur eingebildet. Dieser Daniel soll jedenfalls ein Womanizer sein. Und das ist mehr als ein Gerücht. Mit Sarah, einer Kollegin an der Schule, soll er ein Verhältnis haben und außerdem geht er mit unserer Friseurin ins Bett. Erzählt man.«
»Mit wem? Meinst du Isla O’Brien?«
»Genau die.«
»Apropos Gerüchte«, sagte Myrna. »Ich habe gehört, du hast ein Theaterstück geschrieben, und es soll demnächst bei uns in Doughmore aufgeführt werden. Bist du eigentlich noch Vorsitzende von eurem Literaturclub?«
»Was denkst du denn, liebe Nichte? Wer außer mir sollte es sonst sein? Schließlich bin ich mit meinem Roman und dem Theaterstück die einzige wahre Schriftstellerin in Doughmore.«
»Wie viele sind sonst noch dabei? Im Literaturclub meine ich.«
»Es werden immer mehr. Phoebe Callaghan ist vor einer Woche eingetreten. Und Isla, über die wir gerade gesprochen haben, ist schon ewig Mitglied, außerdem ein paar Frauen aus dem Umfeld der Kirche und manchmal kommt auch Elsie Reid.«
»Die Frau vom Bäcker?«
Die Tante nickte. »Genau die. Wir mögen sie aber nicht so sehr, weil sie immer so klug daherredet und dabei furchtbar dumm ist.«
»Phoebe Callaghan sagt immer, Elsie hat ein obskures intellektuelles Strickmuster.« Roxanne lachte laut auf. »Die Bemerkung würde sie aber nicht mögen.«
»Wie weit seid ihr mit den Vorbereitungen für die Aufführung?«
»Furchtbar viel Arbeit. Du musst dir vorstellen, wir machen alles selbst. Wir bauen die Kulissen, malen alle Dekorationen und schneidern die Kostüme.«
»Eine Theateraufführung bei uns im Dorf. So hat es noch nie gegeben. Ich bin richtig stolz.«
»Denkt dein Barry auch so? Hat der überhaupt meinen Roman schon gelesen?«
»Barry liest den Daily Star.«
»Sonst nichts?«
»Doch. Am Wochenende die Sunday Times.«
»Jedenfalls habe ich mich gefreut, dass das Abstimmungsergebnis im Club einmütig war, mein Stück auf die Bühne zu bringen. Nur Cloe hat dagegen gestimmt.«
»Cloe?«
»Cloe Brady. Sie ist die Vorsitzende unserer Kirchengemeinde und hält mein Stück für gotteslästerlich. Sie sagt, dass unsere Kirche der einzig gültige Maßstab ist, nicht nur für Religion, sondern auch für Kunst und Literatur. Alles neumodische Zeug … da meint sie mein Theaterstück … brauchen wir angeblich nicht. Neumodisches Zeug sagt sie. Verstehst du die Gemeinheit? Dabei habe ich ein halbes Jahr an dem Bühnenstück gearbeitet.«
»Du kannst Cloe nicht leiden. Stimmt’s?«
»Na ja, sie mag ja manchmal ganz nett sein, aber mein Herz würde ich bei ihr nicht ausschütten.«
»Wo findet die Aufführung statt? Im Kino vielleicht? Ich meine, wir haben kein Theater in Doughmore.«
Roxanne machte eine energische Handbewegung. »Alles geklärt. Alfie hat in seinem Lager ein altes Zelt gefunden, das er uns kostenlos zur Verfügung stellt. Da passen an die hundert Leute rein. Wenn sie eng sitzen. Das reicht. Wir haben ohnehin vor, das Stück öfter aufzuführen. Du siehst, da gibt es noch enorm viel zu tun.«
»Kann ich vielleicht bei den Vorbereitungen helfen?«
Roxanne beugte sich vor und legte ihre Hand auf Myrnas Arm. »Jetzt sind wir bei dem Thema, weswegen ich zu dir gekommen bin. Hör zu! Aline Hanlon, die Frau von unserem Malermeister in Doughmore sollte in dem Stück eine wichtige Rolle übernehmen. Eine tragende Rolle, verstehst du?«
»Tragende Rolle verstehe ich«, sagte Myrna lächelnd. »Eine solche spiele ich in Barrys Leben.«
»Lenk nicht ab! Also … Aline Hanlon war die Idealbesetzung für diese Figur, keine Titelrolle, aber eben wichtig. Und weißt du, was gestern am Abend passiert ist? Aline hat sich den Fuß gebrochen.« Roxanne griff nach ihrem Glas und trank den letzten Schluck. »Sie hat, während sie ihre Rolle lernte, zu viel Whiskey getrunken und ist dann die Stiege hinuntergefallen. Sprunggelenksfraktur sagen die Ärzte. Verstehst du?«
»Nicht ganz. Bist du deshalb zu mir gekommen?«
Roxannes Gesicht war anzusehen, dass sie etwas Wichtiges sagen wollte. »Mit einem Gipsfuß kann Aline nicht auf die Bühne kommen, also haben wir im Theaterclub eine Telefonkonferenz einberufen, und sind zu der Meinung gekommen, dass du die Rolle übernimmst.«
»Ich?« Myrna deutete mit dem Daumen auf ihre Brust.
»Genau! Du! Wir alle kennen dich, wir trauen dir das nicht nur zu, sondern halten dich für die Idealbesetzung.«
Myrna schüttelte den Kopf. »Ich dachte, Aline Hanlon war die Idealbesetzung.«
»Du bist die Idealbesetzung ohne Gipsbein.«
»Ich hab dich noch gar nicht gefragt: Wie heißt eigentlich dein Stück?«
»Der Titel lautet: Godot kommt doch noch.«
Es entstand eine kurze Pause. Roxanne lächelte überlegen und Myrna wiederholte in Gedanken den Titel des Stückes. »Samuel Beckett … hat der das nicht schon längst geschrieben?«
Roxanne hob ihr leeres Whiskeyglas, dann zwei Finger in die Höhe und wartete, bis der junge Robin nickte. »Meine liebe Nichte, in Becketts Drama warten zwei Männer auf einen dritten, der den Namen Godot trägt, aber niemals kommt. Mein Theaterstück unterscheidet sich von Beckets Machwerk in zwei wesentlichen Punkten. Erstens ist sein Theaterstück eine reine Männerveranstaltung, während bei mir auch Frauen auf die Bühne dürfen.«
»Und zweitens?«
»Und zweitens warten bei Becket alle umsonst auf Godot. Bei mir erscheint er doch noch. Spät zwar, aber er kommt.«
»Aber er kommt«, wiederholte Myrna in Gedanken versunken. »Und wann kommt er? Ich meine, wann ist die Aufführung? Da müsste ich ja noch den ganzen Text auswendig lernen.«
»Die Premiere ist am Sonntag«, sagte Roxanne. »Du hast noch fast sechs Tage Zeit.«
Als Barry nach Hause kam, war es bereits dunkel. Er betrat die Küche, in der Myrna am Herd beschäftigt war. »Was gibt es zum Essen?«
»Zuerst erwarte ich einen Guten-Abend-Kuss, dann beantworte ich deine Frage.«
Barry murmelte etwas von Erpressung und gab Myrna einen Kuss auf die Wange.
»Du riechst angenehm«, sagte Barry.
»Ich nehme aber nie Parfum.«
»Du riechst nach Whiskey.«
»Ich musste mich um Tante Roxanne kümmern.«
»Ich wette, das Kümmern hat in Murphy’s Pub stattgefunden.«
»Es gab viel zu besprechen. Sie richtete den Oberkörper auf und sah ihn lächelnd an. »Du wirst deine Myrna demnächst auf der Bühne bewundern. Ich werde Schauspielerin.«
Ausführlich erzählte sie von ihrem Gespräch mit Roxanne, ihrem Theaterstück und dass Aline mit einem Gipsfuß die Rolle nicht spielen könne. »Ich habe meinen Text schon fünf Mal durchgelesen. Bis zum Sonntag muss ich ihn auswendig runtersagen können. Was sagst du dazu?«
»Was gibt’s zum Essen?«
Myrna seufzte enttäuscht und rollte die Augen. »Kunstbanause! Es gibt Coddle. Heute frisch zubereitet. Die Zutaten sind von gestern.«
»Ich bin süchtig nach Eintopf.«
»Wie war’s in Doonbeg? Wie geht es Enya? Du weißt, dass wir uns kennen?«
»Das wundert mich nicht«, sagte Barry und nahm auf der Eckbank Platz. »Manchmal denke ich, dass du alle Leute im County kennst. Deiner Post-Kollegin Enya geht es offenbar nicht so gut. Sie ist im Krankenhaus.«
Myrna wirbelte herum. Sie hielt den Kochlöffel wie eine Waffe in der Hand. »Erzähl endlich, was passiert ist. Ist sie schwer verletzt?«
»Man hat Enyas Poststelle in Doonbeg überfallen.«
»Das weiß ich.«
»Es muss in der Nacht gewesen sein. Die Post ist im Erdgeschoss und die Wohnung der Frau liegt genau darüber im ersten Stock. Sie hat wohl verdächtige Geräusche gehört und ist runtergegangen. Dort hat sie der Einbrecher zusammengeschlagen. Viel mehr wissen wir noch nicht.«
»Hast du nicht geredet mit ihr?«
Barry schüttelte den Kopf. »Sie liegt im Bon Secours Hospital in Galway. Man hat mich aber nicht zu ihr gelassen. Schwere Kopfverletzung und künstliches Koma, sagte der Arzt. Aber sie wird durchkommen. Wenn die Nacht gut verläuft, kann ich morgen mit ihr reden.« Barry strich sich über die Stirn. »Ich saß fünf Stunden im Auto und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Außerdem bin ich müde.«
Myrna strich ihm zärtlich über die Wange. »Im Kühlschrank ist noch eine halbe Flasche Tullamore Dew.«
»Das ist die Rettung«, sagte er. Ich brauche Stärkung.«
Sie lächelte. »Die brauchst du tatsächlich. Meine Schwester kommt uns nämlich besuchen.«
Barry drehte sich um. »Deine was …?«
»Cara kommt zu Besuch.«
»Und ihr … Dingsda kommt auch.«
»Der Dingsda ist mein Schwager und heißt Edward. Und ja, der kommt auch. Die beiden machen eine Urlaubsreise, die sie von Sligo bis nach Frankreich führt. Edward ist Hobby-Historiker und möchte sich die Strände in der Normandie ansehen, an denen die Alliierten gelandet sind.«
»Aber die könnten doch fliegen.« Mit der Hand malte Barry einen großen Kreis in die Luft. »Verstehst du? Mit dem Flugzeug zehntausend Kilometer über uns hinweg. Das wäre ein sicherer Abstand von deinem Dingsda.«
»Lass meine Verwandten zufrieden.«
»Deine Schwester mag ich. Nur der Dingsgda …«
»Was hast du gegen meinen Schwager Edward?«
»Er ist langweilig, hat Mundgeruch, und er lacht nicht über meine Witze. Wann kommen sie?«
»Nächste Woche. Und sie bleiben nur zwei Tage.«
»Schlafen die hier im Haus?«
»Nein. Soviel Platz haben wir nicht. Die beiden übernachten im Seaview Hotel. Das habe ich mit meiner Schwester verabredet. Morgen gehe ich zu Donnacha und buche das Zimmer.«
»Donnacha?«
»Du kennst doch Kirby.«
»Natürlich kenne ich ihn. Warum nennst du ihn Donnacha?«
»Weil ich ihn gut kenne. Genauer gesagt, ich kannte auch seinen Bruder Pascal. Früher mal.«
»Pascal ist kein irischer Name. Und was heißt früher mal?«
»Pascal war und ist Donnachas Halbbruder. Oder Stiefbruder. Keine Ahnung. Jedenfalls war der Vater Franzose, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Die Mutter hat dann noch einmal geheiratet.«
»Und wo ist dein Pascal abgeblieben?«
»Das ist nicht mein Pascal. Ich habe ihn gekannt. Na und? Lange, bevor ich dir meine Gunst geschenkt habe. Pascal lebt in den USA. Er arbeitet dort. Oder Kanada. Genau weiß ich das nicht mal. Lange her.«
Drei
Er zuckte zusammen und klammerte sich am Lenkrad fest. Fast hätte ihn der Lastwagen gerammt, der ihn überholt hatte. Vollkommen rücksichtslos. Empört drückte er auf die Hupe. Unbeeindruckt bog der Laster in die Spur vor ihm ein und spritzte ihm die Scheibe voll. Langsam verlor sich die Anspannung und Aufregung, und er beobachtete, wie die roten Rücklichter des Wagens vor ihm hinter einer engen Rechtskurve verschwanden. Ganz ruhig, sagte er sich und schaltete das Radio ein. Der plötzliche Lärm einer Opernarie erschreckte ihn so sehr, dass er rasch auf den Aus-Knopf drückte. Hungergefühle meldeten sich. Beinahe unbewusst stieg er aufs Gaspedal. Die Landschaft wurde bergiger. Als er von einem mit braunem Heidekraut bewachsenen Hügel hinunter ins Tal unterwegs war, fuhr ein dunkler Peugeot langsam an ihm vorbei. Der Mann hinter dem Steuerrad hatte eine Kappe tief ins Gesicht gezogen. Plötzlich bremste der Wagen vor ihm, was ihn wütend machte. Zuerst überholen und dann bremsen. Nicht aufregen! Vielleicht suchte der Typ da vorne nach einer bestimmten Hausnummer oder einer Abzweigung. Doch dann fiel ihm auf, dass der Fahrer in dem Peugeot vor ihm nicht nach draußen sah, sondern in den Rückspiegel schaute. Für einen Moment war es ihm, als ob sich ihre Blicke trafen. Der Mann starrt mich an, durchfuhr es ihn. Was sollte er jetzt tun? Er stieg auf die Bremse und bog scharf nach rechts ab. Dann trat er aufs Gaspedal und fuhr so schnell wie es der Motor seines Wagens hergab durch ein kleines Wäldchen und vorbei an abgeernteten Feldern. Immer wieder blickte er sicherheitshalber in den Rückspiegel. War jemand hinter ihm her? Nein. Er war der Jäger. Nicht der Gejagte.
Wie so oft nach dem Aufwachen dachte Jamie Downs an seine Kindheit, obwohl ihn bereits mehr als drei Jahrzehnte von ihr trennten. Er hätte nicht sagen können, warum seine Gedanken in der Früh so oft in die Zeit zurückliefen, als er gemeinsam mit seinen Eltern in Drogheda lebte, wo er auch die Schule besuchte. Damals gab es zwei Volksschulen in der Stadt, die St. Peter’s National School für Knaben und die Mädchen gingen in die St. Brigid’s School, die am Ortsrand lag.
Er warf einen Blick auf die Uhr. Einige Minuten konnte er noch im Bett bleiben. Bequem ausgestreckt legte er sich auf den Rücken und versuchte sich zu entspannen. In eineinhalb Stunden stand er wieder in der Schulklasse und musste sich mit der Dummheit der Schüler herumschlagen, insbesondere der Migrantenkinder, deren Eltern vor zwanzig Jahren aus Polen nach Irland gekommen waren, und die in vielen Fällen heute noch kein sauberes Englisch sprachen. Was für ein Fehler der damaligen Regierung. Mit weit geöffneten Augen lag er auf seinem Bett und starrte zur Decke. Je mehr Licht ins Zimmer kam, desto deutlicher sah man, wie hässlich der Raum war. Flecken auf der Tapete und Risse im Mauerwerk. Ein Teil der Farbe war abgebröckelt. Wie gerne wäre er im Bett geblieben, statt in die Schule zu gehen. Nicht nur die lästigen Schüler nervten ihn, sondern auch die ständigen Auseinandersetzungen mit dem Schuldirektor. Principal Teacher Patrick Mc Caig. Was für ein Affe. Einen Armadáin hätte ihn sein Vater genannt. Ein weiterer Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es Zeit war, aufzustehen.
Es war noch nicht richtig hell, als Jamie Downs nach einem kärglichen Frühstück den Weg zur Schule antrat. Scoil Naisiúnta an Cláir. Der Regen hatte aufgehört und so beschloss er, sein Auto vor dem Haus stehen zu lassen und zu Fuß zu gehen. Während er die Circular Road entlang marschierte, überlegte er, wie lange er schon an der Schule in Doughmore unterrichtete. Fünf Jahre. Fast sechs.
Eine ältere Frau mit einer Einkaufstasche kam ihm entgegen. Da sie ihn beim Vorbeigehen mit interessiertem Blick musterte, blieb er kurz stehen und grüßte sie übertrieben höflich. Als Lehrer in Doughmore hat man so seine Pflichten.
Die wenigen Schaufenster in der Kilrush Road waren erleuchtet. Ein kühler Wind blies von der Bucht herauf. Das Pflaster des Gehsteigs war nass und glänzend.
Er sah zur anderen Straßenseite hinüber. Sieh mal an, dachte er. Mein Kollege aus der vierten Klasse. Daniel Roche. Sein Gang war eigenartig. Vorsichtig setzte er einen Fuß vor den anderen, machte dann ein paar zögernde Schritte, als bewege er sich auf unsicherem Boden. Alle paar Schritte blieb er stehen, drehte sich um und sah nach allen Seiten.
»Guten Tag, Herr Kollege«, sagte Jamie Downs und versuchte, dynamisch und gut gelaunt zu wirken. Er reichte ihm die Hand, Daniel Roche nickte, sagte aber nichts. Sein Händedruck war schwach, seine Finger kalt und kraftlos.
»Du wirkst etwas nervös heute«, sagte Jamie Downs. »Hast du Angst vor unseren irischen Gespenstern?«
Nebeneinander gingen sie die Straße hinunter und Jamie Downs fiel auf, dass sie in einen exakten Gleichschritt verfallen waren. Am Spielplatz bogen sie in einen schmalen Seitenweg ab. Die Häuser machten einen verwahrlosten Eindruck. Bei einigen der Fassaden war der Putz rissig war und die Farbe blätterte großflächig ab.
»Ich wundere mich«, sagte Jamie Downs. »Du wohnst doch da oben in der Nähe der Schule. Was machst du hier? Und noch dazu in der Früh? Hast du eine geheime Gespielin im Dorf?«
»Gespielin«, wiederholte er und lachte laut. »Ich habe meinen Wagen zur Reparatur gebracht. Kupplungsschaden. Kann teuer werden, hat der Mann in der Werkstätte gemeint.«
Wieder gingen sie wortlos ein paar Schritte.
»Hör mal …«, sagte Jamie Downs. Er wusste genau, was er sagen wollte, war aber unsicher, wie er das Gespräch beginnen sollte. Auf alle Fälle wollte er vermeiden, seinen Kollegen zu kränken. »Ich muss mit dir reden. Das Ehepaar Mahoney war bei mir. Wegen ihrer Tochter Julia.«
»Ach, die Geschichte wieder!«, unterbrach ihn Daniel Roche. »Um es gleich zu sagen: Ich habe nichts Unrechtes getan!«
»Ich glaube dir. Und ich vertraue dir als Kollegen auch.« Jamie Downs blieb stehen und suchte den Augenkontakt zu seinem Gegenüber. »Das Mädchen ist um ein Jahr älter als die anderen in der Klasse. Und somit auch ein Jahr raffinierter. Ihren Eltern gegenüber behauptet sie, du hättest sie angefasst. Ungebührlich gestreichelt, nannte es die Mutter.«
»Das Mädchen lügt.« Daniel Roche rief es laut. Ein Ruck ging durch seinen Körper. Nervös sah er sich um, ob ihn jemand beobachtete. Dann ging er rasch weiter.
»Nochmal, ich vertraue dir.« Jamie ging ein paar schnelle Schritte, um ihn einzuholen. »Ich bitte dich nur, vorsichtig zu sein. Ich kenne Lucas Mahoney. Er ist gewalttätig. Wahrscheinlich wird er dich demnächst aufsuchen. Oder er rennt gleich zu Patrick. Mahoney ist Vice Captain beim Golfclub Doughmore und trifft dort oft mir unserem Principal zusammen. Du bist noch nicht so lange bei uns und weißt nicht, wie engstirnig manche Eltern sein können, wenn sie ihre Kinder in Gefahr sehen. Auch wenn nichts dahinter ist.«
Daniel Roche nickte ihm zu und sah auf die Uhr. »Es ist schon spät. Danke dir für die Warnung. Ich habe ein reines Gewissen.«
»Alles okay mit dir?«
»Alles okay mit mir«, sagte Daniel Roche. Dabei blickte er wieder nervös nach links und nach rechts.
Sie setzten ihren Weg etwas schnelleren Schrittes fort, als Daniel Roche plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Wie vom Blitz getroffen starrte er auf einen Mann, der in einiger Entfernung auf der anderen Straßenseite stand und zu ihnen herübersah. Daniel stieß einen leisen Schrei aus, blickte panisch nach links und rechts, dann rannte er los und versteckte sich hinter einem Gestrüpp.
»Wer ist das?«, rief Jamie Downs seinem Kollegen hinterher, dann blickte er zu dem Mann auf der gegenüberliegenden Seite, der immer noch dort stand und herübersah. Er war hochgewachsen und sah kräftig aus. Sein Gesicht konnte Jamie nicht erkennen, dafür war der Mann zu weit entfernt, der in diesem Moment herumwirbelte und in einer Nebenstraße verschwand.
»Wer immer das war«, sagte Jamie. »Er ist weg. Du kannst wieder herkommen.«
Langsam, nach allen Seiten schauend, kam Daniel Roche aus seinem Versteck heraus.
»Wer war das?«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte Daniel Roche gedehnt. Jamie musterte sein Gegenüber genau. Er glaubte ihm nicht. »Aber warum bist du weggelaufen?«
Daniel machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich möchte nicht darüber reden. Gehen wir. Es ist schon spät.«
Einige Minuten später erreichten sie die Schule. »Ich muss in der Klasse noch etwas vorbereiten«, sagte Daniel Roche. »Schönen Tag noch.« Er tippte zum Abschied mit dem Zeigefinger an die Schläfe. Wie ein militärischer Gruß.
In der Aula standen trotz der frühen Stunde bereits einige Schülergruppen lachend und laut redend beieinander oder wischten über ihre Handys.
Jamie Downs hielt sich rechts und betrat den Flur, der zu den Lehrerzimmern führte. Als erstes kam ihm, wie immer mit verführerisch schwingenden Hüften, die Turnlehrerin Emma entgegen. »Halt«, sagte sie lächelnd und hob wie ein Verkehrspolizist die Hand. »Der Chef will dich sprechen.«
»Chef am Morgen bringt immer Sorgen«, sagte Jamie. »Was will er?«
»Das kannst du ihn gleich selbst fragen.« Die Turnlehrerin deutete über seine Schulter. Mit ausgestreckten Armen kam Patrick Mc Caig auf ihn zu. »Guten Morgen, ich habe dich schon gesucht. Ich muss mit dir reden.«
Jamie zwinkerte der Turnlehrerin zu und folgte Patrick in dessen Büro.
»Komm rein und nimm Platz.« Der Princpial deutete auf den Stuhl, der vor dem Schreibtisch stand.
Jamie setzte sich und sah sich in dem kleinen Raum um, in dem es leicht nach Rasierwasser roch. Neben dem Notebook lagen einige Blätter Papier, genau parallel zur Schreibtischkante, daneben ein Kugelschreiber und zwei exakt gespitzte Bleistifte. Peinliche Ordnung. Patrick war als Pedant verschrien.
»Wie gesagt, ich muss dich sprechen …« Weiter kam Patrick nicht, denn die Tür flog auf und knallte gegen die Wand. Bobby, der Hausmeister kam hereingestürzt und rief: »Einbruch! Bei uns wurde in der Nacht eingebrochen!«
Sie liefen dem Hausmeister nach, der sie in den sogenannten Medienraum führte, in dem sich neben der Bücherei auch der Schrank befand, in dem die Notebooks und Tablets aufbewahrt wurden. Der Schrank war aufgebrochen, zersplittertes Holz lag verstreut herum.
»Wie kam der Einbrecher rein?«
Der Hausmeister deutete auf die Glasscherben am Boden. »Er hat das Fenster eingeschlagen.«
»Haben wir eigentlich keine Alarmanlage hier an unserer Schule?« Die Frage kam von Patrick Mc Caig.
Jamie lachte und sagte leise, aber für alle hörbar: »Wenn du als Principal keine hast einbauen lassen, können wir auch keine.«
»Dummes Gerede!« Patrick Mc Caig wandte sich dem Hausmeister zu. »Wurde was geklaut?«
»Einige Notebooks fehlen. Mindestens sechs oder sieben. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ich habe Sarah gebeten, herzukommen. Sie hat alle Listen.«
»Wir müssen die Polizei rufen«, sagte Patrick Mc Caig. »Schon wegen der Versicherung.«
Der Hausmeister schüttelte den Kopf. »Das war das Erste was ich getan habe. Barry hebt nicht ab. Er hat sein Handy ausgeschaltet.«
»Unser Dorfpolizist hat sein Handy ausgeschaltet. Das nenne ich Sicherheit.«
»Ich bin gleich wieder zurück«, rief Myrna zu Roddy, der auf der anderen Seite des Ladens einen Kunden bediente. Sie schnappte ihre Handtasche, verließ die Poststation und überquerte mit weit ausholenden Schritten die Straße.
Barry wusste, dass die Fahrt nach Galway City bei normalen Verkehrsverhältnissen etwas weniger als zwei Stunden dauern würde. Im Radio stellte ein Quizmaster Fragen zur Geschichte des Landes. »Wenn Sie die Antwort wissen, rufen Sie uns an. Sie erhalten zwei Freikarten für ein Konzert von Gilbert O’Sullivan. Die Frage lautet: In welchem Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts entstand der Staat Irland?«
»Das ist nicht schwer«, sagte Barry laut vor sich hin. Das war im Jahre 1937.« Sollte er anrufen? Er tat es nicht. Seine Begeisterung für den Sänger O’Sullivan hielt sich in Grenzen. In der nächsten Frage wollte der Radiosprecher wissen, wen König Brian Boru im Jahre 1014 in der Schlacht von Contarf besiegte. Er zermarterte sich den Kopf. Verdammt! Das elfte Jahrhundert war immer schon Barrys Schwäche gewesen. Eine Minute später verkündete der Sprecher, dass der König in dieser Schlacht gegen die Wikinger gekämpft hatte und siegreich geblieben war.
Barry hatte schon zwei Mal einen Bekannten im Bon Secours Hospital besucht und wusste, dass sich die Klinik östlich des Stadtzentrums von Galway befand, nicht weit vom Ballyloughane Beach entfernt. Von dem riesigen Parkplatz aus strömten einige Leute Richtung Haupteingang, die meisten mit Blumen oder einer Bonbonniere in der Hand. Schlechtes Gewissen beschlich ihn. Hätte er auch etwas besorgen sollen? Nein. Das ist ein dienstlicher Besuch, zweckdienlich und ermittlungstechnisch bedingt. So etwas muss man nicht mit einem Geschenk abgelten.
Im Eingangsbereich des Krankenhauses standen zwei ungenutzte Rollstühle. Ein freundlich aussehender grauhaarige Pförtner saß hinter der Glasscheibe seiner Loge erklärte Barry den Weg zu Enya Hughes. Zimmer 322. Als Barry in die endlosen Gänge des Krankenhauses eintauchte, in denen es nach desinfizierter Sauberkeit und Äther roch, fühlte er sich wie ein Mitglied der privilegierten Minderheit der Gesunden. Fast beschlich ihn schlechtes Gewissen; er fühlte sich wohlauf. Nicht mal sein Rücken tat ihm heute weh.
Er betrat das Zimmer 322, schloss die Tür leise hinter sich und war froh, dass die Frau im Bett nicht schlief, sondern ihn interessiert betrachtete.
»Ich bin Sergeant Baxter aus Doughmore«, stellte er sich vor. »Wie geht es Ihnen?«
»Deutlich besser als gestern«, sagte die Frau und versuchte ein Lächeln. Sie trug einen riesigen Kopfverband, der einem Turban glich und ihr Gesicht merkwürdig klein und verletzlich aussehen ließ. Die weißen Haare, die unter dem Verband hervorstanden, waren verklebt und strähnig. Über einen Schlauch tropfte eine wasserklare Flüssigkeit in ihren Arm.
Immer noch leicht lächelnd sagte die Frau: »Der Arzt hat mir gratuliert. Er meint, ich habe offenbar einen dicken Schädel und dadurch nur eine leichte Gehirnerschütterung abbekommen.«
»Kopfschmerzen?«
Sie wies auf die Schläuche in ihrem Arm. »Die pumpen mich gerade mit allen möglichen Medikamenten voll.«
Barry setzte sich auf einen Sessel, der neben dem Bett stand.
»Danke, dass Sie zu mir kommen.« Enya Hughes sprach leise und mit brüchiger Stimme.
Barry nickte und überlegte, wie er seine Befragung beginnen sollte.
»Ich habe Angst«, sagte die Frau.
»Das kann ich verstehen.«
»Ich überlege gerade wie ich damit fertig werden soll, dass ich in meinem eigenen Haus überfallen worden bin.«
»Fühlen Sie sich kräftig genug, mir ein paar Fragen zu beantworten?«
»Deswegen sind Sie doch gekommen. Fragen Sie.«
»Wie ging das vor sich? Ich meine, wie war das mit dem Überfall?«
»Es war in der Nacht. Ich bin aufgewacht und habe ein Geräusch gehört. Meine Wohnung ist im ersten Stock, genau über der Post.«
»Haben Sie auf die Uhr gesehen?«
»Halb vier. Es war stockdunkel. Es war ein Poltern und ich war ganz sicher, dass es von unten kam.« Enya Hughes holte ein Taschentuch unter dem Kopfpolster hervor. »Die Erinnerung an den Überfall macht mich fertig. Hier im Krankenhaus schlafe ich viel und jedes Mal habe ich Alpträume … und die Gedanken an den Mann werden immer wieder lebendig.«
Barry berührte kurz den Arm der Frau. »Ich werde Sie nicht lange stören. Nur ein paar Fragen, damit wir den Burschen erwischen. Und wenn Sie nicht mehr darüber reden können, sagen Sie es mir, und wir hören auf. Okay?«
Sie nickte.
»Wenn Sie an den Überfall denken … woran können Sie sich erinnern?«
»An wenig. Es war dunkel. Ich ging die Stiege hinunter …«
»Haben Sie Licht gemacht?«
»Natürlich. Glauben Sie, ich gehe im Dunkeln die Stiege hinunter? Aber als ich unten ankam, wurde es dunkel. Er muss das Licht ausgeschaltet haben.«
»Es war also ein Mann. Ganz sicher?«
»Beschwören kann ich es nicht. Aber ja doch … es war ein Mann. Dunkel angezogen. Durchs Fenster kam etwas Licht herein. Von der Straßenbeleuchtung. Aber gesehen hat man kaum etwas.«
»Haben Sie mit ihm gesprochen. Wie war seine Stimme?«
Sie schüttelte den Kopf, was ihr offenbar Schmerzen bereitete, denn sie griff sich stöhnend an die Stirn. »Kein Wort. Er hat den Mund nicht aufgemacht.«
»Wie hat er gerochen?«
»Gerochen? Keine Ahnung. Was meinen Sie damit?«
»After Shave … Roch er nach Schweiß oder einem besonderen Rasierwasser?«
»Rasierwasser? Hören Sie, es war mitten in der Nacht und ich habe gezittert vor Angst …«
»Sein Gesicht … konnten Sie irgendetwas erkennen?«
»Es war dunkel. Alles war ein dunkler Schatten.«
»Volles Haar oder Glatze?«
»Glattes, volles Haar. Glaube ich.«
»Schwarz, braun oder blond?«
»Eher dunkel. Ich kann mich daran nicht erinnern. Es ging alles so schnell.«
»Wie war er angezogen?«
Sie sah ihn verzweifelt an und schüttelte den Kopf. »Was Sie alles wissen wollen … wie er gerochen hat, möchten Sie wissen. Mein Gott, er hat nicht gestunken«, sagte sie leise. »Wenn er nach Schweiß gerochen hätte … ich meine, daran könnte ich mich wahrscheinlich erinnern. Und wie war er angezogen. Dunkel. Schwarze Hose wahrscheinlich. Keine Ahnung.«
Sie machte eine Pause und legte ihre Hände auf ihr Gesicht. »Das was Sie mich hier fragen … davon bekomme ich bestimmt wieder Alpträume.«
»Tut mir leid, aber das ist notwendig.« Er zeigte mit dem ausgestreckten Arm Richtung Fenster. »Da draußen läuft ein Serieneinbrecher herum. Und ich möchte ihn zur Strecke bringen.«
»Ich bin ja durchaus hilfsbereit«, sagte die Frau. »Aber mehr weiß ich nicht. Als ich zu mir kam, war es schon hell und ich hatte Kopfschmerzen. Ich habe die Polizei angerufen.«
»Das war ich«, sagte Barry.
»Dann kam Ciara und hat sich um mich gekümmert.«
»Wer ist Ciara?«
»Von Zeit zu Zeit unterstützt sie mich in der Post. Ein paar Minuten später kam auch meine Tochter. Ciara hat sie angerufen und auch die Rettung verständigt, die mich hierhergebracht hat. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Offenbar bin ich wieder bewusstlos geworden.«
»Wie kam der Mann ins Haus?«
»Ich habe vor einer Stunde mit meiner Tochter telefoniert. Die hat es mir erzählt. Der Kerl hat ein Fenster aufgebrochen. Auf der Rückseite des Hauses. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht.«
»Wir haben Fachleute, die das noch einmal genau ansehen werden. Vielleicht hat der Einbrecher auch Spuren hinterlassen.«
Die Frau nickte langsam.
»Wissen Sie, ob etwas gestohlen wurde?«
»Die Filiale ist ziemlich verwüstet. Ich hoffe, der Sachschaden wird mir ersetzt. Der Einbrecher hat versucht, meinen kleinen Tresor gewaltsam zu öffnen, hat das aber nicht geschafft. Dafür hat er aus dem Lager einige Pakete geklaut. Ein paar hat er aufgerissen und offenbar Sachen die sich darin befanden, mitgenommen.«
»Gibt es sonst noch irgendetwas, was wichtig sein könnte?«
Nachdem die Frau eine Weile überlegt hatte, sagte sie: »Da fällt mir nichts ein.«
Barry streckte Enya Hughes die Hand hin und verabschiedete sich. »Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.«
Barry warf nochmal einen Blick auf das schmale Gesicht der Frau, winkte ihr zu und verließ das Krankenhaus.
Auf dem Weg zum Parkplatz machte er einen Blick auf sein Handy und sah, dass drei Anrufe in Abwesenheit eingegangen waren, während er im Krankenhaus sein Telefon ausgeschaltet hatte.
»Roddy Waters, wir müssen miteinander reden«, sagte Myrna.
»Und schon stehe ich bereit.« Der junge Mann sprintete los und sprang mit einem Satz über die Absperrung, die den Laden von der Post trennte. »Was gibt’s?«
»Es gibt Handlungsbedarf. Gestern ist die Postfiliale Doonbeg überfallen worden und heute Nacht wurde in unserer Schule eingebrochen. Die Einschläge kommen immer näher, verstehst du? Deshalb müssen wir einen Beschluss fassen, bevor auch hier jemand auf die Idee kommt, die Post oder unseren Laden zu besuchen und auszurauben.«
»Was hast du vor?«
»Wir brauchen entweder eine Alarmanlage oder einen Hund.«
Roddy hebt die Hand und streckt den Daumen nach oben. »Das mit dem Hund gefällt mir.«
»Machen wir aber nicht.« Myrna schüttelte den Kopf. »Zuviel Aufwand. Wir alle haben einen Fulltimejob. Da bleibt für einen Vierbeiner keine Zeit übrig. Ich denke eher an eine Alarmanlage.«
»Wozu? Du lebst mit einem Polizisten zusammen. Da braucht man keine Alarmanlage.«
»Barry? Der wird in der Nacht nicht einmal von einem Erdbeben wach.«
»Verstehe ich nicht«, sagte Roddy. »Wenn wirklich jemand einbrechen will, dann lässt er sich auch von einer Alarmanlage nicht aufhalten.«
»Doch. Roddy, das ist keine Entscheidung, die wir aus dem Bauch treffen dürfen, das müssen wir strategisch angehen.«
Er verzog sein Gesicht. »Strategisch … wie geht das?«
»Komm.« Myrna deutete zur Tür. »Wir sehen uns die Sache von draußen an.«
Als sie auf dem Gehsteig standen, deutete Myrna auf die Vorderfront des Hauses. »Ich habe mich im Internet umgesehen. Neunzig Prozent der Einbrecher kommen entweder durch die Tür oder die Fenster. Also … strategisch vorgehen, habe ich gesagt … unser Post-Laden hat eine Tür und drei Fenster. Die Fenster werden wir vergittern, bei der Tür das Schloss wechseln und zusätzlich kommt eine Alarmanlage ins Haus.«
»Wieso fragen Sie mich, Chefin, wenn Sie insgeheim schon alle Entscheidungen getroffen haben.«
»Weil ich dich einbinden möchte.«
»Wenn Sie unbedingt Geld für eine Alarmanlage ausgeben wollen, gehen Sie zu Martin nach Ennis.«
»Wer ist Martin in Ennis?«
Roddy wischte auf seinem Handy herum. »Martin O’Hare.« Er hielt ihr das Telefon hin.
»Security Systems Ennis.« Myrna las es laut. »Kennst du ihn?«
»Martin trainiert die Hurling-Mannschaft in Ennis. In seinem Geschäft in Ennis verkauft er alles was mit Elektronik zu tun hat. Wir waren mal befreundet.«
»Ist er vertrauenswürdig?«
Roddy legte die rechte Hand aufs Herz und lächelte sie an. »Sonst hätte ich ihn dir nicht empfohlen.«
Das Seaview Hotel war wie ausgestorben. Myrna betrat den kleinen Vorraum, der leer war. Die alten Holzdielen knarrten, am Empfang war niemand. Sie drückte die Klingel, die seltsam scheppernd klang. Nach einer Weile hörte sie Schritte, dann erschien Donnachta Kirby, der beide Arme in die Luft warf und sie mit den Worten »Hallo Myrna!« begrüßte.
»Ich brauche ein Zimmer«, sagte sie. »Ein Doppelzimmer.«
»Du glaubst gar nicht, wie sehr ich dir entgegenkommen kann. Ich habe insgesamt zwanzig Zimmer, davon stehen neunzehn leer, die ich dir anbieten kann.«
»Keine tolle Saison für dein Hotelgewerbe«, sagte sie und sah sich in der Lobby um. »Vielleicht solltest du deine Übernachtungsstätte mal restaurieren und verjüngen.«
»Restaurieren … das hat mir meine Frau, Gott hab sie selig, auch immer gepredigt. Aber das sagt sich leicht. Zum Renovieren braucht man Geld, und genau das ist Mangelware in meiner Kasse.«
Sie unterbrachen ihr Gespräch, weil ein Mann die Treppe herunterkam. Ohne genau hinzusehen, registrierte Myrna, dass der Mann mittleren Alters war und einen Hut trug.
»Das ist mein derzeitiger Gast«, flüsterte Kirby, während er den Mann, der eiligen Schrittes den Raum durchquerte, aus den Augenwinkeln verfolgte. Mit einem lauten Geräusch fiel die Tür hinter dem Mann zu.
»Ein eigenartiger Mensch«, sagte der Hotelbesitzer.
»Meine Schwester und mein Schwager kommen nach Doughmore«, sagte Myrna. »Deshalb brauche ich das Zimmer. Für zwei Nächte.«
»Das geht in Ordnung, Myrna. Das schönste Zimmer im Erdgeschoss für deine Verwandtschaft.«
Sie verabschiedeten sich und Myrna verließ das Hotel. Als sie auf den Platz vor dem Gebäude trat, sah sie den Mann wieder. Er stand, halb von einem Strauch verdeckt da und sah zu ihr herüber. Was wollte der Typ von ihr? Auffällig an dem Mann war lediglich sein seltsamer Hut. Ein Filzhut. Bowler hieß so etwas früher. Typisch Englisch. Wahrscheinlich kam der Bursche von dort. Bevor sie in die Seitenstraße abbog, sah sie noch einmal zu dem Mann hin. Er stand immer noch dort und starrte sie an.
Die Primary School lag auf einem Hügel, von dem man einen weiten Blick auf die Doughmore Bay hatte. Es war ein nichtssagendes, langgestrecktes Gebäude, das eher einem Pferdestall als einer Schule glich. Die Kompetenz der Lehrkräfte ist entscheidend, sagte sich Barry, und nicht die bauliche Qualität des Gebäudes. Die Schule in Doughmore galt von je her als Bollwerk konservativ orientierter Pädagogik und gesunder Religiosität. So war es schon einige Male vorgekommen, dass neumodische Ansichten an der Schule zwar nicht als Ketzereien bekämpft, aber zumindest von Eltern wie von Lehrern vehement abgelehnt wurden.
Barry erinnerte sich an die Grundschule, die er in Wicklow besucht hatte, nichts Anderes als eine Holzbaracke, in der es so feucht war, dass im Winter kleine Eiszapfen an den Fensterbrettern hingen.
Er parkte den Wagen vor dem Schulgebäude und ging in Gedanken versunken auf die Tür aus massivem Holz zu, als diese aufgerissen wurde und James Quinn, der Bürgermeister, angerannt kam. Wie ein wilder Stier. Barry konnte einen Zusammenstoß gerade noch vermeiden, indem er sich mit einem Sprung zur Seite flüchtete, wobei er ins Schleudern kam und gegen die Mauer prallte.
»Guten Tag, Herr Bürgermeister«, sagte Barry und ordnete seine Jacke, die etwas verrutscht war. »Sie sind eifrig und rasch unterwegs. Alles für unser Gemeinwesen, nicht wahr?«
»Nehmen Sie sich ein Beispiel, Barry«, knurrte der Bürgermeister. »Leider muss ich feststellen, dass die Einbrüche im County auch auf Doughmore übergegriffen haben. Die Angst geht um bei uns im Dorf. Und ich frage mich, was die Polizei dagegen unternimmt. Sie sollten einen Zahn zulegen.«
Einen Zahn zulegen … Barry war froh, dass der Bürgermeister davonrannte und nicht auf einen Kommentar wartete.
Jedes Mal wenn Barry eine Schule betrat und den typischen Geruch aus Schülerschweiß, Kleidung und Putzmitteln wahrnahm, stiegen sofort die Erinnerungen an die eigene Schulzeit hoch, verbunden mit der Angst, die Hausaufgabe nur zum Teil erledigt zu haben und für den Mathetest schlecht vorbereitet zu sein.
In einem der Gänge kam ihm lärmend eine ganze Klasse in ihren rot-blauen Schuluniformen entgegengelaufen, eine gutgelaunte Horde, die um ihn herumströmte. Sie trampelten auf seine Füße, stießen ihn mit den Schultaschen und drängten ihn an die Mauer.
Aus einer der Türen zeigte sich ein Kopf, den Barry kannte. Patrick Mc Caig, der Principal. »Da sind Sie ja endlich«, sagte er zur Begrüßung und zeigte auf den Mann, der neben ihm stand. »Jamie Downs kennen Sie sicher. Einer unserer Lehrerkollegen an der Schule.«
Barry gab beiden die Hand. »Ich habe draußen unseren Herr Bürgermeister getroffen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Das sah nicht nach einem Freundschaftsbesuch aus. Er wirkte ziemlich aufgebracht. Was hat er denn?«
Die beiden tauschten einen kurzen Blick und hoben synchron die Schultern. Patrick sagte: »Wegen des Einbruchs. Außerdem gab es wohl eine Beschwerde über einen unserer Lehrer.« Er machte eine vage Handbewegung, die Barry nicht deuten konnte. »Aber wie vieles, was vom Bürgermeister kommt … nicht ernst zu nehmen. Jedenfalls kein Thema das die Polizei interessieren könnte. Zum Unterschied zum Einbruch.«
»Bei euch ist also eingebrochen worden«, sagte Barry.
Jamie Downs nickte und deutete zur Tür. »Gehen wir in den Medienraum. Dort ist der Tatort.«
In dem kleinen Zimmer trafen sie auf eine hübsche Blondine, die Barry bekannt vorkam, deren Namen er aber nicht kannte.
»Das ist Sarah Behan«, sagte Patrick Mc Caig. »Sie unterrichtet IT an der Schule. Ich habe sie gebeten, anhand der Listen festzustellen, was geklaut wurde.«
Sarah Behan hatte eine ausnehmend gute Figur, soweit man das bei einer Frau beurteilen konnte, die einen dicken Wollpullover und weite Jeans trug. Sie warf Barry einen aufmunternden Blick zu und zeigte auf den aufgebrochenen Schrank. »Sehen Sie sich an, mit welcher Brutalität der Gauner vorgegangen ist.«
»Wann war das?«, fragte Barry. »Wissen Sie, um wieviel Uhr der Einbruch stattgefunden hat?«
»Keine Ahnung. Irgendwann in der Nacht.« Die Antwort kam vom Principal. »Unser Hausmeister war heute früh der erste, der hier reinkam und den Einbruch entdeckt hat.«
Barry deutete auf die zertrümmerte Schranktür. »Ich hoffe, es wurde nichts angerührt hier.« Er sah Patrick Mc Caig an, um anzudeuten, dass seine Rede ihm galt. »Es wird sich jemand von der Spurensicherung melden. Vielleicht hat der Einbrecher irgendwelche Spuren hinterlassen, mit denen wir ihn identifizieren können.«
»Wenn die Polizei ihn findet«, sagte Patrick.
»Wenn die Polizei ihn findet«, wiederholte Barry. »In Doonbeg wurde gestern in der Nacht die Poststation überfallen. Möglicherweise ist es derselbe Täter.«
»Es war in den Nachrichten«, sagte Sarah Behan. »Eine Frau soll schwer verletzt worden sein. Wissen Sie, wie es ihr geht?«
»Sie liegt in Galway im Hospital. Ich komme gerade von dort. Die Frau wurde niedergeschlagen und hat den Einbrecher leider nur undeutlich gesehen. Sie hat eine Kopfverletzung, wird aber überleben. Wenn nicht überraschend Komplikationen eintreten.«
»Wir fühlen uns von der Politik und der Polizei allein gelassen und …«, sagte Patrick.
Jamie Downs unterbrach den Principal. »Jetzt sollten wir zuerst über unseren Einbruch reden.«
Barry nickte dem Lehrer dankbar zu und deutete auf den zertrümmerten Schrank. »Was wurde geklaut?«
»Ich habe mir das genau angesehen.« Sarah Behan holte einen Zettel aus ihrer Tasche, legte ihn vor Barry auf den Tisch und strich ihn glatt. »Es fehlen genau diese fünf Laptops. Nicht die allerneuesten Modelle, aber für uns in der Schule ein schmerzlicher Verlust.« Mit dem Finger tippte sie auf das Papier. »Hier ist alles aufgeschrieben. Typ und Seriennummer für jeden der Notebooks, die der Kerl mitgenommen hat.«
»Das haben Sie vorbildlich gemacht«, sagte Barry, faltete das Blatt zusammen und steckte es ein. Dann verabschiedete er sich von Sarah Behan und den beiden Männern und versprach, von sich hören zu lassen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen sollten.
»Ich begleite Sie hinaus«, sagte Jamie Downs. Schweigend gingen sie bis zum Ende des Flures und dann nach links Richtung Haustür, wo man sie nicht mehr hören konnte.
»Was ist denn los in unserem Land?«, fragte Jamie Downs. »Einbrüche allerorten.«
»Wir leben in schwierigen Zeiten.« Barry war stehengeblieben. »Was ich noch sagen wollte … Einbruch in eine Postfiliale und in eine Schule. Das sind vermutlich keine Profi-Einbrecher. Und es gibt ein bestimmtes Tatmuster. Ein bisschen Geld und ein paar Computer. Der oder die Täter kommen in der Nacht.« Barry reichte dem Lehrer die Hand. »Die Gauner haben wir bald. Das verspreche ich Ihnen.«
Barry verließ das Schulgebäude und stieg in sein Auto. Langsam fuhr er die schmale Zufahrtsstraße hinunter als ihm ein Mann auffiel, der am Straßenrand entlangging und über die Schulter unentwegt zu ihm hersah. Für einen Augenblick trafen sich ihre Blicke. Barry hätte nicht sagen können, warum er auf die Bremse stieg, das Fenster auf der Beifahrerseite herunterfuhr und neben dem Mann anhielt.
»Kann ich Sie mitnehmen?«
Der Mann beugte sich zum offenen Wagenfenster herunter. »Sie schickt der Himmel. Fahren Sie ins Zentrum?«
»Bis zur Chapel Street.«
»Das ist okay. Irgendwo dort lassen Sie mich aussteigen.«
Barry sah zu dem Mann hinüber. »Ich habe Sie schon mal in der Schule gesehen. Sind Sie Lehrer?«
»Schon seit einiger Zeit. Daniel Roche ist mein Name. Danke, dass Sie gehalten haben. Mein Auto ist gerade beim Service.«
Barry fuhr bis zum Ende der Dunlicky Street und bog in die Church Road ein, die aus dem Süden kommend Richtung Zentrum führte. Der Mann neben ihm machte einen nervösen Eindruck und fingerte fortwährend an einem Kugelschreiber herum, der in seiner Brusttasche steckte.





























