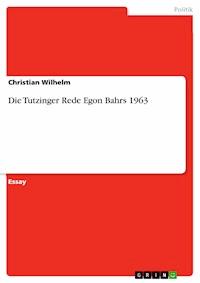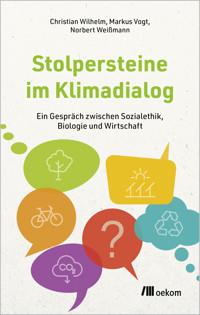
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Was müssen wir angesichts der Klimakatastrophe tun? Brauchen wir für eine Ressourcen- und Energiewende eher neue Techniken und marktwirtschaftliche Instrumente oder Konsumverzicht? Wie kann der Staat zugleich Freiheit und Klimagerechtigkeit sichern? Der Weg ins nächste Jahrhundert verläuft nur friedlich, wenn wir uns sektorübergreifend über die moralischen Eckpunkte eines neuen, zukunftsfähigen Gesellschaftsvertrages verständigen. Doch wie soll das gelingen, wenn Fakten und Argumente wie Schlagstöcke verwendet werden? In einem kritisch-konstruktiven Trialog erörtern ein Biologe, ein Ethiker und ein Praktiker aus der Wirtschaft diese Fragen. Sie führen eine sachkundige, offene Diskussion und regen mit Gleichnissen und Geschichten zum Nachdenken an. Im Mittelpunkt des Buches steht die alltagsnahe Auseinandersetzung mit Hürden und Stolpersteinen für neues Denken und Handeln. Denn nicht das Festhalten an starren Positionen bringt uns weiter, sondern das kooperative Streben nach Lösungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WilhelmChristian
VogtMarkus
WeißmannNorbert
Stolpersteine im Klimadialog
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© Christian Wilhelm, Markus Vogt, Norbert Weißmann erschienen 2024 im oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: le tex, xerif
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Umschlagabbildung: © Adobe Stock: picoStudio, iiierlok_xolms, artnazu
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitungen). Diese Lizenz erlaubt das Vervielfältigen und Weiterverbreiten des Werkes, nicht jedoch seine Veränderung und seine kommerzielle Nutzung. Die Verwendung von Materialien Dritter (wie Grafiken, Abbildungen, Fotos, Auszügen etc.) in diesem Buch bedeutet nicht, dass diese ebenfalls der genannten Creative-Commons-Lizenz unterliegen. Stehen verwendete Materialien nicht unter der genannten Creative-Commons-Lizenz, ist die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers für die Weiterverwendung einzuholen.
In dem vorliegenden Werk verwendete Marken, Unternehmensnamen, allgemein beschreibende Bezeichnungen etc. dürfen nicht frei genutzt werden. Die Rechte des jeweiligen Rechteinhabers müssen beachtet werden, und die Nutzung unterliegt den Regeln des Markenrechts, auch ohne gesonderten Hinweis.
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987264290
DOI: https://doi.org/10.14512/9783987263996
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Ernst Ulrich von Weizsäcker
Vorwort
Stolpersteine im Klimadialog
Was ist an unserer Situation so neu, dass alte moralische Maßstäbe neu definiert werden müssen?
Warum ist die Erderhitzung keine Krise, sondern eine Katastrophe und was daran ist so menschheitsbedrohlich?
Worin besteht diepolitische Sprengkraft des Klimawandels?
Wie müssen wir unser Verhältnis zur Natur neu bestimmen?
Auswege aus dem drohenden Unheil
Schluss
Die Autoren
Danksagung
Anmerkungen
Wir widmen das Buch unseren Kindern, stellvertretend für alle Kinder der kommenden Generationen, in der Hoffnung, dass der eine oder andere Gedanke bei den Lesenden dazu führt, ein wenig mehr für den Klimaschutz zu tun und für einen ökologischen Humanismus einzutreten.
Vorwort
Das tolle Buch heißt »Stolpersteine im Klimadialog«. Ständig hören wir vom Klima. Von grausigen Wasserschäden im Ahrtal, und noch schlimmer in Pakistan, und nun in Ostafrika; von Hitzewellen, die Menschen krank machen und die Ernte verdorren lässt. Für die Zukunft rechnet man mit einem beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels. Millionen, ja eine Milliarde Menschen würden Grund und Boden verlieren.
Unsere Zivilisation muss sich so wandeln, dass das Klima eine für unseren Planeten günstigere Richtung nimmt. Die heutige Philosophie spuckt in die falsche Richtung. Wir sind verliebt in das Prinzip »Höher, Schneller, Weiter«. Das war Jahrhunderte lang das Ziel der Zivilisation, mindestens für die Sieger. Wir Europäer – und erst recht die Nordamerikaner – liebten dieses Schnelligkeitsprinzip.
Das Thema »Klima« – in seiner heutigen Bedeutung – kam Jahrhunderte lang nicht vor. Ganz frühe Klimaforscher waren am ehesten besorgt über eine mögliche neue Eiszeit.
Der erste Durchbruch zur korrekten Klimaanalyse stammte von dem genialen schwedischen Chemiker und Physiker Svante Arrhenius. Im Jahr 1896 publizierte er in dem damals bekanntesten Journal Philosophical Magazine seinen Aufsatz »On the Influence of Carbon Acid in the Air upon the Temperature of the Ground«. Kohlendioxid und Wasserdampf in der Luft sah er – empirisch bezeugt – als Ursache einer Erwärmung der Atmosphäre an. In seinem kühlen Skandinavien betrachtete er den Effekt der Erwärmung allerdings als schöne Verheißung für eine angenehm wärmere Welt.
Gut 60 Jahre später, 1958, konnte der amerikanische Forscher Charles David Keeling die berühmt gewordene Kurve darstellen, die die jährliche Erwärmung der Lufttemperatur über dem Vulkan Mauna Loa auf der Insel Hawaii zeigte. Und nochmal 25 Jahre später, in den 1980er‐Jahren, konnten französische und russische Forscher in der russischen Forschungsstation Wostok in der Antarktis die Chemie von uralten Luftbläschen im Eis entziffern. Die Luftbläschen zeigten die Korrelation von CO2‐Konzentration und Temperatur; und das für zigtausende von Jahren. Daraus entstanden die berühmten Kurven der Parallelität zwischen der Dichte der Treibhausgase und der jeweiligen Temperatur. Dieses Ergebnis führte dazu, dass die Staaten der Welt beim Weltgipfel 1992 in Rio de Janeiro die Klimakonvention beschließen konnten.
Die Klimakonvention ist die Basis für den weltweiten Klimaschutz – zur Vermeidung der ständigen Erwärmung. Wie Johan Rockström heute sagt, müssen wir die »planetaren Grenzen« unseres doch recht kleinen Planeten erkennen. Das ist in der Tat die Gefahr einer raschen Erwärmung, die alsbald zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt. Und wir Menschen müssen aufhören mit der rasenden Ausräuberung der Metalle, des Holzes, der Böden und vor allem der Tiere und Pflanzen auf unserem kleinen Planeten. Der Club of Rome hatte schon 1972 vor den Grenzen dieses Wachstums gewarnt. Doch was ist in diesen 50 und mehr Jahren passiert? Die Ausräuberung hat sich rasant beschleunigt.
Der großartige Chemiker und spätere Nobelpreisträger Paul Crutzen hat im Jahr 2000 das Wort »Anthropozän« erfunden: Das Wort beschreibt ein geologisches Zeitalter, in dem wir Menschen (Anthropoi im Altgriechischen) mit unglaublicher Geschwindigkeit »alles verändern« und dabei leider auch sehr große Schäden anrichten. Crutzen schlug vor, die Atmosphäre so zu beeinflussen, dass die Lufterwärmung gebremst würde. Aber er wusste auch, dass das schiefgehen kann, und dass man in der Hauptsache die Ursachen der Erwärmung anpacken muss.
Die notwendigen Schritte sind allerdings komplex und verlangen eine breite globale Zustimmung. Notwendig ist eine Transformation, die über den Klimaschutz weit hinausgeht: viele Facetten wie neue Technologien, eine alternative Ökonomie, Artenschutz und Renaturierung, soziale Nachhaltigkeit und Armutsbekämpfung.
Für das Engagement der normalen Menschen sind lange Belehrungen wenig hilfreich. Wohl aber sachliche Gespräche, relevante Beispiele, kleine Erzählungen. Das hilft dem Nachdenken. Das freut Ingenieure. Das führt zu einem Austausch über die Grundfragen der Zukunft.
Da kann und soll auch die religiöse Haltung helfen. Es ist gut, dass das Buch die Weltreligionen nennt und anspricht. Der Aufruf »Religionen – Hoffnung für eine taumelnde Welt« vom 14.9.2022 sagt zu Recht, dass die Weltreligionen für Millionen von Menschen Quelle der Hoffnung und der Kraft waren und sind. Das hilft, Angst, Egoismus und Resignation zu überwinden. »Sie sind eine Inspiration für ein universell‐solidarisches Leben«. Darüber müssen die Menschen wertschätzend miteinander sprechen. Klimaschutz als reine Technik, Politik und Wissenschaft – das wäre zu flach.
Stolpersteine im Klimadialog
Ein Gespräch zwischen Sozialethik, Biologie und Wirtschaft
Klimaschutz gelingt nur, wenn möglichst viele Menschen dafür zu gewinnen sind. Die große Transformation zu einer globalen Nachhaltigkeit verlangt nicht nur technische Innovationen und ein vom Wachstum entkoppeltes Wirtschaften, sondern auch ein geändertes Verhalten, eine neue Einstellung. Der Abschied von dem Prinzip »Höher, Schneller, Weiter« fällt schwer und gelingt nur mit einer neuen Kultur des Miteinanders und des rechten Maßes. Im Gespräch darüber werden schnell Kommunikationsbarrieren deutlich: Bevormundung wie »man sich zu verhalten habe«, moralische Zurechtweisung, Besserwisserei, aber auch Faktenleugnung. In dieser Schrift wollen wir uns sachlich fundiert und dialogoffen den moralischen Ansprüchen und psychologischen Barrieren des Klima‐ und Umweltschutzes stellen. Es ist kein belehrender Aufsatz, sondern ein Gespräch zwischen einem Ethiker, einem Naturwissenschaftler und einem Menschen aus der Wirtschaft, die versuchen auf die Fragen einzugehen, die immer wieder in Gesprächen über den Klimawandel auftauchen und eine längere Antwort verlangen, als man sie in einem nur mündlich geführten Gespräch geben kann. Es geht um ruhiges Argumentieren, mit dem Ziel eine gemeinsame Vorstellung gelingenden Lebens zu finden. die auch in der Begrenzung materieller Güter Erfüllung findet und in tatkräftiges Handeln mündet. Wir sprechen hier bewusst von Stolpersteinen, weil negative Erfahrungen angesprochen werden, auf die wir sehr oft emotional reagieren, weil ein bislang eben gedachter Weg, sich plötzlich als steil und steinig erweist. Klimaschutz erfordert das Fallenlassen von vertrautem Denken und liebgewordenen Handlungsmustern. Dieser Prozess ist mit vielfältigen psychologischen Widerständen verknüpft, die sich als Stolpersteine im Klimadialog bemerkbar machen. Hat man sich nach dem Stolpern wieder gefangen, kann der Weg fortgesetzt werden, der zu einem Ziel führt, auf das man sich freuen kann: gutes Leben in den Grenzen des Planeten.
Was ist an unserer Situation so neu, dass alte moralische Maßstäbe neu definiert werden müssen?
Norbert Weißmann: Schon vor 2.600 Jahren empfahl der unter dem Namen Jeremia bekannte Prediger: »Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl« (Jer 29, 4–7). An diese Empfehlung haben sich mehr als 2.000 Jahre lang Völker gehalten, unabhängig davon welches religiöse Selbstverständnis sie hatten. Dieses Verständnis hat die Kulturgeschichte der Menschheit geprägt, warum sollte es auf einmal falsch sein?
Markus Vogt: Die Erfahrung, dass eine solide Architektur, eine auf Erfahrungswissen aufgebaute Landwirtschaft, eine wachsende Bevölkerung verbunden mit einer humanen Sozialorganisation das Leben der Menschen reicher und schöner macht, war sicher eine der starken Triebfedern menschlicher Kulturgeschichte. In der Frühzeit und selbst im Altertum waren die menschlichen Siedlungen im Vergleich zu heute eher klein, bis auf wenige Machtzentren in den Städten, die auch als Brutstätten des technischen und sozialen Fortschritts bezeichnet werden können. In dieser Phase der Menschheitsgeschichte hatten Priester und Beamte aufgrund ihres Wissens eine wichtige soziale Steueraufgabe. Was aber in einer leeren Welt sinnvoll und fortschrittstreibend war, muss es nicht automatisch in einer vollen Welt sein.
Norbert Weißmann: Was meinen Sie mit einer »leeren« und einer »vollen« Welt?
Christian Wilhelm: Man kann das vielleicht am besten an ein paar Beispielen verdeutlichen. Wenn wir heute von den Neandertalern sprechen, denken viele von uns an ein Volk mit mindestens einigen Tausend oder Zehntausend Hominiden. In Wirklichkeit umfasste die Population vermutlich weniger als 1.000 Individuen. Europa war also, aus heutiger Sicht betrachtet, extrem dünn besiedelt. Ein anderes Beispiel. Als im Jahre 70 nach Chr. Jerusalem zerstört wurde, lebten etwa 100.000 Juden im ganzen Römischen Reich. Wie drastisch sich die Bevölkerungsdichte während der Geschichte geändert hat, zeigen diese Zahlen: Zum Zeitpunkt der Wiedergründung des Staates Israel standen 600.000 Einwanderer rund 1,2 Millionen arabischen Palästinensern gegenüber. Heute leben in Israel und den von Israel besetzten Gebieten fast 10 Millionen Menschen, in Palästina (in der Westbank und Gaza) circa 5 Millionen Menschen. In einer leeren Welt war Migration zwar auch ein riskantes Unternehmen, aber in vielen Fällen war es eine gute Lösung, traf man doch in der Regel auf kaum besiedeltes Land. In einer vollen Welt wirkt Migration für manche wie im Reflex als Angriff, da damit eine Umverteilung der Güter befürchtet wird. Je voller die Welt aber wird, und für Menschen an ihrem angestammten Ort aus verschiedenen Ursachen die Existenzgrundlage wegbricht, umso stärker wird Migration als einzige Chance für das Überleben gesehen. Hinzu kommt, dass durch das Wachsen der Weltbevölkerung immer mehr Menschen ernährt werden müssen, die landwirtschaftlichen Nutzflächen aber nicht entsprechend mitwachsen können. In einer vollen Welt kommt es notwendig zu einer Intensivierung der Flächennutzung und der damit verbundenen ökologischen Konflikte.
Norbert Weißmann: Kann der Konflikt um Raum nicht durch die verbesserte Technik gelöst werden? Noch um das Jahr 1900 ernährte ein Bauer nur 4 Menschen, während er heute mit seinen Erzeugnissen bis zu 130 Menschen satt macht?
Markus Vogt: Ja, das stimmt, aber es ist nur ein Teil der Realität. Während im Jahr 1960 weltweit noch 3.700 Quadratmeter Nutzfläche für die Ernährung eines Menschen zur Verfügung standen, sind es heute nur noch ca. 1.500 Quadratmeter. Hinzu kommt, dass diese hohen Erträge »bezahlt« werden mit einem hohen Artenverlust und mit enormen Aufwendungen fossiler Energie verbunden sind. Wir sehen aber, dass dieses kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell auch in der Landwirtschaft auf Dauer nicht haltbar ist. Es gefährdet die Stabilität des Klimasystems und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Die Lage spitzt sich außerdem auch zu, weil bei Starkregen wertvolle Ackerflächen durch Abschwemmung des Oberbodens verloren gehen und langanhaltende Dürreperioden in vielen Ländern die Ernteerträge drastisch reduzieren. Die Transformation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der Kinderarbeit.
Norbert Weißmann: Das sind eine Reihe von Behauptungen, die viele sicher nicht sofort nachvollziehen können: Klimasystem, Transformation zur Klimaverträglichkeit und dann muss das gleich moralisch geboten sein? Das klingt sehr nach moralischem Rigorismus, wie ich ihn leider immer noch von einigen Vertretern der katholischen Kirche kenne. Können Sie bitte Stück um Stück verständlich machen, was Sie meinen?
Christian Wilhelm: Den Vorwurf des moralischen Rigorismus möchte ich so nicht stehen lassen. »Moralisch geboten« heißt ja nicht die Moralkeule zu schwingen und Verdammnis anzudrohen, sondern einfach, dass sich die Situation auf dem Planeten so geändert hat, dass dem Menschen eine neue und umfangreichere Verantwortung zugewachsen ist. Wir müssen neu über das gute Handeln nachdenken, angesichts der Fähigkeiten des Menschen und der realen Zukunftsrisiken. Damit ist gemeint, dass wir in ein neues Erdzeitalter eingetreten sind, das Anthropozän, in dem der Mensch durch sein Können und seine schiere Anzahl das weitere Schicksal der Erde bestimmt. Der Klimaschutz ist nur ein Teil der neuen erdgeschichtlichen Aufgabe des Menschen.
Die Menschheitskrise im Anthropozän
Norbert Weißmann: Vielleicht erläutern Sie an dieser Stelle etwas ausführlicher, was mit Anthropozän gemeint ist.
Christian Wilhelm: Ich erinnere mich noch als ich Student war, dass im Mai 1985 eine Studie veröffentlicht wurde, in der drei britische Wissenschaftler die Existenz des »Ozonlochs« über der Antarktis nachgewiesen hatten. Eilig wurden Meldungen verbreitet, dass dadurch die gefährliche ultraviolette Strahlung ungefiltert auf die Erdoberfläche eindringen könne und wir alle davon erblinden würden. In Australien wurden Sonnenbrillen und breitkrempige Hüte verteilt. Als Grund für den Ozonabbau in 30 Kilometern Höhe wurden die Fluorkohlenwasserstoffe angeführt, die einen Segen für die Menschheit gebracht hatten: Sie hatten als billige Kühlmittel für die Verbreitung der Kühl‐ und Eisschränke und damit für eine neue Form der Vorratshaltung gesorgt. Zusätzlich füllten sie als Treibmittel die Spraydosen für viele neue Anwendungen. So konnte man ohne Pinsel Lacke schlierenfrei auftragen oder Dauerwellen stabilisieren. Horrorgeschichten von UV‑geschädigten, orientierungslosen Hasen mit grauem Star geisterten durch die Medien, nicht ohne Wirkung: Schon 1987 unterzeichneten 46 Staaten das Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht, das bis heute 197 Länder ratifiziert haben. Die FCKWs sind aus Kühlschränken und Spraydosen verschwunden, das Ozonloch schließt sich langsam wieder. Diese Geschichte war der Beginn der Idee, ein neues Erdzeitalter auszurufen. Als Mainzer Student lernte ich Paul Crutzen kennen, der den Einfluss der Polarwolken bei der Bildung des Ozonlochs aufgeklärt hatte und dafür im Jahr 1995 den Nobelpreis für Chemie erhielt. Paul Crutzen war nicht nur ein hervorragender Chemiker, sondern auch ein Denker über den Tellerrand hinaus. Bisher waren die Erdzeitalter nach geologischen Formationen definiert worden, also zum Beispiel als Kreidezeit. Dahinter stand die Idee, dass die materielle Zusammensetzung unserer Erde, also die Gesteinsformationen, Änderungsprozesse durchläuft, die geochemisch bestimmt sind. Durch das Ozonloch und die nun verstärkt auftretende UV‑Strahlung waren es nun nicht mehr natürliche geochemische Prozesse, sondern Chemikalien, die der Mensch geschaffen hatte, die das Schicksal der weiteren Erdentwicklung bestimmen würden. Vor dem Hintergrund des steigenden CO2‐Gehalts in der Atmosphäre formulierte Paul Crutzen im Jahr 2002:1
»In den vergangenen drei Jahrhunderten haben die Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt massiv zugenommen. Durch die anthropogenen CO2‐Emissionen könnte das globale Klima für viele Jahrtausende erheblich von seiner natürlichen Entwicklung abweichen. Es scheint daher angebracht, die gegenwärtige, in vielerlei Hinsicht menschlich dominierte geologische Epoche als ›Anthropozän‹ zu bezeichnen.«
Norbert Weißmann: Das klingt zunächst sehr akademisch, naturwissenschaftlich und so recht ist damit der Lebensbezug zu heute nicht klar.
Markus Vogt: Was Crutzen hier äußert, schließt sich auf das Klima bezogen an das an, was schon im Jahr 1972 der Club of Rome in seinem ersten Bericht formuliert hatte. Obwohl sich der Club of Rome geirrt hatte, was den Zeitpunkt betrifft, wann die Rohstoffe zur Neige gehen, bleibt doch die Kernaussage richtig: Es gibt planetare Grenzen. Wir haben nicht beliebig viele Rohstoffe, nicht beliebig viel Platz auf der Erde. Kurz gesagt: Die Menschheit muss sich darauf einstellen, dass der Ressourcenverbrauch die Vorräte übersteigt und die Abfälle aus dem technologischen Wachstum das Lebensgefüge auf der Erde zerstören. Dies ist die grundlegende und bislang ungelöste Herausforderung des neuen Erdzeitalters Anthropozän. Daher ist erstmalig in der Menschheitsgeschichte vorausschauendes Umsteuern nötig und damit tut sich die Menschheit schwer. Der Zusammenhang zwischen Klima und dem CO2‐Gehalt in der Luft wurde schon 1824 von Fourier entdeckt. Eunice Foote berichtete 1856, dass Kohlendioxid bei der Untersuchung verschiedener Gase den höchsten Treibhauseffekt zeigt. Der schwedische Physiker und Chemiker Svante Arrhenius berechnete schon 1896 den atmosphärischen Treibhauseffekt im Zusammenhang der Eis-Albedo-Rückkopplung. Die Gründe dafür, dass die Erkenntnisse der Klimawissenschaftler nicht ernst genommen wurden, liegen einerseits an unserem eingeschränkten Einschätzungsvermögen der Konsequenzen von exponentiellem Wachstum, insbesondere, wenn sich dieses in langen Zeiträumen vollzieht und andererseits daran, dass, als in den 1980er‐Jahren endlich ein politischer Umdenkungsprozess einsetzte, die fossilen Industrien eine jahrzehntelange Desinformationskampagne starteten, die bis heute andauert.
Norbert Weißmann: Die Durchschnittstemperatur der Erde änderte sich in den letzten Jahren. Aus menschlicher Sicht betrachtet erscheint eine Veränderung von nur rund 1,3 Grad in circa 100 Jahren extrem langsam zu sein. Trotzdem wird dieser Trend von Wissenschaftlern als sehr bedrohlich bezeichnet. Können Sie den Wahrnehmungsfehler, der uns Menschen unterläuft, an einem anschaulichen Beispiel erklären?
Christian Wilhelm: Ich erkläre es mit dem Bild, das der Club of Rome in seinem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« aus dem Jahr 1972 benutzt hat. Stellen wir uns einen großen See vor, bei dem nur am Rand hin und wieder ein paar Seerosen zu sehen sind. Nehmen wir an, dass die Seerosen sich einmal pro Woche verdoppeln. Seerosen sind für den See nicht günstig. Sie nehmen das Licht weg. Ohne Licht kein Planktonwachstum und kein Sauerstoff, keine Wasserflöhe für die Fische, über kurz oder lang ist ein dunkler See tot. Anfangs merkt man gar nicht, dass sich die Seerosen vermehren. Dann werden es aber mehr und es gibt Leute die mahnen: Hört auf, die Seerosen zu düngen, nehmt von den Seerosen immer welche weg, sodass sie den See nicht zuwachsen. Aber man hört nicht auf sie; es sind ja noch so große Seeflächen frei. Inzwischen bedecken die Seerosen ein Viertel des Sees und die Mahner rufen: Hört auf damit, nehmt die Seerosen heraus, so gut ihr könnt denn in zwei Wochen wird der See zugewachsen sein. Doch die anderen antworten. Keine Sorge, schaut doch der See ist doch noch zu drei Viertel frei. Zwei Wochen später war der See von Seerosen vollständig überwuchert und es waren zu viele, als dass man sie hätte entnehmen können. Unser Gefühl warnt uns einfach zu spät und darin liegt die Tragik. Wir müssen dann nüchtern auf die Mathematik und die Wissenschaft vertrauen.
Norbert Weißmann: Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir Menschen uns bedrohliche Entwicklungen, vor denen Wissenschaftler warnen, mit unseren Alltagserfahrungen lange Zeit schönreden. Welche weiteren Beispiele gibt es dafür, dass wir schleichende Entwicklungen, die auf einen Kipppunkt zulaufen, nicht wahrnehmen oder zumindest unterschätzen? Wo müssten wir, ähnlich wie beim Montreal‐Abkommen zum Schutz der Ozonschicht ganz schnell das Ruder herumreißen?
Abbildung 1 Änderung der Verteilung der globalen terrestrischen Biomasse im Laufe der letzten 12.000 Jahre.2
Markus Vogt: Bei den meisten menschengemachten Veränderungen sind die Auswirkungen im Alltag gar nicht so leicht sichtbar. Im Verlauf von Jahrzehnten hat sich die Biosphäre schleichend verändert. Inzwischen sind 75 Prozent der vom Menschen nutzbaren Fläche der Erde vom Menschen überformt. Die freie Natur wurde stetig zurückgedrängt und oft sogar aus Randbereichen vertrieben. Denken wir nur an die von Wildkräutern und Insekten fast völlig gesäuberten Industrie‐Agrarlandschaften. Der Mensch macht inzwischen ein Drittel der Biomasse aller Landwirbeltiere aus, die Nutztiere bilden fast den ganzen Rest. Die absolute Menge der Wildtiere macht nur noch wenige Prozent der tierischen Biomasse aus. Abbildung 1 verdeutlicht diese Verhältnisse.
Christian Wilhelm: Von der Gesamtmenge des verfügbaren Frischwassers verbraucht der Mensch die Hälfte, vor allem für die Landwirtschaft und die Energiegewinnung. Der Mensch verändert den Säurewert der Ozeane mit der Folge, dass die Tiere, die ihre Körper aus Kalk aufbauen (Steinkorallen, Muscheln, Krebse, aber auch viele Kleinstlebewesen wie zum Beispiel die Kalkflagellaten bedroht sind, da die Bildung ihres Kalkskeletts aus dem Meerwasser unter sauren Bedingungen gestört ist. Ein gigantisches Artensterben ist bereits in vollem Gange, im Meer wie an Land: Eine Million Arten sind akut gefährdet. Man spricht vom sechsten große Artensterben in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten. Es treten neue Sedimente auf, die es früher nicht gab: Mikroplastik, radioaktiver Fall‐out, Schichten mit Anreicherung von Schwermetallen und persistenten, sogenannten Ewigkeits‐Chemikalien. Die radioaktiven Abwässer aus dem Reaktorunfall von Fukushima sollen ins Meer abgelassen werden, nachdem die japanische Regierung den Ausstieg von der Atomenergie wieder rückgängig gemacht hat. Last but not least »entsorgen« wir gasförmige Abfälle wie die Klimagase in die Atmosphäre. Das wird dauerhaft und unumkehrbar den Wärmehaushalt des Planeten verändern mit all den Folgen für die Natur, die sich während des stabilen Erdzeitalters Holozäns so vielfältig und divers ausgebildet hat. In ihrem Sachbuch »The Sixth Extinction« hebt die Pulitzer Preisträgerin Elizabeth Kolbert den drastischen Verlust an Biodiversität als Hauptmerkmal des Anthropozäns hervor.3 Nicht erst seit der Covid‐Pandemie wissen wir, dass die Zunahme an »neuen« Infektionen darauf zurückzuführen ist, dass der Mensch ständig tiefer in die Wildnis vordringt und der Natur immer weniger eigenen Platz lässt. Der Ökologe Josef Settele hat in seinem Buch »Die Triple‐Krise« (Klima, Biodiversität und Pandemien) auf diesen Umstand hingewiesen.4 Die drohende Klimakatastrophe ist also nur die Spitze des Eisberges der Veränderungen, die im Anthropozän durch den Menschen verursacht werden.
Norbert Weißmann: Als Otto‐Normalverbraucher nimmt man diese Änderungen ja eher nur aus den Nachrichten wahr, ohne dass die Auswirkungen davon das eigene Leben direkt zu erreichen scheinen. Zudem klingt das eher nach einer Katastrophenvorhersage, der man sich nur sehr ungern stellen will. Zwar nehmen die Extremereignisse beim Wetter zu, aber Extreme gab es schon immer und ob die Unwetter wirklich Zeichen des Klimawandels sind, wird von einigen immer noch bestritten. Nimmt der Ausdruck des Anthropozäns nicht nur einseitig bestimmte naturwissenschaftliche Messwerte als Katastrophenvorhersage in den Blick?
Christian Wilhelm: Da haben Sie teilweise Recht. Der Begriff des Anthropozäns wird oft wie eine Katastrophenerzählung genutzt, aber diese Erzählweise ist nicht nur den Naturwissenschaftlern zu eigen. Diese pessimistische Sicht ist schon von Nietzsche als »Krankheit des Planeten« umschrieben worden. Aber nicht die apokalyptische Sicht ist das Problem, sondern der blinde Mensch gilt als die Krankheit des Planeten. Wenn die gefürchteten Szenarien wirklich wahr werden, dann stellt sich natürlich schon heute die Frage nach den Verursachern und damit die Schuldfrage.
Markus Vogt: Und damit sind wir mitten in der Umweltethik. Die Frage der Verantwortung des Menschen stellt sich bei allen Feldern, die einen Beitrag zur Klimaänderung leisten. Der rasche Anstieg der schädlichen Emissionen ist Ergebnis eines exponentiellen Wirtschaftswachstums. Die Finanzmärkte sind dabei die treibenden Kräfte. Sie kümmern sich aber nicht um die gerechte Verteilung der Erträge und der ökologischen und sozialen Kosten. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Es ist die Aufgabe des Staates und internationaler Organisationen das für eine gute Entwicklung notwendige Regelwerk zu schaffen. Am Gesetzgebungsprozess sind die betroffenen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt, wobei der Einfluss mit den ihnen jeweils zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln zunimmt. Geld steht den großen Industrien reichlich zur Verfügung, und von diesem Macht verleihenden Instrument machen Industrieverbände und große Konzerne reichlich Gebrauch, um die Gesetzgebung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Daher spricht man alternativ zum Anthropozän auch von »Technozän« oder »Kapitalozän«. Allen Begriffen aber bleibt gemeinsam, dass hier menschliche Akteure als Treiber der globalen Veränderungsprozesse benannt werden. Allen Sichtweisen ist gemeinsam, dass der Mensch als der Verantwortliche identifiziert wird, der aber auch die Freiheit hat, anders zu handeln. Angesichts des offenbar katastrophalen Gesamtergebnisses wird die Schuldfrage immer drängender.
Norbert Weißmann: Das ist wohl auch die Erklärung dafür, dass auf der Klimakonferenz 2023 in Dubai von einigen Hauptverursachern der Klimaerwärmung nach massivem Druck von Seiten der Länder des globalen Südens ein Fonds eingerichtet wurde, aus dem die Länder, die kaum zur Klimaerwärmung beigetragen haben, aber am meisten unter den Folgen leiden, einen finanziellen Ausgleich für die Bewältigung der erlittenen Schäden erhalten.
Markus Vogt: Sie bringen es auf den Punkt. In Abbildung 2 sind für das Jahr 2023 die 10 Länder mit den aktuell mengenmäßig höchsten Emissionen aufgeführt. Wir sehen, dass in dieser Abbildung entweder Industrieländer, Staaten mit großer Bevölkerung oder Ölstaaten vertreten sind. Der Rest der Welt teilt sich das restliche Drittel, obwohl sie zwei Drittel der Weltbevölkerung ausmachen.
Abbildung 2 CO2‐Emissionen der Staaten mit den höchsten Emissionen. 5
Länder mit einer viel geringeren CO2‐Freisetzung, die im Ranking erst viel weiter unten auftauchen würden, tragen aber sehr oft einen erheblichen Teil der Klimalasten, weil diese sich in den tropischen und subtropischen Regionen weit stärker auswirken als in den bislang noch gemäßigten Klimazonen. Die unterschiedliche Belastung des Planeten wird am besten durch die Emissionen pro Kopf sichtbar, die in Abbildung 3 dargestellt ist. Schon diese kleine Auswahl zeigt, dass die Menschen in den Industriestaaten den Planeten um ein Vielfaches stärker belasten als die Armen der Welt.
Abbildung 3 Vergleich der Pro‐Kopf‐CO2‐Emissionen in den 10 Staaten mit den höchsten Pro‐Kopf‐Werten im Vergleich mit großen Ländern des Südens.6
Hinzu kommt die unterschiedliche historische Last der Industriestaaten. Europa hat seit Beginn der Industrialisierung am meisten die Atmosphäre mit CO2 angereichert. Damit steht heute den anderen Staaten ein kleineres Restbudget an CO2 zur Verfügung, will man das weltweite Gesamtbudget zum Beispiel für das 2‐Grad‐Ziel einhalten. Man kann es sich so vorstellen:
Die Atmosphäre ist wie ein Mülleimer für Klimagase. Am Anfang wird der Eimer von den Industriestaaten gefüllt und wenn nur noch wenig Platz ist, dürfen die armen Länder auch ihr CO2 entsorgen, bekommen aber nur noch wenig Abfallbudget zur Verfügung gestellt, da der Eimer schon fast voll ist.
Der Eimer ist dann voll, wenn so viel CO2 in der Atmosphäre ist, dass die Erderwärmung gerade noch an der Belastungsgrenze gehalten wird, bevor das ganze System kippt und der Planet in großen Teilen unbewohnbar wird.
Norbert Weißmann: Aber gegen diese Zahlen wird eingewendet, dass wir durch unser Handeln bei einem Anteil von nur wenigen Prozent an der Emission von klimaschädlichen Gasen weltweit gar nicht viel ändern können. Da sollen doch erst einmal die großen Verschmutzer wie USA und China handeln.
Christian Wilhelm: Das klingt rein zahlenmäßig richtig. Auch wenn Deutschland quantitativ nur mit circa 2 Prozent der CO2‐Emission zum Klimawandel beiträgt, ist unsere Verantwortung weit größer. Einmal weil geschichtlich gesehen, also seit dem Beginn der Industrialisierung gerechnet, zunächst die Industriestaaten die Atmosphäre mit dem Löwenanteil belastet haben, inzwischen aber die Schwellenlänger ebenfalls einen hohen Anteil an der historischen Gesamtbelastung tragen. Die historischen Klimaschulden haben zum Beispiel die Klimakonferenz COP27 des Jahres 2022 in Ägypten intensiv und kontrovers beschäftigt. Zum Zweiten sind die Industriestaaten, wie auch Deutschland, für die globale Ausbreitung des CO2‐intensiven Wirtschafts‐ und Lebensstiles verantwortlich. Er ist Teil des westlichen Kulturmodells. Als Drittes ist zu bedenken, dass Deutschland einen erheblichen Teil der klimaschädlichen Produktion ausgelagert hat. Es profitiert durch den Import billiger Konsumgüter (Schuhe aus China, Textilien aus Bangladesch) und den Export von klimaschädlichen Produkten made in Germany (zum Beispiel Verbrennerautos). Als viertes Argument möchte ich schließlich anführen, dass Deutschland und Europa eine Vorbildwirkung haben und aufgrund der größeren Möglichkeiten für technische und soziale Innovationen auch eine Verantwortung, zu globaler Verbreitung klimafreundlicher Technologien beizutragen. Sie sehen, dass der geringe Beitrag unter ethischen und nicht nur unter dem Gesichtspunkt von Prozenten diskutiert werden muss.
Norbert Weißmann: Das Fairness Argument verstehe ich, wobei man uns aber zugutehalten muss, dass unsere Vorfahren am Anfang der Industrialisierung nicht wissen konnten, was sie damit anrichten. Wieso soll das eine ethische Frage sein?
Christian Wilhelm: Nehmen Sie folgendes Beispiel. Jemand hat nicht allzu viel Geld, um sich teure Mode leisten zu können. Er geht in ein Warenhaus sieht einen tollen und teuren Pullover und stielt ihn. Der Hausdetektiv erwischt den Dieb und stellt ihn zur Rede. Was würden Sie meinen, wie der Hausdetektiv reagiert, wenn der Dieb argumentieren würde: »Ich weiß nicht, was Sie sich so aufregen. Der Pullover macht doch nicht einmal ein Prozent des Warenwerts aus, der in ihrem Haus steht; da spielt es doch keine Rolle, wenn ein Pullover fehlt«.
Norbert Weißmann: Ich kann verstehen, was Sie meinen. Ein Diebstahl ist unmoralisch, auch wenn er nur einen kleinen Bruchteil eines anderen Eigentums betrifft. Aber zeigt uns das Beispiel nicht auch das Grundproblem? Alle anderen stehlen ja auch, die ganze Menschheit überstrapaziert das globale CO2‐Budget. Jeder Mensch ist nach dieser Interpretation ein Dieb, der mehr als ein bis 2 Tonnen CO2 emittiert, denn das ist die Menge, welche die Natur wieder aufnehmen kann. Wenn alle anderen auch stehlen, wenn stehlen eine eingeübte Praxis ist, ja als ein Gewohnheitsrecht erscheint, warum sollte ich mich dann zurückhalten, mich in meinen Freiheiten einschränken?
Markus Vogt: Das ist eine individualethische Frage. Es ist einer einzelnen Person wirklich kaum zu vermitteln, dass sie als einzige »Dumme« freiwilligen Verzicht üben soll. Das gleiche gilt natürlich auch für Staaten und deshalb hat die Weltgemeinschaft schon seit 1979 in Klimakonferenzen um Lösungen gerungen und sich schließlich 2015 in Paris auf das 1,5‐Grad‐Ziel geeinigt. Die Staaten sind jetzt in der moralischen Pflicht, ihre nationalen Klimaziele umzusetzen. Tun sie es nicht, dann ist es eine Art von Diebstahl an der gemeinsamen Zukunft.
Norbert Weißmann: Wollen Sie damit sagen, dass es nur fair ist, wenn die Industriestaaten in Zukunft ihren Wohlstand aufgeben müssen? Das wäre eine Forderung, mit der Sie in einer Demokratie kaum Mehrheiten hinter sich bringen können.
Markus Vogt: