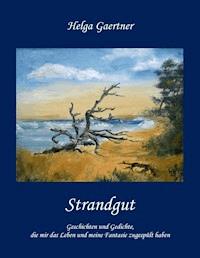
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Und da war wieder das Gefühl, jemand geht hinter mir. Ganz nah! Ich spüre seine Gegenwart und doch weiß ich genau, wenn ich mich umdrehe, ist da absolut nichts. Ich verdränge diese aufdringliche Empfindung, gehe einfach weiter, konzentriere mich auf den Weg. Die Spätsommersonne wird durch das Laub der Rotbuchen gebrochen und lässt den feinen Staub vor mir flimmern. Der schmale Pfad schlängelt sich stetig bergan. Meine Gedanken kreisen um diese absurde Erscheinung hinter mir. Eigentlich ist es nichts Gegenständliches, nur das Gefühl, dass ich plötzlich nicht mehr allein bin. Ich empfinde seine Gegenwart fast körperlich, womit neckt mich mein überreiztes Hirn da!?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Töchter Sabine und Anne
Inhalt
Strandgut
Im Frühlicht
Eine Schifffahrt
Bollulu
Wellen
Mykene
Abgestürzt
Usus
Hochzeitstag
Ein kurzer Abschied
Die Suche
Was ist ein Klauer
Sauna
Mein freier Tag
Stufen
November
Schwarze Vögel
Begegnung
Ein Brötchen
Heimkehr
Der gelbe Hund
Scherben
Meine Brücke
Piestany
Mont-Saint-Michel
Der hinter mir..
Die Anprobe
Härte
Der Raum
Fauxpas
Unruhe
Ein Strudel
Slibowitz
Pittiplatsch
Die Schöne
..und führe uns nicht in Versuchung
Eineuroneunzig
Pfefferkuchen
Moritz
Flucht
Isis und Ali
Wieder daheim
Strandgut
Am 26.Dezember 2004 erschütterte ein Erdbeben den Indischen Ozean. An den Stränden der anliegenden Länder ging das Wasser zuerst wie bei einer großen Ebbe zurück, sodass die Korallenriffe freilagen, um danach in riesigen, über zehn Meter hohen Wellen alle Strände zu überfluten. Allein auf Sumatra verschlang der Tsunami mehr als 200 000 Einheimische und Urlauber.
Er lief im ersten Frühlicht den Strand lang. Seine braunen Zehen gruben sich in den kühlen Sand. Er ging gebeugt, den Blick immer nur auf den Boden gerichtet. Die Arme hingen ihm schwer am Körper herab. Hin und wieder klappte sein ausgemergelter Körper nach vorn und die klauenhaften, dunklen Hände griffen nach etwas, was das Meer in der Nacht ans Ufer gespült hatte. Eine alte Dose, ein Fetzen Tang, eine gebleichte Wurzel, die nun beschlossen hatte, ihre lange Reise über den Ozean, zu beenden. Alles unterlag der genauen Kontrolle seiner langen Finger. Einiges nahm er mit. Es verschwand irgendwo in den Fetzen, die um seinen Körper hingen. Wenn die ersten Gäste an den Strand kamen, war er längst verschwunden. Er war namenlos. Die Einheimischen nannten ihn den Fremden. Dabei lebte er schon lange auf der Insel. Keiner konnte sich erinnern, wann er gekommen war. Es musste vor der großen Flut gewesen sein. Aber er war auch nicht wichtig. Er lief morgens den Strand lang und blieb dann den ganzen Tag unsichtbar. Es wäre nicht schwer gewesen, ihm zu folgen. Aber er war einfach nicht wichtig, weder für die Inselbewohner, noch für die Gäste der Ferienzentren.
Sobald die Sonne kam, stieg er auf einen kleinen Hügel. Die Dornenhecken dort störten ihn nicht. Er war unempfindlich gegen jede Art von Schmerz. Er kroch bis auf eine kleine mit Moos und Flechten bedeckte Anhöhe. Hier war er zu Hause. Achtlos stapelte er sein Strandgut an den Rand der winzigen Lichtung. Muscheln, Holz, Stofffetzen, ein Stück Schnur und Dosen schufen einen kleinen Wall. Ein mächtiger Stein bildete den Abschluss der winzigen Fläche. Vor Jahren hatte ein Olivenbaum Schatten gespendet. Seine Wurzeln krallen sich noch heute in das bisschen Erde zwischen den Steinen. Als den Baum eines Nachts ein Sturm fällte, wäre das auch fast sein Tod gewesen, aber er musste weiterleben, weiterwandern, weitersuchen. Seinen Kopf lehnte er an den Stein hinter sich. Nun erst konnte man sein Gesicht sehen. Es erinnerte an ein Filmnegativ. Das struppige, lange Haar war gelblichweiß, die von tiefen Falten durchzogene Gesichtshaut schwarzbraun. Die sehr hellen Augen öffneten sich selten. Meistens hielt er sie halb geschlossen.
Hier, auf dem kleinen Hügel, hob er die Lider nur so weit, dass er bis zum Horizont sehen konnte. Er konnte stundenlang so sitzen und aufs Meer blicken. Erst in der Dämmerung würde er sich wieder langsam erheben. Das war die Zeit, in der er zu den Küchen der Hotels schlenderte. Dort warf man ihm etwas Essbares zu oder verjagte ihn einfach. Beides nahm er mit stoischer Ruhe hin. Er bedankte sich nie. Er verschwand einfach wieder. Sein Gesicht zeigte niemals ein Lächeln, aber auch nie Unzufriedenheit oder Trauer. Er war namenlos. Auch für das Personal der Ferienzentren war er der Fremde. Auf seiner kleinen Anhöhe, fern aller anderen Betriebsamkeit, rollte er sich zusammen und schloss die Augen. Eigentlich begann jetzt im Schlaf erst wieder sein wirkliches Leben. Immer wenn er einschlief, hatte er denselben Traum. Dreiundzwanzig Jahre schon! Dreiundzwanzig endlos lange Jahre!
“Bring uns ein paar Oliven mit von unserem geheimen Baum!” Mein vierjähriges Töchterchen kann ihre Bitten sehr bestimmend stellen.
“Muss ich mir erst noch überlegen. Ich will nur den Strand ein bisschen ablaufen, ob ich es bis zum Hügel schaffe, weiß ich nicht.”
“Du wirst es schon schaffen!” Susen schaut mich schmunzelnd von der Seite an. “Wenn Lisa dich so schön bittet!?”
“Ich komme mit, ich komme mit!”, jubelt mein Dreikäsehoch mir zu.
“Kommt nicht in Frage! Es ist jetzt schon viel zu heiß und außerdem will Papi joggen, sein Bauch wird vom vielen guten Essen sowieso zu rund! Komm Lisa, wir bauen eine große Sandburg.”
“Mit Muscheln und Steinchen und Stöckchen aber!”
“Mit allem, was du findest. ”
“Und als Fenster nehmen wir die Oliven, die Papi mitbringt. Viele Oliven für viele, viele Burgfenster!“
Die letzten Worte höre ich gerade noch, bevor ich losrenne. Ich laufe meine gewohnte Morgenstrecke. Am Strand entlang, an den Hotels vorbei, bis die Bucht von einem kleinen Berg begrenzt wird. Dort kehre ich meistens um. Heute strample ich auch noch den Hügel hoch.
Abends sind wir mit Lisa den Weg auch schon gegangen. Lisa wollte damals unbedingt noch wissen, was hinter dem Berg war, und wir stiegen gemächlich zu der kleinen Anhöhe. Überraschenderweise endete der Pfad auf einer winzigen freien Fläche. Ein riesiger Stein hatte vor Zeiten den weiteren Weg versperrt und niemand fand es der Mühe wert, ihn wegzuräumen. Gleich neben dem Stein kämpft ein alter Olivenbaum ums Überleben. Wer weiß, wer eher da war, der Baum oder der Stein!? Wir hatten ein idyllisches Plätzchen gefunden. Von hier aus konnte man bis aufs Meer sehen. Es war ein fantastischer Ausblick!
Lisa war begeistert! “Das ist unser geheimer Platz, Papi! Den verraten wir niemandem!
Auch nicht der Frau, die mit uns am Tisch sitzt im Hotel.”
“Einverstanden! In ein paar Tagen fliegen wir ja sowieso wieder nach Hause.
Bis dahin werden wir drei keinem etwas verraten, großes Ehrenwort.” Ich hob zwei Finger und schwor. Mein Töchterchen war zufrieden.
Meine Frau blinzelte mir schmunzelnd zu: “Deine Ehrenwörter kenne ich.”
“Habe ich euch nicht mit meinem Ehrenwort versprochen, Weihnachten wird im Meer gebadet? Und wir baden im Meer. Weihnachten!” Ich spielte Beleidigtsein.
“Hast du, mein Schatz. Es ist wunderschön hier. Komm wir setzen uns einen Moment. Lange können wir nicht bleiben, du weißt, wie schnell es dunkel wird, wenn die Sonne untergegangen ist.“
Susen hatte wie so oft recht. Wir setzten uns und lehnten uns an den von der Sonne erhitzten Stein. Es war wunderschön! Den Strand konnte man von hier aus nicht sehen. Da wir saßen, sah es aus, als wenn gleich hinter dem Buschwerk das Meer beginnen würde.
Auf dem Weg ins Hotel zurück mussten wir uns sehr sputen. Papa war wieder einmal Pferdchen und Lisa auf meinen Schultern Reiter.
Das war vor vierzehn Tagen. Inzwischen ist unser Urlaub auf ganze vier Tage zusammengeschmolzen. Dann werden wir wieder ins kalte Deutschland fliegen. Vielleicht liegt bissel Schnee!? Unwahrscheinlich. Weihnachten bescherte uns meistens Schmuddelwetter. Gut, dass wir uns diese Reise geleistet haben!
Heute mache ich es mir am warmen Stein auch wieder bequem. Der Ölbaum über mir spendet freigiebig Schatten und ich genieße das Geflimmer des Wassers. Es ist jetzt schon sehr heiß. Die Pause tut gut. Komisch, dass man heute den Strand sehen kann! Es sieht aus, als wenn das Wasser wie bei Ebbe zurückgeht. Ich habe Zeit. Es ist schön, mal nicht Lisas Geplapper zu hören, mal nicht auf die tausend Fragen zu antworten! Ich habe viel, viel Zeit.
Ich muss eingeschlafen sein. Das Rauschen des Meeres hat zugenommen. Im Traum liege ich mit Susen und Lisa am Wasser. Es umspült meine Füße.
Es umspült meine Füße!!!
Das ist immer der Moment, wo er aufwacht. Er lässt die Augen geschlossen. Er will nicht in die Gegenwart zurück! Ihm gehört die Vergangenheit! Dunkel erinnert er sich noch an die folgenden Stunden.
Wasser, Wasser, Wasser. Langsam verschwindet es. Er rennt. Alles ist anders! Kein Strand mehr, nur noch Trümmer. Boote mitten im Land! Schreie vom Land. Unser Hotel! Es ist verschwunden!!
Susen!
Lisa!
Hier streikte jedes Mal sein Gedächtnis. Die nächste Zeit verschwand in einem dunklen Loch seines Erinnerungsvermögens. Er weiß nur, dass er suchen muss. Unaufhaltsam suchen. Den Strand läuft er auf und ab. Er wendet alles um und um. Sucht! Sammelt! Sucht! Dreiundzwanzig lange, lange Jahre.
Langsam erhebt er sich. Die Füße finden ihren Weg zum Strand. Man übersieht ihn. Ihm ist es egal. Er ist der Fremde. Ins Land gekommen vor vielen, vielen Jahren. Er kann nicht hier weggehen. Er muss bleiben und suchen. Er sucht Strandgut.
Im Frühlicht
Weich gleitet über den See mein Kahn.
Winzige Wellen kräuseln sich,
Blitzen auf im Morgenlicht
Eilen zum Ufer und wiegen mich.
Mein Rudern bringt mich sanft voran.
Noch ist der Tag nicht ganz erwacht.
Eine Ammer singt im hohen Ried
Aus voller Kehle ihr Hochzeitslied.
Zartblauer Wind übers Wasser zieht
Vertreibt die letzten Schleier der Nacht.
Es fällt der Linden süßer Duft
Sommerschwer herab auf mich.
Die Zweige der Bäume berühren sich,
Dämpfen und filtern das zage Licht.
Und immer wieder die Ammer ruft.
Häng die Gedanken in den Wind,
Träume vom Gestern und vom Morgen,
Fühle im Heute mich geborgen,
Und lass mich treiben. Alle Sorgen
In diesem Frühlicht nichtig sind.
Eine Schifffahrt
Am frühen Morgen, noch vor Sonnenaufgang, hatte das kleine Schiff die Anker gelichtet. Ich sitze direkt an der Reling und spiele mit dem Sonnenhut, der vor mir auf dem Tisch liegt. Mein Blick und meine Gedanken gleiten über das Ägäische Meer. Die Sonne ringt mit dem morgendlichen Dunst über dem anthrazitfarbenen Wasser. Wo ihre Strahlen die dünne Nebelschicht durchdringen, blitzen tausende weißer Lichter im Meer auf. Kleine Wogen eilen unserem Schiff entgegen, werden vom Bug zerpflügt und ordnen sich am Heck wieder zu kurzen, dunklen Wellen mit winzigen Schaumkronen. Unser Ziel, die Insel Hydra, liegt noch ein paar Stunden Bootsfahrt entfernt. Ich habe viel Zeit. Am Geplauder der anderen Gäste beteilige ich mich nicht. Ich schaue.
Ufer schwimmen vorbei. Diese fernen Landlinien wecken meine Fantasie. Da drüben reicht ein Pinienwald bis ans Wasser. Blaudunkle Baumkronen streben in den blassen Morgenhimmel. Sie schwingen sich einen Berg hinauf, aber bevor sie ihn in Besitz nehmen können, bricht der Hügel jäh ab. Ob es Menschen waren, die dort Steine brachen oder ob das Meer selbst in einer stürmischen Nacht einen Teil der Landzunge wegspülte? Eine steile Felswand entstand und große Brocken desselben Gesteins ragen noch aus dem Wasser. An der Abbruchkante kann ich eine freie Fläche erkennen, aus der Ferne betrachtet gefährlich nahe am Abgrund. Das ferne, fremde Stück Erde weckt meine Fantasie und so denke ich mich genau an diese Stelle.
Jeden Tag vor Sonnenaufgang geht er die weite Strecke vom Dorf hierher. Mehr und mehr macht ihm sein Rheuma zu schaffen. Bis vor ein paar Jahren schaffte er ohne Stock den beschwerlichen Gang über die Felder und die Ziegenweiden. Jetzt stützt er sich auf einen selbst geschnitzten Stab aus Olivenholz. Dunkel umhüllen ihn die Schatten der Pinien bis zu der Stelle, wo sich der Feldweg dem Meer zuwendet. Wenn die Sonne den Morgennebel besiegt hat, steht er ganz oben auf dem Hügel. Lange verweilt er dort. Immer zur gleichen Zeit, bei jeder Witterung, gibt er seinen mageren Körper dem Seewind, der Sonne oder auch dem Regen preis, denkt an den einen Tag vor vielen Jahren. Ein ganzes Menschenleben lang ist das her, sein Leben.
Am deutlichsten sieht er in der Erinnerung ihre Augen. Dunkle, etwas schräg stehende Augen. Sie konnten ihn mit so viel Liebe ansehen und bekamen dabei einen Samtblick, wie er es damals nannte. Oder sie schlossen sich zu schmalen Schlitzen, wenn sie verschmitzt lachte. Und Nike lachte gern und oft. Brachte selbst ihn zum Lachen, den seine Freunde einen Griesgram nannten.
Nike, seine Freundin, seine Liebste und seit ein paar Monaten so etwas wie seine Frau. Zumindest Nike sah das so, nachdem sie die verlassene Scheune entdeckt hatten. Sie stand mitten in einem Olivenhain. Die winzigen Früchte der alten Bäume lohnte es nicht mehr zu ernten. So wartete auch die Scheune weit ab vom Dorf darauf, dass sie ein Windstoß endgültig davon befreite, sich aufrecht zu halten. Das Dach bot nur noch an wenigen Stellen Schutz vor dem Regen und eine Seitenwand wurde einzig von einem altersschwachen Tor gehalten. Dieser gebrechliche Verschlag war seit einiger Zeit ihr heimlicher Treffpunkt. Seinem Vater hatte er verschwiegen, dass es eine Ziegenhirtin war, die ihm nicht mehr aus dem Kopf ging und mit der er seine Abende verbrachte. Seine Freunde wussten sowieso Bescheid, neckten ihn und begrüßten ihn mit einem Meckern, wenn man sich traf.
Er erinnert sich an die Stunden im Heu. Es roch nach den Kräutern der umliegenden Wiesen und wenn es geregnet hatte, nach feuchter, warmer Erde. Nike flüsterte ihm wunderbare Dinge ins Ohr. Er verbrachte die Tage wie im Traum auf dem Bauernhof seines Vaters. Nur abends, bei Nike, lebte er wirklich. Nike, seine Liebste, seine Frau!
Und dann kam der bewusste Tag, vor langer, langer Zeit. Sie hatte ihn am frühen Morgen zum Steinbruch bestellt. Schon vor ihm war sie dort. Die zarte Gestalt hob sich deutlich gegen den Himmel ab und wurde von der aufgehenden Sonne umflossen. Sie schaute aufs Meer, stand lange so. Als sie sich zu ihm umdrehte, blickten ihn ihre Samtaugen unendlich glücklich an. Über dem so vertrauten Mädchen lag ein Zauber. Er hatte sie noch nie so schön gesehen.
„Wir bekommen ein Kind, Patras, ein Baby!“
Das traf ihn wie eine Keule. Er erschrak furchtbar. Tausend Gedanken gingen durch seinen Kopf. Er wollte kein Kind! Jetzt noch nicht! Überhaupt nicht! Kinder bringen alles durcheinander im Leben! Er weiß nicht mehr, was er ihr damals sagte und was er dachte. Sie sah ihn nur an. Ihre Augen verloren allen
Glanz. Langsam drehte sie sich um und sprang.
„Warum konnte ich sie nicht halten? Sie stand so nahe bei mir!
Wollte ich sie nicht halten?“
Der alte Mann schaut noch eine Weile aufs Meer. Die Sonne hat den Nebel besiegt. Er steht an der Kante des Abbruches. Zögernd dreht er sich um und geht den Weg zurück ins Dorf.
„Schön, so eine Schifffahrt, finden Sie nicht auch!?“ Eine Blondine mit grellem Make-up reißt mich aus meinen Träumereien. Sie plappert eine Weile munter drauflos. Ich bin höflich und heuchle Interesse. Als ich auf ihre Fragen ein paar Mal falsche Antworten gegeben habe, lässt sie von mir ab und widmet sich einem älteren, weißhaarigen Herrn am Nachbartisch. Wieder erliege ich dem Zauber des Meeres. Die Sonne scheint jetzt durch die breite Krempe meines Sonnenhutes. Das Wechselspiel von geblendet sein und Schattenspielen lässt das Wasser unwirklich erscheinen, wie eine Fläche, die es zu betreten lohne oder in die man zumindest eintauchen, sich fallen lassen könne.
So tauche ich ein in diese andere Dimension. Lasse mich in meiner Fantasie fallen, finde mich wieder im Dämmerlicht einer anderen Welt, genauso vielfältig, wenn nicht gar reichhaltiger als die oberhalb der Wasserfläche, sinke ein in Graugrünes, Weiches, Wohltuendes. Um mich herum Winzlinge, die ich nicht mit Namen kenne. Gehören sie zur Flora des Wassers oder schon zur Fauna? Ich genieße das Versinken, gleite tiefer. Gedämpft, gebrochen über mir die Sonne. Viel weicher sind ihre Strahlen hier unten und doch belebt sie auch diese Welt mit ihrem Licht. Vor mir ein Flimmern, ein Schwarm kleiner Fische! Wie im Herbst die Zugvögel am Himmel so schwingen sich hier die Sardinen nach einer nur ihnen bekannten Choreografie alle gleichzeitig zur Seite, beschreiben einen großen Bogen, fügen sich zum Kreis, schwenken nach oben und zurück, um sich gleich darauf wieder im Kreis zu einen, sind ständig in Bewegung. Keiner entgleitet dieser Geschlossenheit. Ich werde nicht müde zuzuschauen.
Plötzlich wird der Tanz gestört. Etwas Großes, Derbes drängt sich in diese friedliche Verbundenheit. Ein Delfin, dann noch einer, eine ganze Delfingruppe lässt sich die willkommene Mahlzeit nicht entgehen. Die Idylle ist jäh gestört. Ich bin entsetzt über die Räuber, schreie den Nächstbesten an! Erstaunt mustert er mich, scheint mich auszulachen, schlingt seine Sardine runter und dann geschieht das Sonderbare, ich kann seine Gedanken lesen.
„Was willst du hier bei uns? Du badest nicht, du hast dich nur hergedacht! Das ist unnormal! Was also willst du hier bei uns?“
„Ich habe gerade gesehen, dass es bei euch im Wasser genauso zugeht, wie bei uns auf der Erde, die kleinen Fische schwimmen friedlich im Reigen und werden von euch Großen gefressen.“
„Was willst du eigentlich?“ Er scheint jede seiner Reden mit dieser Frage zu beginnen. „Wir können doch nicht hungern, bloß um die Kreise der Fischlein nicht zu stören! Außerdem schwimmen sie keineswegs im Reigen, sondern lassen bei dieser Bewegung Wasser durch ihre Kiemen strömen. Kleine Lebewesen filtern sie so heraus. Bedauerst du auch die Krebschen und anderen Winzlinge, die ihnen als Nahrung dienen?“ Schnapp, schon beendet die nächste Sardine ihr kurzes Leben im Bauch des Delfins. Nachdem er sie verschluckt hat, wendet er sich wieder mir zu: “Warum regst du dich auf? Wir fressen nur so lange, bis wir satt sind. Es bleiben immer ein paar Fische übrig, die wieder Neue produzieren können. Ist das bei euch oben auch so?“ Und diesmal bin ich mir sicher, dass er mich angrinst.
Ich versuche meine Gedanken vor ihm zu verschließen, aber ich weiß genau, er kennt sich mit den Gepflogenheiten der Erdbewohner aus. So ist ihm bekannt, dass wir nicht aufhören zu essen, selbst wenn wir keinen Hunger mehr haben. Wir häufen Dinge an, die wir nicht unbedingt zum Überleben brauchen. Ausgelöst wird diese Krankheit durch den Bazillus Geld. Dabei wäre unser Leben viel einfacher, wenn wir uns, wie ihr, auf das Nötigste beschränkten. Es reichte aus, nur so viel zu besitzen, um satt zu werden und ein Dach über dem Kopf zu haben. Dann würden keine Mitmenschen mehr verhungern, es langte für alle.
Der Delfin grinst mich an: „Na also, jetzt brauch ich nicht mehr zu fragen, warum du hier unten herumschimpfst. Hast mich durch deine eigenen Gedanken begriffen. Ihr mischt euch schon viel zu viel in unsere Welt ein! Eure Netze rauben aus dem Meer unzählige Mitbewohner. Übrigens, bist auch du von diesem Bazillus infiziert?“
Ich entziehe mich einer Antwort, tauche wieder auf und lasse meine Gewissensbisse einfach in eine Schublade gleiten. Ja, auch ich bin infiziert, wenn auch nur geringfügig. Aber ich habe Urlaub und will die Bootsfahrt genießen!
Am späten Vormittag erreicht unser Boot die Insel Hydra. Den Namen erhielt sie wegen ihres Wasserreichtums. Das ist aber schon sehr lange her. Auch hier, wie in vielen Gegenden Griechenlands, beraubte man die steilen Hänge ihres natürlichen Schutzes, des Waldes, und der gemarterte, nackte Boden der Berge kann die spärlichen Regenfälle nicht mehr aufnehmen und speichern. Strahlend weiße Häuser mit blauen Türen und ebensolchen Fensterläden kleben in der südlichen Sonne an steilen Hängen. Alles atmet Wärme, Licht und Freundlichkeit. Auf der ganzen Insel gibt es kein Auto. Maulesel warten geduldig bereits am Hafen auf ihre Lasten. Ich schlängle mich zwischen den Touristen, die die Kioske und kleinen Läden erobern hindurch und betrete eine schmale, ansteigende Gasse. Bald merke ich, dass selbst der steilste Weg unweigerlich in Treppen mündet und die verzweigen sich weiter oben in weitere Treppen, in Gässchen und wieder in Treppen.
Immer höher steige ich den Berg hinauf. Eine kleine Kirche duckt sich an einen wunderschönen Baum mit tellergroßen gelblichweißen Blüten. Daneben ein winziger Garten. Der Duft von Thymian und Rosmarin weht mich an. Weit unter mir liegt der kleine Hafen. Wieder biege ich in eine Gasse ein, die auf der rechten Seite von einer Mauer begrenzt wird und da stehe ich ihm gegenüber. Einem schon etwas ergrauten Muli, der stoisch in der Sonne wartet.
Hallo Muli!“, spreche ich ihn an. Er scheint mich gar nicht wahrzunehmen, oder will er in seiner Mittagspause nur nicht gestört werden? Ich kraule ihn hinter den Ohren. Das scheint ihm zu gefallen, denn die halb geschlossenen Augen öffnen sich und sehen mich an, große, dunkelbraune, feuchte Maultieraugen beschattet von langen, dichten Wimpern.
„Hey, Muli! Wie geht es dir so auf der Insel der Maulesel und Menschen?“
„Ich weiß nicht, was die Frage bedeutet. Ich stehe halt hier und warte.“
„Worauf wartest du?“
„Auch das weiß ich nicht. Irgendwann wird ein Zweibeiner kommen und etwas auf meinen Rücken laden oder er bindet mich los, führt mich woanders hin und lädt dort etwas auf meinen Rücken. Dann laufe ich die dummen Stufen hoch oder auch runter, vielleicht bis zum Hafen. Dort stehen eine Menge, die genauso aussehen wie ich.“
„Wie heißt du? Wenn wir uns unterhalten, möchte ich gern deinen Namen wissen!“
„Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Zweibeiner ruft mich, wenn ich loslaufen soll Holla-Holla und wenn ich stehen soll Ttrrrrrrrr. Ich glaube, das ist mein Name.“
„Nein, das ist nur ein Befehl, kein Name, Muli. Ich werde dich Emil nennen, wenn du nichts dagegen hast. Ich kenne einen Mann, der sieht dir bissel ähnlich.“
„Meinetwegen. Nenne mich so.“
Ich krame aus meinem Rucksack einen Apfel hervor und teile ihn mit dem Muli. Beim Kauen blicken wir uns wieder tief in die Augen. Mein Gegenüber schmatzt und genießt.
Plötzlich öffnet sich in der Mauer eine Tür, die ich gar nicht bemerkt hatte. Ein junger Mann kommt mit einem kleinen Tisch und zwei Stühlen. Alles packt er auf den Rücken des Maulesels. Und dann hört Emil, oder wie auch immer sein Name sein mag, wieder seinen vermeintlichen Namen: „Holla-Holla!“
Ich schaue den beiden noch eine Weile hinterher, dann steige ich ein paar Stufen hinab. Das Schild einer Gaststätte hätte ich fast übersehen, üppiges Weinlaub verdeckt es. Unter diesen grünen Ranken laden zwei blank gescheuerte Holztische und ein paar Stühle, mit der hier üblichen aus Hanfstricken geflochtenen, etwas unbequemen Sitzfläche, zum Verweilen ein. So weit oben verirren sich kaum Touristen in die Taverne. Trotzdem hat dieser herrlich kühle Platz seine Gäste. An einem Tisch sitzen zwei Männer. Auf meinen freundlichen Gruß reagiert nur der Jüngere. Der zweite Tisch ist von einer gelben Katze belegt und zu ihr geselle ich mich. Sie lässt sich auch nicht stören, putzt sich weiter, blinzelt mich nur hin und wieder aus zusammengekniffenen Augen an. Mein Streicheln quittiert sie mit einem leisen Schnurren. Der Wirt verscheucht sie und fragt mich, was ich möchte. Da ich ihn natürlich nicht verstanden habe, rede ich mit den Händen und hoffe trotzdem, dass er mir etwas einigermaßen Genießbares bringt. Was er dann auftischt, übertrifft alle meine Erwartungen, Salat, Feta, Zaziki knuspriges Brot und ein vollmundig roter Landwein. Ich habe noch viel Zeit bis zur Rückfahrt des Bootes und die nehme ich mir an diesem gemütlichen Plätzchen auch. Die Katze liegt inzwischen wieder auf dem Tisch, beobachtet mich beim Essen, ist aber anscheinend satt. Durch das Weinlaub schlüpfen ein paar Sonnenstrahlen und malen auf dem Tisch und dem Fell der Katze helle Kringel. Alles atmet Friede und Ruhe und Freundlichkeit.
Am Nachbartisch beginnen sich die Männer zu streiten. Zumindest der Ältere wird immer lauter. Er bellt seine Worte dem Jüngeren geradezu ins Gesicht, erreicht aber nur, dass der hellauf lacht. Ich sehe sie mir genauer an. Die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Der alte Mann mit dunklem Anzug, Krawatte und Hut, das Gesicht von der Sonne des Südens gegerbt und von vielen Falten durchzogen, redet sich immer mehr in Rage. Er hätte fast sein Glas umgeschmissen, als er wieder und wieder mit der Faust auf den Tisch schlägt. Der Jüngere, vielleicht sein Sohn, trägt moderne beigefarbene Jeans, ein Hemd im selben Ton und teure italienische Sandalen. Je temperamentvoller der Alte auf den Jungen einredet, umso mehr scheint es diesen zu amüsieren. Selbst der Katze wird es zu laut, sie flüchtet sich ins Haus. Ich bin erstaunt, als der junge Mann auf mich zukommt und sich in gebrochenem Deutsch für seinen Vater entschuldigt. Er bittet mich, wenn es mir nichts ausmachen würde und ich ausgetrunken hätte, zu gehen. Sein Vater sei der altmodischen Meinung, eine Frau, noch dazu allein, gehöre nicht hier oben in ein Gasthaus. Das sei den Männern vorbehalten.
„Er ist eben leider einer vom alten Schlag, entschuldigen Sie bitte sein Benehmen.“ Ein Augenzwinkern, ein Lächeln und er setzt sich wieder zum Vater. Hinter mir steht bereits der Wirt mit der Rechnung.
Ich habe das Gefühl, die Sonne scheint ein bisschen weniger hell, als ich die Gasse wieder betrete. Die Insel hatte mich so einladend empfangen und ich vertraute dieser freundlichen Geste, aber auch hier wohnen Menschen mit ihren ganz besonderen Gepflogenheiten und Grundsätzen. Ich vergaß mein Bauchgefühl zu befragen, als ich hier rastete.
Langsam steige ich die vielen Treppen hinab zum Hafen. Unter den Touristen fühle ich mich plötzlich heimisch. Dort gehöre ich hin. Hier wäre jeder Wirt über meinen Besuch erfreut gewesen und über meine Euros. Die Insel hat etwas von ihrem Zauber für mich verloren.
Bis zur Abfahrt des Schiffes sind es noch einige Stunden, also schlendere ich einen Weg entlang. Er führt mich unweigerlich wieder auf eine kleine Anhöhe. An der Ruine eines Hauses hat eine Bank den Verfall des Gemäuers hinter sich seltsamerweise überstanden. Dankbar nehme ich auf ihr Platz und schaue aufs Meer. Von hier oben schimmert das Wasser in den unterschiedlichsten Farben. Unter mir, in Ufernähe zeigt es sich türkisfarben, geht aber bald in ein tiefes Blau über und das wieder, weiter draußen in Dunkelgrau, bis es sich am Horizont hellgrau mit dem blassen Frühsommerhimmel vermählt. Neben mir raschelt es im dürren Gras. Es ist wunderschön hier! Langsam gewinne ich meine Gelassenheit zurück, genieße die Farben und Formen mit denen meine Augen verwöhnt werden und schimpfe ein bisschen mit mir, dass ich mich durch die Episode in dem kleinen Ausschank auf dem Berg so aus meinem Gleichgewicht bringen ließ. Ich fühle, wie die Zeit dahin rinnt, um mich herum und in mir, so wie sie auch das Haus hinter mir zeichnete.
Am späten Nachmittag nimmt uns das Boot wieder an Bord. Diesmal setze ich mich auf das obere Deck. Noch beweist die Sonne ihre Kraft, aber ein leichter Wind kündet den scheidenden Tag an. Auch die Wellen haben zugenommen. Wieder sitze ich an der Reling und wieder spielt meine rechte Hand mit der Krempe meines Sonnenhutes vor mir auf dem Tisch. Die geschwätzige Blondine hat eine Gruppe Ebenbürtiger um sich gesammelt und verschwindet mit ihnen unter Deck. Jetzt bin ich allein mit mir und meinem Hut und meinen Gedanken. Wieder schwimmen Inseln vorbei, nur erzählen sie mir keine Geschichten mehr. Ganz tief in mir quält mich noch der Gedanke an die Taverne auf dem Berg.
„Stört es Sie, wenn ich mich zu Ihnen setze?“ Ein älterer Mann fragt mich das und es wäre unhöflich, einfach nein zu sagen. Trotzdem bin ich froh, dass er mich nicht gleich mit belanglosen Sätzen belästigt. Wir schweigen und schauen. Die Sonne neigt sich der Horizontlinie entgegen und verwandelt das Wasser in flüssiges Silber. Als sie die Wasserlinie berührt, färbt sie diese ganz langsam erst golden, dann kupferfarben und zuletzt, kurz vor ihrem völligen Eintauchen ins Meer blutrot. Unser Boot durchschneidet diese Kostbarkeit, gleitet und gleitet und gleitet vorwärts.
„Delfine!“ Eine Hand zeigt an meinem Hut vorbei aufs Meer. „Wie sie springen! Als ob sie uns noch eine Sondervorstellung geben wollten!“
Ich folge der Hand mit dem Blick und bin fasziniert von dem Schauspiel. Schlanke, schwarzglänzende Leiber schwingen sich aus dem Meer, schnellen im Bogen durch die Luft, einige überschlagen sich sogar und tauchen elegant wieder in ihr Element ein. Man hat das Gefühl, dass sie die letzten Sonnenstrahlen genießen, dass sie in der Abendluft baden. Wir beide, mein Nachbar und ich, sehen gebannt diesem außergewöhnlichen Schauspiel zu. Eigentlich wollte ich nur aufs Meer schauen, vielleicht wieder ein bisschen träumen. Das gemeinsame Erlebnis lockert meine Zunge und ich erzähle vom vergangenen Tag und meinen Begegnungen.
„Heute Vormittag habe ich mich sogar mit einem Delfin unterhalten.“
„Hat er Ihnen die richtigen Antworten gegeben?“
„Ja, und sie fielen nicht unbedingt zu meinen Gunsten aus.“
„Kann ich mir denken. So was hab ich auch schon gemacht. Ich unterhalte mich hin und wieder zu Hause mit meinem Hund. Ich habe einen recht gescheiten Hund, müssen Sie wissen!“
Inzwischen ist es dunkel geworden. Die spärliche Beleuchtung auf dem oberen Deck lässt die Wasserfläche unter uns nur erahnen. Zögerlich wagen sich erste Sterne in die Unendlichkeit über uns. Unsere Worte tropfen in die anbrechende Nacht, klingen eine Weile nach, verstummen endlich. Wir schweigen und schauen und träumen.
„Das da oben in der Schenke auf der Insel tut mir leid! Wir hätten zusammen gehen sollen. Auch ich habe die vielen Stufen erklommen, aber sicher gerade in eine andere Richtung.“ Und dann legt sich ganz sanft eine warme Altmännerhand auf meine von vielen Adern und dem Alter gezeichnete Hand.
Ist doch schön, so eine Schifffahrt, denken wir beide.
Bollulo
Schwarze Felsen stürzen in gischtendes Meer. Zwischen diesen vor Jahrmillionen aufgetürmten steinernen Wänden brandet Welle um Welle in eine kleine Bucht aus schwarzem Sand. Es ist einer der schönsten Strände in der Nähe von Puerto de la Cruz auf Teneriffa. Der dunkelgraue Atlantik vermählt sich am Horizont mit einem sattblauen Himmel. Bevor die Wellen die Felsen mit weißer Gischt überschütten, färben sie sich erst azurblau und in Untiefen türkis. Es ist ein Schauspiel, das mich jedes Mal, wenn ich es sehe, begeistert. Zum Schwimmen lädt dieser Strand nicht ein, auch wenn der Sand nirgends so fein ist und die Bucht den Winden Teneriffas trotzt, aber zum Schauen.
So führt uns meistens unsere erste Wanderung auf Teneriffa zum Bollulo-Strand. Wir durchqueren die halbe Stadt, lassen die letzten Hotelburgen hinter uns und tauchen in die ländliche Gegend Puertos ein. Hübsche kleine Villen säumen die schmale Straße. Ein Baranko ist auch keine Herausforderung für meine Wanderschuhe. Stufen führen in seinen Grund und auf der Gegenseite wieder hinauf zu einer idyllisch gelegenen Finka. Während der ganzen Wanderung begleitet uns das Rauschen des Meeres in 100 m Tiefe. Nun gehen wir durch Bananenplantagen. Sie werden von Avokadobäumen und Palmen unterbrochen. Eidechsen huschen an Mauern entlang, verstecken sich in den Rosetten der Hauswurz. Auf dürrem Boden behauptet sich eine Agave. Vor ihrem Absterben brachte sie noch eine vier Meter hohe Blüte hervor.
Endlich stehen wir oberhalb des Bollulo-Strandes. Mit ein paar anderen einsamen Wanderern blicken wir hinunter zum Meer. Uns trennen nur noch ein Pfad und einige Treppen von unserem Ziel.
Der warme schwarze Sand schmeichelt am Strand unseren Füßen. Während ich die Handtücher ausbreite, steht mein Mann schon in der Badehose da und schreitet zielsicher ins Meer. Die erste Welle beherrscht er noch, doch die Zweite holt ihn von den Füßen und wirft ihn unsanft auf den harten Sand. Er sieht ein, dass man den Elementen als kleiner Mensch nicht trotzen darf. Brav setzt er sich neben mich auf das Handtuch.
Es ist schön, zu zweit so zu sitzen und die Zeit wie die anschäumenden Wellen vorbeifließen zu lassen. Ich schmecke die salzige Luft.
“Was glaubst du liegt hinter dem Horizont dort draußen, Europa, Amerika?”, träume ich vor mich hin.
“Ich schätze erst mal Madeira. Wenn uns der Fels rechts nicht die Sicht versperren würde, könnten wir vielleicht La Palma sehen.”
Welle um Welle rollt vor uns in die kleine Bucht. Ein paar hungrige Möwen betteln. In unserem Rucksack sind nur zwei Äpfel und ein paar Bananen, keine Möwenspeise, so segeln sie enttäuscht davon. Vor uns, mitten im Meer, trotzt ein hoher Fels der Brandung. Die anstürmenden Wellen haben ihn an einigen Stellen rundgeschliffen. Wo der Lavafels mit weicheren Gesteinsarten durchsetzt ist, entstanden kleine Grotten. Diese winzigen Winkel eroberten sich Moose, Flechten und auch schon erste Dickblattgewächse. Jeder Wellenbrecher überschüttet ein solches Biotop mit funkelnden Tropfen.
“Wollen wir noch zum Paradies?” Mein Mann weckt mich aus meiner Träumerei. Das Paradies ist ein Cafe dreihundert Meter über dem Bollulo-Strand. Höhenmeter!
“Einverstanden! Dann war es doch richtig, die Wanderschuhe anzuziehen.” Ich denke etwas beklommen an den Aufstieg. Als wir vor vier Jahren hier waren, kraxelten wir schon einmal die steile Wand zum `Cafe Pareiso´, wie es in der Landessprache heißt, empor.
Handtücher und die nasse Badehose werden im Rucksack verstaut. Wir steigen den Pfad zur dörflichen Straße hoch.





























