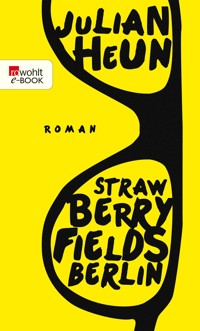
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei junge Männer, zwei Geschichten: Schüttler, ein Berliner Boulevardjournalist, durchlebt sadomasochistische Arbeitstage, muss grenzdebile Artikel und Promi-Storys schreiben. In der Freizeit treibt er sich mit einer Bande herum, die auf behornbrillte Hipster schießt - mit Sektkorken. Doch trotz aller Abgebrühtheit träumt Schüttler von einem anderen Leben … Ein Leben, das Robert gefunden zu haben glaubt. Robert ist ausgestiegen aus dem deutschen Mief und reist nun, bis über beide Ohren verliebt, der schönen Luca durch Indien hinterher. Er findet sie in einem Hippie-Camp auf den Andamanen, feiert, lebt und liebt. Doch die Romanze wie die endlosen Partys werden Robert bald fremd und fremder. Julian Heun lässt Robert und Schüttler überraschend zusammentreffen – und lotet das Lebensgefühl der Twentysomethings zwischen Anpassung und Exzess, Vernunft und Freiheit aus. Die «unerhört poetische Kraft» (NZZ) des Slam-Dichters Julian Heun spürt man auch in seinem Romandebüt: Kühn konstruiert, frisch, originell und kraftvoll erzählt, ist «Strawberry Fields Berlin» ein pointiertes, oft ironisches Zeitbild – und dabei durchdrungen von einer wunderbaren Sehnsucht nach dem wahren Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Julian Heun
Strawberry Fields Berlin
Roman
«There must be some way out of here said the joker to the thief»
BOB DYLAN
und suchst du das nicht auch
irgendein weitdadraußen
fern von den ganzen schweinen
ein weitdadraußen das leuchtet
entwaffnend und entwurzelnd schön
in einer noch nie gesehenen farbe
neoneon oder so
ein funken der vorbeizieht
verglühend vor wahrhaftigkeit vor idee
nicht einfach zum festklammern
sondern sodass man darauf reiten kann
oder zumindest treiben ach
weißt du was ich meine?
SCHÜTTLER.BERLIN.«Kitschscheiße, widerwärtige Deluxe-Kitschscheiße – und»
ROBERT.«Ein Funke, der vorbeizieht, verglühend vor Wahrhaftigkeit, ach, weißt du, was ich meine?»,
hatte Luca gesagt, halb zu sich, halb zu mir, wie ein Mantra, das ich eigentlich mitsprechen sollte. Vielleicht sind zwei, drei Worte etwas schöngeflunkert, aber im Grunde ist alles wahr. Soweit man das sagen kann, denn häufig weiß ich nicht mal so genau, ob ich mir überhaupt selber glauben soll. Schatten wie kalligraphische Kringel auf ihrem Hals.
«Ja»,
war meine Antwort. Und so fing das an.
SCHÜTTLER.BERLIN.«Kitschscheiße, widerwärtige Deluxe-Kitschscheiße – und das in sieben Porträts à hundertzwanzig Zeilen. Das wird unsere Mauerfallausgabe. Der Leser darf die Augen nicht vom Papier kriegen vor Rührung, bis zur letzten Seite. De-luxe-Kitschscheiße, von langer Hand vorbereitet. Das muss von langer Hand geplant werden, noch diesen Monat fangen Sie mit Ihrem Porträt an. Jetzt zur Nacktmalerin! Wie war’s?»
Mein Blick geht zu Wieland, dann aus dem Fenster, zu lang aus dem Fenster.
«Gut.»
«Nein, Schüttler, Sie verstehen wieder nicht. Ich will hören, wie sie war!»
«Na … gut, wirklich gut. Einige Sätze, die reinhauen, bäm, bäm. Ich würde sagen, man muss die Zitate ein bisschen anrichten, und der Artikel wird ’ne schicke Geschichte.»
«Schüttler!»
«Was denn?»
«Es kratzt mich nicht, was die Usche gesagt hat. Und was Sie wie anrichten. Die Titten, Schüttler, die Titten! Groß? Knapp? Prall? Tütig?»
«Was, bitte? Tütig?»
«Schüttler! Wenn wir eine Nacktmalerin bringen, eine Nacktmalerin, Schüttler, dann müssen die Titten der absolute Knaller sein. Wenn es nur ’ne drittklassige Swingerclubpomeranze ist, streiche ich das. Ganz. Und Sie wissen doch genau … Nun?»
Ich weiß es: Ich muss «etwas bringen». Wie ein Präpubertärer antworte ich mit einer wiegenden Geste. Wieland feixt. Von wegen Pomeranze. Sie war, ach, und ich auch, geil! Gleich werde ich massiv Kaffee trinken, denke ich. Wielands Grienen. Es spiegelt sich fratzig auf der Oberfläche der milchglasigen Schreibtischplatte. Wie sich überhaupt alles spiegelt: Draußen im Dunstflirren spiegeln die Glasfronten des Verlagsgebäudes, arktikblau, stahlstrebendurchrastert, sie spiegeln den Fluss und seine Wellen, und das Metalldach des Nachbargebäudes spiegelt den Himmel. Weiß vor Hitze. Dahinter die anderen Würfelgebäude, und die Menschen kriechen darin durch die glänzenden Flure, und ich ahne Fische im Fluss, und alles reflektiert, reflektiert wieder zurück und ist gleichzeitig auch transparent.
Dann versiegt Wielands Grinsen, und er setzt seinen üblichen Mund auf, geschäftig und spöttisch. Schnalzend rollt er sich hinter seinen Bildschirm und winkt mich raus. Geschäftig. Beim Türschließen denke ich an die Fotos und daran, wie Wieland über sie staunen wird. Dazu ein paar schäkernde Zeilen, und ich kann den Rest des Tages verbummeln. Der Artikel muss mit Tempo erzählen, schnelle, bildstarke Schwenks, und das ist genau mein Metier. Ich schreibe rasant, ich schreibe gut, nur nicht gründlich. Und dann der Kaffee. Viel Espresso ist gut gegen den Kater, ja, doch. Da spüre ich es ganz plötzlich in den Mundwinkeln: Ich lächle.
ROBERT.BOEING777.Das Gefühl, als die Turbinen dröhnten, beschleunigten, mich beim Abheben endgültig herrlich in den Sitz drückten, ist geblieben, beim Schub spürte ich ein breites Glühen im Rücken. Etwas Sexuelles ist dabei. Ich bin allein und auf dem Weg, und es fühlt sich überirdisch an. Aber all das dürfte nichts sein, gar nichts, nicht das allergeringste, futzelkleine Molekülbisschen gegen Strawberry Fields. Die verkitschten Alpen sind schon lange vorüber, unten jetzt ist die Türkei als ockerne Platte. Durch das Flugzeugdoppelfenster betrachtet, liegt sie uninteressant herum wie eine ungleich geschnittene Scheibe Dinkelbrot. Es ist ja auch der falsche Weg. Fliegen ist Antipilgern. Das Richtige – klar – wäre der Landweg, der heilige Hippietrail. So langsam reisen, dass auch die Seele Schritt hält. So heißt es doch. Dabei muss ich an ein Buch denken: ein Typ, im Mittzwanziger-Taumel, Philosophiestudent, Spätsommer 1967, auf dem Hippietrail – herrlich perfekte Bedingungen also. Beim Lesen seiner eklig anheimelnden Spinnerworte schnürte es mir fast die Kehle zu. Mies war es. Ich hab sogar einmal auf den Teppich gerotzt und den Fleck dann schnell mit dem Hausschuh verrieben. Klar, das war affig, aber alle zwei Seiten musste ich denken: Was für ein verwirrter Idiot das doch ist. Ich, in seiner Situation, hätte alles besser und schöner und wahrer gemacht. Er hatte sogar eine Freundin. Auf den Hippietrail mit der Freundin – das muss man sich mal reinziehen. Amateur. Mir passierte das nicht. Wie erbärmlich: Vorzügliche Bedingungen für den Trip der Trips, und dann verschlurfte er es derart. Amateur. Ich weiß, wie man es anstellen müsste.
Den Grundton, sozusagen den Beat der Tour, gibt der viel zu billige, um einen kaum möglichen Preis erstandene Bus an. So beginnt die Tour schon im Irrealen. Das ist gut. Der Bus, das sollte ein gebrauchter VW T1 sein. Vielleicht dunkelmint, unbemerkt vor sich hinrostende Achsen, die geteilte Frontscheibe und optimistisch aufgerissene Scheinwerferaugen. Niemals ein T2. Der T2 stand damals noch als glänzender Spießertraum in den Autohäusern. Heute hat er zwar ein Hippie-Image, jedoch nur, weil die Leute ihn nicht vom T1 unterscheiden können. Ein noch älterer, kastiger Mercedes täte es auch. Die sind größer, mehr wie Planwägen. Das spielt dann auf Furthur, den Magic Bus von Ken Kesey, an, auf die Merry Pranksters, Acid Tests, oder Uschi Obermaiers Bus. Auch nicht übel. So ein Karawanen-Feeling. Und wenn man dann unterwegs ist, folgt etwas, was es ja kaum mehr gibt: die schrittweise Entfremdung. Zuletzt rasierte man sich auf einer Rasthoftoilette in Franken. Danach sprießt der Bart, die Haare sind ohnehin lang, es geht immer ostwärts. Die Gegenbewegung zum Fortschrittswahn folgt der Erdrotation. Im Erwartungsrausch fährt man zwischen schwarzem Nadelwald über Autobahnen durch Tschechien, Slowenien. In Ungarn liest man eine Tramperin mit ovalen Augen und einem bei jeder Bodenwelle scheppernden Tamburin auf. Rumänien. Einen kurzzottigen Bart hätte man schon in Istanbul. Dann Teheran, Kabul, wie Marco Polo über den Chaiber-Pass nach Peshawar. Wie ich daran denke, wird das Glühen um die Wirbelsäule immer breiter. Mein Magen pulsiert. Und wenn die tabakkrümeligen Bartspitzen schon in den Masala Chai hingen, dann ist man endlich in Kathmandu. Das wäre ein wahrhaftiger Trip. Und hätte der Öldurst von ein paar Colablütern nicht den Irak und Afghanistan verwüstet, wäre er auch noch möglich, sicher und bezahlbar, na ja, fast. Aber ich will ja ohnehin nicht in die Freak-Street in Kathmandu oder an den Anjuna Beach in Goa. Wir leben in anderen Zeiten. Deshalb das Flugzeug. Das ist okay.
Wenn ich ehrlich bin: Mein breiter Sessel, das kühle Kopfkissen – eigentlich ist es wirklich bequem, so bequem, dass ich sogar nur geringe Rückenschmerzen habe. Dieser Schmerz begleitet mich lange schon, kommt überall mit hin, spitz durchdringend, wie wenn ein Schraubenzieher drinsteckt. Aber was bedeutet denn schon bequem? Irgendetwas sehr Falsches zwischen Playmobil-Orient-Palast und Tupperdose ist das hier, denke ich sofort und reibe mir die Augen. Bald kommt das echte Indien, beruhige ich mich. «Bunt und wild», hatte Luca gesagt. Luca. Bald.
SCHÜTTLER.BERLIN.Verkokelter Espresso. Ich würde mich wundern, wenn der Espresso in dieser Bar einmal nicht verkokelt schmeckte. Aber ich mag das. Und auch die breiten Gehsteige, zerbrechliche Caféstühlchen, die Baustelle mit Teergeruch und etwas wie Zypressen beim Halbhingucken, für den genaueren Blick aber irgendein urdeutsches Unansehnlichkeitsgewächs, das seinen muffigen Stamm in diesem preußischen Mistsand nähren kann. Das nur hier wachsen kann, wenn man das überhaupt wachsen nennen kann.
«Das ist der Paul, mein Neffe», sagt Roman und grinst. Die beiden setzen sich an meinen Tisch. Ich glaube Roman kein Wort. Nicht Roman. Man sollte ihm nie glauben. Nicht, dass alles gelogen wäre, was er sagt, es ist nur nie richtig wahr.
«Wink mal, Paul.»
Paul winkt. Paul winkt und ist dick und ungefähr sieben Jahre alt. Ich kenne mich mit Kindern nicht so genau aus. Er könnte Romans Sohn sein oder ein Kind, das er frisch gekidnappt hat, oder tatsächlich sein Neffe. Im Grunde ist es aber auch egal. Paul sieht genervt aus. Vor dem Café zieht ein Nordic Walker vorbei und wird von einem Sportkinderwagen überholt.
«Wusstest du, Paul», sage ich, «wenn du Wassermolchen LSD gibst, entfärbt sich ihre Haut?»
Paul schaut interessiert, Roman winkt ab.
«Du glaubst aber auch alles. Und du Paul, glaub ihm nicht. Er ist ein Lügenbold.»
«Hab ich heute erst gelesen. Und Spinnen weben besonders feinmaschige, gleichmäßige Netze. Bei sehr viel LSD jedoch weben sie völlig unsinnige Muster.»
Als Roman auf der Toilette ist, geht alles ganz schnell. Aus einem bröckligen Hauseingang taucht ein Hipster auf: Röhre, riesige Fensterglasbrille, Achtziger-Trainingsanzugjacke in Lila, ja, lila, das Seitenhaar links zum Sidecut abrasiert – perfekt! Neben sich her schiebt er einen Schrotthaufen von Fahrrad, fern jeder Funktionstüchtigkeit. Besonders hipstermäßig ist, dass es keine Bremsen hat, sicher auch keine Gangschaltung. Ein entfernter Verwandter eines Rennrads. Ich reagiere sofort.
«Paul, pass auf, willst du dir zwanzig Euro verdienen?»
«Nee, lieber Eis.»
Der kleine Mann ist gewitzt. Ich mag keine Kinder, schon gar keine dicken Kinder, aber wenn sie gewitzt sind, geht es schon fast wieder.
«Gut, kleiner Mann, gut. Eis. Du kriegst ein Eis, wenn du dem jungen Mann mit dem Fahrrad, dem da drüben, sobald er vorbeigegangen ist, in die Hacken trittst. Wenn er sich dann umdreht, sagst du: Nimm das, Hipster!»
«Hibber?»
«Hipster, Paul, Hipster. Es gibt Eis, Paul!»
«Wie viele Kugeln?»
«Wie viele schaffst du? Fünf?»
«Ich will zehn!»
«Wie du willst, zehn.»
«Man darf nicht treten.»
«Ja, das stimmt. Aber heute darfst du es. Ich erlaube es dir, du kriegst zehn Kugeln Eis, und der junge Mann freut sich bestimmt. Und falls er böse wird, dann beschütze ich dich.»
«Okeydokey.»
Paul nimmt seinen Finger aus der Nase und steht auf. Der Hipster passiert uns und wird dabei von einem Sportkinderwagen überholt, Paul schaut mich kurz an. Mit einer für seinen rundlichen Körper erstaunlichen Flinkheit setzt er dem Hipster nach, tritt ihm in die Hacken und beobachtet lachend, wie er stolpert. Ich lache auch. Roman steht hinter mir und nickt. Nickt anerkennend, Respekt zollend, und ich sehe seinen Ärger, dass er nicht selbst auf die Idee gekommen ist.
«Schüttelini, das gibt vier Punkte.»
Ich weiß nicht viel über Roman, ich werde vermutlich nie viel mehr über ihn wissen als jetzt, aber unser gemeinsamer Hipsterhass schenkt uns ein Gefühl tiefbrüderlicher Verbundenheit, das sicher nur wenige kennen. Wir sind zwei Hauptstadtbewohner, die mit dem Fluch einer Überdosis an Geschmack auf die Welt gekommen sind. Paul schafft nur neun Kugeln Eis und ist dann noch genervter.
Zurück in der Redaktion, starre ich eine halbe Stunde gegen die dünnen Wände meines Büros. Ich schließe die Augen. Zuckende Lichtspiele, wie Regenstrippen, knalllila und glutweiß, wie sie aufglimmen. Wenn man die Augen zumacht und mit den Fingerspitzen leicht auf die Lider drückt, dann sieht man dieses Farbflimmern. Als ich den Druck löse, schieben sich die Bilder von gestern davor. Bild schlägt auf Bild. Alles rekonstruiert sich.
ROBERT.BOEING777.Die Stewardessen hoppeln den Gang entlang. Eher Zuchtgänse als Tempeldienerinnen. Ihre einteiligen Gewänder in den Logofarben der Airline werfen keine Falten. Das Innengehäuse des Flugzeugs mit seiner wellenförmigen Deckenverkleidung in Eierschale und den ausgebuchteten Kabinenabtrennungen passt zum Playmobilpalast und riecht nach Neuwagen, halbechtem Luxus. Ach, nicht mal halb. Und dann diese trockene Konservenluft, die sie dauernd einleiten und die den Passagieren so lange Plastik in den Kreislauf pumpt, bis sie allesamt aussehen wie die knubbeligen Figuren in der Notfallanleitung. Die Frauen tragen beige Kostüme, die Männer dunkelblaue Anzüge, und die Kinder sehen aus wie Tim ohne Struppi – alles Europäer, obwohl es eine indische Fluggesellschaft ist. Es geschieht schleichend. Zuerst strömen staubkornkleine Plastikpartikel in die Lunge und füllen sie aus. Schubartiges Aufdrehen der Heizung und Schockkühlen lassen die Partikel dann erst schmelzen, dann erstarren, und schon ist das erste Organ synthetisiert. Niemand merkt das. Lungenbläschen werden zu Gummikugeln, Wirbel zu Stahlträgern, Nervenstränge zu Kabelbündeln, Blut zu flüssigem Silizium. Ein Quietschen im Nacken, und schon ist der Hals ein übertaktetes Markenstaubsaugergewinde und der Kopf ein fratzig bemalter Luftballon mit Tim-Grinsen. Dazu süße Cocktails. So ungefähr.
SCHÜTTLER.BERLIN.Bild schlägt auf Bild. Und der Abend rekonstruiert sich.
Die Wände sind das Schönste. Das Weiß, ihre Größe und Glätte, das Unzweideutige. Ich möchte mit der Hand über die Wand fahren, sie streicheln. Aber das brächte mich nur von meinem Plan ab. Ach, diese Wände. Diese Galerie ist nicht die erste, bei der ich die Wände am schönsten finde. Das ist jetzt wirklich keine große Beleidigung. Ich mag solche Wände einfach außerordentlich gerne.
Die Vernissage beginnt mit dem üblichen Spiel. Abgleicherei: Wir blicken einander auf die Spiegelreflexkameras, alle haben dasselbe Modell, nur die Objektive sind verschieden. Ich fange zu meiner Tarnung eine beliebige Unterhaltung mit einem Kunsthipster an. Kunsthipster tragen immer eine Kamera um den Hals, Spiegelreflex, analog, oder eine eingedellte Lomo, im schlimmstmöglichen Fall das vorletzte Einzelstück irgendeines anderen ausgefallenen Sowjetmodells. Der normale Hipster trägt eine Polaroidkamera, die für ihn eigentlich ein Kleidungsstück ist, der Kunsthipster ist für so was aber schon wieder zu versiert. Wenn man also so tun will, als würde man jeden auf der Vernissage kennen, fragt man einfach einen Kunsthipster, was er da denn für ein hochinteressantes Objektiv habe. Da wird dir der Gesprächsstoff nie ausgehen. Aber ich bezweifle, dass auch nur irgendjemand bemerkt, dass mein Objektiv für das grelle Galerielicht nicht geeignet ist, dass ich die dummen Bilder nicht fotografieren will und die unerträglichen Menschen erst recht nicht, dass alles Attrappe ist. Die Abgleicherei. Wie beim Autoquartett, wie früher bei der zwanzigsten Partie auf irgendeiner ölbeschmierten, griechischen Fähre, ganz so wie früher, nur verzweifelter. Die Wette lautet: Um welchen Androgynling wurde das schmalste Jackett geschneidert? Am weißen Hartplastik des DJ-Pults lehnend bietet ein Kandidat, Brustumfang: eine Straßenlaterne. Nicht übel. Durch die Seitentür stolpert das Gegengebot – chromkalte Eleganz sogar im Stolpern, Spinnenfinger, provokant gelähmter Mund, Brustumfang: ein Bleistift. Dann aber setzt er an zu sprechen, und seine Stimme wirft die Partie um: kehlig, mit Bratfett auf den Stimmbändern, knödelkehlig – das ist die Niederlage, mein Gott, er hätte beim Stolpern bleiben sollen.
Ich habe einen Plan. Ich sehe mich gerne von außen, und von außen gesehen wirkt mein Vorhaben waghalsig. Tatsächlich ist es raffiniert und basiert zugleich auf schlichten Mechanismen, auf die ich mich verlassen kann. Wenn ich einen Artikel über eine Nacktmalerin bringe, dann brauche ich ein Foto, auf dem sie nackt malt oder zumindest nackt ist. Nur lässt sich die Nacktmalerin nicht beim Malen fotografieren. Normalerweise wäre damit die Geschichte gestorben. Aber ich habe mir etwas ausgedacht.
Im letzten Raum gehe ich ihre Bilder durch, stelle fest, dass ich nur eines nicht kenne, und positioniere mich vor der Stiefelfetzencollage, wohl das hässlichste Bild hier. Einen Moment noch. Den Gin Borgward stürzen, dann den Hemdkragen unterschwellig zerknittern und die Frisur im spiegelnden Fenster überprüfen – links zurück, rechts vor –, das gibt mir die nötige Form, das richtige Bauchgefühl. Ich brauche das. Nun kann es losgehen. Der Plan steht: Der Glas-Opener mit dem ersten Dämpfer, der sie gleichzeitig aus anderen Konversationen isoliert und zum Einer-Set macht. Es ist ihre Vernissage, und sie sieht überdurchschnittlich gut aus, mit zwei, drei filzigen Strähnchen im leicht antoupierten Haar, diesem Farbhuschen von Kleid und dieser, dieser Hüfte. Alle hier himmeln sie an. Deswegen braucht sie besonders viele Dämpfer. Ich himmle sie eben nicht an – das macht den Unterschied. Meine Gunst ist ihr nicht sicher, nein, sie muss sich darum bemühen. Und das werde ich ihr jetzt vermitteln.
Opener, Dämpfer, Kurswert erhöhen – grundlegende Aufreißstrategien in Theorie und Praxis zu beherrschen ist inzwischen einfach unverzichtbar. Das gehört sich so, das ist überlebenswichtig. Klar geht es auch ohne. Man kann ja auch ohne Ritalin eine Doktorarbeit schreiben oder nüchtern in einen Technoclub gehen. Es ist nur sehr mühsam. Sie sagt, sie malt nackt. Sie malt ihre Bilder mit ihrem Körper. Das sei kein Konzept, sondern für sie die einzige Art zu malen. Pinsel seien schön und gut, aber völlig überbewertet. Sie täuscht geschickt vor, dass das Nacktmalen eine Notwendigkeit und ihre künstlerische Natur sei, keine Marketingstrategie. Sie ist durchaus listig. Aber selbst berechnende und geschickte Menschen verhalten sich in Balzsituationen völlig unreflektiert, gehen untaktisch vor und sind leicht zu manipulieren. Und das ist meine Chance.
Also der Opener. Ich gehe im richtigen Winkel auf sie zu. Den zweiten Gin Borgward halte ich in den Fingerspitzen, fallbereit. Meine Körperhaltung ist optimiert, ein kleines Lächeln, dann die Drehung. Demütigen. Jetzt steht sie hinter mir, ich drehe mich um, mein Glas streift ihre Hand und zerklirrt auf dem Boden. Ihr Blick nach dem ersten Erstaunen sagt: Die Nummer willst du nicht wirklich bringen, Junge!
Deute ich diesen Blick richtig? Hoffentlich nicht. Sie hat die Masche nicht durchschaut, oder? Das wäre zu früh. Ich sollte mir nicht zu viele Gedanken machen. Nicht schon wieder. Kurs halten. Ich halte Kurs, mache einen Laut des Erschreckens, richte einen Blick auf die nassen Scherben, halte ihn etwas zu lange, schwenke erst dann zu ihr und platziere ein Lächeln auf meinen Lippen, das man rahmen müsste. Ich fühle eine Art Sicherheit. Auftrieb. Alles sitzt.
Nach einer halben Stunde hat sie keine Chance mehr. Wir stehen mitten in ihrer Vernissage in einer Blase, sie schaut nur noch auf mich, und ich fixiere konsequent den Punkt zwischen ihren Augen. Keine Chance. Ihr Beuteschema auszumachen war nur eine Fingerübung. Einerseits will sie einen, der auch Kunst macht, damit sie ihre Künstlermarotten teilen und sich seines Verständnisses sicher sein kann. Andererseits machen sowieso alle um sie herum Kunst, und das langweilt sie schon lange. Ich arbeite also als Geflügelgeschlechtsbestimmer. Das ist bei uns Familientradition. Geflügelgeschlechtsbestimmer, ein einfacher Beruf, den sie aber nicht kennt und der mir einen Paradiesvogelfaktor verleiht. Zugleich ist das auch eine Identität, die mir erlaubt, von ihrer Position als der Umschwärmten, Ausstellenden unbeeindruckt zu sein, um ihr geschickt Dämpfer zu versetzen. Nicht ganz leicht: Denn du kannst einer Künstlerin natürlich nicht sagen, dass du ihre Bilder schrecklich findest. Das würde nicht dämpfen, sondern verletzen. Also kritisiere ich nur, dass sie die Bilder verkauft. Antikommerzialisierung der Kunst, das ist die zweite Schiene. Aber nicht auf die plumpe Art. Ich bin nicht gegen Geld – das würde sie auch langweilen –, sondern nur gegen die Kommerzialisierung, dagegen, dass man für Kunst Geld nimmt, Kunst also als Produkt in das kapitalistische System einspeist. Ich sage ihr, ich will den Kapitalismus nicht abschaffen, ich will nur nicht, dass der Wert der Kunst in Euro gesetzt wird, und das dadurch entstehende Wertgefälle will ich auch nicht unterstützen. Der Wert eines Kunstwerks ist subjektiv. Nur, dass niemand zehntausend Euro für das Bild vom Porträtmaler auf der Straße bezahlen würde. Und das ist falsch. Das ist der zweite Teil der Identität: Fotograf. Ganz beträchtliche Mengen Geld habe ich mit Fotografien verdient. Aber als mir klar wurde, dass ich dazu beitrage, dass eine kleine Anzahl widerlicher Personen die Marktwerte für Kunst bestimmt und ich das unterstütze, habe ich aufgehört, meine Fotos zu verkaufen. Ich wollte kein Teil dessen sein. Ich mache noch immer Kunst, nur verkaufe ich sie nicht mehr.
«Seitdem arbeite ich wieder als Geflügelgeschlechtsbestimmer. Als GeGeBe, wie wir im Betrieb genannt werden.»
Ich spiele Karte für Karte aus.
Während der Fährfahrten nach Griechenland habe ich immer irgendwann begonnen zu schummeln. Wenn deine Karten perfekt auf die deines Gegners abgestimmt sind, hat er keine Chance. Aber das habe ich die anderen nie merken lassen. Verborgene Überlegenheit schmeckt am besten. Später habe ich oft in die Ägäis gekotzt.
In einem Interview las ich, dass sie für Dash Snow schwärmt, den Kunst-Outlaw mit den Heroin-und-Huren-Polaroids. Eigentlich stecke ich in ihr drin. Genau wie Wieland es will, wie er es mit seinem Wielandgrienen immer fordert:
«Schüttler, analysieren Sie, spionieren Sie, bis Sie sich die Haut des Interviewpartners überziehen und mit seiner Familie unentlarvt Weihnachten feiern könnten.»
Sie hat eine leichte Drogenaffinität, eine semipsychedelische Macke, einen Hang zu sackartigen Kleidern, möchte gern etwas berühmter werden (aber dann doch nicht nur fürs Nacktsein) und hat ein Faible für amerikanische Staub-auf-Jeans-und-Rocky-Mountains-Romantik – ich kenne sie. Mit einem Finger zeige ich auf ihr Stiefelfetzenbild. Karte für Karte. Keine Chance.
«Dash hätte diese Stiefel geleckt, das hätte er. Und mit seinen Zungenpiercings wäre er hängengeblieben. Sein Schmerz im Blick würde alles aussagen, was auch in seiner Kunst steckt, dieses kristalline Elend. Alles, was Dash tat, war so. Der Dash hat eine sehr furchige Zunge, wie ein Stalagmit, weißt du. Kristallin. Schön. Elend. Ich stand noch mit ihm auf dem Dach vom ArtCrush in Aspen. Wir hatten nur ein Portiönchen 2-CB geleckt, von einem Foto einer blassen Frau, die in einem Haufen pinker Korken sitzt, aber er, er wurde aufgekratzt wie drei Junghengste, kaute mahlend auf dem Stiel so einer Plastikorchidee und bat mich, ihn zu fotografieren, wie …»
Sie lächelt. Immer muss ich so schrecklich übertreiben, wenn es gut läuft. Aber sie nickt kreisend. In ihren Augen steht irgendwie eine eklig schöne Treue. Sie sieht mich als Verbündeten an. Die ersten zwanzig Sekunden haben vermutlich schon gereicht. Karte für Karte. Ich lächle, ich sage:
«Goldschaum und Day Glow auf enthaarten Kaninchen.»
Sie zögert im Lächeln, ich lächle pseudounterdrückt:
«Was, du malst auch nackt? Ich finde einfach, nackt …»
Sie lächelt, ich schmunzle, ich sage:
«Diese Schwangere auf Speed, Larry Clark, ‹Teenage Lust›.»
Irgendwer sagt:
«Das rearrangiert den Raum der Gefühlsfelder.»
Ich erzähle ihr brutal ekliges Zeug. Nicht dass es besonders pervers ist – ich habe schon gewaltig Perverseres erzählt –, nur vielleicht eklig kitschig. Aber ich stehe da ziemlich drüber.
«Lass mich dich jetzt beim Malen fotografieren!»
«Du meinst – warte kurz.»
Sie lässt den Blick durch die Galerie schweifen und nickt, und wir gehen. Beim Herausblicken zwinkere ich dem dünnsten Androgynling zu und trete einem Hipster in die Hacken. Nummer vierundfünzig. Demütigen.
ROBERT.BOEING777.Einen vergesslichen Moment lang, in dem ich Hunderte Meter türkischer Luft durchquere, lasse ich meinen Blick auf der rissigen Wolkendecke ruhen, gipsweiß, mit länglich-wulstigen Hubbeln. Wie Schaumbläschen. Schaumbläschen. Mein letztes Bild, das jetzt verlassen auf der Staffelei in meinem Zimmer steht. In der Nacht, eigentlich am Morgen nach dem Abiball, hatte ich eine Leinwand rausgezerrt. Betrunken und rotzfrustriert zog ich kreisende Striche zu Schaumbläschen, um mich zu beruhigen, um etwas vorzumalen. Dieser Abiball: Stundenlang wechselte ich das Standbein, die Finger um das Geländer der Galerie gekrampft, und hasste ausgiebig, trank einiges, aber immer noch zu wenig, und starrte auf die Marmortanzfläche, die Fußnägel in die schweißnassen Sohlen gekrallt, teils, weil ich mich so unwohl fühlte, teils, weil die Schuhe einfach doch irgendwie zu klein waren. Hassformeln schossen mir durch den Kopf, und dann kam Gothic-Kevin und erzählte mir wieder eine seiner Leichenstorys.
«War megaschön gewesen, Leichen zu schminken. Megaschön.»
Ab dem vierten Bier erzählt Gothic-Kevin immer ausgiebig und ausschließlich von seinem Betriebspraktikum beim Bestatter.
«Für Trauerfeiern mit offenem Sarg – Deckel zu geht ja mal gar nicht klar –, also für Feiern mit offenem Deckel, da schminkt man die Leichen, weil die Angehörigen es nämlich nicht ertragen, dass Tote eben wie Tote aussehen, ne? Dabei sind Tote so wachsig, und die Blässe ist so nobel blass, an sich sind die ja voll schön. Fast aristokratisch irgendwie so.»
Dieses Leichenschänderimage schien sein Ding zu sein. Die letzten Herbstferien stolperten wir ständig auf denselben Partys ineinander. Und es kam immer dazu, dass wir irgendwann – das Bier zu voll, um eine Getränk-holen-Ausrede zu benutzen – in der Küche standen und er mir und sich von seinen Leichen erzählte. Ich hab keine Ahnung, wie Gothic-Kevin eigentlich drauf ist, womit er sonst so seine Zeit verplempert, aber über seine Leichen weiß ich bestens Bescheid. Wenn er mitten im Plappern seinen Blick zur Deckenlampe hob und dann wieder senkte, war ich mir immer unsicher, ob er mich wirklich sah oder noch immer den Spiegel, vor dem er diesen Satz wochenlang beim Wimpernanmalen geübt haben musste, sich in das Gesicht, dass er nicht unbedingt haben wollte, blickend:
«Tote sind voll schön, Tote sind voll schön, Tote sind voll schön.»
So sind die alle. Nicht, dass in meiner Schule so viele Gothics gewesen wären. Sie erzählen nur alle diesen unerträglichen Unsinn, mit dem sie beweisen wollen, dass sie etwas sind, was niemand sein wollen sollte. Und langweilig sind sie, im tiefsten Grund ihres Wesens, sie sind durchzogen von Langeweile und Langweiligkeit. Wenn es ein Ödnisatom gäbe, sie bestünden daraus. Die Tanzfläche war eine Trauerfeier mit offenem Sarg.
Im Versuch, sich jung und lebendig zu fühlen, waren sie zombiehafter denn je. Pasteninhalte verformten ihre Fratzen, Gesten wie an Fäden, Tanzen wie auf Schienen – nicht die Gothics, die kommen, bis auf Kevin, eh nie zu Abibällen, sondern die ganz anderen Abiturienten. Ihre Normalnullvisagen waren verzogen, ein Loch von Maul, ausgestopfte Fische, und darüber funkelte Sarglackglanz in Schlampenaugen, die Augenhöhlen höllenschwarz. Gestankmischungen durchdrangen einander, krätziges Modeparfum, Haarspülungsmief und Haarspraybrisen. Darunter, und das ging und ging nicht aus der Nase, schimmelten ihre Seelen. Der Gestank vorzeitiger Verwesung. Sogar das Leuchten ihrer Pupillen war lediglich ein Widerschein der Fotoblitze. Sie versuchten, das festzuhalten, was sowieso nicht da war und nie da sein wird: das Leben. Das richtige Leben. Foto auf Foto auf Foto wird gemacht, und die müssen sie dann sofort ansehen, sich sehen, sich angaffen, in ihren geschmacklosen Anzügen, ihren triefenden Freundschaftsposen, weil sie eigentlich gar nicht richtig leben. Sie haben keine Gefühle, keine, die sie sich wirklich glauben könnten. Aber den Fotos glauben sie. Das ist ihre Religion.
Dagegen habe ich gemalt. Erst waren es ineinandergreifende Strudel, dann raumzehrende Flammenblüten um einen kopfüber fallenden Fakir, dann die länglich-wulstigen Acrylbläschen. In Kobaltviolett. Ich entspannte mich, und als ich am nächsten Morgen aufwachte, waren Hemd und Anzughose, die ich noch immer trug, über und über bekleckst. Mir gefiel das.
Vielleicht sollte ich meine Hemden bemalen, wenn ich endlich angekommen bin, nicht gleich Batik, aber vielleicht etwas Gekleckstes, denke ich, mich umdrehend. Dann lasse ich meinen Zeigefinger über die Armlehne streifen und suchen, bis mein Sitz endlich zurückgleitet, und schließe die brennenden Augen. Luca. Ihr Blick, halb aus den Augenwinkeln. Ihr Mund mit der leichten Spannung, sprungbereit zum Schmunzeln. Wie ihr Blick von Wand zu Wand springt, sie die Kontakte aber sparsam verteilt, die Wimpern kurz senkt, dann die Augen aufreißt. Luca.
SCHÜTTLER.BERLIN.Ihr Townhouse ist wie erwartet. Lachs. Die hohen Neubauwände in Lachs. Vor einem riesigen Panoramafenster steht ihre Staffelei, darauf eine riesige Leinwand, davor sie, inzwischen nackt. Die Fotos schieße ich aus der Hüfte. Das habe ich mir von einem polnischen Filmemacher abgeschaut. Ihr wird die Veröffentlichung der Fotos natürlich nicht recht sein. Aber das ist egal. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie auch so beschämt sein, sich von einem wie mir reingelegt haben zu lassen, dass sie nichts machen und die Geschichte auf sich beruhen lassen wird. Ich kann mir alles erlauben:
«Der Körper ist der beste Pinsel.»
Nachdem ich sie gevögelt habe, liege ich in Glück und Watte. Ich habe uns zwei Gin Borgward gemixt. Die Sonne geht auf, und plötzlich kommt da so ein Gefühl aus dem Bauch. Nicht etwa Ekel vor ihr – die Form ihrer Brüste, wie sie unter dem Tuch liegt, ihre Bilder, das ist alles heiß und perfekt –, es ist ein unangenehmes Piksen, ein kalter Stich irgendwo, wo ich nicht ganz genau hinspüren kann. Schon als kleines Kind hatte ich das. Wenn ich lange in der Badewanne saß und mich ansah und merkte, wie ich Fleisch bin, wucherndes, teigiges Fleisch, da wurde es mir unmöglich, diesen Teig in Verbindung mit mir zu setzen mit.
Ich öffne die Augen, sehe die dünnen Bürowände, und schreibe den Artikel über sie in einer halben Stunde fertig. Bevor ich gehe, stöbere ich noch zwanzig Minuten in den Agenturmeldungen. Es ist nichts passiert.
ROBERT.BOEING777.Als ich die Augen wieder öffne, hat mein Sitznachbar ein Sandwichpaket auf meinem Schoß abgelegt und hört aus einem scheppernden Kopfhörer Hindipop, während er meditativ das Sudokuspiel auf seinem Notebook angrinst. Augenscheinlich ist er ein Inder und ein ziemlicher Nerd dazu. Ich zwinge mich: Sei nicht so verklemmt, interessiere dich, da sitzt ein milliardstel Indien neben dir. Das milliardstel Indien schwitzt, und sein Gesicht zuckt, vor allem die Nasenflügel, sein Mund sieht aus wie ein Regenwurm. Interessiere dich, mehr Abenteuer. Also wende ich mich ihm zu, reiche ihm überdeutlich freundlich seine Sandwichs, um ein Gespräch zu provozieren. Er entschuldigt sich heftig, weil er nicht schneller war, fast fällt sein Laptop herunter. Und schon geht es los, auf Deutsch. Er sei aus Hyderabad, habe für seinen Bruder in Kassel als Kosmetikvertreter gearbeitet, jetzt, er zuckt wieder, jetzt würde er etwas anderes machen, «gan gan toll» sei Hyderabad, ich solle unbedingt Hyderabad besuchen. Chaman, sein Name, bedeute Garten, ja, Garten. Wie stark der Monsun jetzt sei, frage ich. Garten-Chaman wiederholt «Monsun» und scheint mich nicht zu verstehen. Monsun, Regenzeit, ja, ja, ja, jetzt sei Regenzeit, ja, Regenzeit, nein, das sei nicht schlimm, es regne nicht oft, wie oft? Nein, das wisse er nicht, ich könne ihn gerne besuchen in Hyderabad, also nicht jetzt, aber in zwei Wochen. Hyderabad, hm. Vielleicht sei sein Cousin, genau, sein Bruder auch dort. Dabei schaut er mir eine Sekunde zu lang in die Augen. Garten-Chaman wischt sich fortwährend Schweiß von der Oberlippe, und dann klopft er mir auf den Oberschenkel. Ob ich mal sein Sudokuspiel ausprobieren wolle. Ich hasse Sudoku. Wir tauchen in Wolken ein und schlüpfen wieder heraus. Es ist Nacht geworden.
SCHÜTTLER.BERLIN.





























