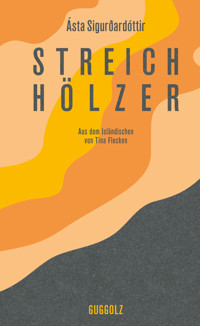
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Guggolz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ásta Sigurðardóttir (1930–1971) war eine Ausnahmeerscheinung. Schon ihre erste Erzählung 1951, »Sonntagabend bis Montagmorgen«, sorgte für Aufsehen, da sie nicht in die beschauliche isländische Gesellschaft passte. In ihrem Leben, das geprägt war von Liebschaften, Schwangerschaften und Kindern, von Unmengen an Alkohol und unbändigem Schaffensdrang, fand Ásta weder Ruhe noch Frieden. Umso erstaunlicher sind Präzision und Radikalität ihrer Geschichten sowie der sprachliche Glanz ihres Schreibens. Jede der 13 Geschichten, die sie bis zu ihrem frühen Tod verfasst hat, steht wie ein Solitär für sich, strahlt fast unheimliche Souveränität aus. Ihre Figuren zählen nicht zum klassischen Literaturrepertoire, es sind Tagediebinnen, junge Frauen, die sich nicht für ihr sexuelles Begehren schämen, verschüchterte Kinder, einsame gealterte Damen: beschädigte und überforderte Existenzen, getrieben von unstillbarer Sehnsucht. Ásta Sigurðardóttirs Erzählungen ermöglichen einen Blick in alltägliche Abgründe, in Verhärtungen und Vergeblichkeiten sowie in die Brutalität der Verhältnisse. Ihre lauernde Bedrohlichkeit beziehen sie daraus, dass sie Allgegenwärtiges beschreiben, das üblicherweise verdrängt und in seiner Zerstörungskraft unterschätzt wird. Tina Fleckens Übersetzung gelingt es auf eindrucksvolle Weise, die Unmittelbarkeit zu bewahren. Die Erzählungen überwinden sprachliche und zeitliche Distanzen spielend, haben keinerlei Kraft verloren und bohren sich so direkt in uns, wie sie es im Island der 1950er und 1960er Jahre getan haben. »Streichhölzer« ermöglicht endlich die verspätete Entdeckung einer großen isländischen Autorin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ásta Sigurðardóttir
Streichhölzer
Ásta Sigurðardóttir
STREICHHÖLZER
ERZÄHLUNGEN
Aus dem Isländischen von
Tina Flecken
Mit einem Nachwort von
Dagný Kristjánsdóttir
SONNTAGABEND BIS MONTAGMORGEN
Wenn jemand darauf geachtet hätte, wie die Frauen mich musterten, kurz bevor ich ging, wie sie sich Blicke zuwarfen, als sie an mir vorbeikamen, hätte er daraus geschlossen:
– Da ist sie, die Schuldige – die Hure.
Wie hätten sie mich auch verstehen können?
Lehnten sie sich doch an ihre Ehemänner und schäkerten vertraulich mit ihnen, treuherzige Gesichter, dezent geschminkt und ordentlich frisiert. Jede von ihnen hatte nur einen geliebt – einen einzigen Mann.
Ich sah aus wie ein Flittchen und starrte alle Männer begehrlich an, musste mich am Stuhl festkrallen, um mich ihnen nicht an den Hals zu werfen.
Lange betrachtete ich die Haare eines Mannes und wartete auf eine günstige Gelegenheit, mich zu ihm zu setzen.
– Du bist aufdringlich, sagte er. Verschwinde!
Als ich mich auf dem Platz neben ihm niederließ, stand er auf. Seine Haare wellten sich wie ein Ozean aus schimmernden Metallfäden.
Mit beiden Händen fasste ich hinein, wickelte die Haare um meine Finger und zog daran.
Das war so wundervoll, dass ich den Tumult, der um mich herum entstand, nicht wahrnahm, nur den undeutlichen Klang von Frauenstimmen und zerbrechendem Glas hörte.
Ich spürte, wie er sich wegduckte, um dem Schmerz auszuweichen. Bald wären sie mein, diese wogenden Haare, und ich würde meine Hände darin baden.
Er zuckte zurück, als ich meinen Griff genießerisch verstärkte. Sie durften mir nicht entgleiten, um keinen Preis – eher wollte ich sterben. Plötzlich umfasste jemand meine Finger und bog sie zurück, bis es knackte.
Zwar fühlte ich keinen Schmerz, aber mein Griff lockerte sich. Der mit den Haaren und ein anderer Mann lösten meine rechte Hand, doch mit der linken konnte ich wieder zupacken. So ging es eine ganze Weile. Keinem kam in den Sinn, dass ich mehr als eine Hand hatte.
Ich war vollkommen ruhig, sicher, dass ich gewinnen und diesen Schatz besitzen würde.
Ich fühlte nichts, wie sehr sie auch an meinen Fingern drehten und zerrten.
Ohne nachzudenken, griff ich immer wieder nach den Haaren, sobald meine Hände davon weggerissen wurden.
Doch dann durchfuhr mich ein heftiger Schmerz. Jemand zog meine Hand auseinander und renkte mir den Daumen aus. Ich spürte, wie sich die Knochen voneinander trennten.
– Lass los, du Bestie, zischte der mit den Haaren.
Ich sträubte mich, wand meine Hand widerwillig aus dem Haarschopf, ein paar ausgerissene, glänzende Kupferfäden hingen zwischen meinen Fingern.
Der Ärmel meines Kleids riss ein, jemand stieß mich, und ich fiel auf den Boden. Der Teppich war nass, unter mir knirschten Glasscherben.
Ich konnte spüren, wie sie durch den Stoff schnitten, in meine Haut stachen.
Das Gesicht des Hausherrn schwebte über mir, feist, mit empörter Miene – ein bizarrer Mond.
Er packte mich am Arm und schleifte mich über den Boden.
– Sie gehen jetzt! Straßenmädchen wie Sie will ich hier nicht sehen. Niemand hat Sie eingeladen. Meine Frau und ich laden nie solche Frauenzimmer ein, solche … solche Dirnen.
Der Treppenabgang klaffte kohlschwarz vor mir, bereit, mich lebendig zu verschlingen. Irgendwo tief unten konnte ich den Boden erahnen. Entsetzliche Angst packte mich, und ich tastete nach dem freien Arm des Verfolgers. Ich wollte um Gnade bitten, brachte aber vor Schluchzen kein Wort heraus. Gleich würde ich in diese grauenhafte Dunkelheit stürzen – ein Leben lang stürzt man, stürzt, und ganz unten auf dem Grund ist Teer, eine Teergrube, in der kleine Mäuse sich im zähen Schlamm winden, mit den winzigen, zierlichen Pfoten scharren und gegen den Tod ankämpfen. Dann tränkt der Teer ihr weiches Fell und füllt ihre großen, dunklen Augen – als ich gerade begann, zu fallen, zu stürzen, umfing mich jemand und zog mich wieder hoch.
– Wirf sie nicht raus, sonst musst du mich auch rauswerfen! Sie sitzt bei mir Modell. Sie zittert ja wie ein verängstigtes Tier.
Beide zerrten an mir.
– Lass sie los! Deine Gläser kosten doch nicht mehr als zweifünfzig das Stück.
Dann half er mir auf einen Stuhl.
Ich wagte nicht aufzuschauen, Tränen flossen mir in einem fort über die Wangen und aus der Nase und sammelten sich in meinem Schoß, wo der Samtstoff sie aufsaugte. Ich musste an die Bewässerungsgräben denken, die ich früher einmal ausgehoben hatte.
Niemand sollte mich weinen sehen. Ich starrte auf den Teppich, wo die zerbrochenen Gläser gelegen hatten.
Die meisten Scherben waren aufgesammelt worden, aber die Weinflecken waren noch nicht getrocknet.
Da musste ich noch mehr weinen, weil alles so traurig und aufwühlend war – die Gläser würden nie mehr heil, der Wein würde niemals getrunken, die abgerissenen, verdrehten Saiten meiner Finger würden nie wieder auf ihre Harfe aufgezogen werden.
Etwas in meinem Inneren sagte mir, dass ich es verdient hätte, in dem Teersumpf zu versinken und qualvoll zu sterben, so wie die armen, kleinen, weichen Mäuse, die nie etwas verbrochen hatten.
Ich, eine Mörderin, Diebin und Hure.
Ein Heer von Richtern stand mir gegenüber. Sie waren ernst, streng und unglaublich weise. Ihren durchdringenden Blicken war ich schutzlos ausgeliefert. Alle meine Vergehen waren in meine Seele eingeschrieben und lagen vor ihnen wie ein aufgeschlagenes Buch.
Angstvoll krümmte ich mich zusammen und zitterte vor Schluchzen. Ich wusste, um Gnade zu bitten war zwecklos, doch als letzte Hoffnung kam mir in den Sinn, dass Verbrecher mitunter begnadigt werden. Angespannt wartete ich.
Mit einem Mal verwandelte sich eine Richterin in einen bebrillten Engel, der zu mir kam und mich stützte. Sie führte mich zur Toilette und strich mir sanft die Haare aus den Augen.
– Wenn du weinst, muss ich auch weinen, sagte sie, und während sie mir mit dem Handrücken die Tränen abwischte, sah ich ihre Augen hinter den Brillengläsern feucht werden.
Ich schmiegte mich an sie und hörte, wie ihr Herz schlug. Da wurden mir meine Sünden noch schmerzlicher bewusst, denn sie war so gut. Einiges beichtete ich ihr, und sie vergab mir, ohne sich um ihr Kleid zu scheren. Ich war nicht mehr allein – einer der guten Engel war bei mir.
So fürsorglich war der liebe Gott.
Dann war sie plötzlich verschwunden, und als ich sie jammernd suchte, traf ich auf einen weiteren verwandelten Richter. Er war zu einem Seemann geworden.
– Weinst du etwa, Ásta? Du? Die Stärkste von uns allen?
Er streichelte mit seiner großen Hand meine Wange.
– Wer war böse zu dir? Den schlage ich zu Brei … zu Fischbrei, meine ich.
– Niemand war böse zu mir, wisperte ich schluchzend.
– Wir halten alle zu dir, Ásta, sagte dieser große Mann mitfühlend.
– Geh nicht allein hinaus ins Dunkle, ich begleite dich, fügte er hinzu. Es ist nicht schön, allein unterwegs zu sein.
Dann ging er seinen Mantel holen.
Draußen wartete ich eine Weile und horchte auf Schritte von der Treppe. Es war eine steile und gefährliche Treppe, man musste vorsichtig sein. Ich wartete lange, doch als niemand kam, lief ich los und suchte nach den Gästen, die schon vor mir gegangen waren. Die Straßen waren leer und eigentümlich still. Die Häuser hatten die Augen geschlossen und schliefen tief und fest. Nur die Straßenlaternen hielten einsam Wache in der Dunkelheit, ohne zu blinzeln. Eine unheilvolle Stille lag über der Stadt. Meine Schritte hallten dumpf von den steinernen Wänden um mich herum.
Vor dem Schaufenster des Souvenirladens an der Ecke Austurstræti und Aðalstræti blieb ich stehen. Schlagartig wurde mir bewusst, dass die Straßen schneefrei waren und sich keine Spuren abzeichneten. Ich konnte keiner Fährte folgen, und niemand würde mich finden; ich hatte keine Spur hinterlassen. Ich begriff, dass die Welt, nach der ich suchte, verschwunden, das Vergnügen vorbei und nirgends eine Begleitung in Sicht war.
Man hatte mich wegen all meiner früheren und späteren Vergehen in die tiefste Dunkelheit hinausgejagt. Gott würde mir nicht vergeben. Jetzt verstand ich, wie Jesus sich am Kreuz gefühlt hatte, als er nach Gott rief und fragte, warum dieser ihn verlassen habe. Ich war vollkommen allein, verirrt, verloren; sogar Jesus hatte vergessen, wie es ihm am Kreuz ergangen war, und dachte nicht mehr an mich. Ihm ging es gut im Himmel.
Nirgendwo konnte ich mich zur Ruhe betten, nirgendwo dem ruhigen Herzschlag eines anderen Lebewesens lauschen, die Augen schließen und einschlafen.
Unter diesen steifen, stierenden Laternen war ich zu ewigem Wachsein verdammt.
Wieder begann ich zu weinen, laut und hemmungslos, wie ein zu Tode verängstigtes Kind, das seine Mutter verloren hat und die Dunkelheit herannahen sieht.
Die Laute wurden von einem Steinkoloss zum anderen geworfen und verhallten in der endlosen Ferne.
Ich setzte mich auf die Straße, streckte die Beine aus, gab mich geschlagen und schloss die Augen, damit ich nicht sehen musste, wovor mir graute.
Auf einmal hörte ich Schritte hinter der Straßenecke. Ich hielt die Luft an und horchte.
Gott hatte mir wohl doch vergeben und einen weiteren Tröster gesandt. Es dauerte nicht lange, bis er um die Ecke marschierte.
Ein Mann mittleren Alters, äußerst vertrauenerweckend. Er blieb abrupt stehen und wich ein Stück zurück, als er mich da liegen sah. Dann kam er zu mir und hob mein Kinn an.
– Hast du dir wehgetan, Schätzchen?, fragte er.
– Nein, nein.
– Warum weinst du dann so?
– Ich weiß es nicht.
– Du bist ein hübsches Püppchen, sagte er. Komm mit zu mir und wasch dir das Gesicht. Dann half er mir auf die Beine und nahm mich am Arm. So gut sind die Menschen.
Unversehens fand ich mich in einem vornehmen Wohnzimmer wieder, hatte mir den Schmutz aus dem Gesicht gewaschen und mich gekämmt. Vor mir standen ein Kristallglas mit Champagner und eine große Platte mit belegten Broten.
Der Tröster hatte den Mantel abgelegt, und erst jetzt fiel mir auf, wie korpulent er war. Er lächelte mir väterlich zu, der Sessel knarrte behaglich, als er sich setzte. Dann zündete er sich eine riesige Zigarre an und fixierte mich.
– Du hast etwas an dir, sagte er. Du bist was Besonderes, mein Täubchen.
Er trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte und sah aus, als wollte er einen Geschäftsbrief diktieren.
– Woher hast du nur diese Augen? Ich habe noch nie so schöne Augen gesehen.
Er stieß eine dicke Rauchwolke aus und musterte mich von oben bis unten.
– Welche Augenfarbe hast du? Bist du hellsichtig?
Darauf wusste ich keine Antwort und beugte mich über das Champagnerglas. Eine Zeitlang herrschte Schweigen.
Er räusperte sich.
– Was machst du so, Schätzchen?, fragte er.
– Ich bin Modell, antwortete ich lebhaft.
– Aha, Modell? Was war das noch gleich?, fragte er ein wenig verwundert.
– Ich posiere vor Leuten, die zeichnen, sitze nackt auf einem Stuhl oder auf dem Boden, antwortete ich und setzte mich in Positur.
– Ach ja, richtig. Ich male und zeichne auch gelegentlich.
Er zeigte auf die Wand.
– Da siehst du meine Werke, sagte er nicht ohne Stolz. Fantasien hauptsächlich.
Ich blickte auf und sah ein großes Gemälde in einem prunkvollen Rahmen. Eine junge Frau war darauf in einem knappen Badeanzug mit ungeheuer großen Brüsten und einer Taille, die genauso schmal war wie der Hals. Sie hielt eine Angelrute in der Hand. Im Hintergrund ein violetter Berg und ein friedlicher See mit schnittigen Segelbooten. Um die Frau rankten sich üppige Rosen. Das Bild war dilettantisch.
Es gab noch mehr Bilder der gleichen Machart mit ähnlichen Motiven, nur kleiner. Ich zuckte zusammen, als er aus heiterem Himmel sagte:
– Würdest du dich ausziehen, damit ich sehen kann, wie du gebaut bist? Vielleicht kannst du mir auch Modell sitzen.
– Na gut, sagte ich, froh, ihm einen kleinen Gefallen erweisen zu können. Er hatte so viel für mich getan. Ich hörte, wie er nach Luft schnappte.
– Dann beeil dich, Schätzchen, sagte er.
Ich leerte das Champagnerglas und ging ins Bad, um mich auszuziehen.
Mein Kleid war völlig zerrissen, was ich erst jetzt bemerkte, der Rock fast bis oben hin, ein Ärmel lose, und die Naht am Ausschnitt geplatzt. Das war mein bestes Kleid gewesen.
Ich brauchte länger, um aus den Fetzen herauszukommen, weil mir die Hand wehtat, die die Richter auseinandergezerrt hatten. Schließlich stand ich nackt auf dem gefliesten Boden und strich mit den Händen über meinen Körper. Beinahe hätte ich mich geschämt bei dem Gedanken an das Mädchen auf dem Bild im Wohnzimmer. Ich war so dick, meine Brüste waren zu klein und nicht anziehend, und die Schamhaare bildeten kein gleichseitiges Dreieck …
Da stand er urplötzlich splitternackt vor mir, dieser gutmütige Mann, mit blaurot geschwollenem Gesicht. Er verdrehte die Augen und streckte die bebenden Hände nach mir aus. Sein Schmerbauch hing ihm bis unter die Knie, die Brüste baumelten schlaff auf seiner behaarten Brust und wackelten bei jedem Herzschlag.
In Panik wich ich zurück, vor Ekel drehte sich mir der Magen um.
Ich hatte ihn für einen Tröster gehalten, einen väterlichen Engel, und jetzt wollte er über mich herfallen. Als er von hinten auf meinen Oberschenkel tatschte, verlor ich den Halt und stürzte auf den spiegelglatten Fußboden. Er fiel auch, wabbelte auf dem Schmerbauch zwischen meinen Beinen. Dann wälzte er sich auf mich, schäumend vor Gier.
Ich drehte durch, biss ihn, kratzte ihn mit den Fingernägeln und riss ihm graue Haarsträhnen vom halbkahlen Schädel. Er stank nach Zwiebeln, sein strenger Mundgeruch erstickte mich fast, aber ich kämpfte wie eine Wildkatze um mein Leben. Als er meine Hände zu packen bekam und auf den Boden drückte, durchfuhr der Schmerz meine verletzte Hand.
Er zwang meine Beine auseinander und legte sich mit vollem Gewicht auf mich.
Ich merkte, dass es kein Entkommen mehr gab, und dachte an all die Männer, die ich geliebt hatte, um die ich die Beine geschlungen hatte, voller Hingabe.
Mein Körper sank kraftlos auf den eiskalten Boden und gab auf.
Dann brach ein Laut aus meiner Kehle, schwoll an und wurde zu einem gellenden Schrei, der in den Sälen des Hauses hallte. Einen solchen Laut hatte ich noch nie gehört. Ein Zucken durchfuhr mich, und ich begann zu wimmern.
Er schreckte zurück, und ich sah, dass er zu sich kam. Sein fettes Gesicht nahm Form an und ähnelte wieder dem des Trösters. In seine kreisrunden Augen trat Angst. Er rappelte sich hoch und hockte sich auf den Badewannenrand, der Schmerbauch und der Hintern sackten auf beiden Seiten nach unten.
Ich fing wieder an zu schluchzen.
– W-was machst du da … m-machst du mit mir? Ich dachte, du wärst gut wie ein V-Vater.
Tränen strömten mir über die Wangen.
Er konnte kaum verstehen, was ich sagte, aber seine sabbrigen Lippen bewegten sich, ein merkwürdiger Ausdruck trat in sein Gesicht, und sein Mund verzog sich zu einer speckigen Grimasse.
Er tat mir aufrichtig leid, so sehr, dass ich mein eigenes Elend vergaß.
Bestimmt hatte er eine Tochter, vielleicht ein Mädchen in meinem Alter.
Er schniefte, drehte niedergeschlagen den Diamantring an seinem Finger. Ich zog mich so hastig an, dass mein Kleid noch mehr einriss. Überall richtete ich Unheil an. Kam hierher wie der leibhaftige Teufel und führte diesen Mann in Versuchung, der aussah wie ein Apostel und normalerweise gewiss grundanständig war.
War er etwa nicht nett zu mir gewesen?
Ich lief in den Flur und stolperte die teppichbelegte Treppe hinunter. Die Haustür fiel ins Schloss, ich rannte los, rannte durch die Straßen wie ein gehetztes Tier, der schneidend kalte Wind ließ mein von Tränen und Wein durchnässtes Lumpenkleid gefrieren und wirbelte Schneeflocken in mein Gesicht.
Mir war eiskalt, ich suchte nach einem Zufluchtsort.
Alle Häuser waren fest verrammelt, der Sturm pfiff und heulte durch die Gassen.
Zitternd ging ich von Autofenster zu Autofenster und starrte auf die gepolsterten Sitze und warmen Wolldecken. Alle Autos waren verriegelt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, kauerte mich schließlich hinter einen kleinen, roten Wagen und machte mich am Griff der Hintertür zu schaffen. Sie sprang auf.
Hurra! Der Wagen war offen.
Freude durchströmte mich, und ich staunte über die Güte Gottes. Ich rollte mich auf der Rückbank zusammen, kuschelte mich in meinen Mantel und döste vor mich hin. Geraume Zeit verging, ich muss wohl eingeschlafen sein. Erst als jemand in der Nähe einen Presslufthammer in Gang setzte, erwachte ich. Es war schon taghell, die Sonne schien. Ich war durchgefroren und mein Körper bis hinauf zur Brust gänzlich taub. Ich konnte mich nicht rühren und schloss noch einmal die Augen, in der Hoffnung auf einen Tagtraum, bis ich draußen Schritte hörte. Die Wagentür wurde aufgerissen.
– Fräulein! Fräulein! Was machen Sie in meinem Auto?
Ich öffnete die Augen wieder.
Der Autobesitzer war ein abweisender, gut gekleideter Mann. Von dem war weder Verständnis noch Barmherzigkeit zu erwarten, das erkannte ich schon an seinem Gabardine-Mantel.
– Irgendwo muss man ja schlafen, antwortete ich und setzte mich auf.
– Das können Sie woanders machen, mein Auto ist kein Schlafplatz. Verschwinden Sie, aber dalli. Sofort, habe ich gesagt. Haben Sie verstanden? Dieses Auto ist nicht dazu da, irgendein Dreckspack zu beherbergen.
Ich krabbelte hinaus und versuchte, mit den tauben Füßen aufzutreten. Bis zur Taille fühlte ich mich wie abgestorben. Ein paar Schritte schaffte ich, dann fiel ich auf die Straße und rappelte mich wieder hoch. Während ich mich weiterschleppte, knickte ich immer wieder ein, entfernte mich aber Stück für Stück von dem Auto und seinem Besitzer.
Ich befand mich in der Weststadt, direkt am Meer.
Schneeweiße Möwen kreisten über dem Ozean, während helle Wellenkämme in langen Reihen auf der tiefblauen Wasseroberfläche heranrollten und an der Flutlinie brachen. Die Sonne schien fröhlich, zartrosa Wolkenbänder umgürteten den Gletscher.
Ich sog die frische Luft ein und faltete die Hände vor Freude, weil das alles so schön war.
Als jemand nicht weit von mir einen langgezogenen Pfiff ausstieß, drehte ich mich um. Es war ein Arbeiter in einem blauen Denim-Overall und Gummistiefeln.
– Na, Süße! Hast du dich letzte Nacht amüsiert?, rief er.
Allmählich kehrte wieder Gefühl in meine Beine zurück. Aus der anderen Richtung kam ein weiterer Arbeiter, der genauso aussah, bloß in einem gelben Overall. Plötzlich war ich von lauter Arbeitern umringt.
Die Aussicht auf Gesellschaft stimmte mich zuversichtlich, und ich wollte zu den Männern gehen, fiel aber wieder auf die Straße.
Jemand hob mich hoch, trug mich in einen Schuppen und setzte mich auf eine Bank neben einen kleinen Kohleofen. Großzügig wurden Kohlen nachgefeuert, die Hitze brannte auf meiner Haut. Jetzt spürte ich, dass mein Gesicht bis zum Hals eingefroren war, filzige Haarsträhnen fielen mir in die Augen. Ich zitterte, während sich die Wärme in meinem Körper ausbreitete. Ein älterer Mann mit einer Pelzmütze, wässrigen Augen und Triefnase tätschelte mir den Kopf. Dann zog er ein schmutziges Taschentuch heraus und wischte mir das Gesicht ab. Es roch angenehm nach Tabak.
– Sie hat schöne Augen, sagte er.
Die jungen Männer am Tisch unterhielten sich auffallend laut und rissen unverhohlen Witze über den Vorarbeiter. Ab und zu blickten sie verlegen zu mir herüber.
– Willst du einen Kaffee?, fragte einer.
– Aber sicher will sie Kaffee!
Er holte seine Thermoskanne, goss Kaffee in eine Tasse und reichte sie mir. In dem Kaffee waren Milch und Zucker, er wärmte meine Hände.
– Sie hat bestimmt auch Hunger, sagte einer der jungen Männer. Er trug eine schwarze Strickmütze, unter der blondes Haar hervorlugte.
Dann zog er sein in rostbraunes Packpapier eingewickeltes Frühstücksbrot aus der Hosentasche, reichte mir eine Schnitte und ließ mich abbeißen. Das Brot war mit Butter und Lammpastete belegt. Es war köstlich.
Inzwischen war mir warm geworden, das Zittern hatte aufgehört. Ein wohliges Gefühl zog sich durch jeden Nerv meines Körpers – ich spürte ihn wieder bis in die Zehen und genoss es, noch lebendig zu sein, nicht versunken im Teersumpf wie die armen kleinen Mäuse.
Ich aß das Brot und trank den Kaffee, jemand gab mir eine Zigarette, ein anderer Feuer. Ach, wie schön das Leben war. Die Männer wunderten sich nicht, stellten keine Fragen, brachten mich nur auf die Beine und halfen mir hinaus.
Sie verstanden alles.
Zum Abschied winkten sie lächelnd. Einer pfiff den neuesten Schlager, und die Melodie begleitete mich. Noch nie hatte ich so deutlich gespürt, wie gut die Menschen zueinander und zu Gott sind, und wie gut Gott zu den Menschen und sich selbst ist.
Ich hätte laut lachen können vor Glück und Zufriedenheit.
An der Südseite der Häuser hatte die Sonne den Schnee zum Schmelzen gebracht, kleine Vögel hüpften zwitschernd im Matsch und pickten Körner, die gute Menschen durchs Küchenfenster ausgestreut hatten.
Ihr Gesang und ihr fröhliches Zwitschern erfüllten mich mit unbeschreiblicher Freude.
Das Gehen bereitete mir noch Schwierigkeiten, denn die Absätze meiner Schuhe waren locker, und meine Füße taten weh, waren gequetscht und wundgescheuert, aber mir war schön warm.
Unwillkürlich begann ich, dieselbe Schlagermelodie zu summen, und kickte einen kleinen, hübschen Stein auf der Straße vor mir her.
DIE STRASSE IM REGEN
Der graue Asphalt glänzte regennass in der Abendsonne, die Pfützen warfen Lichtspeere in alle Richtungen. Regentropfen nieselten herab, saugten das Licht auf und trudelten zur Erde wie dem Tode geweihte Nachtfalter.
Ab und zu fegte eine Meeresbrise durch die Bäume, strich über das Gras und bauschte die Wäsche, die zum Trocknen draußen aufgehängt worden war.
Ich fühlte mich elend, weil das feuchte Kleid an meinem Körper klebte und wie ein nasses Segel um meine nackten Beine schlackerte. Aber ich fand mich damit ab, denn es regnete schon weniger, und meine Kleidung würde schnell wieder trocknen.
Ich war durstig und ein wenig hungrig, doch am meisten sehnte ich mich nach einer Zigarette, die ich nicht hatte.
Eine freundliche Holzbank lockte mich an, ich ließ mich erschöpft darauf nieder.
Jetzt hatte ich einen guten Platz in diesem großen Theatersaal ergattert, ohne zu bezahlen. Ich betrachtete die Kulisse und die Bühne.
Schneeweiße und ockergelbe Hausgiebel leuchteten im Abendlicht wie unbeschriebene Seiten, die Dächer funkelten in tausend Farben, grün, schwarz und rot.
Über den bleigrauen Asphalt schritten die Personen. Junge Männer, resolut und selbstsicher, stolzierten mit lautem Gejuxe an mir vorbei, junge Mädchen schlenderten tuschelnd Arm in Arm, stießen schrille Lacher aus, wie das Geräusch von zerschellendem Glas.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite weinte ein kleines Kind bitterlich über sein kaputtes Spielzeugauto, die Tränen flossen unaufhaltsam, obwohl es sie immer wieder wegwischte.
Eine alte, gebückte Frau schleppte mit geschwollenen Händen einen Mülleimer in einen Hinterhof.
Gleich neben mir spielten zwei weiße Tauben. Ihre Augen schimmerten dunkel, sie gurrten verliebt in die Welt hinaus, hoben die weißen Flügel und flatterten unbeschwert im Rinnstein herum. Glitzernde Regentropfen stoben auf wie Funken.
Da kam ein alter Säufer über die Straße auf mich zugewankt. Er streckte die zitternde, knochige Hand aus und sank schwerfällig neben mir auf die Bank.
– Du solltest fröhlich sein, sagte er vorwurfsvoll. Heut Abend weht der Wind nach Norden. Warum weinst du?
Ich schaute auf und tupfte mit dem Kopftuch meine Wangen ab.
– Ich weine nicht, antwortete ich. Mich hat nur die Sonne geblendet.
Er zog eine Flasche Schwarzen Tod heraus und hielt sie ins Licht. Sie war noch knapp halbvoll.
– Das ist der Tod, sagte er wichtigtuerisch. Willst du ’nen Schluck?
Ein Konterschnaps war nicht zu verachten, also griff ich wortlos nach der Flasche und trank einen ordentlichen Schluck. Der Schnaps war unverdünnt, mir wurde leicht übel, aber dann durchströmte mich eine angenehme Wärme. Der Säufer beäugte mich.
– Ich glaub, du könntest ’ne Zigarette vertragen, sagte er.
Er fischte zwei zerknitterte Zigaretten aus der Brusttasche und gab mir eine. Nachdem ich sie angezündet hatte, bibberte ich kaum noch und spürte die Kälte nicht mehr so sehr. Die Schönheit des Tages stieg in höhere Sphären auf und näherte sich zusehends der Vollkommenheit. Der Säufer begann, mit heiserer Stimme einen Psalm vor sich hinzusingen, traf aber nicht einen richtigen Ton und hörte wieder auf.
– Hör mal, hast du ’nen Fünfer?, krächzte er.
Ich lief rot an, weil ich so arm war, dass ich für diesen großzügigen Mann noch nicht einmal einen Fünfer übrig hatte.
Um meine Verlegenheit zu überspielen, suchte ich hektisch in meinen leeren Taschen, obwohl ich wusste, dass dort nichts zu finden war.
– Nein, ich hab keinen Fünfer, flüsterte ich. Der ist weg.
Der Säufer schaute mich mitfühlend an:
– Macht doch nichts. Ich wollte mir nur ’ne Suppe holen, warme Suppe. Da gibt’s ein Mädchen, die verkauft mir manchmal welche, wenn ich Hunger hab.
Er schaute mich an, als wollte er sich entschuldigen.
– Man hat so selten Geld für Essen, fügte er hinzu.
Dann trank er einen großen Schluck aus der Flasche und bekam einen Hustenanfall.
Ich dachte, er würde ersticken, und stützte ihn, während er sich vor Schmerzen krümmte.
Seine Zigarette fiel in eine Pfütze, die Glut erstarb zischend und der trockene Tabak saugte das Wasser auf wie ein Schwamm.
Der Schnaps troff ihm aus den Mundwinkeln in den schmutzigen Bart und auf den Hals. Ich tätschelte seine Wange, wischte ihm mit meinem schäbigen Tuch das Gesicht ab, und als er sich wieder gefangen hatte, gab ich ihm die andere Zigarette.
Dann nahm ich noch einen Schluck aus der Flasche. Prost!, sagte ich.
Verwundert schaute er auf.
– Du bist wieder fröhlich, sagte er. So sollen Mädchen bei Sonnenschein sein … junge Mädchen, fröhliche Mädchen. Prost!
Ein Lächeln erstreckte sich über sein bärtiges, zerfurchtes Gesicht und entblößte seinen zahnlosen Oberkiefer.
– Soll ich dir mal was erzählen?, fragte er. Vor vielen Jahren saß ich mal mit ’nem Mädchen in einem schönen Garten. Es war ein junges Mädchen, so schön wie du und so gut zu mir wie du. Ich glaub, ich erinnere mich … auflandiger Wind und Regenschauer, genau wie jetzt, und zwischendurch fröhlicher Sonnenschein …
Der Säufer verstummte und starrte an mir vorbei in die Ferne.
Als ich in seine rotunterlaufenen Augen blickte, sah ich, dass aus einer mysteriösen Quelle Wasser hineinfloss und sie bis zu den Lidern füllte.
Sein Kopf blieb reglos, er lächelte immer noch. Die Tränen tropften wie Quecksilberkugeln auf seine zerlumpte Kleidung und fielen zusammen mit dem Regen in die Pfützen.
Schwungvoll schüttelte ich mein regennasses Haar aus der Stirn.
– Ist sie gestorben?, fragte ich.
Der Säufer kam wieder zu sich und begann zu schluchzen.
– Nein. Sie ist n-noch am L-Leben. Jetzt wächst Hi-Hirtentäschel auf ihrem G-Grab …
Ich gab ihm mein Tuch, damit er sich die Tränen abwischen konnte. Dann schaute er mir direkt ins Gesicht.
– H-Hör mal, ich hab gehört, du kannst dichten. W-Würdest du ’nen Nachruf auf sie schreiben, kann ruhig ein modernes Gedicht sein. B-Bitte.
Er blickte mich hoffnungsvoll an. Das Schluchzen hatte nachgelassen.
– Ich kann es versuchen, entgegnete ich. Darauf trinken wir! Auf den Sonnenschein! Findest du es nicht seltsam, dass es bei Sonnenschein regnet?
Der Säufer nahm einen Schluck aus der Flasche und hielt sie prüfend ins Licht. Dann sah er mich lächelnd an.
– Das bedeutet, dass ’ne Regenpause kommt, erklärte er. Heut Nacht dreht der Wind auf Nord. Leise fügte er hinzu:
– Jetzt haben wir nicht mehr viel übrig.
– Glaubst du, dass es kalt wird?, fragte ich zwischen Bangen und Hoffen.
– Nein, nein. Nicht im Hochsommer, außer manchmal kurz vor Sonnenaufgang. Sobald die Sonne rauskommt, wird einem schnell warm …
Unsere Zigarette war heruntergebrannt und die Flasche leer.
Der Säufer hob eine Kippe auf und gab sie mir.
– Vergiss das Gedicht nicht, sagte er. Schreib was über Küstenkamille. Ich geh runter ins Stræti.
– Ja, antwortete ich und steckte den Zigarettenstummel in meinen Büstenhalter. Ich hoffe, du kriegst eine Suppe.
Er schlurfte die Straße hinunter und begann zu singen:
Jesus will glücklich mich sehen
als wahren Sonnenschein,
der alle Tage hell leuchtet
für jeden, Groß und Klein.
Seine zittrige, heisere Stimme wurde von einem heftigen Husten erstickt, er fiel auf die Knie. Die leere Flasche schlug auf die Straße und zerbrach.
Die weißen Tauben wurden aufgescheucht und flogen über die Traufe eines grünen Hausdachs.
Der Säufer kam wieder auf die Beine und wischte die blutige Hand an seiner Jacke ab. Er hatte sich an den Scherben geschnitten. Dann wankte er die Straße hinunter.
Die leichte Brise trug Fetzen des Lieds zu mir herüber:
Für Jesus, für Jesus
will ich ein Sonnenstrahl sein!
Ich überließ mich dem Rausch, selig in mich versunken, und genoss die Berührungen der Regentropfen, die schwer herabfielen.
Ruhe überkam mich, eine angenehme Taubheit. Ich hörte ein gewaltiges Orchester auf den Dachrinnen und den Mülltonnendeckeln spielen. Der Singsang der fallenden Regentropfen wurde zu einem zusammenhängenden Stück mit Tempo und Crescendo – das unsterbliche Genie spielte ein Klaviersolo, begleitet von diesem grandiosen Orchester. Ein zaghaftes, suchendes Stakkato. Der Regen schwoll an, die Trommeln dröhnten, und die sausenden Schlägel stürzten wie Lawinen auf die Becken.
Ich war beseelt, spürte keinen Hunger und keine Kälte und besaß eine halbe Zigarette. Was machte es da schon, dass ich ein wenig durstig war und kein Streichholz hatte? Es war wundervoll, zu leben.
Als ich an den Nachruf dachte, hob sich meine Laune ins Unermessliche.
Hier wollte ich für immer bleiben.
Und das Orchester spielte weiter.
– Guten Tag!
Die Ansprache klang so streng, dass ich erschrak. Es waren zwei Polizisten. Sie hatten sich rechts und links von mir aufgebaut, breitbeinig und ernst, die Hände hinterm Rücken.
Es wurde entsetzlich still.
Das Orchester hörte auf zu spielen, als wäre das Tonband zerschnitten worden, und die Regentropfen prasselten wieder ungeordnet auf die Mülltonnendeckel.
Ich überlegte fieberhaft. Wie tragisch, dass alle gut zu mir sein wollten, wenn ich es gar nicht brauchte.
Regelrecht zum Heulen.
Ich wusste kaum, wie ich mich entschuldigen sollte:
– Herzlichen Dank, aber Gott tut gerade so viel für mich, dass die Polizei es nicht besser machen kann.
Das klang fast unhöflich, stellte ich fest.
Die Polizisten wirkten leicht irritiert.
– Aber du bist tropfnass, sagte der eine. Willst du kein Obdach?
Obdach! Ich zuckte vor Schreck zusammen, als ich an die enge Zelle und die Blechtassen mit dem lauwarmen Wasser dachte – allein die Vorstellung, ins Dunkle gebracht und hinter Eisenriegeln und Steinwänden von all der Pracht hier draußen abgeschottet zu werden! Womöglich verängstigt den wutschnaubenden Flüchen und halbherzigen Gebeten der Gefangenen lauschen zu müssen anstatt dem Liebesgurren weißer Tauben, den Sonnenscheinliedern freier Menschen und nicht zuletzt diesem himmlischen Klaviersolo auf den Mülltonnendeckeln.
Ich lächelte liebenswürdig und versuchte, meine vorherige Unverfrorenheit wiedergutzumachen:
– Vielen Dank, aber ich denke, das ist nicht nötig. Wenn Gott dich nassregnet, trocknet er dich gleich wieder. Der Wind dreht auf Nord, und wenn zwischen den Schauern die Sonne scheint, deutet das immer auf eine Regenpause hin.
Tapfer wartete ich auf den Ausgang des Gesprächs – kluge Bemerkungen über das Wetter steigern stets die Erfolgsaussichten.
Die Polizisten tauschten einen fragenden Blick. Schließlich sagte der eine:
– Sie ist nicht volltrunken. Lassen wir sie lieber.
– Tschüss!, sagte ich kumpelhaft und stolzierte erhobenen Hauptes über die Straße, darum bemüht, möglichst wenig zu schwanken.
Die weißen Tauben waren zurückgekehrt und schossen in einem großen Kreis an mir vorbei.
Bald wurde ich müde und war so unsicher auf den Beinen, dass selbst die Straße mich zum Hinlegen reizte. Vor mir war eine verlockende, grüne Wiese, die ich mit letzter Kraft erreichen wollte.
Schon von Weitem spürte ich, wie weich das Gras war, die Brise wehte mir den herben Erdgeruch in die Nase.





























