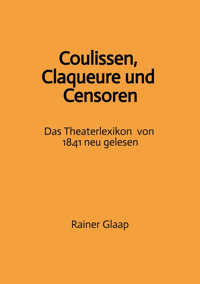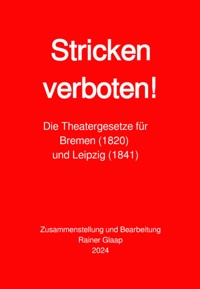
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Das Buch gibt die vollständigen Theatergesetze für das Theater Bremen von 1820 und das Theater in Leipzig von 1841 wieder. Mit einer Einführung zur Einordnung dieser Theatergesetze, die man heute eher als Hausordnung oder Vertragsbestandteile in Arbeitsverträgen sehen würde (z.B. dem Normalvertrag Bühne). Beschrieben werden die Aufgaben von Intendanz, Regie, Mitwirkenden, Friseur, Garderobiere, Theaterdiener etc. pp. inklusive der Zahlungen, die bei Nichtbeachtung der Vorschriften anfallen. Besonders interessant: Es gibt eigene Absätze zum Schutze von Frauen auf der Bühne. So ist Küssen nur erlaubt, wenn es in der Rolle ausdrücklich angegeben ist. Und: Stricken auf den Proben ist für Schauspielerinnen verboten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stricken verboten!
Die Theatergesetze für Bremen (1820) und Leipzig (1841)
Zusammenstellung und Bearbeitung
Rainer Glaap
2024
Zusammenstellung und Bearbeitung:Texte (Vorwort und Einführung): © Copyright by Rainer GlaapUmschlaggestaltung: © Copyright by Rainer Glaap
Autor:Rainer GlaapHackfeldstr. 3628213 Bremen / [email protected]
Verlag Rainer Glaap
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur Bearbeitung
Warum die Theatergesetze heute noch lesen?
Auszüge aus den Bremer Theatergesetzen
Auszüge aus den Leipziger Theatergesetzen
Gesetze für das Bremer Theater (1820) unter der Direction von August Pichler.
Erster Artikel.
Den Inspicienten betreffend
Soufleur
Garderobenordnungen
Friseur
Theater-Diener
Straf-Kasse
Die Leipziger Theatergesetze
Vorwort der Autoren von 1841
I. Abtheilung. Gesetze.
I. Abschnitt. Allgemeines.
II. Abschnitt. Rollen.
III. Abschnitt. Proben.
IV. Abschnitt. Vorstellungen.
V. Abschnitt. Oper, Chor, Ballet, Orchester
II. Abtheilung. Instructionen.
Regisseur.
Inspector.
Bibliothekar und Secretair.
Souffleur.
Theaterdiener.
Garderobe, Garderobepersonale.
Maschinist. Decorationspersonale.
Requisiteur.
Theater – Ordnung.
III. Abtheilung. Strafcasse.
Schlußbemerkung
Anhang
Das Bremer Stadttheater (Auszüge aus dem Wikipedia-Eintrag)
Theater der Stadt Leipzig (Auszüge aus dem Wikipedia-Eintrag)
Titelblatt der „Gesetze für das Bremer Theater“ (1820)
Gesetze für das Bremer Theater: Seite 1
Gesetze für das Bremer Theater: Seite 20/21 (Friseur, Theater-Diener u. Straf-Casse)
Titelblatt für das Theater-Lexikon Leipzig
Theater-Lexikon Leipzig: Inhaltsverzeichnis Theatergesetze
Theater-Lexikon Leipzig: Vorwort
Bespiel: Stichwort Extemporiren (Leipzig)
Theater-Lexikon von 1841 (ausgewählte Stichwörter)
Ensemble
Extemporieren
Gestikulieren
Verbeugung
Google: Über dieses Buch
Vorwort zur Bearbeitung
Die Gesetze für das Bremer Theater (1820)1, ebenso die Leipziger Theatergesetze (als Anhang zum Theater-Lexikon)2, liegen bei Google Books als eingescannte Exemplare vor. Die Texte sind diesen Exemplaren entnommen und behutsam bearbeitet (mehr dazu im Anhang).
Google hat die Bücher automatisiert einem OCR-Verfahren unterzogen, der erkannte Text wurde von mir übernommen. Die Schreibweise des Originals wurde beibehalten, lediglich Erkennungsfehler wurden von mir bereinigt.
Die Leipziger Theatergesetze wurden 1841 als Anhang zum Theater-Lexikon publiziert. Eine Publikation einzelner Stichworte befindet sich in Vorbereitung.
Rainer Glaap
Bremen, Februar 2024
Blog: https://publikumsschwund.wordpress.comBuch: „Publikumsschwund? Ein Blick auf die Theaterstatistik seit 1949“ erscheint im Frühjahr 2024 bei Springer.
Warum die Theatergesetze heute noch lesen?
Die Theatergesetze von damals haben sich im Theaterrecht von heute mit zahlreichen Regelungen im Normalvertrag - Bühne, Tarifverträgen etc. niedergeschlagen. Einen guten Überblick über das Theaterrecht bietet z. B. der Jurist und ehemalige Theaterintendant Christoph Nix (in Kassel und Konstanz) in der gleichnamigen Publikation von 20193.
Viele der Theatergesetze haben überdauert und sich in heutigen Regelungen niedergeschlagen. Interessant ist, dass manche Fragestellungen des frühen 19. Jahrhunderts bis heute an Aktualität nichts verloren haben – so findet sich schon 1820 ein Absatz, den man heute als Anleitung zur Intimitätskoordination verstehen kann (s. u.).
Zur Geschichte der Gesetze: Offensichtlich gab es einen solchen Wildwuchs am Theater, dass es einen großen Regelungsbedarf für den Umgang miteinander gab. Sicher geschuldet dem Obrigkeitsdenken des 18. Jahrhunderts wurde daraus gleich eine Gesetzes-Sammlung, die in zahlreichen Varianten über die Jahrzehnte und Jahrhunderte fortgeschrieben wurde (und die nicht erst 1820 ihren Anfang gefunden hatte, die Wurzeln der Gesetze gehen zurück bis zu einem „Règlement für die Opera“ für die Pariser Oper von 17134).
„Unter „Theatergesetz“ wurden theaterinterne Regelwerke („Hausordnungen“) gefasst, wie sie im 18. Jahrhundert vermehrt entstanden. Durch derartige Regelwerke sollte die innerbetriebliche Organisation der stehenden Theater auf intern gültige Regeln gestellt werden. Diese betrafen vorrangig das Verhalten der Schauspieler diesseits und jenseits der Bühne und legten deren Rechte und Pflichten fest. Neben dem eher praktischen Aspekt der Ordnung von Proben und Aufführungsbetrieb wurden explizit auch Anforderungen an die von den Schauspielern zu beachtende ,Sittlichkeit‘ gestellt, und zwar sowohl auf der Bühne wie auch außerhalb des Theaters. Die Regelwerke wirken damit einerseits nach innen, haben aber auch ihre Wirkung auf den öffentlichen Raum im Blick. Mit derlei Rechtssetzungen strebten Theaterprinzipale und Bühnendirektoren eine Professionalisierung ihrer Spielstätten an. Die grundlegende Fragestellung der Tagung war, ob mit diesen Theatergesetzen auch eine umfassende Normierung und Disziplinierung der am Theater Tätigen und des Theaterbetriebs einherging. Der einführende Vortrag des Juristen Bodo PlEROTH (Münster) - zugleich der einzige nichtliteratur- oder theaterwissenschaftliche Beitrag - ging auf den Begriff des „Gesetzes“ ein und legte unter Rückgriff auf juristische Terminologie dessen Mehrdeutigkeit dar. Pieroth mahnte vor diesem Hintergrund eine Begriffsklärung an. Er führte aus, dass es im 18. und 19. Jahrhundert kein spezielles Theaterrecht und damit keine Theatergesetze im engeren Sinne gab, da die so bezeichneten Regelungen nicht von gesetzgebenden Körperschaften stammten. Vielmehr handele es sich um intern erlassene Dienstverordnungen und Verpflichtungen der Schauspieler, einschließlich der Festlegung der Sanktionierung von Verfehlungen.“5
Wie Walters in seinem Buch „Oper – Geschichte einer Institution“ schreibt, gab es Ende des 19. Jahrhunderts mehr als 100 verschiedene Theatergesetze, aus denen 1899 der Bühnenverein ein „Theaterhausgesetz des Deutschen Bühnenvereins“ mit 169 Paragraphen erstellt hatte. Die Bühnengenossenschaft lehnte dieses Theaterhausgesetz umgehend ab6.
„Die aktuellen Tarifverhandlungen über das Thema ‘Entlastung und Planbarkeit‘ werden im März 2024 wieder aufgenommen.
Darum geht es:
Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells – Das Rahmenmodell
Probenregelungen
Freie Tage-Regelungen
Ruhezeitregelungen
Planbarkeit: Regelungen zu Wochenplänen, Tagesplänen
Regelungen zur Erreichbarkeit“
11
Für einige der Regelungen im Umgang miteinander würde man da heute eher von einem Code of Conduct sprechen oder eben von einem „Wertebasierten Verhaltenskodex“, wie es der Deutsche Bühnenverein seit 2021 macht12. Anlass für die Erstellung des Verhaltendskodex‘ waren zahlreiche Missbrauchsfälle, die letztlich (auch in Verbindung mit den #metoo-Fällen in der Filmbranche) zur Einrichtung der Beratungsstelle Themis (Themis – die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt)13 für die Kulturbranche insgesamt geführt haben.
Ein Auszug aus dem Verhaltenskodex des Bühnenvereins:
„Wir teilen grundsätzliche gesellschaftliche Werte. Dazu zählen der Schutz der Menschenwürde, die Wahrung persönlicher Integrität und gegenseitigen Respekts, die Anerkennung von gesellschaftlicher Diversität sowie die Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Wir tragen die Verantwortung, dass diese Werte in unseren öffentlichen Einrichtungen, insbesondere im Verhältnis zu unseren Mitarbeiter*innen, auch gelebt werden.
Als Arbeitgeber*innen stehen wir in der Pflicht, unsere festangestellten und freiberuflichen Mitarbeiter*innen und Arbeitspartner*innen aktiv vor jeder Form von Diskriminierung, sexuellen Übergriffen, Machtmissbrauch, Mobbing und herabwürdigendem Verhalten zu schützen. Wir dulden keine Benachteiligungen aufgrund von nationaler oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, politischer Überzeugung, Behinderung, Alter, Familienstand, sexueller Identität oder Orientierung sowie sozialer Herkunft.
Um diese Werte im Alltag wirksam werden zu lassen, bekennen wir uns zu den folgenden Verhaltensregeln, deren Geltung auch unter den Mitarbeitenden in unserer Verantwortung liegt:
- Ich verhalte mich anderen gegenüber rechtskonform und respektvoll. Das gilt auch für den künstlerischen Arbeitsprozess.
- Ich unterlasse jede körperliche, sprachliche oder gestische Form von Übergriff oder Diskriminierung.
- Ich bin mir bewusst, dass mein Verhalten bei meinem Gegenüber eine andere Wirkung erzielen kann als beabsichtigt. Deshalb bemühe ich mich darum, eindeutig und klar zu kommunizieren. Ich verhalte mich empathisch, selbstkritisch und gesprächsbereit.
- Ich gehe gewissenhaft mit der mir übertragenen Verantwortung um.
- Ich spreche Konflikte offen an und trage aktiv dazu bei, diese fair zu lösen.
- Ich schreite ein, wenn ich Zeug*in von situationsunangemessenem Verhalten jeglicher Art werde und spreche dies direkt an.
- Bei der Aufklärung von Übergriffen oder diskriminierendem Verhalten unterstütze ich eine umfassende und ergebnisoffene Prüfung und höre allen Beteiligten unvoreingenommen zu.“
Um die Sittlichkeit weiter zu befördern, kam es auch zu dieser abstrusen Forderung:
„Den hohen Stellenwert der ‚Sittlichkeit‘ innerhalb der Theaterreglements illustriert die zu jener Zeit erhobene Forderung, Theaterjournale sollten ‚Sittenregister‘ für Schauspieler anlegen. Darüber hinaus sollte der Staat zur Sozialdisziplinierung eine Art ‚theatralisches Zuchthaus‘ für diejenigen Schauspieler errichten, die das Theater, den ‚Tempel der Moral‘, in Verruf bringen könnten.“14
Wie stark die Regelwerke befolgt wurden oder nicht, ist eine in der Forschung offene Frage. Walters zitiert dazu eine Glosse aus dem Würzburger Conversationsblatt von 1847:
„Professor Engel gab im Jahre 1788 dem Berliner Hoftheater feste Gesetze. Diese Theatergesetze hatten mit dem jetzigen Küstner’schen das gemein, dass sie nicht eingehalten wurden. Der Professor rief daher einst zornig aus: ‚Der Engel hat Gesetze gegeben, aber kein Teufel will sie halten!‘“15
Es folgt eine kleine Kostprobe mit Auszügen. Die vollständigen Theatergesetze werden danach wiedergegeben. Eine kurze Geschichte der beiden Theater befindet sich zur besseren Einordnung in die Historie im Anhang (Wikipedia-Auszüge).
Auszüge aus den Bremer Theatergesetzen
Die Bremer Theatergesetze von 1820 starten mit einer kleinen Einführung, in der festgelegt wird, diese „als unerläßliche Norm der zweckmäßigsten und würdigen Leitung der Bühne zu bestimmen“.
Wer sich den Anordnungen von Regisseur oder Inspizient widersetzt, der wird „als Feind der Ordnung behandelt“ (1.1).
Die erste strafbewehrte Regelung (1.4) steht schon im ersten Absatz. Sie beschäftigt sich mit dem Rollenstudium. Je nach Größe der Rollen (bemessen in Bogen) gibt es zwischen 1 Tag (1-2 Bogen) oder 12 Tage (9-10 Bogen) Zeit dazu. Wer es nicht schafft, bis zur letzten Probe seine Rolle vollständig zu memorieren, muss eine Geldstrafe zahlen.
Wer zu Proben zu spät oder gar nicht erscheint (1.7), wird mit einer Geldstrafe belegt. Wer auf einer Probe stört, durch falsche Stellung, Herumgehen oder anderes, zahlt eine Geldstrafe.
Wer sich „inhuman“ (1.8) gegen ein anderes Mitglied der Gesellschaft (gemeint ist die Theatergesellschaft) beträgt, kann auf der Stelle entlassen werden.
Extemporieren „ist erlaubt, insofern es nur einzelne Ausflüge des Witzes und passender Laune in sich begreift, und dasselbe weder Sitten noch andere geachtete Gegenstände beleidigt. Doch bleibt der Extemporirende für jedes Wort verantwortlich.“ (1.12)
Stricken verboten. Wer erwischt wird, zahlt 12 Grote Strafe (1.13).
Für die Umkleide stehen 10 Minuten zur Verfügung, wer länger braucht, zahlt eine Geldstrafe (1.19).
Über Aufführungen schlecht in der Öffentlichkeit zu reden, ist verboten. Wer es tut, zahlt eine Geldstrafe oder riskiert seine Entlassung (1.21).
Wer über Nacht oder überhaupt länger als 24 Stunden vom Spielort abwesend ist, muss sich dazu mit dem Regisseur abstimmen (1.24).
Sollten Sänger oder Sängerinnen einzelne Arien weglassen, so zahlen sie eine Geldstrafe.
Sollte ein Regisseur selbst gegen die Ordnung verstoßen, zahlt er die Geldstrafe für das jeweilige Vergehen – aber in doppelter Höhe (1.39).
Es folgen besondere Bestimmungen für Inspizienten, Souffleure, Garderobe, Friseur und den Theaterdiener.
Über die Einnahmen der Strafkasse wird genauestens Buch geführt. Sie sind bestimmt für verarmte oder kranke Schauspieler:innen, allerdings keinesfalls für „von einer Bühne zur andern herumziehende müssige Bettler, oder theatralische Handwerker, welche die Kunst selbst entehren und schänden. Alten müdegewordenen, oder durch ein wirkliches Unglück getroffenen, den Mitgliedern der Gesellschaft bekannten Schauspielern soll dagegen nach Mehrheit der Stimmen eine, jedoch niemals die Summe von zehn Thalern übersteigende Beihülfe gereicht werden.“ (Straf-Kasse)
Auszüge aus den Leipziger Theatergesetzen
Die Leipziger Theatergesetze (die als Anhang zu einem sehr umfangreichen Theaterlexikon vorliegen) sind 22 Jahre nach den Bremer Theatergesetzen entstanden und im Umfang deutlich ausführlicher: 21.180 Worte für die Leipziger vs. 3.625 für die Bremer Theatergesetze – also eine Steigerung um fast 500%. Fast 200 Jahre später hat es der NV-Bühne bloß auf eine weitere Steigerung um 35% gebracht.
Abbildung 1: Wortzählung der Theatergesetze in Bremen u. Leipzig im Vergleich mit dem NV-Bühne von 2022
Im Vorwort heißt es, „Gesetze sollen Dämme sein gegen Despotie, Unordnung, Uebertreibung und Heftigkeit der Direction; Dämme gegen Nachlässigkeit, Unsittlichkeit und Heftigkeit der Schauspieler. Die Direction muß weder willkührlich strafen, noch entschuldigen können“.
Einleitend werden die Strafsätze erstmal in ein Verhältnis zu den Einnahmen der Mitspielenden gesetzt, es erfolgt eine Klasseneinteilung: erste Klasse: 200-500 Thaler (unter 200 Thaler von der Strafe nur die Hälfte), zweite Klasse: bis 800 Thaler, dritte Klasse: über 800 Thaler (also die Spitzenverdiener und Stars).
Zum Schutz von Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird eine Kündigungsfrist von drei Monaten festgelegt, Kündigungen dürfen nur schriftlich erfolgen und müssen quittiert werden, wie überhaupt alle „Geschäftsvorgänge schriftlich betrieben werden“ müssen (I.I.5).
Streitigkeiten oder Beleidigungen werden mit einer Geldstrafe belegt.
Wer im „Wortwechsel, unpassenden Scherzen mit einer Dame des Theaters die Achtung, welche der dem Geschlechte schuldig ist, verletzt“, zahlt eine Geldstrafe eines Viertels der Monatsgage. Gleiches gilt für Beleidigungen des Publikums (I.I.14).
Wer betrunken das Theatergebäude betritt, zahlt eine Geldstrafe. Wer betrunken auf Proben erscheint, zahlt eine Monatsgage. Wer betrunken auftritt, zahlt eine Monatsgage und kann u.U. sofort entlassen werden (I.I.18).
Weder dürfen Tiere mitgebracht noch darf im Theater geraucht werden (I.I.19).
Alle Mitglieder sind verpflichtet, zugewiesene Statistenrollen anzunehmen. Wer sich weigert, zahlt eine Monatsgage. Interessant der Hinweis auf zwei englische Theater, an denen man nicht nur zur Statisterie verpflichtet sei, sondern „jeder Schauspieler soll spielen, singen, tanzen, in Zügen gehen u. s. w. nach seinen besten Kräften“ (I.I.29).
Das Versammlungszimmer darf nur von Schauspielern einer Probe oder Vorstellung genutzt werden. Niemand darf sich darin ankleiden, umkleiden oder frisieren, es dient rein als Ruhepunkt. Niemand darf das Zimmer mit dem Hut auf dem Kopf betreten oder gar seine (nasse) Oberkleidung mit hereinbringen (I.I.25).
Das Mitbringen von Kindern, die keine Rolle im Stück haben, ist verboten (I.I.25).
Sollten sich die Künstler Veranstaltungen im eigenen Hause anschauen wollen, an denen sie nicht beteiligt sind, gilt: die Damen dürfen die Theaterloge benutzen, die Herren müssen sich einen Platz im Parkett suchen. Andere Plätze erfordern den Kauf einer Eintrittskarte (I.I.27).
Krankheiten und Unpässlichkeiten müssen umgehend der Direktion gemeldet werden. Allerdings gelten bei „Krankheiten, welche als Folge von Unsittlichkeit, Unmäßigkeit u. s. w. erkannt werden,“ dass „die Suspendirung des Gehaltes bis zur Wiedergenesung zur Folge, insofern die Krankheit nicht länger als 8 Wochen anhält, nach welcher Frist in diesem Falle die Aufhebung des Contractes eintritt.“ (I.I.27)
Für ledige Frauen und Witwen gilt, dass sie im Falle einer Schwangerschaft, wenn sie ihre Arbeit behindert, die Hälfte ihrer Gage verlieren, im Wiederholungsfalle die komplette Gage (I.I.29).
Für das Ausplaudern von Interna, z. B. vorläufiger Informationen über das Repertoire, zahlt eine Geldstrafe (I.I.32).
Sollten Mitglieder des Theaters als Kritiker in öffentlichen Blättern über ihre eigenen Kollegen schreiben oder das Publikum gegen die Direktion aufhetzen (und dessen überführt wird), zahlt eine Geldstrafe von mindestens einer Monatsgage. Wer allerdings nachhaltig „den Bestand des Theaters untergräbt“, kann fristlos und ohne Auszahlung einer Gage entlassen werden (I.I.31).
Da unter keinen Umständen Vorstellungen ausfallen sollen, müssen sich alle Mitglieder ständig bereithalten, eine fremde Rolle zu übernehmen. So muss „jeder, der sich auf länger als zwei Stunden von seiner Wohnung entfernt, seinen Hausleuten hinterlassen, wo er bestimmt anzutreffen sei“. Wer nicht anzutreffen ist, muss eine Geldstrafe zahlen. Diese Erreichbarkeit hat noch einen weiteren Preis: Wohnungen auf dem Lande dürfen nur mit Genehmigung der Direktion bezogen werden.“ (I.I.37/38)16
Für die Frauen gibt es einen Taxidienst, für die Männer nicht: „Die Schauspielerinnen, Sängerinnen und Solotänzerinnen werden zu den Proben (letztere jedoch nicht zu den täglichen Exercitien) und zu den Vorstellungen mit dem Theaterwagen abgeholt, die Figurantinnen und Choristinnen nur zu den Vorstellungen. Individuen des Männerkunstpersonals werden nicht abgeholt, außer bei Unpäßlichkeit auf ihr Begehren und mit Erlaubniß der Regie. Weibliche Eleven jeder Gattung unter vierzehn Jahren werden weder in die Proben, noch in die Vorstellungen, sondern nur aus den Vorstellungen gefahren.“ Wer nicht rechtzeitig am Wagen ist, hat Pech gehabt, die Fahrer haben Anweisung, nach vier Minuten wieder loszufahren (I.I.39).
Über Gastspiele entscheidet die Direktion. Entstehende Kosten müssen von ihr übernommen werden. Man hat allerdings großzügig auf eine aus dem kgl. französischen Theater verzichtet: „Jedes Mitglied ist verbunden, jederzeit und überall, wann und wo die Direction des Theaters es fordert sein Talent auszuüben und zwar auf deren Verlangen zweimal an einem Tage, sowohl für Vorstellungen, als für Concerte und es kann das Mitglied keine andere Entschädigung fordern, als die Transportkosten für seine Person und seine Effecten nach den Städten und Orten, wo es der Direction genehm sein wird, es seine Verbindlichkeiten erfüllen zu lassen.“ (I.I.42)
Dem Thema „Rollen“ wird ein eigenes ausführliches Kapitel gewidmet. Rollen werden von der Direktion zugeteilt. Wem eine Zuteilung begründet nicht gefällt, der kann Widerspruch einlegen. Rollen können jederzeit auch anderen Mitgliedern zugeteilt werden. Wer sich weigert, seine Rolle (nebst Text oder Partitur) zurückzugeben, zahlt eine Strafe. Sollte sich erweisen, dass eine Rolle falsch besetzt wurde, weil sich z. B. das Publikum beschwert, „wird die Direction den Schauspieler freundlich um Abgabe der sich nicht für ihn eignenden Rolle ersuchen.“
Für das Rollenstudium wird für eine Hauptrolle längstens drei Wochen ab der ersten Leseprobe zugestanden, für Nebenrollen acht Tage. Für größere Opern sechs Wochen, für kleinere drei, für Liederspiele etc. acht Tage (II.48).
Der Spielplan wird 14 Tage im Voraus festgelegt (II.50).
Da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass alle Mitglieder über eine Taschenuhr verfügten, wurde eine „Normaluhr“ bestimmt. Für die Uhrzeiten zur Festlegung von Proben gilt: „Die Zeitbestimmungen für Proben und Vorstellungen richten sich nach der dem Theatergebäude zunächst gelegenen Thurmuhr, welche als Normaluhr angenommen wird, und Falls dieselbe einen Stillstand erleiden sollte, nach der dieser alsdann zunächst gelegenen Thurmuhr.“ Verspätungen werden gestaffelt bestraft, wer eine Hauptprobe vergißt, zahlt ein viertel seiner Monatsgage (III.55ff).
Plaudern, Lachen oder hartes Auftreten während einer Probe wird mit 4 Groschen Geldstrafe belegt (III.57).
Wer Fremde zu Proben mitbringt, zahlt 8 Groschen Strafe, zu Vorstellungen gar 1 Taler (III.73).
Wer nach der ersten Probe von der falschen Seite her auftritt, zahlt eine Geldstrafe. Wem das während der Vorstellung passiert, zahlt das vierfache (III.74).
„Bei allen Proben hat der Schauspieler laut und deutlich zu sprechen.“ (III.81)
Stricken oder Nähen während der Proben ist untersagt.
Censur„Wer eine von der Censurbehörde gestrichene Stelle spricht, verfällt, außer der Conventionalstrafe von 5 Thalern, welche sich im Wiederholungsfalle verdoppelt, der öffentlichen Polizeibehörde zur Ahndung anheim.“ (IV.101)
Auch in den Leipziger Theatergesetzen gibt es einen eigenen Paragraphen zum Extemporieren. Wer gegen das Verbot verstößt, kann u.U. sogar der Polizei gemeldet werden. „Es wird jedoch ausdrücklich bemerkt, daß der Schauspieler überall für jedes zu gesetzte Wort responsabel ist, und falls er auf irgendeine Weise gegen Anstand, Schicklichkeit, bestehende öffentliche oder Privatverhältnisse u. s. w. verstoßen sollte, nicht nur dem Vorfalle gemäß in 5 Thlr. Strafe genommen werden, sondern auch der öffentlichen Polizeibehörde, welche hier gleichfalls competent ist, zur Ahndung anheimfallen würde.“
Intimitätskoordination17
Es gibt mit §105 sogar einen Intimitätsparagraphen, mit dem ausdrücklich die Rechte der Frauen auf der Bühne geschützt werden sollen: „Außer der Vorschrift des Verfassers darf nicht geküßt werden. – Es darf nie geschehen, daß man ein Frauenzimmer an sich hinaufhebt und küßt. – In keinem Fall muß ein Mann ein Frauenzimmer auf den Mund küssen; hat der Verfasser den Kuß mit der Handlung verknüpft, so küsse man die Wange oder Stirn. – Auch gibt es besondere Berührungen, die man vermeiden muß, z. B. wenn ein Mann beim Umfassen eines Frauenzimmers der Brust zu nahe kommt. Wer gegen einen dieser Puncte handelt, bezahlt 8 Gr. Strafe.“
Die Entgegennahme des Applauses nach der Vorstellung wird in den Paragraphen 100-114 ausführlich geregelt, so ist es verboten, sich zu verbeugen. Wer ausgebuht wird, auch während des Stückes, darf darauf nicht reagieren. Wer vom Publikum explizit gerufen wird, darf durch eine stumme Verbeugung seinen Dank ausdrücken, darf aber unter Strafandrohung das Publikum nicht ansprechen (§110).
Es folgen ausführliche Sonderbestimmungen für Sänger, Choristen, Tänzer und Orchestermitglieder, die die Besonderheiten der jeweiligen Profession mit den entsprechenden Vorschriften benennen.
Für Regisseure gilt, dass die üblichen Vergehen auch für sie strafbewehrt sind. Sie haben aber besondere Leitungsaufgaben, darunter z. B. die Aufgabe, sicherzustellen, dass die „Beschäftigung unter der Gesellschaft billig vertheilt, kein Mitglied in der Woche zu mehr als drei anstrengenden Hauptrollen verbünden, und jedes von diesen wenigstens ein Mal frei sei.“ (II. §6)
Weitere Berufsgruppen mit eigenen Hinweisen sind Inspizienten, Bibliothekare, Souffleure, Theaterdiener, das Garderobenpersonal, Maschinisten und Dekorationspersonal sowie Requisiteure.
Die beiden letzten Kapitel widmen sich der Theater-Ordnung und der Strafkasse.
Hier wird auf Gesundheit großen Wert gelegt: „Das Theater muß außer der Zeit der Proben und Vorstellungen gelüftet und früh genug gereinigt werden, damit weder bei Proben noch Vorstellungen Spuren des Staubes das Athmen erschweren und dem Organ der Künstler nachtheilig werden. Ebenso muß der Zug durch das sorgsamste Schließen aller Fenster und Thüren vermieden werden.“ (II. Theater-Ordnung)
Auch Sicherheitshinweise zur Beleuchtung sind notwendig („Die Lichter dürfen niemals durch bloßes Dampf verursachendes Blasen ausgelöscht werden.“) ebenso wie Vorschriften für die Lagerung von Kulissen zur Brandvermeidung („Der Raum hinter den Coulissen muß auf alle mögliche Art und Weise durch gedrängtes und geordnetes Zusammenstellen der Coulissen, Versetzstücke und Stellagen erweitert, und alle unnothwendige Möbeln und Utensilien gleich nach geschehenem Gebrauche aufgehoben werden.“ (II. Theater-Ordnung)
Die Strafkasse wird in etwa so behandelt wie in Bremen, zusätzlich gibt es u.a. noch den Hinweis, dass ein Überschuss in der Strafkasse dem Pensionsfond überschrieben werden soll (III. Strafcasse, 8). Ein schönes Beispiel für Zahlungen in die Strafkasse liefert der Der Schauspieler und Theaterleiter Iffland (1759-1814)18: