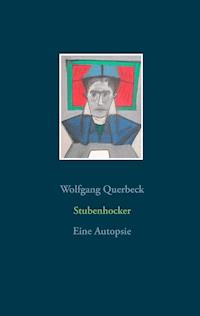
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Um zehn nach zehn haben wir Mutter alarmiert und treffen uns im Krankenhaus. Um sechs nach elf bist du tot. In Rom meldet sich niemand. Ich bin mit dem Unfassbaren allein. „Stubenhocker – eine Autopsie“ zeichnet ein Leben nach, das vorzeitig erstarrt ist: Die schmerzvolle Trennung der Eltern, der plötzliche Tod des Vaters, die frühe Geburt seiner Tochter treffen Wolfgang Querbeck unvorbereitet und werden ihm zum Verhängnis. Überfordert zieht er sich in ein inneres Schneckenhaus zurück und geht dem Leben aus dem Weg. Seiner Frau erscheint er, nicht einmal 40 Jahre alt, wie tot. In einem nüchternen, beinahe analytischen Selbstgespräch zieht Querbeck Bilanz und seziert mit chirurgischer Präzision, wie es zu dieser inneren Auslöschung gekommen ist. Er will wissen, was seinem Leben diese verhängnisvolle Wendung gegeben hat, und spürt deshalb unerbittlich den wunden Punkten in seiner persönlichen Entwicklung nach. In der späten Auseinandersetzung mit dem gefühlsarmen, meist abwesenden Vater, der harmoniebedürftigen Mutter und seinen frühen Liebschaften entdeckt Querbeck zahlreiche Facetten seiner eigenen Persönlichkeit. Er hält nicht nur sich selbst den Spiegel vor, sondern bietet Reflektionsmöglichkeiten für all jene, die sich alleine durchschlagen mussten, weil ihnen die männlichen Vorbilder abhanden gekommen waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Viele erkennen sich selbst, nur wenige kommen dazu, sich selbst auch anzunehmen. Wie viel Selbsterkenntnis erschöpft sich darin, den andern mit einer noch etwas präziseren und genaueren Beschreibung unserer Schwächen zuvorzukommen, also in Koketterie! … Er war im Begriff, den zweiten und noch viel schwereren Schritt zu tun, herauszutreten aus der Resignation darüber, dass man nicht ist, was man so gerne gewesen wäre, und zu werden, was man ist. Nichts ist schwerer als sich selbst anzunehmen!“
Max Frisch: Stiller
When everything’s made to be broken, I just want you to know who I am.
Goo Goo Dolls: Iris
für T., ich hab’s Dir versprochen
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Teil II
Teil III
Teil I
1
Da liegt mein Vater, nackt auf einem blutbefleckten Laken, von Nadeln zerstochen, mit Schläuchen verkabelt, beinahe aufgebahrt, mit angewinkelten Knien, den Kopf nach hinten geworfen im aussichtslosen Ringen nach Luft. Die Abstände zwischen deinen Atemzügen werden länger, ich gehe zu den Ärzten ins Nebenzimmer, doch auch die machen mir keine Hoffnung mehr. Wir sitzen alle da, Mutter, Sofia, Julius und ich, wie im Film blicken wir auf das Gerät über deinem Kopf, das die Herzfrequenz angibt, und warten auf den Pfeifton. Im Fünf-Minuten-Takt kommt ein Pfleger herein und schaltet ein Gerät ab oder zieht einen Schlauch heraus.
Wir halten deine Hand, streichen dir durchs strubbelige, kaum gekämmte Haar, küssen deine Stirn. Längst machen wir uns nichts mehr vor, abwechselnd raunen wir dir verzweifelte Durchhalteparolen zu, Aufmunterungen, die eher uns gelten als dir. Wir wissen nicht einmal, ob du sie überhaupt noch hören kannst.
Wir glauben schon selbst nicht mehr dran, viel zu lange schleppt sich dein Kampf hin, es dauert eine Ewigkeit, bis dein Mund wieder nach Sauerstoff schnappt wie ein Frosch nach der Fliege. Ich beginne langsam zu zählen: eins, zwei, drei, vier; die Angst lässt mich schneller werden: fünf, sechs, sieben; ich flehe dich an: bitte halt durch! Acht, neun; oh Gott, bitte, lass es nicht zu Ende sein, bitte! Zehn, elf-
Du schaffst es nicht mehr.
Die anderen gehen, tränenüberströmt.
Ich stehe da, regungslos, halte deine Hand.
Es ist, als würde in einem Film plötzlich der Ton abgedreht: Die Handlung nimmt ihren normalen Lauf, Pfleger kommen, lösen die Schläuche, schalten das letzte Gerät aus, bitten die Angehörigen, kurz hinauszugehen, um ihre Arbeit verrichten zu können, alles ganz normal, so wie immer. Bloß ich stehe da, umgeben von rauschender Leere, in einem Meer von Stille. Zu keinem Gedanken fähig. Ich begreife nicht.
Perplex harre ich aus, ich hoffe noch auf irgendeine Regung, auf ein Zeichen von Dir, ein Lächeln, ein Händedruck, ein kurzes Öffnen deiner Augen.
Doch da kommt nichts mehr.
„Der Patient ist leider um 23.06 Uhr verstorben. Wir bedauern, Ihnen kein anderes Ergebnis mitteilen zu können“, wird es später im Bericht des Krankenhauses an den behandelnden Arzt heißen. „Mit freundlichen, kollegialen Grüßen …“
2
Ich hatte mir den Tod immer anders vorgestellt. Das Sterben hielt ich entweder für einen heroischen Kampf oder für ein elendiges Verrecken, für ein wildes Aufbegehren oder für einen schäbigen, stinkenden Verfall. Auf jeden Fall spektakulär habe ich mir den Tod vorgestellt, bloß eines nie: menschlich.
Von Erlösung zu sprechen, erscheint mir unpassend, dazu hast du viel zu sehr am Leben gehangen. Aber am Ende schien es doch, als hättest du Frieden gefunden, als wärst du innerlich zur Ruhe gekommen. Es blieb dir erspart, verbittert deine Schwäche ertragen zu müssen. Als es ernst wurde, warst du längst zu keinem Kampf mehr fähig. Du brauchtest nicht mehr zu wählen zwischen schmerzvollem Widerstand und resigniertem, mutlosem Ergeben. Diese Entscheidung wurde dir abgenommen.
Die Wahrheit hättest du nicht ertragen. Ob du sie geahnt hast, werden wir nie erfahren. Du hast dem Tod das Spiel verdorben, hast ihm einen Strich durch seine Rechnung gemacht: Als deine Zeit abgelaufen war, bist du von uns gegangen. Rechtzeitig, bevor du zum Pflegefall geworden wärest. Still und leise, friedvoll und zärtlich, sanft und verwundbar. Du hast keine Anstalten gemacht, dem Tod Bedeutung zu verleihen. Im Gegenteil: Dein letzter Atemzug hat dir – und nicht dem Tod – Würde verliehen.
Du hast ihn nicht selbst inszeniert, deinen Abgang, und das hat dir zu einem großen Auftritt verholfen, menschlicher als je zuvor. Auf große Worte und Zeremonien hast du verzichtet. Freiwillig hättest du das nicht getan. Und auch zum leisen, unauffälligen Davonstehlen warst du nicht imstande. Dazu hast du uns zu sehr geliebt. Aufs Abschiednehmen hättest du nicht verzichtet. Zum Heroismus warst du zu larmoyant, zum Selbstmord zu schwach.
Du bist von uns gegangen, als ob das Sterben etwas ganz Natürliches wäre. So, wie andere kaufen gehen oder die Zeitung holen, hast du deinen letzten Atemzug getan. Ohne Gegenwehr gegen den Tod, ohne Verrat am Leben.
3
Dabei war es nur einem Zufall zu verdanken, dass wir alle da waren in der Stunde deines Todes. Wäre ich nach dem Fußballturnier gleich in die Kneipe gefahren, ohne vorher noch die verschwitzten Sachen nach Hause zu bringen, hätte ich auch nicht rechtzeitig den blinkenden Anrufbeantworter bemerkt. Sofia war es, die mir sagte, dass sie dich wieder ins Krankenhaus gebracht hätten. Es sei wohl relativ ernst, aber nicht so, dass ich mir Urlaub nehmen und zu dir kommen müsste.
Noch während ich das schweißnasse Trikot zum Trocknen im Bad aufhing, klingelte das Telefon erneut. Wieder Sofia. Aufgelöst. Tränenüberströmt. Verzweifelt. Die Ärzte hätten so komisch getan. Sie war, nachdem sie dich ins Krankenhaus gebracht hatte, wieder heimgefahren. Man sagte, dort könne sie jetzt sowieso nichts mehr für dich tun. Jetzt müssten erst einmal die Ärzte ihre Arbeit machen. Sie könne aber in ein paar Stunden anrufen, um zu hören, ob es dir schon wieder besser ginge.
Sie rief an, und die Ärzte drucksten herum. Perplex, ungläubig, fragte Sofia, was denn das alles zu bedeuten hätte. Sie täten ja gerade so, als ob du die Nacht nicht mehr überstehen würdest.
Pause.
Dafür könnten sie nicht mehr garantieren.
Pause.
Sofia will sofort zu dir kommen, bei dir sein. Doch die Ärzte vertrösten sie. Im Moment könne sie nichts tun, sie störe nur. Man verspreche, sie anzurufen, wenn es mit dir bergab gehe.
Um sieben Uhr kam Sofias Anruf.
Mein Bauch sagte mir, dass es dein Ende sein würde. Mir wurde bewusst, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben würde mit ansehen müssen, wie ein Mensch stirbt. Genauso wie damals, als Giulia zur Welt kam: Da konnte ich mir auch nicht vorstellen, dabei zu sein, wie ein neues Leben entsteht. Bloß dass es diesmal ums Sterben geht.
Bevor ich losfahre, überlege ich, ob ich mir einen dunklen Anzug einstecken soll. Das kann nicht sein kann nicht sein kann nicht sein.
Zittrig packe ich das Nötigste zusammen.
Nervös. Aufgedreht.
Um acht Uhr rase ich los.
Um halb zehn bin ich bei Sofia.
Um zehn kommt der Anruf aus dem Lazarett.
Verzweiflung. Tränen. Magendrehn.
Unser Schädel droht zu zerplatzen, das Herz zu zerreißen.
Um zehn nach zehn haben wir Mutter alarmiert und treffen uns im Krankenhaus.
Um sechs nach elf bist du tot.
In Rom meldet sich niemand.
Ich bin mit dem Unfassbaren allein.
4
Jedenfalls hielt ich deine Hand auch noch in der Leichenhalle, als wir erneut versuchten, Abschied zu nehmen, uns loszulassen.
Draußen der goldene Feiertagsmorgen im Sommer. Laub raschelt. Die Sonne blinzelt durch die dicht gewachsenen Blätter. Störende Kühle in der spartanisch eingerichteten Leichenhalle.
Du liegst da, als würdest du schlafen. Im dunklen Anzug, darunter das weiße Hemd mit der Krawatte, die wir dir geschenkt haben. In der Hand ein dürrer Strauß selbstgepflückter Rosen aus Johannas Garten. Die Knospen sind weit offen, beinahe übermäßig aufgeblüht, es fehlen noch ein paar Tage, dann fallen die Blütenblätter ab.
Deinen Mund haben sie geschlossen, deine Hände übereinander gefaltet.
Dein Gesicht hat Farbe bekommen, so gut haben sie dich nach der Obduktion wieder hergerichtet. Sahst fast besser aus als vorher.
Todesursache: Lungenembolie.
Man könnte auch sagen: In deinem Innern war alles kaputt und erstickte am Blut. Deine Organe rangen um Sauerstoff, vergebens.
Giulia wartete draußen im Kinderwagen. Sie hat von allem nichts mitgekriegt.
Du hast sie so gemocht. Sie hätte dich zum Auftauen gebracht. Sie hätte dich geliebt und dich das Lieben wieder gelehrt.
Heute sieht sie dein Foto über meinem Bett, über meinem Schreibtisch, in der Brieftasche, im Portemonnaie und die vielen Bilder im Fotoalbum.
Sie sagt Nonno, doch sie begreift nicht.
Immer wieder sind wir zu dir gekommen, vor das Fenster, haben durch die Glasscheibe geguckt. Auch am folgenden Tag waren wir da, haben dich betrachtet. Ungläubig, doch immer friedlicher. Die Fliesen auf dem Boden sahen aus wie in einer Metzgerei.
Warum durften wir dich nicht mehr anfassen? Warum konnten wir nicht mehr deine Hand halten? Es war ein erstes kleines Loslassen.
Großmutter war die einzige, die weiterdachte.
Auf Wiedersehen, sagte sie, mit einem leichten Zittern in der Stimme.
Und zu uns: Ich bin die nächste.
5
Am 21. September wärst du 58 Jahre alt geworden. Deine Pensionierung hast du nicht mehr erlebt. Dein Traum von einem Haus im Süden hat sich nicht mehr erfüllt.
Wer weiß, ob dir der Ausstieg gelungen wäre. Du hättest auf so vieles verzichten müssen: auf deine Posten, auf die vielen falschen Freunde, auf die vielen Bekannten, denen du geholfen hast und die am Ende nicht mehr an dich dachten.
Das hättest du nicht ausgehalten, so einsam und allein, fern von der Heimat.
Und die Frau, auf die du dein ganzes Leben vergeblich gewartet hast, wäre auch dann nicht gekommen. Es gab sie nicht.
Du hast zu viel erwartet. Du hast zu viele Worte gemacht. Du hattest schon lange nicht mehr den Mut, wirklich zu träumen. Dich hatte längst der Mut verlassen: Es würde sich sowieso nichts ändern. Du konntest nicht aus deiner Haut.
Jeder von uns hat irgendwann einmal sein Gleis gefunden, und auf dem rollt er dann bis ans Ende weiter. Du hattest längst die Kraft und den Willen verloren, etwas zu ändern. Du hast dich zufrieden gegeben. Du hast es hingenommen – als sei dir dein Leben unabänderlich auferlegt, und deine Aufgabe bestehe darin, dieses Leben still und duldsam zu durchleiden.
Heute erschrecke ich, wenn ich die Parallelen in unseren Leben erkenne. Wie es uns im entscheidenden Moment nicht gelingt, nein zu sagen, umzukehren. Weil wir anderen nicht wehtun wollen – und doch nichts anderes tun. Weil wir zu feige sind, um zu verzichten. Weil wir schon etwas zu verlieren haben.
Der Fehler lag am Anfang, als du die Weichen noch hättest stellen können. Später warst du zu sehr in Fahrt, als dass du deinen Irrtum bemerkt hättest. Und dann war es zu spät. Da rollten die Räder schon langsamer, unbeirrbar auf das Abstellgleis zu.
Wie viel verschenken wir im·Leben von unseren Möglichkeiten, bloß weil wir zu müde geworden sind–
6
Mutter war am stärksten gezeichnet. Auf der Beerdigung war sie eine echte Witwe. Als ob ihr nie getrennt gewesen wärt. Manche Ehen werden erst nach dem Tod geschlossen, sagt man.
Von uns allen hat sie dein Tod am stärksten mitgenommen, scheint es. Aber das ist nur verständlich. Sie hat dich am längsten gekannt. Und sie war mit dir glücklich. Wenigstens für ein paar Jahre. Sie hat ihre Jugend mit dir verbracht.
Das war die schöne Zeit.
Ihr hattet wenig Geld. Du hast gebüffelt, um Inspektor zu werden. Sie hat ihr Geld bei den Amerikanern verdient und lebte in einem kleinen Zimmer. Am Wochenende seid ihr ausgegangen. Da bist du dann aufgeblüht. Und sie hockte da. Wenn sie sich auch mal amüsierte, bist du aus Eifersucht ins Wasser gegangen. Die Geschichte erzählt sie heute noch.
Nach heutigen Verhältnissen würde man sagen: Ihr kanntet euch kaum, als ihr geheiratet habt. Das Bett wurde euch, nach allem, was ich bisher erfahren habe, zum Verhängnis.
Vierzehn Jahre habt ihr es miteinander ausgehalten. Dann, 1976, kam die Scheidung. Ich war zwölf, Sofia sieben.
An die glücklichen Jahre habe ich keine Erinnerung mehr. Wenigstens keine klare. Das Schöne liegt zu weit zurück. Die Erinnerung setzt erst da wieder ein, wo die Entzweiung begann.
Tränen, dicke Luft, Missverständnisse, Streit.
Du bist ausgezogen, und wir haben uns kaum gesehen.
Mutter versuchte es mit einem anderen, ohne Erfolg.
Du versuchtest es mit einer anderen. Auch nicht besser.
Wir besuchten uns kaum öfter als an Weihnachten und zum Geburtstag. Ihr kommt immer nur, um die Hand aufzuhalten, hast du gesagt.
Hast du dich jemals gefragt, warum?
Erst in letzter Zeit sind wir uns wieder näher gekommen. Vielleicht seitdem du dich von Franziska getrennt hattest. Du hast es lange genug hinausgezögert.
Als wir deine Sachen durchstöberten nach deinem Tod, fanden wir den Zettel. Vielleicht war es auch ein Tagebucheintrag oder ein Brief an uns, imaginär: Sie ertrug uns nicht in ihrer Nähe. Sie stellte dich jedes Mal vor die Wahl: die Kinder oder ich. Wenn wir kamen, war sie weg. Wir dachten, dies sei aus Höflichkeit oder Respekt geschehen. Damit wir dich die wenigen Stunden ganz für uns alleine haben. In Wahrheit hat sie dir das Leben zur Hölle gemacht. Wenn sie da war, wollten wir nicht kommen.
Du hast zwischen zwei Stühlen gesessen. Und hast dann einen großen (auch meinen) Fehler gemacht: Du wolltest es allen recht machen. So hast du beide verloren.
Wir dachten, dir würde an uns nichts liegen.
Wir wussten, dass das nicht stimmte.
Aber wir wussten nicht, wieso du dich so verhieltest.
7
Zu uns warst du genauso hart wie zu dir selbst.
Wir haben erst spät verstanden, was das bedeutet.
Im Umgang mit uns fehlte dir jedes Gefühl. Für andere hast du liebevoll und mit viel Phantasie Geschenke gebastelt. Aufmerksam hast du registriert, womit du ihnen eine kleine Freude machen könntest.
Nur bei uns warst du überfragt. Wir bekamen jedes Jahr dasselbe: Eine salbungsvolle Karte mit den Worten „Frohe Weihnachten wünscht Euer Euch über alles liebende Vater“, dazu Geld.
Für dich selbst konntest du hemmungslos Geld ausgeben. Ohne Scheu – und ohne Takt, möchte ich hinzufügen – hast du mir erzählt, wie du an einem einzigen Abend in der Spielbank vierhundert Mark verjubelt hast. Das ist dein gutes Recht. Doch so etwas hört man nicht gerne, wenn man mit demselben Betrag zwei Wochen auskommen und dir dazu noch jede Mark einzeln abtrotzen muss.
Anderen hast du gerne geholfen. Wir mussten dich erst mühsam bitten.
Erst spät, in den Tagen unmittelbar nach deinem Tod, haben wir eine Erklärung erhalten: Du warst zu uns so hart wie zu dir selbst. Andere mochten Hilfe nötig haben, ein Querbeck kam immer auch all eine zurecht. Andere brauchten Geld, ein Querbeck konnte seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Andere sehnten sich nach Zärtlichkeit. Ein Querbeck war hart – wie das Leben.
Du wärst nicht auf den Gedanken gekommen, es bei uns anders zu machen als bei dir selbst, meinte dein Chef, der dich seit vielen Jahren kannte. Nicht aus Bosheit, nicht aus Absicht, nicht aus Vergesslichkeit und auch nicht aus Naivität. Es kam dir einfach nicht in den Sinn. Es war von vornherein klar.





























