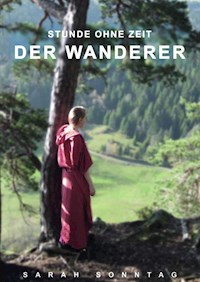
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer ist der Fremde den Felice beim alten Herrenhaus trifft und der sie immer in letzter Sekunde zu retten scheint? Bei dem Versuch etwas über den Mann herauszufinden, gerät die junge Frau nicht nur in die wundersame Welt jenseits der Zeit sondern auch in große Gefahr... Eine Wanderung durch eine Welt voller Magie beginnt. Auszug Ein großer Ginsterstrauch wuchs neben dem Eingang und verdeckte ihn mit seiner Blütenpracht. Dahinter saß gut versteckt ein Junge. Er mochte etwa zehn Jahre zählen, hatte eine schmächtige Gestalt und große dunkle Augen. (...) Wenn er nicht aufpasste, würde sie bald hinter das Geheimnis kommen und das wäre nicht nur für sie gefährlich. Der Junge konnte Felice nicht ausstehen. Dabei war sie nur ein kleines Mädchen, ein kleines dummes Mädchen, das alles kaputt machte. Er wusste, dass er ungerecht war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Sonntag
Stunde ohne Zeit
Der Wanderer
Roman
Meiner Mutter,
in Liebe
Impressum
Stunde ohne Zeit
Der Wanderer
Sarah Sonntag
Copyright: © 2014 Sarah Sonntag
Published by epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
ISBN 978-3-8442-9215-2
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Prolog
Die Frühlingssonne schien auf die halb zerfallenen Mauern des alten Herrenhauses.
Durch ein geborstenes Fenster im oberen Stockwerk flogen Spatzen ein und aus und eine Schar Mäuse lief über den Dachfirst. Ein großer Ginsterstrauch wuchs neben dem Eingang und verdeckte ihn mit seiner Blütenpracht.
Dahinter saß gut versteckt ein Junge. Er mochte etwa zehn Jahre zählen, hatte eine schmächtige Gestalt und große dunkle Augen. Gedankenversunken blickte er durch die Zweige des Ginsters auf einen großen Stein, der seitlich neben den Stufen stand, die zur Tür heraufführten. Darauf war schwach von Kinderhand gezeichnet die Skizze einer Eule zu erkennen.
„Wenn sie doch nur mit mir sprechen würde!“, dachte er. Es schien keinen anderen Ausweg zu geben, als die Tür zu schließen und das Geheimnis für immer zu verbergen.
Seit die Brückners mit Felice im Nachbarhaus eingezogen waren, hatte sich alles verändert. Das Mädchen war viel zu neugierig, stöberte überall herum, tauchte in unpassenden Momenten auf und ließ sich nur schwer wieder abschütteln. Wenn er nicht aufpasste, würde sie bald hinter das Geheimnis kommen und das wäre nicht nur für sie gefährlich. Der Junge konnte Felice nicht ausstehen. Dabei war sie nur ein kleines Mädchen, ein kleines dummes Mädchen, das alles kaputt machte. Er wusste, dass er ungerecht war. Immerhin konnte sie nichts dafür, dass seine Mutter in die Stadt ziehen wollte.
Er seufzte. Es war eine schwierige Entscheidung: wenn die Tür geschlossen wurde, ließ sie sich nicht einfach wieder öffnen. Zumindest wollte er Minerva um Rat fragen, doch die tauchte vor Sonnenuntergang nicht auf. Und so viel Zeit blieb ihm nicht.
Der Junge fasste einen Entschluss und rappelte sich auf.
„Tom! Tom Liebling, es gibt Essen!“, rief seine Mutter. Tom zögerte kurz, dann verschwand er im Innern des Hauses, stieg vorsichtig die knarrenden Stufen hoch und lief den dunklen Korridor entlang. Jetzt musste er sich beeilen: da seine Mutter nicht wollte, dass er im alten Herrenhaus spielte, ließ er sich besser nicht erwischen.
Am Ende des Flurs lag eine Tür, durch die Tom hindurchschlüpfte. Sofort umfing ihn das vertraute Geflüster und ein Kribbeln stieg ihm den Rücken hoch. Schnell ging er zu dem Schrank in der Ecke, in dessen Innern ein Spiegel verborgen war. Seine Tür war leicht angelehnt. Tom öffnete sie und warf einen Blick in das angelaufene und an manchen Stellen gesprungene Glas. „Schließt du die Tür, kannst du sie nicht ohne Opfer erneut öffnen.“ Die Worte hallten in seinem Kopf wider.
„Ich weiß“, antwortete Tom leise. „Es tut mir Leid.“
Einen Moment lang stand er vor dem Schrank, dann schloss er die Tür.
1
Zwanzig Jahre später
Felice ging durch den kleinen Vorgarten auf das Haus ihrer Eltern zu. Die Sonne schien ihr warm in den Rücken und warf den Schatten ihrer schlanken Gestalt vor sie auf den Boden.
„Mama ich bin da!“, rief sie. Seit sie den Job in der Buchhandlung bekommen hatte, konnte sie sich selbst in den Semesterferien nur noch selten frei machen, um nach Hause zu kommen. Das Geschäft litt unter chronischem Personalmangel und ihr Chef spannte sie oft spontan ein. Es war zwar nicht gerade die interessanteste Arbeit aber immerhin wurde sie darüber auf dem Laufenden gehalten, welche Bücher gerade neu auf den Markt kamen. Und es war ein Job –etwas worauf nicht jeder Student hoffen konnte.
An der Haustür bellte ein Hund. Sie öffnete sich und heraus schoss ein Labrador.
“Ist ja gut Bella”, lachte Felice, während sie versuchte ihn daran zu hindern, ihr das Gesicht abzulecken. Eine ältere Frau trat in die Tür. “Hallo, meine Liebe”, grüßte sie. Frau Brückner hatte die schlanke Gestalt und die feinen Gesichtszüge ihrer Tochter, die es endlich geschafft hatte, den Hund abzuschütteln und auf sie zukam, um sie zu umarmen.
„Ich gehe erst mal mit Bella spazieren, sonst dreht sie völlig durch”, sagte Felice, als der Hund seine Schnauze, wild mit dem Schwanz wedelnd, zwischen sie drängte. Sie löste sich von ihrer Mutter und ging durch das Gartentürchen zurück auf die Straße. “Komm!”, rief sie Bella zu, die der Aufforderung, ohne zu zögern, folgte und laut bellend an Felice vorbeiwetzte.
Da die Straße am Haus der Brückners in einer Sackgasse endete, lagen vor ihnen ausgebreitet Wiesen und Felder, die früher dem alten Herrenhaus angehört hatten, das ein Stück entfernt stand und inzwischen schon recht verfallen war.
Sie schlugen einen Pfad ein, der nach einer Weile von niedrigen Mäuerchen gesäumt wurde und später ein Stück am Waldrand entlang lief. Es war ein warmer Septembernachmittag mit einer leichten Brise, die angenehm über Gesicht und Arme strich. Der Boden federte unter ihren Schritten und strahlte die angestaute Wärme zusammen mit dem Duft von getrocknetem Gras ab. Ausgelassen tollte Bella herum, jagte Feldmäusen nach oder sprang nach Schatten von Blättern oder Vögeln. Felice genoss es, nur mit dem Hund unterwegs zu sein, ohne den Druck einer Verpflichtung oder eines Termins. Irgendwann ließ sie sich auf den Boden nieder und döste, während Bella neben ihr einen Stock zerkaute.
Es wurde ein langer Spaziergang und die Sonne stand schon ziemlich tief, als sie heimkehrten. Felice warf einen Blick auf das alte Herrenhaus. „ Da gehen wir morgen hin“, sagte sie zu Bella, die müde neben ihr her trottete.
Als Kind hatte sie gerne dort gespielt. Ihre Mutter hatte es ihr verboten, da sie es zu gefährlich fand. Trotzdem war Felice in dem alten Gemäuer herumgeklettert oder hatte nach verborgenen Geheimgängen gesucht, von denen sie geglaubt hatte, dass es sie dort geben müsste. Das Haus hatte in seinem verwahrlosten Zustand etwas sehr anziehend Geheimnisvolles an sich.
Beim Abendessen herrschte, wie meistens wenn Felice nach Hause kam, eine rege Gesprächsstimmung. Frau Brückner erzählte von Frau Müller, die Zwillinge bekommen hatte, regte sich über die Fellners und irgendeine Klatschmeldung aus der Zeitung auf und ging dann gleich zu ihrem Boss über, der keine Hauptschüler mehr einstellen wollte, weil ihr Niveau so gesunken sei. Zwischendurch fragte sie ihre Tochter, wie es ihr gehe, ließ sie jedoch kaum zu Wort kommen, da sie es sehr eilig hatte, ihr zu erzählen, dass Bella in den letzten Tagen abends öfter angeschlagen habe. Wenn der Hund nicht wäre, hielte sie es keine Minute länger aus so abgelegen vom Dorf und außerdem sei es ja auch sehr einsam.
Herr Brückner saß ruhig daneben und gab Geräusche der Zustimmung von sich, wenn seine Meinung gefragt war. Er war ein gutmütiger Mann von kräftiger Statur, der die Mitte des Lebens bereits überschritten hatte. Hin und wieder warf er seiner Tochter belustigte Blicke zu, wenn Frau Brückner den Versuch zu antworten mit einem erneuten Wortschwall verhinderte.
Nachdem der Tisch abgeräumt war, setzten sich die drei ins Wohnzimmer, wo im offenen Kamin ein Feuer brannte. Nun löcherte Frau Brückner ihre Tochter mit Fragen über die anstehenden Abschlussprüfungen und ihren Freund. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Die beiden Dinge, die sie vergessen wollte: ihr fast Exfreund und die Prüfungen. Eine Weile wand sie sich mit halben Antworten um das eigentliche Thema herum, doch schließlich entschuldigte sie sich, dass sie müde sei und ergriff die Flucht.
Erleichtert ließ sich Felice in ihrem Zimmer auf dem Bett nieder, ohne das Licht anzuknipsen. Sie fand es angenehm, in dem kühlen Zimmer zu sitzen und niemanden etwas über ihre gescheiterte Beziehung oder die Prüfungen erzählen zu müssen. Ihre Mutter war nur neugierig, aber ihr Vater würde bestimmt merken, wie es ihr wirklich ging, egal, was sie erzählte. Felice trat fröstelnd ans Fenster und schaute hinaus. Am Horizont war noch ein schwacher rosa Streifen zu erkennen, sonst war alles dunkel. Die Felder, der Wald, das Herrenhaus, alles lag in Schatten gehüllt.
Sie sah hinüber zu dem Nachbarhaus, in dem seit Jahren niemand mehr wohnte und stellte erstaunt einen matten Lichtschimmer fest. Die alten Besitzer waren lange weggezogen und es war unwahrscheinlich, dass sie zurückkommen würden. Im Laufe der Zeit hatte das Gebäude eine ähnlich geheimnisvolle Aura angenommen wie das alte Herrenhaus. Ihre Mutter hatte nicht erzählt, dass es neue Bewohner gab und ihre Mutter wusste alles, was in zehn Kilometern Umkreis vor sich ging.
Neugierig geworden, zog Felice sich ihre weiße Strickjacke über und stieg leise die Treppen hinunter. Sie wollte um jeden Preis verhindern, dass sie erneut mit Fragen überschüttet wurde. Geräuschlos öffnete sie die Tür und trat hinaus in die klare Nachtluft. Einen Moment blieb sie stehen, unsicher ob sie nicht doch ihren Eltern Bescheid sagen sollte. Nur für den Fall, dass irgendwelche Rowdys eingebrochen waren. Dann ging sie kurzentschlossen hinüber zum Nachbarhaus. Sie musste ein Stück durch den Garten gehen, um zu den großen Verandatüren zu gelangen, durch die das Licht auf den Rasen fiel.
Jemand hatte Vorhänge angebracht, die verhinderten, dass man hineinsehen konnte. Aber es gab einen schmalen Spalt, an den Felice herantrat. Soweit sie erkennen konnte, war der Raum leer, abgesehen von einem Mann, der sich, zwei Stöcke durch die Luft wirbelnd, geschmeidig vor und zurück bewegte. Er schien eine Art Tanz zu vollführen oder einen unsichtbaren Gegner zu bekämpfen.
Felice war fasziniert von der Eleganz und der Kraft, die in seinen Bewegungen lagen und ihnen etwas Raubkatzenartiges verliehen. Nach einer Weile hielt er inne, zog das Oberteil seines Kimonos aus, trank etwas und tauschte die beiden Stöcke gegen eine einzelne Stange, bevor er mit seinem Tanz fortfuhr. Wie gebannt beobachtete Felice das Spiel der Muskeln auf seinem trainierten Körper. Der Tanz ging weiter und sie schaute ihm zu, unfähig sich zu lösen.
Die Augen des Mannes blitzten zu ihr herüber. Erschrocken wich sie zurück. Einen Augenblick lang war sie sich sicher, dass er sie gesehen hatte. Sie bemerkte, wie auffällig ihre weiße Strickjacke in der Dunkelheit schimmerte. Es war dumm gewesen, etwas Helles anzuziehen, um die Lage auszukundschaften. Es würde bestimmt keine angenehme Begegnung werden, wenn er sie fand. Normalerweise zogen Leute Vorhänge vor, damit man sie nicht beobachtete. Doch als sie wieder hinschaute, hatte der Mann seinen Tanz unverändert fortgesetzt. Felice wusste, dass es besser war zu gehen, bevor er sie erwischte und fragte, warum sie ihn anstarrte wie das achte Weltwunder. Trotzdem blieb sie stehen. Dieser Mann wirkte fast unnatürlich attraktiv auf sie.
Nach einigen Minuten unterbrach er seinen Tanz wieder, nahm seine Trinkflasche und verschwand in einer Ecke des Raumes, die außerhalb ihres Gesichtsfeldes lag. Sie trat dichter an das Fenster, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Ihr Blick streifte die kahlen Wände des Raumes, doch er schien verschwunden zu sein.
„Na, spionieren wir?“, fragte plötzlich eine sanfte Stimme hinter Felice und sie fuhr erschrocken herum. Keinen Meter vor ihr stand der Mann, den sie eben noch beobachtete hatte. Er musste sich völlig lautlos angeschlichen haben. Sie hatte ihn nicht kommen hören.
„Nein... nein, ich...“, stotterte sie und wurde rot. Sie zitterte von dem Schreck dieser Überraschung. „Ich dachte, es wäre eingebrochen worden und wollte nachsehen“, fügte sie matt hinzu. „Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?“, fragte der Fremde spöttisch. Die dunklen Augen blitzten gefährlich.
„Sieht wohl eher nicht nach einem Einbruch aus“, murmelte sie verlegen. Der Fremde ragte drohend vor ihr auf. Felice senkte den Blick. Mit dem Rücken zur Verandatür, hatte sie keine Möglichkeit auszuweichen.
„Gut“, erwiderte der Fremde sanft, „dann können Sie jetzt gehen. Ich schätze ungeladenen Besuch nicht besonders.“ Die Warnung in seiner Stimme war nicht zu überhören.
„Okay, ich gehe dann jetzt besser“, sagte sie mit höherer Stimme und versuchte zu lächeln. Ihr war bewusst, dass sie alleine war und niemand wusste, wo sie steckte. Einen Moment hielt der Mann sie in seinem Blick gefangen. Die Sekunden zogen sich in die Länge, während er regungslos vor ihr stand. Dann trat er zur Seite.
So schnell sie konnte, ohne zu rennen, ging Felice an ihm vorbei. Auch wenn sie sich nicht umsah, war sie sich sicher, dass er ihr mit dem Blick folgte. Um ihm keinen Anlass zu geben, hinter ihr herzukommen, lief sie direkt zu ihrem Elternhaus und ging hinein. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, lehnte sie sich schweratmend dagegen. Wie hatte sie so dumm sein können, sich erwischen zu lassen. Er war der attraktivste Mann, den sie je getroffen hatte. Aber sie wollte ihm auf keinen Fall noch einmal begegnen, erst Recht nicht alleine und unter keinen Umständen im Dunkeln. Ihr Herz raste noch immer und ihr Magen schien aus einem einzigen, schmerzhaften Knoten zu bestehen.
In dieser Nacht schlief sie sehr unruhig und träumte wirres Zeug von vermummten Gestalten und einem attraktiven Jäger, der sie für ein Reh hielt und durch den Wald jagte. Doch am nächsten Morgen konnte sie sich kaum noch daran erinnern. Allerdings hatte sie Kopfschmerzen und da ihre Eltern noch schliefen, beschloss sie, noch vor dem Frühstück eine Runde mit Bella zu drehen. Es war ziemlich kalt für einen Septembermorgen. Irgendwann in der Nacht musste es geregnet haben, so dass die Wiesen nass und die Welt in eine Nebelsuppe getaucht war.
„Na, der Tag fängt ja super an“, murmelte sie, als sie missmutig den Feldweg entlang stapfte. Bella ließ sich von dem Wetter nicht beeindrucken; sie sprang herum, froh darüber, dass schon so früh jemand bereit war, mit ihr nach draußen zu gehen. Schon nach kurzer Zeit hatte Felice nasse Füße und fror. So wählte sie eine sehr kurze Runde, ging jedoch auf dem Rückweg an dem alten Herrenhaus vorbei.
Da sich ihre Kopfschmerzen in der frischen Luft aufgelöst hatten, kletterte sie die bröcklige Mauer hinauf, die wohl einmal den Garten eingegrenzt hatte, der jetzt verwildert zu ihren Füßen lag. Der Nebel begann sich langsam zu lichten und die Sonne kämpfte sich durch. Über sich konnte Felice den blauen Himmel erkennen. Bei klarer Sicht konnte man von hier oben bis zu dem Baggersee schauen, in dem sie als Kind gebadet hatte.
„Sie sollten besser da runterkommen. Die Mauer ist ziemlich brüchig“, sagte plötzlich eine sanfte Stimme hinter ihr. Vor Schreck wäre sie beinahe gefallen. So früh hatte sie hier niemanden erwartet. Sie wandte sich um und sah den Fremden aus dem Nachbarhaus. Ihr Blick glitt flüchtig über ihn hinweg. Er trug einen dunklen Baumwollpullover über einem weißen Hemd und Jeans. Bei Tageslicht wirkte er fast normal. Fast. Doch auch jetzt lag in seiner abwartenden Haltung etwas, das keinen Widerspruch duldete. Vorsichtig begann sie die Mauer herunterzuklettern.
„Bella!“, rief sie unsicher. Ihr Verstand sagte ihr, dass sie albern war. Was sollte schon geschehen? Er würde sie ja nicht umbringen oder so und sie hatte jedes Recht hier zu sein. Aber dieser Mann war ihr unheimlich.
„Felice Brückner, nehme ich an?“, fragte er, während er ihr die Hand reichte, um ihr über die letzten Steine herunterzuhelfen. Als er sie berührte, schoss Adrenalin durch ihre Adern. „Oder Östrogen“, dachte sie peinlich berührt. Er war doch bloß ein Mann wie andere auch und normalerweise fühlte sie sich nicht wie ein unerfahrenes Schulmädchen. Sie nickte auf seine Frage.
In dem Augenblick kam Bella um die Ecke geschossen. Sie beschnüffelte den Fremden und wedelte mit dem Schwanz. Er streichelte sie.
„Als Wachhund taugt sie nicht gerade“, dachte Felice und warf ihr einen beunruhigten Blick zu.
„Sie sollten ihr vertrauen“, sagte der Mann, der ihren Blick anscheinend bemerkt hatte. „Sie wohnen eigentlich nicht mehr bei Ihren Eltern?“
„Ja... nein, ich bin nur zu Besuch“, antwortete sie und wich seinem forschenden Blick aus. Seine Präsenz war fast mit Händen greifbar und brachte ihre Gedanken durcheinander.
„Ich war gerade auf dem Heimweg. Gehen wir doch zusammen“, sagte er mit einem gewinnenden Lächeln. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er los. Sie zögerte, doch Bella lief bereits neben ihm her und sie wollte ja tatsächlich nach Hause.
„Wo wohnen Sie dann?“, wollte er wissen.
„In Freiburg“, entgegnete sie und bemerkte, dass er sie ausfragte, ohne etwas über sich zu erzählen. Sie kannte noch nicht einmal seinen Namen.
„Eine schöne Stadt“, nickte er. „Und Sie studieren?“, fuhr er fort. Sie warf ihm einen Blick zu. Lächelnd erwiderte er ihn. Im Gehen hob er einen Stock auf und warf ihn für Bella, die ihm nachjagte.
„Ja, Lehramt an Grundschulen“, antwortete sie zögernd. Sie konnte das Bild des gefährlichen Fremden nicht ganz mit seiner neuen Freundlichkeit in Verbindung bringen.
„Das klingt… passend“, meinte er „Und wie lange studieren Sie schon?“ Felice warf ihm einen irritierten Blick zu, dann gab sie sich geschlagen und erzählte von ihrem Studium und dass sie in drei Wochen die letzte Prüfungen haben würde. Als sie vor ihrem Haus auseinandergingen, hatte er tatsächlich herausgefunden, dass sie gerade dabei war, sich von ihrem Freund zu trennen; eine Sache, die sie nicht einmal ihrer Mutter erzählt hatte. Seinen Namen hatte sie nicht erfahren. Im Nachhinein konnte sie sich nicht erinnern, warum sie nicht einfach danach gefragt hatte.
Da es viel regnete, verbrachte Felice das restliche Wochenende hauptsächlich bei ihrem Vater vor dem Kamin oder bei ihrer Mutter in der Küche und versuchte nicht an die Prüfungen oder ihren Freund Eric zu denken. Manchmal ging sie mit Bella spazieren, aber dem Fremden begegnete sie nicht mehr.
Auf der Rückfahrt am Sonntagnachmittag tat sie das, was sie das ganze Wochenende über vermieden hatte: sie überlegte, wie sie Eric beibringen sollte, dass es endgültig vorbei war und es keinen Sinn mehr hatte, noch weiter darüber zu reden. Vermutlich hatte er wieder den ganzen Anrufbeantworter mit Entschuldigungen und Versprechungen gefüllt.
Felice seufzte. Eigentlich gab es genug andere Probleme, um die sie sich kümmern musste. Zum Beispiel war am nächsten Tag der Abgabetermin für ihre Hausarbeit, die sie noch einmal durchschauen wollte. Außerdem musste sie sich auf die letzten Prüfungen vorbereiten und sie hatte ein Vorstellungsgespräch bei einer Grundschule in Freiburg. Die Beziehung mit Eric war sowieso schon lange nicht mehr das, was sie mal war, lediglich noch ein Einander-ertragen.
Felice fuhr jetzt durch ein kleines Dörfchen mit ein paar alten Scheunen und einer Handvoll Häusern. Sie bremste, als ein Kind vor ihr über die Straße schlenderte.
Als sie Eric kennen gelernt hatte, hatten sie beide jedes Wochenende auf Partys abgehangen, die Nächte durchgetanzt und ein paar von den harmloseren Drogen ausprobiert. Das Leben war ihnen leicht vorgekommen und an Konsequenzen hatten sie nicht gedacht. Inzwischen hatte das Partyleben für sie den Reiz verloren. Für Eric nicht. Sein Lebenssinn schien im Feiern zu bestehen. Das Schlimmste war aber, dass er immer wieder in Schwierigkeiten mit Drogendealern geriet.
Felices Gedanken kehrten in die Gegenwart zurück, als sie in einen Stau hineinfuhr. Es waren noch ungefähr 30 Kilometer bis Freiburg. Stirnrunzelnd sah sie nach vorne. Eigentlich gab es an dieser Stelle nie Stau. Nachdem sie einige Minuten gestanden hatte, ohne dass es im Geringsten vorwärts ging, drehte sie das Radio an und wartete auf die Verkehrsmeldungen. Stöhnend wechselte sie kurz darauf auf einen Musiksender und lehnte sich zurück: 10 km Stau wegen eines Unfalls. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Wenn sie umdrehte und eine andere Strecke nahm, musste sie einen Umweg von 50 Kilometern über einen Haufen kleiner Dörfer in Kauf nehmen. Und sie musste unbedingt ihre Hausarbeit fertig schreiben, was bedeutete, dass sie eine Nachtschicht einlegen musste, falls der Stau sich nicht bald auflöste. Ungeduldig trommelte sie mit ihren Fingern auf das Lenkrad.
Als sie schließlich ihre Wohnungstür aufschloss war es nach 21 Uhr. Instinktiv warf sie als erstes einen Blick auf das Telefon und war überrascht, dass das Lämpchen des Anrufbeantworters nicht blinkte. Dann hörte sie den Fernseher. Wütend ließ sie ihre Tasche fallen und marschierte zum Wohnzimmer - ihre Hausarbeit konnte sie wahrscheinlich vergessen. Sie riss die Tür auf und wurde beinahe vom Schlag getroffen. Flaschen standen auf dem Couchtischchen, es roch nach Bier und auf dem Sofa saß Eric, wild mit einer knapp bekleideten Blondine knutschend.
„Ach hallo“, sagte Felice ironisch. „Störe ich?“ Sie ließ den Blick durchs Zimmer wandern und stellte fest, dass Eric mindestens seit letzter Nacht hier gewesen sein musste. Was bedeutete, dass die Küche auch wie ein Saustall aussah. Das besserte ihre Laune nicht gerade. Mit zwei Schritten war sie beim Fernseher und schaltete ihn aus.
„Hallo“, sagte Eric, der sich inzwischen von der Frau gelöst hatte. Es hätte nicht deutlicher sein können, dass Felice ihn überrascht hatte. „Sabine wollte gerade gehen...“, meinte er betreten.
„Ja, das sollte sie auch besser“, antwortete Felice und ihre Augen blitzten zu der Blondine. „Und ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf!“, fügte sie hinzu, als die Frau umständlich begann, ihre Sachen zusammenzusuchen. „Und eigentlich kannst du gleich mitgehen“, sagte sie und warf Eric einen giftigen Blick zu. Sie war so wütend, dass sie das Gefühl hatte, sie müsste im nächsten Moment explodieren. Die Frau verließ den Raum und Felice ging ihr nach, um die Wohnungstür zu schließen, dann kehrte sie ins Wohnzimmer zurück. Eric räumte die Flaschen zusammen.
„Wie bist du reingekommen?“, blaffte sie ihn an.
„Deine Freundin“, sagte er leise, „Andrea. Sie hat mir den Schlüssel gegeben.“ Er hielt ihn, wie zum Beweis, in Luft die und ließ ihn dann zurück auf den Tisch fallen. „Ich habe die Blumen gegossen“, meinte er und zeigte auf ein paar Pflanzen.
Felice lehnte mit verschränkten Armen in der Tür. „Und? Habt ihr euch amüsiert?“, fragte sie mit zusammengebissenen Zähnen. Es fiel ihr schwer nicht loszuschreien.
„Nein...sorry, wegen Sabine...ich...wir...es war...also, ich muss mit dir reden“, brachte er heraus.
„Tatsächlich“, sagte sie mit zusammengepressten Lippen. Noch immer stand sie bewegungslos in der Tür. Es war eine Weile still. „Also, was ist? Brauchst du wieder Geld?“, brach es aus ihr heraus, als er nichts sagte.
„Nein, es tut mir L…“, setzte er an, doch sie unterbrach ihn.
„Du bekommst auch keins. Und weißt du was? Du bekommst überhaupt kein Geld mehr und sonst auch nichts!“ Ihre Stimme wurde immer lauter. Er versuchte etwas zu sagen, aber sie überfuhr ihn: „Verschwinde einfach aus meinem Leben! Hau ab und komm nicht wieder zurück! Ich habe deine scheiß Entschuldigungen satt. Ich habe echt was Besseres zu tun, als mich immer um deine bekloppten Probleme zu kümmern! Ruinier dich doch! Ich werde dich nicht mehr daran hindern!“ Sie holte tief Luft und er nutzte die Gelegenheit, um zu sagen: „Sabine war nur ein Ausrutscher...“
„Sabine war nur ein Ausrutscher“, äffte sie ihn nach und schnaubte dabei vor Wut. „Und Jessica und Kati und Cindy und Janet und keine Ahnung wer noch alles waren auch nur Ausrutscher!“, schrie sie. Felice nahm ein Kissen vom Sofa und warf es ihm an den Kopf. „Alles nur ein paar kleine Ausrutscher!“ Sie nahm ein anderes Kissen und schlug auf ihn ein. „Hau ab!“, schrie sie. „Hau endlich ab!“
Eric hielt sich schützend die Arme über den Kopf und murmelte etwas wie: „Immer mit der Ruhe.“ Dann sagte er lauter: „Ist ja gut! Ich gehe ja schon!“ Aber in Felice kochte es so, dass sie nicht aufhören konnte, auf ihn einzuschlagen. Erst als er seine Jacke nahm und sich zur Tür hinaus rettete, ließ sie von ihm ab.
„Und lass es dir ja nicht einfallen wiederzukommen oder anzurufen!“, rief sie ihm nach, bevor die Haustür hinter ihm ins Schloss fiel. Felice ließ sich erschöpft auf einen Sessel fallen. Tränen schossen ihr in die Augen. Von Männern, schwor sie sich, hatte sie erst mal genug.
2
Im Nachhinein wusste Felice nicht mehr, wie sie die folgenden drei Wochen und die Prüfung hinter sich gebracht hatte. Ihre Klausurnoten waren ganz gut ausgefallen, die Grundschule erteilte ihr eine Absage.
Sie genoss die freie Zeit, die sie hatte, wenn sie nicht gerade in der Buchhandlung half und war viel draußen in der Natur. Und als ihre Eltern eine Weile ohne Bella wegfahren wollten, nahm sie den Hund zu sich. Die Oktobertage blieben warm und trocken und so verabredete sich Felice für den letzten Samstag des Monats mit ihrer Freundin Andrea. Sie wollten ein Stück von der Stadt entfernt einen Rundwanderweg ausprobieren, den sie beide noch nicht kannten.
Vorsorglich ließ sie an dem Tag ihr Handy zu Hause, um sich nicht durch irgendwelche Anrufer, zum Beispiel ihren Chef - der es auch fertig brächte, sie von einem Waldspaziergang abzukommandieren - stören zu lassen. Sie nahm Bella und fuhr mit dem Zug zu dem Dorf, wo der Rundweg begann. Andrea wartete schon auf sie. Es war ein schöner Tag, der noch viel von der Wärme des vergangenen Sommers in sich trug und so machten sie sich gut gelaunt auf den Weg. Die Bäume um sie her leuchteten golden im Sonnenlicht, am Wegrand wuchsen rote Beeren und Vogelscharen waren am Himmel zu sehen. Nach den Prüfungen und der Trennung von Eric fühlte sich Felice federleicht. Sie lachte und alberte mit Andrea, die auch glänzender Laune war. Gegen Mittag machten sie auf einer kleinen Bank Rast, aßen ihr mitgebrachtes Proviant und plauderten. Über die Hälfte des Weges war geschafft und so gingen sie erst am späteren Nachmittag weiter. Etwa eine halbe Stunde, nachdem sie wieder aufgebrochen waren, kamen sie zu einer Weggabelung, die auf der Wanderkarte nicht eingezeichnet war.
„Ich würde vorschlagen, wir gehen nach links“, sagte Felice, da sie keinen Wegweiser entdecken konnten.
„Der Sonne nach zu schließen müssten wir nach rechts“, entgegnete Andrea mit einem Blick zum Himmel.
„Du mit deinen Himmelskenntnissen, da kommen wir am Ende noch am Nordpol raus“, spöttelte Felice. Sie selbst nicht sagen können, warum, aber der linke Weg übte eine starke Anziehung auf sie aus. Halb unbewusst machte sie einen Schritt in seine Richtung. Empört sah Andrea sie an. „Okay, mal sehen, wer zuerst zu Hause ist“, sagte sie herausfordernd.
„Gut“ erwiderte Felice lachend „aber ich habe Bella.“
„Ich habe die Hundekuchen“, versetzte Andrea feixend. „Komm Bella!“, fügte sie an den Hund gewandt hinzu und machte sich mit der Hundekuchentüte raschelnd auf den Weg. Bella lief ihr hinterher.
„Ich bin trotzdem zuerst zu Hause“, rief Felice ihr vergnügt nach. Sie macht sich sofort auf den Weg, immer dem linken Pfad nach. Wenige Minuten später hatte sie Andrea schon fast vergessen. Leise vor sich hin summend überquerte sie von Stein zu Stein springend einen Bach, der ihren Weg kreuzte. Sanft wogten die Baumwipfel über ihrem Kopf. Die Vögel sangen und alles war friedlich. Manchmal tauchten Baumstämme oder sperrige Äste vor ihr auf, die ihr den Weg versperrten. Dann kletterte und balancierte sie darüber, wie sie es als junges Mädchen getan hatte. Einmal beobachtete sie ein Eichhörnchen, das in einem Busch flink von Ast zu Ast sprang, um dann laut schimpfend den glatten Stamm eines Baumes hinaufzurennen. Felice lachte ihm hinterher. Das Ganze erschien ihr fast wie ein Abenteuer. Es kam ihr merkwürdig vor, dass die Zeit verging, ohne dass sie andere Wege kreuzte oder der Wald sich lichtete. Aber etwas trieb sie an weiterzugehen und so schob sie die Zweifel beiseite.
Der Nachmittag ging allmählich zur Neige und der Pfad, dem Felice folgte, wurde immer schmaler, bis er sich schließlich ganz auflöste. Als sie merkte, dass sie ihn verloren hatte, war es unter den Bäumen schon ziemlich schattig. Ratlos lief sie ein Stück zurück, doch sie war sich nicht sicher, ob sie richtig ging und im Dämmerlicht konnte sie nicht weit sehen.
„Hurra, verloren in der Wildnis!“, dachte sie sarkastisch und musste unwillkürlich grinsen. Doch als sie den Pfad nach mehreren Minuten noch immer nicht gefunden hatte, war ihr ganz und gar nicht mehr zum Lachen zu Mute. Nach dem warmen Tag war es nun unangenehm kühl und der Wald wurde ihr langsam unheimlich. Da sie wenig sehen konnte, schienen alle Geräusche umso deutlicher zu werden. Eine leichte Brise kam auf und ließ Felice frösteln. Die Bäume stöhnten leise, wenn der Wind durch die Kronen strich. Es wurde dunkler und der Wald erwachte zum Leben. Fledermäuse flatterten über Felice hinweg. Es raschelte und knackte, und es gab noch andere Geräusche, die sie nicht zuordnen konnte. „Wenn ich immer in eine Richtung gehe, muss ich doch irgendwo rauskommen“, murmelte sie und stapfte aufs Geratewohl los. Um sich Mut zu machen, trat sie fester auf als nötig. Plötzlich brach sie mit dem linken Fuß durch ein paar Zweige in ein Erdloch und knickte um. Sie stürzte. „Aua, aua, aua“, jammerte sie halblaut und Tränen schossen ihr in die Augen. Stechende Schmerzen durchzuckten ihren Fuß. Sie versuchte ihn aus dem Loch zu ziehen, doch das ließ sie schnell wieder bleiben. So gut es ging, setzte sie sich auf und betrachtete den entstandenen Schaden. Ihre Hände waren von dem Sturz aufgeschürft und ihre Jeans am Knie zerrissen. Während sie versuchte die Äste von dem Loch, in welchem ihr Fuß steckte, wegzuziehen, schimpfte sie leise vor sich hin. Schließlich gelang es ihr, den Fuß zu befreien. Vorsichtig zog sie ihn aus dem Loch und betastete ihn. Missmutig dachte sie an ihr Handy, das sicher verwahrt zu Hause auf dem Küchentisch lag, als der Fuß zu stechen begann. „Hilfe“, rief sie kläglich. Aber natürlich würde niemand sie hören. „Hilfe“, versuchte sie es noch einmal lauter. Doch der Wald verschluckte ihre Rufe. Nur die schweigende Dunkelheit dröhnte ihr entgegen.
Mühsam versuchte Felice sich aufzurichten, ohne den verletzten Fuß zu belasten.
„So komme ich nie nach Hause“, dachte sie resigniert. „Vielleicht werde ich erfrieren.“ Sie schauderte. Schon jetzt war ihr ziemlich kalt und die Temperatur sank in den Oktobernächten bis an den Gefrierpunkt. Sie hatte nur einen dünnen Pullover an. Immerhin hatte sie vorgehabt, vor der Dämmerung zu Hause zu sein. Ihr Magen knurrte. Ungeschickt hüpfte sie vorwärts und holte sich dabei Schrammen und Kratzer. Nach wenigen Schritten fiel sie hin. Unwirsch rappelte sie sich wieder auf und hüpfte weiter. Nachdem sie das dritte Mal aufgestanden und wieder hingefallen war, konnte sie nicht mehr. „So geht das nicht“, dachte sie leicht panisch. „Kann mir jemand helfen… irgendjemand…“, fügte sie hoffnungslos hinzu. Wer ging schon um diese Uhrzeit in der Natur spazieren?
Inzwischen war rund und voll der Mond über dem Wald aufgegangen und tauchte alles in sein gespenstisches Licht. Schatten sprangen über den Boden. Felice saß zusammengekauert an einen Baum gelehnt und lauschte. Die Bäume knarrten, das Laub raschelte wie Geflüster. Tiere huschten immer wieder an ihr vorbei. Sie zitterte vor Kälte und sie hatte Hunger. Wie sollte sie wieder nach Hause kommen? Sie dachte an ihre Eltern. Was würden sie tun, wenn sie Bella holen wollten und ihre Tochter nicht da war? Und Andrea? Sie würde vielleicht die Polizei alarmieren, wenn Felice nicht nach Hause kam. Es konnte allerdings dauern, bis etwas passierte… So schnell schickte man keine Suchtrupps durch den Wald. Inzwischen war sie vielleicht erfroren. Sie schauderte.
Schweres Federgeraschel ließ Felice aus ihren Gedanken aufschrecken. Sie sah nach oben. Ein großer Vogel landete auf einem Ast des nächsten Baumes. Er schuhute traurig.
„Was mache ich hier eigentlich?“, dachte Felice. „Ich muss aufstehen und mich bewegen! Ich kann nicht hier rumsitzen und warten, dass irgendwer kommt oder ich zur Eisleiche erstarrt bin.“ Da sie es nicht schaffte aufzustehen, begann sie auf Händen und Knien vorwärts zu kriechen. Der Vogel beobachtete sie und flog ihr nach. Felice ignorierte die Schrammen, die sie sich zuzog und kroch immer weiter. Doch sie war erschöpft vom Tag und nach etwa 200 Metern, die ihr eher wie zwei Kilometer vorkamen, ließ sie sich fallen und blieb liegen. Der Vogel flatterte auf einen Ast in ihrer Nähe und sah stumm auf sie herab.
„Hilfe“, sagte Felice matt und dann schrie sie noch einmal lauter: „Hilfe!“ Mit geschlossenen Augen lag sie zusammengerollt am Boden und malte sich ihr Schicksal aus. Langsam glitt sie in einen Halbschlaf.
Sie erwachte jäh, als helles Licht durch ihre Lider drang. „Hilfe“, murmelte sie und öffnete die Augen. Wegen des grellen Lichts einer Taschenlampe, das ihr ins Gesicht schien, konnte sie nur ungenau die Gestalt eines Menschen erkennen, der vor ihr stand.
„Hallo? Können Sie mich hören?“, fragte eine Stimme, die ihr vage bekannt vorkam. Die Gestalt kniete sich zu ihr, die Taschenlampe wurde abgeblendet und Felice erkannte den Mann aus dem Nachbarhaus ihrer Eltern.
„Hallo“, erwiderte sie leise. „Wie haben Sie mich gefunden?“
„Ich war zufällig in der Nähe und hörte sie rufen“, sagte er sanft. „Sie sehen nicht gut aus. Können Sie laufen?“, fügte er hinzu. Vorsichtig versuchte Felice sich aufzurichten. Doch der Fremde schüttelte den Kopf. „Nein, so kommen wir nicht vorwärts. Warten Sie!“ Er schob seine Arme unter ihren Körper und hob sie einfach vom Boden hoch. Dann trug er sie mit federnden, kaum hörbaren Schritten durch den Wald. Felice hatte nicht mehr die Kraft verlegen zu sein. Sie war einfach nur dankbar, dass jemand sie gefunden hatte und sie nicht allein im Wald lag und fror.
Vielleicht war sie eingeschlafen, jedenfalls war das nächste, was sie mitbekam, dass sie auf ein Bett gelegt und eine Decke über sie gebreitet wurde. Das Bett war weich, ihr war wohlig warm und der Schmerz in ihrem Fuß war zu einem dumpfen Pochen abgeflaut. Am liebsten hätte sie einfach weiter geschlafen, aber sie dachte an Andrea, die sich bestimmt Sorgen machte. Sie öffnete die Augen und richtete sich auf. Sie befand sich in einem kleinen Raum, der einfach eingerichtet war: In einer Ecke gegenüber ihrem Bett stand ein schmaler Tisch mit einem Stuhl davor, eine Kommode war an der Wand platziert. Der Nachbar ihrer Eltern stand mit dem Rücken zu ihr an einem Waschbecken.
Er trocknete sich sorgfältig die Hände ab, bevor er sich ihr zuwandte. „Sie sind wach“, sagte er ruhig, nahm sich den Stuhl und setzte sich zu ihr ans Bett. „Wie geht es Ihnen?“, fragte er und musterte sie. Felice hatte das unangenehme Gefühl, dass sein Blick durch ihren Körper hindurch bis in ihr Unterbewusstsein drang und sich ihm alle ihre Geheimnisse offenbarten. Verlegen sah sie weg und betrachtete stattdessen die Hände des Mannes. Sie waren groß, braungebrannt und sahen sehr gepflegt aus.
„Gut“, versuchte sie zu sagen, doch sie brachte nur ein heiseres Krächzen heraus. Sie räusperte sich und bemerkte, dass ihr Hals rau war und brannte. „Gut“, wiederholte sie.
„Ich bin Arzt.“ Der Mann lächelte. „Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Es könnte sein, dass Sie ein wenig Fieber bekommen werden. Sie waren ganz schön ausgekühlt, als ich Sie gefunden habe.“ Er schwieg einen Moment und sah sie an. Dann fuhr er fort: „Wenn Sie sich kräftig genug fühlen, möchten Sie vielleicht duschen. Und ich würde gerne Ihren Fuß untersuchen. Er sieht ein wenig... lädiert aus.“ Seine Stimme hatte einen warmen, beruhigenden Klang.
Felice nickte. „Danke für Ihre Hilfe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Sie mich nicht gefunden hätten“, sagte sie leise. Das Reden strengte sie an und verursachte ihr Schmerzen im Hals. „Dann hätte es vielleicht ein anderer getan“, erwiderte der Mann, doch seine dunklen Augen blieben ernst und er lächelte nicht.
Felice wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Beim besten Willen konnte sie sich nicht vorstellen, wer sie sonst hätte finden können. Es grenzte schon an ein Wunder, dass er sie gefunden hatte. Schließlich gingen nicht haufenweise Leute nach Einbruch der Dunkelheit im tiefsten Wald spazieren, noch dazu abseits der Wege. Aber das zu erklären kam ihr viel zu umständlich und anstrengend vor. Stattdessen fragte sie: „Meine Freundin wartet auf mich. Könnte ich mal kurz mit ihr telefonieren? Oder“, fügte sie halbherzig hinzu „komme ich von hier aus irgendwie nach Hause?“
„Ja, Sie können telefonieren. Nein, Sie kommen von hier aus nicht nach Hause, außer Sie haben Lust auf einen mehrstündigen Fußmarsch. Außerdem sind Sie zu schwach. Ich werde Sie morgen nach Hause bringen, wenn Ihr Zustand es erlaubt.“ Ein scharfer Unterton lag nun in seiner sanften Stimme und in seinen Augen flackerte es. Felice war ein wenig erschrocken über seine Reaktion. Eigentlich musste er doch froh sein über jede Gelegenheit, sie loszuwerden. Der Mann verschwand und erschien fast sofort wieder mit einem Telefon in der Hand. Er reichte es Felice und ließ sie dann allein, damit sie ungestört reden konnte.
Es hatte kaum einmal getutet, als Andrea abnahm.
„Andrea Siebenlist.“
„Hallo, ich bin´s“, antwortete Felice.
„Oh Gott sei Dank, Felice! Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht! Wo steckst du denn? Ist was passiert?“, tönte es ihr entgegen.
„Äh, ich habe mich verlaufen. Mein Nachbar hat mich aufgegabelt und da bin ich jetzt“, antwortete sie. Sie musste sich mehrmals räuspern und es strengte sie an, in halbwegs verständlicher Lautstärke zu sprechen. „Dein Nachbar. Heißt das, du bist zu Hause? Hat er auch einen Namen? Und wie hörst du dich überhaupt an?“, fragte Andrea misstrauisch.
„Ich hatte noch keine Gelegenheit ihn zu fragen.“ Felice runzelte die Stirn. „Nein, ich bin nicht zu Hause. Er scheint mehrere Wohnungen zu haben. Er ist Arzt. Du, ich erzähl´s dir, wenn wir uns sehen. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen.“ Das Telefonat und Andreas Aufregung strengten sie an.
„Gut“, sagte Andrea skeptisch. „Aber melde dich morgen wieder. Wenn ich nichts von dir höre, rufe ich die Polizei.“
„Okay. Danke“, antwortete Felice matt und legte auf.
Einen Moment blieb sie sitzen, dann stand sie auf, um den Mann zu suchen. Sie machte einen unsicheren Schritt nach vorne und blieb stehen. Ihr Kopf dröhnte, schwarze Flecken tanzten ihr vor den Augen und ihr schwindelte. Alles drehte sich. Erfolglos suchte sie mit der Hand nach einem Halt. Ihr Fuß begann heftig zu stechen, als sie ihn belastete. Sie taumelte vorwärts. In dem Augenblick kam der Mann herein und fing sie auf.
„Langsam, langsam“, sagte er und setzte sie auf das Bett zurück. Felice wartete, bis der Schwindel vorüber war. „Oh Gott“, stöhnte sie und strich sich mit der Hand über die Stirn.
Der Mann sah sie besorgt an und legte ihr eine Hand auf die Stirn. Sie fühlte sich weich und kühl an. „Geben sie ihrem Körper Zeit“, meinte er sanft. „haben Sie mit Ihrer Freundin gesprochen?“
„Ja“, antwortete Felice. „Sie hat schon einen ziemlichen Wirbel veranstaltet und will die Polizei holen, falls ich mich nicht melde.“ Sie war bemüht ihrer Stimme einen beiläufigen, etwas entnervten Ton zu geben, aber er durchschaute sie sofort.
„Und jetzt soll ich Ihnen sagen, ob das nötig ist“, stellte er mit leichtem Spott fest. Er schwieg und sah sie durchdringend an. Seine Augen schienen zu glühen. Ein Schauer lief ihr über den Rücken.
„Was denken Sie denn?“, fragte er leise.
Hilflos zuckte sie mit den Schultern. „Ich kenne nicht einmal Ihren Namen“, erwiderte sie.
„Würde mein Name denn etwas ändern?“, wollte er wissen und beugte sich leicht zu ihr vor.
Felice errötete. Sie wollte woanders hinsehen, doch er hielt sie mit seinem Blick gefangen. „Glauben Sie, ich bin gefährlich?“, fragte er und klang sanft und bedrohlich zugleich.
„Vielleicht“, hauchte sie und wurde noch röter.
Er lehnte sich von ihr weg, seine Stimme bekam wieder ihren beruhigenden Klang und der Bann brach. „Ja, vielleicht bin ich gefährlich. Aber Sie können unbesorgt sein. Als Arzt habe ich den Eid geleistet, Leben zu schützen, nicht sie zu zerstören. Ich heiße Tom Andarin.“
Bei dem Namen regte sich etwas in Felices Kopf, doch sie kam nicht darauf, wo sie den Namen schon gehört hatte. Und Herr Andarin ließ ihr keine Zeit nachzudenken.
„Kommen Sie!“, sagte er und half ihr auf. Diesmal flaute das Schwindelgefühl schnell wieder ab. Auf wackeligen Beinen folgte sie ihm über den kleinen Flur zum Badezimmer.
„Ich habe Ihnen saubere Schlafkleidung und Handtücher rein gelegt. Duschen Sie nur kurz und rufen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen“, wies er sie an. „In zwanzig Minuten komme ich und schaue nach Ihnen.“ Felice spürte, wie sie erneut von Schwindel ergriffen wurde. Hitze und Kälte spielten mit ihrem Körper und der Fußboden schien sich zu verselbstständigen. „Ich schaue in fünfzehn Minuten nach Ihnen“, korrigierte sich Herr Andarin und stützte sie. Sie wartete, bis sie wieder alleine stehen konnte, dann humpelte sie ins Badezimmer und schloss die Tür hinter sich.
Als erstes bemerkte sie, dass es keinen Schlüssel gab, als zweites den mannhohen Spiegel. Erschrocken sah sie ihr Spiegelbild an. Ihre Kleidung war zerrissen, sie hatte überall Kratzer, war kreidebleich und dreckverschmiert. Sie ließ sich auf den Toilettendeckel sinken und warf einen Blick zur Tür. Langsam begann sie sich auszuziehen. Sie hoffte, dass Herr Andarin nicht hereinplatzen würde, während sie unter der Dusche stand. Doch nachdem sie es geschafft hatte, sich ihrer Kleidung zu entledigen - was nicht leicht war, da sie versuchte, weder ihren Fuß, der inzwischen deutlich angeschwollen war, zu belasten, noch vor Schwindel vom Stuhl zu fallen - war es ihr egal. Immerhin war er Arzt.
Mühsam stand Felice auf, humpelte zur Dusche und kletterte hinein. Drinnen lehnte sie sich gegen die kühle Wand und wartete bis die Welle von Schwindel und Übelkeit vorüber war. „Oh Gott“, dachte sie. „Wie kann es einem innerhalb so kurzer Zeit so schlecht gehen.“ Sie drehte die Dusche auf und ließ sich das heiße Wasser über den Körper laufen.
Wie sich herausstellte, war ihre Sorge, Herr Andarin könnte hereinkommen, unbegründet gewesen. Er klopfte erst, als sie gerade fertig angezogen war. „Ja, herein“, antwortete Felice.
„Jetzt erkenne ich Sie wieder“, bemerkte er lächelnd und half ihr, zurück in ihr Zimmer zu humpeln. Dankbar ließ sie sich auf dem Bett nieder und wollte sich hinlegen.
„Halt, ich würde mir gerne noch Ihren Fuß ansehen“, hielt Herr Andarin sie auf. Er nahm eine Tasche mit Verbandszeug vom Tisch, setzte sich wieder auf den Stuhl vor ihrem Bett und hob den Fuß vorsichtig auf seinen Oberschenkel. Sanft betastete er ihn, mit kaum spürbaren Berührungen. Dann hielt er in der Bewegung inne und schloss die Augen. „Er scheint angebrochen zu sein“, erklärte er, als er sie wieder öffnete. „Ich werde ihn stützen. Sie können ihn gipsen lassen, wenn Sie in die Stadt kommen.“ Er sah sie an. „Achtung“, fügte er hinzu, verstärkte seinen Griff und drückte. Ein scharfer Schmerz schoss durch Felices Knöchel. Sie zog hörbar die Luft ein und Tränen schwammen ihr in den Augen.
„Tut mir Leid. Jetzt ist es vorbei. Dafür wird Ihr Fuß wieder gesund und schön“, entschuldigte sich Herr Andarin mit sanfter Stimme. Er griff nach dem Verbandszeug, schmierte eine dicke Paste auf den Fuß und bandagierte ihn. „So, jetzt können Sie schlafen“, meinte er, als er fertig war.
„Danke“, seufzte Felice. Ihr war schon wieder schwindlig, ihr Hals und ihr Fuß taten ihr weh und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich ihre Ruhe zu haben. Sie ließ sich auf ihr Kissen sinken, zog die Decke über sich und schlief ein, noch ehe Herr Andarin den Raum verlassen hatte.
Später erwachte Felice, weil sie fror. Dämmerlicht sickerte durch die zugezogenen Vorhänge ihres Fensters. Sie versuchte sich aufzurichten, ließ sich jedoch sofort wieder zurücksinken. Ihr war speiübel und in ihrem Kopf hämmerte es. Eine Weile wälzte sie sich herum und suchte nach einer Position, in welcher ihr weniger kalt sein würde, dann sank sie in einen unruhigen Schlaf.
Sie irrte durch ein Labyrinth auf der Suche nach etwas, das sie nicht finden konnte. Ständig lief sie in Sackgassen oder Hindernisse versperrten ihr den Weg und sie musste umkehren. Es schien keinen Ausweg aus dem Irrgarten zu geben und ihre Hoffnung schwand, jemals zu finden, was sie suchte und plötzlich wusste sie auch nicht mehr, was es war. Das einzig Sichere war, dass sie nicht aufgeben durfte. Sie litt schrecklichen Durst, ihr Kopf schmerzte und sie war zum Umfallen müde. Nebel begann sich in den Gängen auszubreiten und nahm ihr jede Orientierung. Erschöpft ließ sie sich zu Boden sinken, doch da wurde er glühen heiß. Trotz ihrer Müdigkeit stemmte sie sich hoch und schleppte sich weiter. Der Nebel wurde dichter und sie hatte das Gefühl zu ersticken. „Ich bekomme keine Luft“, murmelte sie.
„Dann atme!“, befahl eine gebieterische Stimme. Plötzlich stand Herr Andarin neben ihr und nahm sie an der Hand. Der Nebel lichtete sich. Vor ihr lag frei und schnurgerade der Weg zum Ausgang.
Felice erwachte. Sie lag noch immer in dem kleinen Zimmer und Herr Andarin saß vor ihr. Als er sah, dass sie wach war, nahm er eine Tasse von der Kommode und hielt sie ihr an die Lippen. „Trink!“, befahl er. Die Flüssigkeit schmeckte bitter und sie versuchte sich zu weigern. Aber Herr Andarin flößte ihr sanft alles ein, bevor sie wieder einschlief.
Diesmal war ihr Schlaf tief und traumlos und als sie erwachte, fühlte sie sich besser.
Die Vorhänge waren zurückgezogen worden und die Strahlen der Herbstsonne fielen in ihr Zimmer. Eine Weile blieb Felice liegen. Draußen sang ein Vogel, doch im Haus waren keine Geräusche zu hören. Sie setzte sich auf und bemerkte, dass der Schwindel ausblieb. Umsichtig stand sie auf und ging ein paar Schritte hin und her. Erstaunt realisierte sie, dass nicht nur der Schwindel verschwunden war, sondern auch die Schmerzen in ihrem Fuß.
Ein leises Klopfen ließ sie zur Tür blicken. Herr Andarin lehnte im Türrahmen. „Wie ich sehe, geht es Ihnen wieder besser“, sagte er freundlich.
„Ja“, erwiderte Felice lächelnd. „Danke, dass Sie sich seit gestern um mich gekümmert haben.“
„Gern geschehen“, entgegnete er. „Wenn auch nicht seit gestern, sondern seit drei Tagen.“
„Was?“, fragte sie erschrocken. „Was ist heute für ein Tag?“
„Dienstag, der erste November“, antwortete er. Bei näherem Hinsehen wirkte er erschöpft. Dunkle Schatten unter seinen Augen betonten die Blässe in seinem Gesicht.
„O nein!“, stöhnte Felice. „Es tut mir Leid. Warum haben Sie nicht einfach einen Krankenwagen gerufen und mich abholen lassen?“
„Das war nicht nötig. Ich bin Arzt und mir hat es nichts ausgemacht, mich um Sie zu kümmern. Sie waren hier sicher“, gab Herr Andarin schulterzuckend zurück. „Und ich habe mir erlaubt, Ihre Freundin daran zu hindern, die Polizei loszuschicken“, fügte er hinzu. Erstaunt sah Felice ihn an. Es wunderte sie, dass es ihm gelungen war, Andrea zu überzeugen.
An diesen Nachmittag fuhr Herr Andarin sie nach Hause. Felice staunte, wie weit sie von Freiburg entfernt waren. Obwohl die Straßen frei waren, brauchten sie fast drei Stunden, bis sie die Stadt erreichten. Als sie aussteigen wollte, hielt Herr Andarin sie zurück. „Versprechen Sie mir, dass Sie nicht allein im Wald spazieren gehen und überhaupt nicht nach Einbruch der Dunkelheit“, bat er.
„Hm. Gilt Bella als Person?“, fragte sie. „Sie gilt“, erwiderte er. „Aber nur, wenn Sie auf ihre Warnungen hören.“
„Okay. Klar“, versprach sie leicht verwirrt. „Ich habe erst mal genug.“
Stirnrunzelnd sah sie ihm nach, als er davonfuhr.
3
Düsteres Licht erhellte notdürftig den kleinen Laborraum. An den Wänden reihten sich Reagenzgläser, Döschen und Fläschchen und in einem Regal standen fein säuberlich beschriftete Flaschen, die mit verschiedenfarbigen Flüssigkeiten gefüllt waren.
In der Mitte des Raumes stand Tom an einem Tisch, über den diverse Pflanzenreste verteilt lagen. Er hatte ein Reagenzglas in der Hand, das er sorgfältig verschloss und schüttelte. Prüfend hielt er es gegen das Licht, wartete einen Augenblick und schüttelte es abermals. Dann hängte er es in eine Halterung, räumte die Pflanzenreste weg und schritt aus dem Raum. Das Präparat würde ein paar Stunden ziehen müssen, bevor er es abfüllen konnte.
Der Vorraum des Labors war gefüllt mit Kräutern, die von der Decke hingen oder in Gläsern verstaut aufbewahrt wurden. Zeichen und Symbole waren an den Wänden zu erkennen. Ganz hinten in einer Ecke lagen vergilbte Bücher und Schriftrollen.
Tom durchquerte den Raum, zog eines der Bücher aus dem Regal und blätterte darin. Als er fand, was er suchte, ließ er sich auf einen Stuhl sinken und begann zu lesen. Nach einer Weile stand er auf und begann seinen Besuch beim Bundespräsidenten vorzubereiten. Geschmeidig glitt er durch den Raum, suchte verschiedene Kräuter zusammen und verstaute sie in einem kleinen Stoffbeutelchen, das er sich am Gürtel befestigte. Zum Schluss entnahm er aus einem verschlossenen Eckschrank im Labor eine Phiole mit klarer Flüssigkeit. Er steckte sie zu den Kräutern, nahm seinen schwarzen Umhang, der auf einer Stuhllehne hing, und warf ihn sich über sie Schultern. Er verließ das Haus und verschmolz durch jahrelange Übung sofort mit dem Schatten.
Die Abenddämmerung lag schon über dem kleinen Dorf und an dem kalten Februarabend waren keine Spaziergänger unterwegs. Eine dünne Schicht aus Schnee und Eis bedeckte die Erde. Tom zog den Umhang fest um seine Schultern und schritt über die Wiese. Ungesehen gelangte er zum alten Herrenhaus, wo er auf Minerva wartete. Mit einem leisen Schuhuen flog die Eule auf Toms Schulter und gemeinsam verschwanden sie im nahen Wald.
Eine halbe Stunde später kehrte Minerva allein zurück, während Tom sich, 500 Kilometer weiter nördlich, aus dem Nichts heraus im Schlafzimmer des Bundespräsidenten materialisierte.
„Guten Abend“, grüßte er leise den im Bett liegenden Präsidenten.
Erschrocken öffnete der Angesprochene die Augen. „Wer sind Sie? Wie sind Sie hierher gekommen?“ fragte er.
Tom durchquerte mit geschmeidigen Schritten den Raum. „Ich bin Arzt. Ich habe Ihnen mein Kommen angekündigt“, erwiderte er, nahm ein Kärtchen vom Nachttisch des Kranken und ließ es durch die Finger gleiten.
„Und wie sind Sie hier hereingekommen?“, verlangte der Präsident zu wissen. Er hatte sich aufgerichtet und versuchte unauffällig an die Klingel zu kommen, die seinen Bodyguard alarmieren sollte.
Tom lächelte spöttisch: „Die Klingel brauchen Sie vorläufig nicht. Ich komme gewöhnlich dahin, wo ich hin will – wie, ist meine Sache. Die Frage ist, ob Sie mein Angebot annehmen oder nicht.“ Er betrachtete den Präsidenten. „Ich kann Ihnen Ihre Gesundheit vielleicht zurückgeben.“
„Wie haben Sie überhaupt von der Art meiner Krankheit erfahren?“, fragte der Präsident misstrauisch.
Tom lächelte: „Ich habe meine eigenen Quellen.“
„Hm, und Ihre Bedingungen sind?“, fragte der Präsident matt und schloss die Augen.
Tom trat auf ihn zu: „Ein Honorar in Höhe Ihres eigenen Ermessens, nach erfolgter Genesung. Und“, fügte er mit einer unmissverständlichen Warnung in der Stimme hinzu: „meine Existenz bleibt geheim. Keine Kameras, Tonträger oder dritte Personen während meiner Aufenthalte bei Ihnen. Seien Sie gewarnt: Ich würde jeden Versuch mich zu hintergehen, sofort bemerken.“ Es trat eine Pause ein.
„Woher weiß ich, dass Sie nicht versuchen, mich zu vergiften?“, fragte der Kranke schließlich.
„Dafür“, entgegnete Tom sanft „würde ich Sie nicht um Erlaubnis fragen.“
„Wenn ich Ihren Vorschlag ablehne...“, begann der Präsident. „Verschwinde ich und Sie werden nie wieder etwas von mir hören“, vollendete Tom den Satz ruhig. Es folgte eine lange Stille, in welcher er völlig bewegungslos im Raum stand. Er konnte die Gedankengänge des Präsidenten in dessen Gesicht verfolgen. Endlich sagte der Präsident langsam: „Ich nehme Ihre Bedingungen an. Helfen Sie mir und ich werde Sie gut bezahlen.“
„Gut“, erwiderte Tom. Seine Stimme war jetzt, nachdem die Rahmenbedingungen geklärt waren, wesentlich sanfter. „Lassen Sie mich Ihren Puls messen.“ Er fühlte mit geschlossenen Augen den Puls und lauschte auf den Atem des Patienten, dann machte er sich an die Arbeit.
Aus der im Zimmer vorhandenen Minibar nahm er ein Glas, füllte es mit Wasser und wählte ein Kraut aus seinem Beutelchen. Vorsichtig trennte er die Blüten vom Stängel und zerrieb sie über dem Wasser, während er unhörbar ein altes Gebet vor sich hin sang. Zum Schluss fügte er einen Tropfen aus der Phiole bei.
Den Beutel mit den Kräutern löste er vom Gürtel und reichte ihn dem Kranken, zusammen mit dem Wasserglas. „Den Beutel legen Sie unters Kopfkissen. Von dem Wasser trinken Sie stündlich einen Schluck“, wies er den Präsidenten an. „Außerdem würde ich Ihnen empfehlen weniger Fleisch zu essen“, fügte er hinzu. „Ich wünsche Ihnen gute Besserung.“ Mit einem leichten Neigen des Kopfes drehte er sich um und rauschte in Richtung Tür davon. Noch bevor er sie erreicht hatte, verschwand er und ließ den völlig verdatterten Präsidenten zurück.
Tom taucht in der Nähe des alten Herrenhauses wieder auf. Es war inzwischen ganz dunkel geworden und er musste sich keine Sorgen um unerwünschte Beobachter machen. Er war mit dem Ergebnis seines Besuches zufrieden. Die meisten seiner Patienten reagierten ähnlich, wenn er das erste Mal bei ihnen auftauchte. Manche brauchten etwas länger mit ihrer Entscheidung, Tom als Arzt zu konsultieren, aber er war erst einmal völlig abgewiesen worden.
Minerva war in der Nähe auf der Jagd. Er konnte ihre Anwesenheit spüren. „Du hast Besuch“, teilte sie ihm mit.
„Danke“, dachte er.
„Vergile wartet vor deiner Haustür auf dich“, fuhr sie fort, während sie sich auf ihre Beute stürzte.
Tom hatte alle seine Wohnungen mit starken Schutzzaubern umgeben, so dass es Vergile nicht möglich sein würde, in sein Haus einzudringen. Trotzdem war er über den Besucher beunruhigt. Er zog seinen Umhang enger und wurde eins mit der Nacht. Unhörbar näherte er sich seinem Haus, doch es war ein hoffnungsloser Versuch, sich an einen Zauberkünstler wie Vergile heranzuschleichen. „Wahrscheinlich hat er mich schon bemerkt, als ich beim alten Herrenhaus aufgetaucht bin“, dachte Tom, als ihn das meckernde Lachen des Zauberers begrüßte.
„Hallo Tom“, krächzte Vergile. Er hatte das Aussehen eines kleinen, alten, klapperdürren Mannes, mit schütterem Haar und schiefen Zähnen. Seine Augen waren klein und stechend. Bisweilen zuckte seine Zunge zwischen seinen Lippen hervor, als könnte er damit etwas in der Luft wittern.
„Guten Abend Vergile“, nickte Tom ihm zu und verbarg seine Wachsamkeit unter einem Mantel von gleichgültiger Höflichkeit.
„Kommst spät. Hattest wohl ´ne Audienz, he?“, geckerte Vergile. Tom gab einen vagen Laut von sich, der sowohl Zustimmung als auch Ablehnung bedeuten konnte.
„Immer noch der Alte. Immer so geheimnisvoll“, lachte Vergile krächzend.
„Niemand von uns redet viel über seine Arbeit“, antwortete Tom mit einem Achselzucken. Äußerlich war er ruhig, doch innerlich wartete er auf die Wende in Vergiles Gehabe. Es gab einen Grund, warum der Magier ihn aufgesucht hatte und bei ihm konnte man sich nie sicher sein, ob er einen nicht im nächsten Moment angriff.
„Tom, Tom“, gackerte Vergile und seine Zunge schoss zwischen seinen Zähnen vor. „Wir erzählen nix und wir mischen uns nich ein, stimmt´s?“, fragte er lauernd.
„Wenn die anderen sich an die Gesetze halten, mischen wir uns gewöhnlich nicht ein“, erwiderte Tom.
Jetzt schlug Vergiles Ton um. „Und was is mit dem Mädchen? Wo is se? Hast se mir gestohlen?“, zischte er und seine Augen blitzten wütend.
„Es gibt keine Menschenopfer“, versetzte Tom. Er hatte geahnt, dass es Vergile gewesen war, der Felice in seinem Netz gefangen hatte.
„War Samhain. Alle ham gejagt. Kann ja nix dafür, wenn das Gör sich verläuft und genau über meinen Jagdpfad trampelt. Jedenfalls gehörte se danach mir!“, keifte Vergile.
Tom dachte an den vergangenen Oktober zurück. Der zweite Vollmond nach Herbstbeginn war jedes Jahr der Mond der großen Jagd. Tom hatte sich mit anderen Wesen, die magische Fähigkeiten besaßen - Vergile eingeschlossen - zum Wettstreit getroffen. Jeder war seinem eigenen Jagdpfad gefolgt und hatte sich den Aufgaben gestellt, die sich ihm dort boten. Tom hatte die Jagd sofort abgebrochen, als Minerva ihn warnte, dass ein normaler Mensch auf die Jagdpfade geraten war. Früher waren Menschen manchmal bei solchen Jagden umgekommen.
„Sie hat sich nicht verlaufen. Du hast sie gelockt. Für andere Wanderer wäre die Weggabelung nicht vorhanden gewesen“, entgegnete er scharf.
„Ach tatsächlich!“, erwiderte Vergile mit einem hämischen Grinsen. „Den Knöchel hat se sich jedenfalls allein gebrochen.“
„Ganz ohne Hilfe, schätze ich“, gab Tom spöttisch zurück. „Und dann hat sie vermutlich ihren Vorrat an Alraunenwurzeln und Belladonnabeeren ausgepackt und sich selbst damit vergiftet.“ Als Tom Felice gefunden hatte, hatte sie starke Vergiftungserscheinungen aufgewiesen. Doch sie hatte keine stofflichen Reste des Giftes in sich gehabt, was bedeutete, dass jemand den Geist der Pflanzen, die Giftessenz, durch Magie in ihren Geist verpflanzt hatte. Tom musste Felice auf ihren Traumpfaden nachwandern, um sie zurückzuholen. Es war schon fast zu spät gewesen, als er sie gefunden hatte.
„Hättest auch nix mehr machen können, wenn dein verfluchter Vogel mich nich daran gehindert hätte“, schnarrte Vergile mit böse funkelnden Augen.
„Du beleidigst die hohe Frau?“, fragte Tom mit hochgezogenen Augenbrauen.
„Frag mich, was dir die Kleine wert is“, sagte Vergile plötzlich in deutlich verändertem Tonfall, ohne auf Tom einzugehen. „Hm, sags mir. Was is se dir wert?“, schnurrte er.
Stirnrunzelnd sah Tom ihn an. Er verstand nicht, worauf Vergile hinaus wollte. Was sollte die Frage? Doch er ließ sich seine Verwirrung nicht anmerken und antwortete ruhig: „Ein Menschenleben. Ich bin Arzt.“
Vergile schnaubte. „Also würdest du se gegen jemand anders eintauschen?“, fragte er lauernd und seine Zunge huscht über seine Lippen.
„Ich handle nicht mit Leben“, erwiderte Tom. Vergile war ein Gauner, der die Leute über den Tisch zog und ihnen böse Streiche spielte. Tom hatte nicht vor, eines seiner Opfer zu werden und sich von ihm erpressen zu lassen. Abgesehen davon fragte er sich, warum Vergile ein so starkes Interesse an dem Mädchen hatte.
„Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest“, fügte er hinzu und wandte sich seiner Haustür zu.
„Was das für ´ne Katastrophe wär, wenn der Bundespräsident plötzlich sterben würde“, säuselte Vergile. Tom fuhr herum. Woher wusste Vergile, wo er gewesen war? Eigentlich war seine Spur nicht so leicht zurückzuverfolgen.
„Ich handle nicht mit Leben!“, wiederholte er und seine Stimme klang jetzt hart und kalt.
Vergiles Zunge flatterte zwischen seinen Lippen hervor. „Oder wenn alle, die du behandelst, sterben“, gluckste er. „Eujeujeu – der große Tom kann nix mehr helfen, weil se dann alle sterben.“ Er brach in krächzendes Gelächter aus.
„Das“, versetzte Tom „wirst du nicht tun.“ Er fragte sich, ob Vergile tatsächlich vorhatte, so gravierend gegen die Regeln zu verstoßen. Die Konsequenzen konnten schwerwiegend sein. Welches Interesse konnte der Magier an dem Mädchen haben? Soweit ihm bewusst war, verfügte Felice über keine Eigenschaften, die ihm für seine Belange nutzen konnten.
„Ich brauche nur ´nen Namen Tom“, raunzte Vergile, ohne auf ihn einzugehen. „Gib mir den Namen!“ In diesem Augenblick flutete Scheinwerferlicht über sie hinweg. Ein Auto kam die Straße entlang und parkte am Haus der Brückners.
„Ha!“, gackerte Vergile plötzlich. „Brauche keine Namen mehr.“ Seine kleinen Augen funkelten und seine Zunge wanderte wild flatternd zwischen seinen Lippen hin und her. Dann war er verschwunden.
Eine Minute später stieg Felice aus dem Auto.
Mit einer blitzschnellen Bewegung löste Tom den auffälligen Umhang von seinen Schultern und ließ ihn verschwinden, als sie auf ihn zukam. „Wo ist Vergile?“ fragte er in Gedanken Minerva, die über ihm kreiste.
„Fort“, gab die Eule zurück. „Er ist gegangen.“
„Hallo! Guten Abend Herr Andarin“, begrüßt Felice ihn strahlend, als sie herangekommen war.
„Guten Abend“, erwiderte Tom knapp. Diese Frau hatte wirklich ein Talent dafür, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Halb fragte er sich, warum Minerva nicht eingegriffen und verhindert hatte, dass Felice in das Treffen platzte. „Besuchen Sie Ihre Eltern?“, fragte er etwas freundlicher.
„Naja, ich wohne jetzt erst mal die nächsten drei Monate hier“, erzählte sie gutgelaunt.
4
Die Dämmerung senkte sich über die Häuser des kleinen Dorfes, breitete sich über die Felder und den Wald. Eine Amsel sang in der lauen Luft des Aprilabends, sonst war es still. Die Welt schien in ein Tuch tiefen Friedens gehüllt. Die Fenster in Felices Zimmer waren weit geöffnet und ließen den Frühling herein.
Sie saß auf ihrem Bett, den Rücken gegen die Wand gelehnt und sah hinaus in die Dämmerung. Ihre Eltern waren über das Wochenende zu einem Freund ihres Vaters gefahren und hatten Bella bei ihr gelassen. Der Hund lag mit dem Kopf auf ihrem Schoß und ließ sich kraulen.
Mit einem Mal veränderte sich etwas in der Luft. Die Amsel hörte auf zu singen und Bella hob den Kopf und begann leise zu knurren. Eine eigenartige Erregung ergriff Besitz von Felice. Sie hatte das Gefühl vor Energie zu sprühen und jetzt auf der Stelle irgendetwas tun zu müssen. Sie sprang zum Fenster und schaute hinaus. Ein kleiner, alter Mann, in einen Kapuzenumhang gehüllt, wackelte langsam die Straße entlang.
Vor ihrem Haus blieb er einen Augenblick stehen, schaute stumm zu ihr hinauf und schlug dann den Weg über die Felder zum alten Herrenhaus ein. Fast schien es, als hätte er sie aufgefordert, ihm zu folgen. Bella knurrte lauter, doch Felice bemerkte es kaum. Eine ungeheure Neugierde hatte sie gepackt und mit einem Mal konnte sie sich nichts Schöneres vorstellen, als dem Mann heimlich zum alten Herrenhaus hinterherzuschleichen.





























