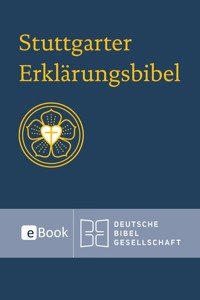
Stuttgarter Erklärungsbibel E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Deutsche Bibelgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die neue Stuttgarter Erklärungsbibel bietet den aktuellen Text der revidierten Lutherbibel 2017 mit vollständig überarbeiteten Erläuterungen zu jedem Abschnitt. Zu jeder Bibelstelle eine fundierte Erklärung? Dafür benötigt man eine ganze Kommentarreihe – oder die Stuttgarter Erklärungsbibel! Kommentare zu jedem Abschnitt bieten Verständnishilfen und ordnen die Texte historisch und theologisch ein, ohne dass Fachwissen vorausgesetzt wird. Die Erklärungen sind als Einschübe in den Bibeltext gestaltet. So muss die fortlaufende Lektüre nicht zum Nachschlagen der Kommentare unterbrochen werden und der Überblick bleibt gewahrt. Grundlage bildet der aktuelle Text der revidierten Lutherbibel 2017. Für die Neuausgabe wurden alle Erklärungs- und Einführungstexte auf Basis der aktuellen bibelwissenschaftlichen Erkenntnisse überprüft und überarbeitet. Das neue Layout ermöglicht eine noch bessere Orientierung zwischen Bibel- und Erklärungstexten. Übergreifende Einführungen, erweiterte Sach- und Worterklärungen sowie aktualisierte Karten bieten zusätzliche Informationen zum »Buch der Bücher«. Die neue Stuttgarter Erklärungsbibel enthält den kompletten Text der Lutherbibel mit umfangreichen Erläuterungen auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung. Die Stuttgarter Erklärungsbibel ist ein »Muss« für interessierte Bibelleserinnen und -leser ebenso wie für Studierende, Lehrende, Pfarrerinnen und Pfarrer. - Vollständig überarbeitete Neuausgabe des Klassikers - Enthält den kompletten Text der Lutherbibel 2017 inkl. Apokryphen - Einführungen und Kommentare im Bibeltext auf neuestem wissenschaftlichen Stand
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 9832
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Navigation in diesem eBook
Dieses eBook verfügt über folgende Navigationshilfen:
Klicken Sie auf eine Kapitelziffer, um zum Anfang des entsprechenden Buchs zurückzukehren.Klicken Sie auf den Buchtitel am Anfang eines Buchs, um zum Inhaltsverzeichnis zurückzukehren.Klicken Sie auf die hochgestellten Ziffern im Bibeltext, um zu den Verweisen und Anmerkungen zu gelangen.Klicken Sie auf Bibelstellenangaben in den Verweisen oder Anmerkungen, um zum entsprechenden Text zu gelangen.Weitere Hinweise zu diesem eBook finden Sie unter »Hinweise zum Gebrauch«. Beachten Sie bitte außerdem die Navigationshilfen Ihres eBook-Readers.
Vorwort der Herausgeber
Rechtzeitig zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation wurde im Oktober 2016 die revidierte Lutherbibel 2017 veröffentlicht. Durch diese Revision wurde auch eine Überarbeitung der Stuttgarter Erklärungsbibel notwendig, die sich seit ihrem ersten Erscheinen 1992 in Studium, theologisch-religionspädagogischer Praxis und persönlicher Bibellektüre fest etabliert hat.
Wir freuen uns sehr, dass diese Studienbibel jetzt in einer vollständig neu bearbeiteten Ausgabe vorliegt. Die bewährten Qualitätskriterien der Stuttgarter Erklärungsbibel wurden beibehalten und fortgeführt. Sie bietet fundierte historische und theologische Einführungen zur Entstehung der Bibel, zum Schriftverständnis und zu den einzelnen Büchern sowie Kommentare zum kompletten Bibeltext, einschließlich der Apokryphen, und passt doch in einen Band. Sie ist auf dem aktuellen Stand der Bibelwissenschaft und präsentiert die relevanten Ergebnisse allgemeinverständlich und theologisch ausgewogen. Sie konzentriert sich auf Wesentliches und wird gerade dadurch zu einem wertvollen und gerne verwendeten Hilfsmittel.
Bibeltext und Kommentar sind durch unterschiedliche Schriftgrößen und Schriftarten deutlich voneinander unterschieden. Einführungen und Inhaltsübersichten zu allen biblischen Büchern sowie ein Anhang mit ausführlichen Sach- und Worterklärungen, Landkarten, Zeittafel u. a.m. sorgen für zusätzliche Orientierung.
Im Rahmen der jetzt vorgelegten Überarbeitung der Stuttgarter Erklärungsbibel wurden die Erklärungen nicht nur an den revidierten Text der Lutherbibel 2017 angepasst, sondern von Fachleuten aus der deutschsprachigen Bibelwissenschaft (vgl. die Übersicht unter Die Stuttgarter Erklärungsbibel) gründlich durchgesehen und an vielen Stellen völlig neu erarbeitet. Auch die Erklärungen, die übernommen wurden, entsprechen dem Stand der Wissenschaft. Allen, die an der Überarbeitung mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt.
Widmungen in Bibelausgaben enthalten häufig die Wendung »Zum gesegneten Gebrauch«. Das ist es, was wir auch der Stuttgarter Erklärungsbibel wünschen. Wer sie zur Hand nimmt, soll dadurch den biblischen Text und seine Botschaft besser verstehen und erschließen können. So soll sie dazu beitragen, dass das Evangelium von Jesus Christus auch heute Menschen bewegt und verändert.
Stuttgart, am 31. Oktober 2022
Die Herausgeber
Beate Ego, Bochum
Ulrich Heckel, Stuttgart
Christoph Rösel, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Orientierungspunkte
Inhaltsverzeichnis
Cover
Textanfang: Einführung »Die Bibel«
Kurzregister: »Wo finde ich was?«
Stichwortverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Zur Navigation in diesem eBook
Vorwort der Herausgeber
Inhaltsverzeichnis
Die Stuttgarter Erklärungsbibel
Hinweise zum Gebrauch
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis und weitere Abkürzungen
Die Bibel
Bücher der Bibel
DAS ALTE TESTAMENT
GESCHICHTSBÜCHER
Das erste Buch Mose (Genesis)
Das zweite Buch Mose (Exodus)
Das dritte Buch Mose (Levitikus)
Das vierte Buch Mose (Numeri)
Das fünfte Buch Mose (Deuteronomium)
Das Buch Josua
Das Buch der Richter
Das Buch Rut
Das erste Buch Samuel
Das zweite Buch Samuel
Das erste Buch der Könige
Das zweite Buch der Könige
Das erste Buch der Chronik
Das zweite Buch der Chronik
Das Buch Esra
Das Buch Nehemia
Das Buch Ester
LEHRBÜCHER UND PSALMEN
Das Buch Hiob (Ijob)
Der Psalter
Die Sprüche Salomos (Proverbia)
Der Prediger Salomo (Kohelet)
Das Hohelied Salomos
PROPHETENBÜCHER
Der Prophet Jesaja
Der Prophet Jeremia
Die Klagelieder Jeremias
Der Prophet Hesekiel (Ezechiel)
Das Buch Daniel
Der Prophet Hosea
Der Prophet Joel
Der Prophet Amos
Der Prophet Obadja
Der Prophet Jona
Der Prophet Micha
Der Prophet Nahum
Der Prophet Habakuk
Der Prophet Zefanja
Der Prophet Haggai
Der Prophet Sacharja
Der Prophet Maleachi
APOKRYPHEN
Das Buch Judit
Die Weisheit Salomos
Das Buch Tobias (Tobit)
Das Buch Jesus Sirach
Das Buch Baruch
Das erste Buch der Makkabäer
Das zweite Buch der Makkabäer
Stücke zum Buch Ester
Stücke zum Buch Daniel
Das Gebet Manasses
DAS NEUE TESTAMENT
GESCHICHTSBÜCHER
Das Evangelium nach Matthäus
Das Evangelium nach Markus
Das Evangelium nach Lukas
Das Evangelium nach Johannes
Die Apostelgeschichte des Lukas
BRIEFE
Der Brief des Paulus an die Römer
Der erste Brief des Paulus an die Korinther
Der zweite Brief des Paulus an die Korinther
Der Brief des Paulus an die Galater
Der Brief des Paulus an die Epheser
Der Brief des Paulus an die Philipper
Der Brief des Paulus an die Kolosser
Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher
Der zweite Brief des Paulus an die Thessalonicher
Der erste Brief des Paulus an Timotheus
Der zweite Brief des Paulus an Timotheus
Der Brief des Paulus an Titus
Der Brief des Paulus an Philemon
Der erste Brief des Petrus
Der zweite Brief des Petrus
Der erste Brief des Johannes
Der zweite Brief des Johannes
Der dritte Brief des Johannes
Der Brief an die Hebräer
Der Brief des Jakobus
Der Brief des Judas
Die Offenbarung des Johannes
Anhang
Zeittafel zur biblischen Geschichte
Maße, Gewichte und Geldwerte
Sach- und Worterklärungen
Zur Textüberlieferung der Bibel
Archäologie und Bibelwissenschaft
Wo finde ich was?
Stichwortverzeichnis
Zur Schreibung der Eigennamen
Kartenskizzen
Baugeschichte Jerusalems
Tempelskizzen
Farbige Landkarten
Ortsregister zu den farbigen Landkarten
Impressum
Die Stuttgarter Erklärungsbibel
Der Bibeltext
Der in der Stuttgarter Erklärungsbibel abgedruckte Bibeltext ist die zum Reformationsjubiläum 2017 überarbeitete (revidierte) Fassung der Bibelübersetzung Martin Luthers. Nach den großen kirchenamtlichen Revisionen des letzten Jahrhunderts (1912 und 1984) wurde der Text der Lutherbibel in den Jahren 2010 bis 2015 einer erneuten Überprüfung unterzogen. Dies geschah durch einen Kreis von Fachleuten, die die Evangelische Kirche in Deutschland berief, und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibelgesellschaft. Im Unterschied zur letzten Revision, die für die verschiedenen Bibelteile in mehreren Schritten erfolgte (Altes Testament 1964, Apokryphen 1970, Neues Testament 1984), wurden bei der aktuellen Revision alle Kanonteile gemeinsam bearbeitet.
Grundanliegen der Revision 2017 war es, die Übersetzung Martin Luthers anhand der hebräischen und griechischen Ausgangstexte auf exegetische und sachliche Richtigkeit zu überprüfen. Auf sprachliche Modernisierungen wurde weitestgehend verzichtet. Nur dort, wo Worte oder Ausdrücke nicht mehr oder falsch verstanden werden können, kam es zu einer sprachlichen Anpassung. So wurde zum Beispiel der Begriff »Wehmutter« durch das heute gebräuchliche Synonym »Hebamme« ersetzt (1. Mose 35,17). An etlichen anderen Stellen kehrte man aber auch zum Wortlaut der Übersetzung Martin Luthers zurück. In Röm 10,10 heißt es jetzt wieder wie bei Luther selbst: »Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird selig.« Die vorhergehende Revision hatte – sachlich durchaus richtig – hier den Begriff »gerettet« eingesetzt, damit aber einen zentralen theologischen Begriff preisgegeben, der einen festen Bestandteil der evangelisch-lutherischen Tradition darstellt.
Besonders umfangreich sind die Veränderungen, die die Apokryphen im Rahmen der Revision erfahren haben. Die lateinischen und griechischen Texte, die Luther und seine Mitarbeiter ihrer Übersetzung zugrunde legten, sind zum Teil kaum zu identifizieren und entsprechen aus heutiger Sicht nicht mehr den wissenschaftlichen Anforderungen. So verlor die Lutherbibel im akademischen Bereich, aber auch im Vergleich mit anderen deutschen Übersetzungen immer mehr an Bedeutung. Für die Revision 2017 wurde nun durchgängig der älteste griechische Text, die Septuaginta, als Textgrundlage für die Apokryphen verwendet.
Weiterführende Informationen zur Revision 2017 finden sich in dem Band »Die Revision der Lutherbibel 2017. Hintergründe – Kontroversen – Entscheidungen«, Stuttgart 2019.
Die Erklärungen
Die Stuttgarter Erklärungsbibel steht in der Tradition der Jubiläumsbibel von 1912. Diese Ausgabe »mit erklärenden Anmerkungen« direkt beim Bibeltext erschien zum 100-jährigen Jubiläum der Württembergischen Bibelanstalt. Im Vorwort wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Schrift »ohne uns durch sich selbst vermögend (ist), zur Seligkeit weise zu machen«. Die Erläuterungen sollen denjenigen helfen, die »weiter und tiefer in die Kenntnis und in das Verständnis des ganzen Schriftinhalts« eindringen wollen. In den folgenden Jahrzehnten fand diese Ausgabe weite Verbreitung und wurde vielfach nachgedruckt.
Nach Abschluss der Revision der Lutherbibel im Jahr 1984 begann eine vollständige Überarbeitung des Erklärungsteils der Jubiläumsbibel. Die Erklärungen, die Einführungen in die biblischen Bücher sowie die weiterführenden Informationen im Anhang orientierten sich stärker am Stand der Bibelwissenschaft, als dies bisher der Fall gewesen war. Das Ziel einer kompakten Ausgabe wurde jedoch beibehalten. So erschien im Jahr 1992 die 1. Auflage der Stuttgarter Erklärungsbibel mit Altem und Neuem Testament erneut als einbändiges Werk. Auch diese Ausgabe hat sich rasch etabliert. Daraufhin entstand der Wunsch, auch die Apokryphen, die bei der Jubiläumsbibel in einem Sonderband erhältlich waren, in die Stuttgarter Erklärungsbibel aufzunehmen. Im Jahr 2005 konnte eine erweiterte Neuausgabe einschließlich Apokryphen veröffentlicht werden. Damit lag zum ersten Mal ein Kommentar zur gesamten Lutherbibel in einem Band vor. Um einem veränderten Nutzungsverhalten Rechnung zu tragen, erscheint die Stuttgarter Erklärungsbibel seit 2005 zudem auf CD-Rom und in weiteren digitalen Ausgaben.
Mit der Revision der Lutherbibel 2017 wurde auch eine Überarbeitung der Stuttgarter Erklärungsbibel notwendig. Es wurde v. a. geprüft, inwieweit die bisherigen Erläuterungen und weiteren Lese- und Verstehenshilfen für den revidierten Text der Lutherbibel dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechen. Je nach Bedarf wurden die Texte unterschiedlich stark überarbeitet und an vielen Stellen durch neue Erklärungen ersetzt. Dies gilt vor allem für die historischen und theologischen Einführungen zu den einzelnen Schriften sowie zu den Teilsammlungen des Kanons. Aus den oben genannten Gründen sind hier zudem die Texte zu den Apokryphen zu nennen. Neu hinzugekommen ist eine Einführung zur Entstehung der Bibel, zu ihren Übersetzungen und zum Schriftverständnis. Auch die Anhänge wurden gegenüber der Ausgabe von 2005 grundlegend überarbeitet. Dabei wurde der Textbestand der Lutherbibel 2017 vor allem im Bereich der Sach- und Worterklärungen und im Abschnitt Karten und Kartenskizzen deutlich erweitert. Die kompakte Ausgabe des Werkes in einem Band wird weiterhin beibehalten, da viele weitere Inhalte auf den Webseiten der Deutschen Bibelgesellschaft allen Interessierten zur Verfügung stehen:
www.bibelwissenschaft.dewww.die-bibel.de
Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter
Ausgabe 1992/2005
Altes Testament: Dr. Helmut Flender, Dr. Hellmut Haug, Prof. Dr. Dr. Siegfried Herrmann, Rudolf Kassühlke DD.Apokryphen: Prof. Dr. Beate Ego, Prof. Dr. Jutta Hausmann, Prof. Dr. Reinhard G. Kratz, Dr. Joachim Lange, Prof. Dr. Hermann Lichtenberger, Prof. Dr. Manfred Oeming, Prof. Dr. Klaus-Dietrich Schunck, PD Dr. Anna Maria Schwemer, Prof. Dr. Odil Hannes Steck, Prof. Dr. Oda Wischmeyer, Prof. Dr. Erich Zenger.Neues Testament: Dr. Ako Haarbeck, Prof. Dr. Gisela Kittel, Dr. Walter Klaiber, Prof. Dr. Hans Joachim Kraus, Dr. Joachim Lange, D. Dr. Eduard Lohse, Dr. Dietrich Mann, Prof. D. Dr. Eduard Schweizer, Prof. Dr. Hans Weder.Gesamtredaktion: Dr. Hellmut Haug, Dr. Joachim Lange, Dr. Rolf Schäfer, Dr. Florian Voss.Ausgabe 2023
Altes Testament:Prof. Dr. Klaus-Peter Adam (Einführung Geschichtsbücher [Josua bis Ester], Einführungen Josua bis Ester)Dr. Veronika Bachmann (Ester)Prof. Dr. Achim Behrens (Einführung Altes Testament, Einführung Propheten, Einführungen Jesaja bis Maleachi)PD Dr. Michael Emmendörffer (Einführung Geschichtsbücher [1. Mose bis 5. Mose], Einführungen 1. Mose bis 5. Mose, Einführung Lehrbücher und Psalmen, Einführung Hiob, Einführungen Sprüche bis Hoheslied)PD Dr. Alexander Fischer (1./2. Samuel, Jesaja)Prof. Dr. Georg Fischer SJ (Jeremia)PD Dr. Stefan Fischer (Hiob, Hoheslied)Dr. Matthias Jendrek (Esra, Nehemia)Prof. Dr. Rainer Kessler (Micha)Prof. Dr. Melanie Köhlmoos (Rut)Prof. Dr. Stefan Kürle (2. Mose)PD Dr. Antje Labahn (1./2. Chronik)Prof. Dr. Thomas Naumann (1. Mose)Prof. Dr. Heinz-Dieter Neef (Josua, Richter)Dr. Sven Petry (5. Mose)Prof. Dr. Michael Pietsch (1./2. Könige)Dr. Gregor Reichenbach (Sprüche)Dr. Christoph Rösel (Hesekiel)Prof. Dr. Aaron Schart (Jona, Nahum)Prof. Dr. Uta Schmidt (Daniel)Claus-Dieter Stoll (Prediger, Klagelieder)Prof. Dr. Torsten Uhlig (4. Mose)Dr. Johannes Wachowski (3. Mose)PD Dr. Thomas Wagner (Joel, Amos, Obadja, Habakuk, Zefanja, Maleachi)Dr. Beat Weber (Einführung Psalmen, Psalmen)Dr. Kay Weißflog (Hosea, Haggai, Sacharja)Apokryphen:Prof. Dr. Christfried Böttrich (Judit)Prof. Dr. Beate Ego (Tobit, Stücke zu Ester)PD Dr. Alexander Fischer (Einführung Stücke zu Ester, Einführung Stücke zu Daniel, Gebet Manasses)Dr. Gerhard Karner (Sirach)Dr. Martina Kepper (Einführung Apokryphen, Einführung Judit bis 2. Makkabäer, Einführung Gebet Manasses, Weisheit, Baruch)Prof. Dr. Stefan Krauter (1./2. Makkabäer)Prof. Dr. Martin Rösel (Stücke zu Daniel)Neues Testament:Prof. Dr. Carsten Claußen (Johannes; 1. Johannes bis 3. Johannes)Julian Elschenbroich (2. Korinther)Prof. Dr. Michael Gese (Kolosser, Philemon)Dr. Eckhard Hagedorn (Hebräer)Prof. Dr. Ulrich Heckel (Einführung Neues Testament, Einführung Geschichtsbücher, Einführung Briefe, Einführungen Matthäus bis Offenbarung)Ulrich Mack (Markus, Apostelgeschichte, Philipper)PD Dr. Rainer Metzner (Matthäus, 1. Korinther, Jakobus, 1./2. Petrus, Judas)Prof. Dr. Bernhard Mutschler (1./2. Timotheus, Titus)Dr. Fritz Röcker (Lukas, Epheser, 1./2. Thessalonicher, Offenbarung)Prof. Dr. Axel Wiemer (Römer, Galater)BegleitmaterialProf. Dr. Klaus Bieberstein (Erläuterungen und Karten zur Baugeschichte Jerusalems)PD Dr. Alexander Fischer (Anhänge »Zur Textüberlieferung der Bibel« und »Archäologie und Bibelwissenschaft«)Prof. Dr. Ulrich Heckel (Einführung Bibel)Eine inhaltliche Gesamtdurchsicht erfolgte durch die Herausgeber Prof. Dr. Beate Ego (Apokryphen), Prof. Dr. Ulrich Heckel (Neues Testament) und Dr. Christoph Rösel (Altes Testament). Die Projektkoordination lag bei Annette Graeber und Andrea Häuser.
Hinweise zum Gebrauch
Der Bibeltext
Der Bibeltext stellt die zum Reformationsjubiläum 2017 überarbeitete Fassung der Bibelübersetzung Martin Luthers dar.
Schriftarten und Hervorhebungen
Bibeltext In dieser Bibelausgabe werden zwei verschiedene Schriftarten verwendet. Die Serifenschrift (vgl. die Schriftprobe links) wird für den eigentlichen Bibeltext gebraucht.redaktionelle Hinzufügungen In der serifenlosen Schrift (vgl. die Schriftprobe links) sind die redaktionellen Beigaben wie z. B. Überschriften, Verweisstellen, Anmerkungen und Kommentare zum Bibeltext gesetzt; weitere Informationen s. u. »Zusätze und Erklärungen zum Bibeltext«.KernstellenAuf Luther selbst geht der Brauch zurück, wichtige Bibelworte (sog. Kernstellen) hervorzuheben. Im Nachwort zu der letzten von Luther selbst herausgebrachten Bibelausgabe von 1545 heißt es dazu, »dass erstlich von Anfang der Bibel bis ans Ende die vornehmsten Sprüche, darin Christus verheißen ist und [die] im Neuen Testament [her]angezogen werden, mit großer Schrift gedruckt sind, dass sie der Leser leicht und bald finden könne.« Auch wenn sich der Bestand der Kernstellen im Lauf der Jahrhunderte verändert hat, gehören sie doch bis heute als unverzichtbarer Bestandteil zum Text. Bei der Revision wurden die Kernstellen noch einmal kritisch überprüft. In dieser Ausgabe der Lutherbibel sind sie durch halbfette Schrift hervorgehoben.betonte EinzelwörterBesonders betonte Einzelwörter sind als Lesehilfe kursiv gesetzt. Das betrifft v. a. das Zahlwort »ein« (im Gegensatz zum unbestimmten Artikel »ein«; vgl. Lk 15,7: »So wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut«).HERRDas Wort »Herr« hat immer dann die Form HERR, wenn im hebräischen Grundtext der Gottesname, geschrieben »Jhwh«, gebraucht wird (→ HERR).Sonderzeichen und Ergänzungen im Bibeltext
[ ... ]Manche Texte, die erst sehr spät in der handschriftlichen Überlieferung nachweisbar sind, zugleich aber so bekannt sind, dass sie im Haupttext stehen, sind mit eckigen Klammern gekennzeichnet (vgl. Mt 6,13; s. »Zur Textüberlieferung der Bibel«).wie geschrieben steht (Habakuk 2,4):Im Neuen Testament werden alttestamentliche Schriften zum Teil wörtlich zitiert. Die Stellenangaben, die im griechischen Text nicht vorhanden sind, sondern zum besseren Verständnis ergänzt wurden, lassen sich durch die andere Schriftart leicht als solche erkennen.90906,9 (9-13) Lk 11,2-4Hochgestellte, umrahmte kleine Ziffern im Bibeltext verweisen auf den Verweisstellenapparat; weitere Informationen s. u. »Zusätze und Erklärungen zum Bibeltext«.Besonderheiten in den Psalmen und poetischen Texten
Die Psalmen und andere poetische Texte sind im Hebräischen nach dem Grundprinzip des Parallelismus in sinnparallele Halbverse gegliedert. Der jeweils zweite Halbvers ist in dieser Ausgabe durch Einrückung gekennzeichnet.
Poetische Texte und Gebete, die nicht nach dem Grundprinzip des Parallelismus gegliedert sind, aber dennoch in ihrem besonderen Charakter erkennbar sein sollen (vgl. Mt 6,9-13; Phil 2,5-11), sind in Sinnzeilen gesetzt.
Über das bereits Beschriebene hinaus werden in den Psalmen folgende besondere Schriften und Symbole verwendet:
KAPITÄLCHENDen Psalmen ist im Hebräischen meist eine kurze Einleitung vorangestellt (vgl. Ps 3,1). Diese Psalmeneinleitungen sind in dieser Ausgabe durch Kapitälchen markiert. Außerdem wird das Hebräische → »Sela« (vgl. Ps 3,3) durch Kapitälchen gekennzeichnet.kursivKehrverse, also Verse oder Versteile, die sich innerhalb eines Psalms wiederholen, sind in kursiver Schrift gesetzt.Besonderheiten in den Apokryphen
13 [16] Für die Apokryphen wurde bei der Revision 2017 konsequent die griechische Septuaginta als Textgrundlage verwendet. Im Vergleich zu den früheren Lutherbibeln hat sich dadurch an einigen Stellen auch die Verszählung geändert. Damit die Vergleichbarkeit mit älteren Ausgaben der Lutherbibel gewährleistet ist, werden die ursprünglichen Versangaben an den meisten Stellen in eckigen Klammern mitgeteilt. In den Büchern Judit und Tobias sind die Unterschiede zur bisherigen Textfassung so groß, dass es nicht möglich ist, die ursprünglichen Versziffern im Einzelnen anzugeben.[ ... ] Das Buch Jesus Sirach ist in der handschriftlichen Überlieferung in unterschiedlichen Textfassungen erhalten. Die später zugewachsenen Texte (»Langtexte«), die nur in einem Teil der Handschriften enthalten sind, werden in dieser Ausgabe durch eckige Klammern gekennzeichnet; vgl. Sir 1,5; s. Einf. Sirach.Überschrift An einigen wenigen Stellen im Buch Jesus Sirach sind die Abschnittsüberschriften bereits in den griechischen Handschriften enthalten (vgl. Sir 30,1). Um dies kenntlich zu machen, werden sie in der Schriftart des Bibeltextes (s. o.) gesetzt; zu den sonstigen Überschriften s. u. »Zusätze und Erklärungen zum Bibeltext«.A B C Das griechische Esterbuch weist im Vergleich zum hebräischen Esterbuch einige Ergänzungen auf. Diese sind in der Lutherbibel als »Stücke zu Ester« in den Apokryphen enthalten. Die Kapitel innerhalb dieses Buches werden in dieser Ausgabe – entsprechend dem wissenschaftlichen Gebrauch – nicht mit Ziffern angegeben, sondern mit Buchstaben, weil sie keinen durchgehenden Text darstellen; s. Einf. Stücke zu Ester.Zusätze und Erklärungen zum Bibeltext
Einführungen in die Teile der Bibel und in die biblischen Bücher
Am Beginn eines jeden biblischen Buches steht eine allgemeine Einführung, die jeweils über die historischen Zusammenhänge und Hintergründe des Buches, über wichtige Themen und theologische Akzentsetzungen, den Buchaufbau, die Entstehung und die Verfasserschaft informiert. Weitere Einführungen zu übergreifenden Fragestellungen finden sich am Beginn der verschiedenen Buchgruppen (z. B. am Beginn des Alten Testaments oder der Geschichtsbücher).
Überschriften und Übersichten
Der Bibeltext ist ergänzt durch eine Reihe von zusätzlichen Lese- und Verstehenshilfen. Dazu gehören zunächst die Überschriften und Übersichten:
AbschnittsüberschriftenDen einzelnen Abschnitten des Textes (Perikopen) sind Überschriften vorangestellt, die über den Inhalt des jeweiligen Abschnitts informieren.Buchteilüberschriften Gelegentlich lassen sich mehrere kleinere Abschnitte unter eine größere Buchteilüberschrift zusammenfassen (vgl. Mt 26–28).Kapitel 20,22–23,19 Die Angaben unter den Buchteilüberschriften nennen den Bereich, den diese umfassen.Inhaltsübersichten Eine rasche Orientierung über den Inhalt der biblischen Bücher bieten die Inhaltsübersichten, die auf die Einführungen zum Buch folgen.Sinnverwandte Abschnitte und biblische Verweisstellen
(Parallelstellen) Direkt unter den Abschnittsüberschriften finden sich v. a. in den Evangelien, aber auch in anderen Büchern Angaben zu Parallelstellen. Das sind Texte, die an anderer Stelle ähnlich oder gleichlautend überliefert sind.90906,9 (9-13) Lk 11,2-4Um die vielfältigen Textbezüge innerhalb der Bibel zu erschließen, finden sich zusätzlich zu den im Kommentar genannten Bibelstellen über 20 000 Verweisstellen in der jeweils rechten Spalte am Fuß jeder Seite. Hochgestellte, umrahmte kleine Ziffern im Bibeltext stellen die Verbindung zu den Stellenangaben her. Wenn sich die angeführte Verweisstelle auf ein Einzelwort oder eine Wortgruppe bezieht, steht der Verweisbuchstabe unmittelbar davor; bezieht sie sich auf einen ganzen Vers, so steht er an dessen Ende; wenn sie mehrere Verse umfasst, folgt er auf die erste Versziffer.Besonderheiten im Kommentar und in den Einführungen
SchlüsselbegriffIn den Einführungen sind Schlüsselbegriffe zur leichteren Orientierung fett gesetzt.→ Name (Gottes)Vor einem Wort kennzeichnet der Pfeil wiederkehrende Begriffe und Sachverhalte (wie Bund, Kanaan, Wunder), die in den Sach- und Worterklärungen im Anhang erläutert werden.→ 2. Mose 3,13-15Vor einer Bibelstelle zeigt der Pfeil an, dass es im Kommentar zu dieser Stelle weiterführende Informationen gibt. Die Bibelstellenangaben in den Kommentaren ergänzen dabei den Verweisstellenapparat, s. o. »Sinnverwandte Abschnitte und biblische Verweisstellen«.Ich werde sein, der ich sein werde.Worte und Passagen aus dem direkt vorangehenden biblischen Text werden im Kommentar halbfett und kursiv dargestellt. Alternative Übersetzungen oder Zitate anderer biblischer Texte stehen dagegen in »Anführungszeichen«.tohu wavohuTransliterationen fremdsprachiger Worte sind kursiv gesetzt; zu tohu wavohu→ 1. Mose 1,2.Abkürzungen
Ein Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen findet sich im Anschluss an das alphabetische Inhaltsverzeichnis im Vorspann.
Anhänge
Zeittafel zur biblischen Geschichte
Eine Zeittafel zur biblischen Geschichte bietet einen Überblick über die Zusammenhänge und Entwicklungen in der biblischen Geschichte ab der Königszeit, indem sie der biblischen Geschichte wichtige Ereignisse aus den umliegenden Reichen an die Seite stellt. So hilft sie, die bibl. Geschichte in ihrem historischen Kontext zu begreifen und damit die Botschaft der biblischen Texte besser zu verstehen.
Maße, Gewichte und Geldwerte
Die Übersicht zu Maßen, Gewichten und Geldwerten in der Bibel informiert über die Umrechnung der Mengen- bzw. Größenangaben, die in den biblischen Texten verwendet werden, in heute gebräuchliche Einheiten, und bietet knappe Informationen zum Umgang mit Messgeräten und Zahlungsmitteln in biblischer Zeit.
Sach- und Worterklärungen
Die Sach- und Worterklärungen bieten ergänzend zu den Kommentaren zum biblischen Text weiterführende Informationen zum geschichtlichen Hintergrund, zu Personen- oder Personengruppen, religiösen Vorstellungen, gottesdienstlichen und kulturellen Einrichtungen etc. In den Kommentaren wird mit einem Pfeil (→) vor einem Wort auf sie verwiesen. Die Sach- und Worterklärungen der Stuttgarter Erklärungsbibel sind umfangreicher als in anderen Ausgaben der Lutherbibel 2017. Sie können auch als kleines Lexikon zur Bibel eigenständig verwendet werden.
Zur Textüberlieferung der Bibel
Die Überlieferung der biblischen Texte war ein langer und komplexer Prozess. Das zeigt sich u. a. daran, dass es für manche Verse verschiedene Fassungen und damit auch verschiedene Möglichkeiten für die Übersetzung gibt (z. B. 5. Mose 27,4). Hier findet sich ein knapper Überblick über diesen Prozess.
Archäologie und Bibelwissenschaft
Die biblische Archäologie beschäftigt sich mit den materiellen Hinterlassenschaften in den für die Bibel relevanten Regionen. Sie hilft, die historischen Zusammenhänge und kulturellen Hintergründe der biblischen Texte besser zu verstehen. Hier gibt es einen knappen Überblick über Geschichte, Ziele und Methoden dieser Disziplin.
Wo finde ich was?
Unter der Überschrift »Wo finde ich was?« sind zentrale biblische Texte zu wichtigen christlichen Festen, Personen, Ereignissen und Themen zusammengestellt.
Stichwortverzeichnis
Das Stichwortverzeichnis führt eine Auswahl der wichtigsten Texte zu über 400 Namen, Orten und zentralen Themen der Bibel in alphabetischer Reihenfolge auf. Es kann als kleine Konkordanz zur Lutherbibel verwendet werden.
Zur Schreibung der Eigennamen
Die Schreibung der Personen- und Ortsnamen folgt in der Lutherbibel seit 1984 weitgehend den »Loccumer Richtlinien zur einheitlichen Schreibung biblischer Eigennamen«, die im Interesse einer ökumenischen Vereinheitlichung der Namensformen von einer evangelisch-katholischen Kommission erarbeitet worden sind. Lediglich bei Namen, die in der evangelischen Tradition einen besonderen Stellenwert haben, wurde von dieser ökumenischen Regelung abgewichen und die lange vertraute Lutherschreibweise beibehalten. Über die Ausnahmen, die für die Lutherbibel gelten, informiert die Liste »Zur Schreibung der Eigennamen«.
Die Schreibung nicht-biblischer Eigennamen, die sich in den Kommentaren finden, orientiert sich an den vereinfachten Transliterationsregeln des Online-Lexikons www.wibilex.de.
Landkarten und Kartenskizzen
Der Kartenteil gliedert sich in siebzehn schwarz-weiße Karten und Kartenskizzen und vier farbige Landkarten. Die farbigen Landkarten werden durch ein Ortsregister erschlossen. Dort werden auch die bei Kartenverweisen innerhalb der Erklärungen verwendeten Abkürzungen aufgeschlüsselt.
Besonders hervorzuheben ist der Essay zur Baugeschichte Jerusalems, der die Karten zur Stadtentwicklung begleitet, da er die wechselhafte Geschichte der Region am Beispiel Jerusalems plastisch nachvollziehbar macht.
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis und weitere Abkürzungen
In Verweisen und Bibelstellenangaben bezeichnen die Ziffern hinter der Abkürzung für das Buch die jeweiligen Kapitel. Durch Komma abgetrennt folgen die Versangaben. Mehrere Verse werden durch einen Bindestrich oder einen Punkt getrennt, mehrere Kapitel durch einen etwas längeren Strich oder ein Semikolon. So bedeutet die Angabe Jes 6,1-4.12; 18–20 beispielsweise: Im Buch Jesaja, Kapitel 6, Verse 1 bis 4 und Vers 12, und Kapitel 18 bis 20.
Die bei Kartenverweisen innerhalb der Erklärungen verwendeten Abkürzungen werden im Zusammenhang mit dem Ortsregister zu den farbigen Landkarten aufgeschlüsselt. In der Stuttgarter Erklärungsbibel werden darüber hinaus folgende Abkürzungen verwendet:
ägypt. – ägyptisch
ähnl. – ähnlich
allg. – allgemein
arab. – arabisch
AT – Altes Testament
arab. – arabisch
assyr. – assyrisch
babyl. – babylonisch
bes. – besonders, besondere
bibl. – biblisch
bzw. – beziehungsweise
ca. – circa
christl. – christlich
d. h. – das heißt
dt. – deutsch
eigtl. – eigentlich
Einf. – Einführung
entspr. – entsprechend
etc. – et cetera
ev. – evangelisch
evtl. – eventuell
geistl. – geistlich
gem. – gemeinsam
gen. – genannt
geschichtl. – geschichtlich
ggf. – gegebenenfalls
ggü. – gegenüber
göttl. – göttlich
griech. – griechisch
Handschr. – Handschrift
hebr. – hebräisch
heidn. – heidnisch
hell. – hellenistisch
himml. – himmlisch
hist. – historisch
inkl. – inklusive
insb. – insbesondere
insg. – insgesamt
inzw. – inzwischen
ird. – irdisch
israelit. – israelitisch
Jh. – Jahrhundert
jüd. – jüdisch
kanaanit. – kanaanitisch
Kap – Kapitel
kath. – katholisch
kirchl. – kirchlich
lat. – lateinisch
menschl. – menschlich
milit. – militärisch
mögl. – möglich
nördl. – nördlich
NT – Neues Testament
o. ä. – oder ähnlich
o. Ä. – oder Ähnliches
östl. – östlich
pol. – politisch
proph. – prophetisch
rel. – religiös
röm. – römisch
s. – siehe
s. o. – siehe oben
s. u. – siehe unten
schließl. – schließlich
sog. – sogenannt
südl. – südlich
syr. – syrisch
teilw. – teilweise
theol. – theologisch
u. a. – unter anderem
u. ö. – und öfter
u. U. – unter Umständen
Übers. – Übersetzung
urspr. – ursprünglich
usw. – und so weiter
V. – Vers
v. a. – vor allem
Verf. – Verfasser
versch. – verschieden
vgl. – vergleiche
vmtl. – vermutlich
wahrsch. – wahrscheinlich
westl. – westlich
wörtl. – wörtlich
z. B. – zum Beispiel
z. T. – zum Teil
zw. – zwischen
Die Bibel
Die Bibel ist die Heilige Schrift der Christen. Sie besteht aus zwei Teilen, dem Alten und dem Neuen Testament.
Was Christen das Alte Testament (AT) nennen, ist zugleich die Heilige Schrift der Juden, die aus zahlreichen Einzelschriften besteht. Sie erzählt die Geschichte Gottes mit der Welt und bes. mit seinem erwählten Volk Israel. Für den Juden Jesus war die Schrift die maßgebliche Autorität. Er kannte sie als Schriftlesung aus dem jüd. Gottesdienst, legte sie als Lehrer mit Vollmacht aus und argumentierte mit ihr.
Das Neue Testament (NT) entfaltet das Evangelium von Jesus Christus. Dieser wird nicht nur als Sohn Gottes vorgestellt (Mk 1,1; Röm 1,3-4), sondern auch als Messias Israels, Sohn Davids und Nachkomme Abrahams (Mt 1,1; Röm 1,3). Wie Jesus und die Juden so verwendeten auch die ersten Christen die heiligen Schriften Israels weiterhin als Schriftlesung in ihren gottesdienstlichen Versammlungen. V. a. aber verkündigten sie das Evangelium von Jesus Christus, dem Heil Gottes für die Welt. Dazu sammelten sie einerseits die Berichte vom Wirken Jesu, die in den Evangelien zusammengestellt wurden, andererseits die Briefe der Apostel, die das Evangelium von seinem Tod und seiner Auferstehung in seiner Bedeutung für die Gemeinden weiter ausführen. Am Ende gibt die Johannesoffenbarung einen Ausblick auf die Vollendung der Welt.
Das frühe Christentum hat in seinen Gottesdiensten an den herkömmlichen heiligen Schriften Israels festgehalten, zugleich aber auch aus den Evangelien und den Briefen vorgelesen. So ist der zweiteilige Kanon der christl. Bibel aus AT und NT entstanden, der die sinnstiftenden Grunderzählungen der Kirche enthält. Dieser hier grob skizzierte Prozess soll nun anhand der bibl. Quellen genauer dargestellt werden.
Die Bezeichnungen
Das dt. Wort »Bibel« ist von lat. biblia abgeleitet, das seinerseits ein Lehnwort von griech. ta biblia ist (»die Bücher«; Joh 21,25). Das Wort bezeichnete urspr. den Bast der Papyrusstaude aus dem Nildelta in Ägypten, dann das daraus hergestellte Schreibmaterial und schließl. das Schriftstück, den Brief (z. B. den Scheidebrief Mk 10,4) und das Buch. Im NT wurden dem jüd. Sprachgebrauch folgend für einzelne bibl. Bücher die Worte biblos (Mt 1,1; Mk 12,26) oder die Verkleinerungsform biblion gebraucht (Gal 3,10; Lk 4,17; Joh 20,30). Seit dem 2. Jh. v. Chr. wurde der Ausdruck für Bücher des späteren AT verwendet (Dan 9,2; 1. Makk 12,9), seit dem Kirchenvater Johannes Chrysostomus (4. Jh. n. Chr.) auch für die zweiteilige christl. Bibel aus AT und NT. So umfasst die Bibel eine ganze Bibliothek von Büchern, die jeweils für sich entstanden sind, dann gesammelt wurden und später in den bibl. Kanon gelangten. Das Wort »Bibel« ist daher zunächst einmal eine literarische Bezeichnung für das Buch der Bücher.
Wird die Bibel »Heilige Schrift« genannt, so handelt es sich um einen theol. Begriff, der auf ihren Gebrauch als maßgebliche Autorität in der Kirche hinweist. Dieser Ausdruck findet sich im NT nur zweimal (Röm 1,2; 2. Tim 3,15) und bezieht sich hier – wie im jüd. Sprachgebrauch (1. Makk 12,9; Philo; Josephus) – auf die Schriften des AT. Ab Mitte des 2. Jh. wird er auch für neutestamentliche Schriften verwendet. Das Adjektiv »heilig« bringt zum Ausdruck, dass in diesen Schriften Gott selbst zu Wort kommt. Gott tut dies durch Menschen, nämlich die Propheten (2. Sam 7; 12; Lk 1,70; Apg 3,18.21; Röm 1,2; Hebr 1,1). Deren Reden ist vermittelt durch den Heiligen Geist (4. Mose 11,29; Jes 42,1; 61,1; Sach 7,12), der in der Schrift spricht (Hebr 3,7; 10,15) durch David (Apg 1,16; 4,25; → Mk 12,36) und durch die Propheten (Apg 28,25; 2. Petr 1,21). Nichts anderes ist gemeint, wenn diese Schriften von Gott eingegeben sind (2. Tim 3,16). Sie haben eine bes. Autorität, weil darin Gottes Wille zur Sprache kommt. Deshalb werden sie nach dem babyl. Exil seit Esra (um 400 v. Chr.) als Schriftlesung im Gottesdienst verwendet (→ Neh 8,1-8; Lk 4,16-21; → Apg 13,15; 2. Kor 3,14-15). Jüd. Ausdrucksweise übernehmend wird im NT auf die »Schrift(en)« insg. (Mk 12,24; Lk 24,27.32.45; Joh 5,39; Röm 15,4; 1. Kor 15,3.4 u. ö.), auf Schriftteile (Mt 26,56) oder auf einzelne Schriftstellen verwiesen (Mk 12,10; Lk 4,21; Joh 19,37), das Ganze zusammenfassend aber auch einfach »die Schrift« genannt (Joh 2,22; Röm 4,3; Gal 3,8.22; 1. Tim 5,18 u. ö.).
Die Bezeichnungen »Altes« und »Neues Testament« für die beiden Teile der Bibel sind christl. Wortprägungen aus der Zeit der Alten Kirche, die auf die lat. Übers. für den »alten« und den »neuen Bund« in 2. Kor 3,6.14 zurückgehen. Dort sind jedoch weder der »alte Bund« (Bundesschluss vom Sinai) noch das heutige »Alte Testament« gemeint, sondern die fünf Bücher Mose (1. bis 5. Mose), die im jüd. Synagogengottesdienst als Schriftlesung verwendet werden. Auch mit dem »neuen Bund« ist nicht die Schriftensammlung des NT gemeint, die es bei der Abfassung des 2. Korintherbriefs noch gar nicht gab, sondern eine neue, heilvolle Setzung bzw. Verfügung Gottes – so erstmals in Jer 31,31-34 (vgl. Lk 22,20; 1. Kor 11,25; → Hebr 8,6-13; → Hebr 9,15). Erst Bischof Melito von Sardes (um 160/180 n. Chr.) erwähnt »die Bücher des Alten Testaments«. Gegen Ende des 2. Jh. n. Chr. sind »Altes« und »Neues Testament« als neue, zugleich verbindende wie unterscheidende Bezeichnungen für die beiden Teile der christl. Bibel weit verbreitet (Clemens von Alexandrien; Origenes; Tertullian). Dabei klingt die rechtstechnische Bedeutung »Testament« als einer schriftlich niedergelegten letztwilligen Verfügung an, die das griech. Wort für den Bund (diathēkē) schon im bibl. Sprachgebrauch einschloss (Gal 3,15-18; Hebr 9,16-17). Das Adjektiv »neu« soll das AT nicht als veraltet abwerten, sondern nimmt die proph. Ankündigung eines neuen Bundes auf (Jer 31,31-34) und bekräftigt die endgültige, endzeitlich entscheidende Erneuerung der göttl. Heilssetzung im Christuszeugnis des NT.
Das Alte Testament und seine Übersetzungen
Das Alte Testament besteht beim selben Textumfang nach jüd. Zählung aus 24 oder 22 Büchern, nach unserer heutigen Zählung aus 39 Schriften. In der jüd. Zählweise werden die zwölf kleinen Propheten als ein einziges Buch gezählt, außerdem werden jeweils die Samuel-, Könige- und Chronikbücher zusammengefasst und schließl. Esra und Nehemia. So ergeben sich 24 Bücher. Wenn man darüber hinaus Klagelieder zu Jeremia und Rut zu Richter zählt, sind es 22. Diese Schriften gliedern sich in drei Teile: das Gesetz im jüd. Sinne der Tora (Weisung), d. h. die fünf Bücher Mose, die Propheten und die übrigen Schriften (vgl. die Vorrede Sirach V. 1-2.8-10). Bei den Propheten wird unterschieden zw. den vorderen Propheten, d. h. den Geschichtsbüchern, die auch von Propheten berichten (Josua bis 2. Könige), und den hinteren Propheten, mit denen die Schriftpropheten gemeint sind, d. h. die drei großen Propheten (Jesaja; Jeremia; Hesekiel) und die zwölf kleinen Propheten (Hosea bis Maleachi). Alle diese Bücher wurden in hebr. Sprache geschrieben, nur einzelne Stellen sind auf Aramäisch abgefasst (Dan 2,4–7,28; Esra 4,8–6,18; 7,12-26). Der Prozess der Kanonbildung erstreckte sich über mehrere Jahrhunderte. Begonnen haben könnte er etwa ab 700 v. Chr. mit der Abfassung des Deuteronomiums (5. Mose 4,2; 31,9). Abgeschlossen wurde die Kanonisierung der fünf Bücher Mose zur Zeit Esras um 400 v. Chr. (vgl. Neh 8,1), der zweite Kanonteil mit den Propheten etwa um 200 v. Chr. und der dritte Teil mit den übrigen Schriften am Ende des 1. Jh. n. Chr., nach neueren Forschungen frühestens Mitte, eher Ende des 2. Jh. n. Chr. (zur Entstehung der Schriften und Teilsammlungen s. jeweils die Einf.).
Als viele Juden in Ägypten den hebr. Text nicht mehr in der Originalsprache verstanden, wurden die Schriften der Hebräischen Bibel ins Griechische übertragen, die damalige Weltsprache. Diese Übers. heißt Septuaginta (aus dem Lat. für die Übers. »der Siebzig«) nach der legendären Zahl der 72 Übersetzer (6 für jeden der 12 Stämme Israels; überliefert im Aristeasbrief), abgekürzt 70 (in röm. Zahlzeichen: LXX). Sie ist das größte Übersetzungswerk der Antike. Sie erfolgte in Alexandria, der Hauptstadt Ägyptens, einem Zentrum griech. Kultur. Dort lebte eine große jüd. Gemeinde. Die Übers. ist im Wesentlichen zw. dem 3. und 1. Jh. v. Chr. entstanden, zog sich teilw. aber bis ins 1. Jh. n. Chr. hin. Sie begann zunächst mit dem Gesetz (1. bis 5. Mose), erst ab etwa 200 v. Chr. folgten die Propheten und die übrigen Bücher. Sie enthält den Grundbestand der Hebr. Bibel, außerdem weitere urspr. hebr. oder aramäische Schriften, die nicht in die Hebr. Bibel aufgenommen wurden (Tobias; 1. Makkabäer; Gebet Manasses; Sirach), sowie weitere Schriften, die von vornherein auf Griech. abgefasst waren (Judit; 2. bis 4. Makkabäer; Weisheit; Baruch; Stücke zu Ester; Stücke zu Daniel). Die hebr. Vorlagen sind nicht immer identisch mit den heutigen Textausgaben des AT.
Die Septuaginta wurde zur Heiligen Schrift der griechisch sprechenden Christen, sodass das Christentum in der Regel von der Heiligen Schrift des Judentums in ihrer griech. Übers. geprägt ist. Dies zeigen z. B. der griech. Titel »Christus«, der Jesus als Messias, d. h. als den erwarteten Heilsbringer Israels bezeichnet (Joh 1,41; 4,25), die Umschreibung des Gottesnamens »Jahwe« mit dem Titel → HERR (zur Kennzeichnung des Gottesnamens in Kapitälchen gedruckt), die im NT auf Jesus Christus übertragen wird (Röm 10,9; Phil 2,11), die griech. Übers. von Jes 7,14 (»junge Frau«) mit dem Wort »Jungfrau« (vgl. Mt 1,23), die Textfassung von Am 9,11-12 in Apg 15,16-18 (v. a. »suchen« statt »in Besitz nehmen«) sowie die Aussagen über Christus bei der Erschaffung der Welt, die von der jüd. Weisheitstradition geprägt sind (Joh 1,1-3; 1. Kor 8,6; Kol 1,15-18; Hebr 1,2-3; vgl. Weish 7,22–8,1; 9,1-9; Sir 24,3-9). Als die Septuaginta zur Bibel der Christen geworden war, verlor sie im Judentum an Bedeutung und wurde durch andere griech. Übers. verdrängt. Für die orthodoxe Kirche ist das AT bis heute in Gestalt der Septuaginta maßgeblich.
Vulgata (lat. für die »verbreitete« Übers.) heißt die lateinische Übersetzung der gesamten Bibel (entstanden zw. 383 und 405 n. Chr.), die vom Kirchenvater Hieronymus stammt und sich seit dem 7. Jh. in der lat. Kirche allg. durchsetzte. Während ältere Bibelübers., Vetus Latina genannt (die »alte lateinische« Übers.), im AT die Septuaginta zugrunde legten, griff Hieronymus weitgehend auf den hebr. Urtext zurück.
Martin Luther folgte bei seiner Bibelübers. den Grundsätzen des Humanismus, die eine Rückkehr »zu den Quellen«, d. h. zu den Originaltexten, verlangten. Deshalb übersetzte er die bibl. Texte neu aus der urspr. Sprache, das AT aus dem Hebr., das NT aus dem Griech. – statt aus der damals gebräuchlichen lat. Übers. der Vulgata. Aus denselben Gründen nahm Luther in seine Übers. des AT nur die Schriften der Hebr. Bibel auf. Die übrigen Schriften der Septuaginta hat er – gegen die gesamte bisherige christl. Tradition – an das Ende des AT in einen Anhang umgestellt. Diesen versah er mit dem Titel »Apokryphen« (griech. für »verborgene«, d. h. vom öffentlichen Gebrauch ausgeschlossene Schriften) und ergänzte: »Das sind Bücher, so der Heiligen Schrift nicht gleich gehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind.« Der Begriff »Apokryphen« bezeichnet im Protestantismus daher den »Überschuss« des griech. (und lat.) AT ggü. der Hebr. Bibel. Die Apokryphen stehen in der Lutherbibel zw. AT und NT, spiegeln die Lage des Judentums im 2. Jh. v. Chr. und bilden – hist. gesehen – den Übergang von der Hebr. Bibel zum NT. Im ökumenischen Gespräch bezeichnet man diese Bücher als »Spätschriften des Alten Testaments« oder als deuterokanonische Schriften (griech. für »zweiter Kanon«), da sie in der Hebr. Bibel nicht enthalten sind, in der Septuaginta aber zum erweiterten Kanon des AT gehören (s. Einf. Apokryphen).
Andere Bibelübersetzungen haben die Anordnung der einzelnen Schriften in der Septuaginta und der Vulgata beibehalten, die zunächst noch offen war und sich erst langsam verfestigte. Auf den Synoden von Hippo (393 n. Chr.) und Karthago (397 n. Chr.) wurde beschlossen, dass auch diejenigen Schriften der Septuaginta in den Kanon der Kirche aufgenommen werden, die über den hebr. Kanon hinausgehen. Auf dem Konzil von Trient (1546) wurden diese Bücher für die röm.-kath. Kirche bestätigt und die Vulgata zur verbindlichen Bibelausgabe erklärt. Während die Hebr. Bibel mit der Rückkehr aus dem babyl. Exil und dem Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem endet (2. Chr 36,23), stehen in diesen Übers. wie in der Septuaginta die Propheten (Jesaja bis Maleachi) am Ende des alttestamentlichen Kanons. Ihre proph. Weissagungen wurden als Verheißungen angesehen, an die das NT mit dem Christusgeschehen als deren Erfüllung unmittelbar anschließt.
Jesus Christus und das Alte Testament
Für Jesus und seine Jünger war die jüdische Bibel, das heutige AT, – ebenso wie für Juden – ihre Heilige Schrift. Aus ihr wurden am Sabbat im jüd. Synagogengottesdienst Abschnitte aus dem Gesetz und den Propheten als Schriftlesung vorgetragen (→ Apg 13,15; 2. Kor 3,14-15), die fünf Bücher Mose gepredigt (Apg 15,21) und Prophetenabschnitte gedeutet (Lk 4,16-21). Auch für die ersten Christen besteht die Schrift aus dem → Gesetz als Tora (übersetzt: »Weisung«), d. h. den fünf Büchern Mose, den Propheten und den Psalmen (Lk 24,44), die hier stellvertretend für die übrigen Schriften stehen (vgl. die Vorrede Sirach V. 1-2.8-10). Der Umfang des alttestamentlichen Kanons stand in neutestamentlicher Zeit im Wesentlichen fest, war an den Rändern aber noch nicht abgeschlossen. So begegnen im NT zum einen Zitate aus Schriften, die nicht in den bibl. Kanon aufgenommen wurden (vgl. Henoch in Jud 14), zum anderen Schriftzitate, die keiner Schriftstelle sicher zugeordnet werden können (Joh 7,38; 1. Kor 2,9; Jak 4,5). Zitiert wird das AT in der Regel nach der Septuaginta, wobei es noch keine einheitliche, allseits anerkannte Textfassung gab, sondern teilw. sehr unterschiedliche Fassungen einzelner Bücher vorlagen (s. Einf. Jeremia, Einf. Stücke zu Ester und Einf. Stücke zu Daniel).
Jesus zieht die Schrift als unbestritten anerkannte Autorität heran, um ein theol. Argument einzuführen (Mt 5,17-48; 12,41-42; Mk 2,25-26; 7,6-7; 10,2-9.19; 12,10-11.24-27.29-31.35-37; Lk 14,3-5). Auf die Frage »Was soll ich tun?« (Mk 10,17) erinnert er an das Bekenntnis zu dem einen Gott (5. Mose 6,4; vgl. 1. Kor 8,4.6; Eph 4,5-6; 1. Tim 2,5; Jak 2,19) und die Zehn Gebote (2. Mose 20,12-16; vgl. Mt 5,21.27.28; Mk 7,10; 10,17-19; Röm 7,7; 13,9; Eph 6,2-3; Jak 2,11). Auf die Frage nach dem höchsten Gebot (Mk 12,28-34) zitiert er das Gebot der Gottesliebe aus dem »Höre Israel« (hebr. schema jisrael; vgl. 5. Mose 6,4-5) und das Gebot der Nächstenliebe (3. Mose 19,18) als Zusammenfassung des göttl. Willens (Mk 12,28-34; Gal 5,6 ; → 1. Kor 13,13; → 1. Tim 1,5). Je nach Situation wird die Nächstenliebe (Mk 12,31; Röm 13,9; Gal 5,14; Jak 2,8) zugespitzt auf die Feindesliebe (Mt 5,43-48; vgl. Röm 12,14.20; 1. Petr 3,9) oder die Geschwisterliebe (Röm 12,10; Hebr 13,1; 1. Petr 1,22; Gal 6,10) untereinander (Joh 13,34; Röm 13,8-9; 1. Thess 4,9; Eph 4,2; 1. Joh 3,11). Schon zu Lebzeiten erscheint Jesus als vollmächtiger Ausleger der Schrift mit einem eigenen autoritativen Anspruch: »Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: … Ich aber sage euch: …« (Mt 5,21-48; 7,29).
Für die ersten Christen galt das heutige AT als »Heilige Schrift« (Röm 1,2; 2. Tim 3,15), die ihnen – wie gesagt – aus dem jüd. Synagogengottesdienst vertraut war. Was Jesus aus dem AT als Gottes Wille bekräftigt hat, bleibt quer durch das NT maßgeblich (s. o.). Da die meisten neutestamentlichen Autoren jüd. Herkunft oder zumindest judenchristl. beeinflusst sind, verwenden sie die Schrift mit großer Selbstverständlichkeit (Matthäus; Markus; Lukas; Johannes), argumentieren mit ihr als Autorität (Römer; Galater; 1. und 2. Korinther; Hebräer; 1. und 2. Petrus; Jakobus) und arbeiten mit vielen Anspielungen (Offenbarung; s. jeweils die Einf.). Haben sie die Schrift als Ganzes im Sinn, verweisen sie auf »die Schrift(en)«, ohne diese einzugrenzen (s. o.). Als umfassenden Oberbegriff können sie auch einzelne Kanonteile nennen: »das Gesetz« (Mt 5,18; Röm 3,19.31) oder »das Gesetz und die Propheten« (Mt 5,17; 7,12; Lk 16,16; Joh 1,45; Röm 3,21) bzw. »Mose und die Propheten« (Lk 16,29.31; 24,27). Doch erwähnen sie v. a. »die Propheten« (Mt 26,56; Apg 2,29-36; 3,18-24; 13,27-41) und zitieren vielfach aus ihnen (Mt 1,22-23; Mk 1,2-3; Lk 4,17-18; Apg 8,28-32; Röm 15,12 u. ö.), da Gott durch sie in der Heiligen Schrift gesprochen hat (s. o.). Diese Hervorhebung der Propheten hat einen tieferen Grund:
Was die Christen im AT gesucht haben, waren v. a. Hinweise auf Jesus Christus, den Messias, den Heilsbringer Israels, der von den Schriften sagt: »Sie sind’s, die von mir zeugen« (→ Joh 5,39; vgl. Röm 1,2; 1. Kor 15,3.4; 1. Petr 1,10-12). Am pointiertesten formuliert es der Auferstandene in Lk 24,44: »Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen.« Immer wieder wird gesagt, dass in Jesu Auftreten und Wirken sich die Schrift »erfüllt« (Mk 14,49; Lk 4,21; Joh 19,24.28.36; Apg 13,32-33). Programmatisch sind die Erfüllungs- bzw. Reflexionszitate im Matthäusevangelium (u. a. Mt 1,22-23; vgl. Jes 7,14). Selbst Mose erscheint nicht nur als Gesetzgeber (Joh 1,17; Apg 15,5), sondern wird in einem Atemzug mit den Propheten genannt, die das Christusgeschehen angesagt haben (Lk 24,27; Joh 1,45; → Apg 7,37; 26,22-23). So haben die ersten Christen die Schrift ihrer jüd. Herkunft entspr. zwar auch als Gesetz aufgefasst, das nach wie vor geistl., heilig, gerecht und gut ist (Röm 7,12.14), darin aber v. a. nach endzeitlichen und messianischen Ankündigungen geforscht. Am häufigsten angeführt haben sie Worte aus den Psalmen (Ps 2,7; 110,1; vgl. auch Mk 14,34; 15,24.29.34.36) und aus dem Jesajabuch (Jes 7,14; 9,1-6; 11,1-10; 53; 61,1-2). Auch David galt als vom Heiligen Geist inspirierter Psalmensänger, der das Christusgeschehen vorausgesagt hat (Mk 12,36-37; Apg 1,16; 4,25).
Diese Schriftworte haben die ersten Christen als prophetische Weissagung (Mt 11,13; 26,56; 1. Petr 1,10-11) oder Voraussage (Röm 9,29; Apg 3,18; 7,52) auf Christus gedeutet (Röm 1,2; Gal 3,8.16). Paulus verwendet dafür den Begriff der »Verheißung«. Inhaltlich bezieht er sich v. a. auf die Verheißung an Abraham, die er in Christus verwirklicht sieht (Gal 3,8–4,31; vgl. Röm 1,2; 4,13-21; 2. Kor 1,20). Mit Christus sind Gottes Verheißungen aber nicht hinfällig geworden, nicht überholt und erledigt, sondern sie bleiben Ausdruck der Treue Gottes zur Erwählung Israels (Röm 9,4.6-13; 11,5.28; vgl. Eph 2,12). Die Gabe der Verheißungen kann Gott nicht gereuen (Röm 11,29), vielmehr hat Christus die Verheißungen bestätigt, die den Vätern, konkret Abraham (Gal 3,18; Röm 4,13-21), gegeben sind (Röm 15,8). Sie werden nach dem Zeugnis der Schrift zur Vollendung gelangen, wenn Christus bei seiner endzeitlichen Wiederkunft als Erlöser aus Zion kommen (→ Röm 11,26; 1. Thess 1,10; Phil 3,20) und den verheißenen neuen Bund der Vergebung vollenden wird (Jer 31,31-34; 1. Kor 11,24-25; 2. Kor 3,6; Röm 11,27). Deshalb kann Paulus mit einer frühen urchristlichen Bekenntnisüberlieferung allg. ohne Stellenangabe sagen, dass Christus gestorben und auferstanden ist »nach der Schrift« (1. Kor 15,3.4; vgl. Röm 1,2). Die Schriftgemäßheit des Evangeliums von Jesus Christus nachzuweisen, war ein wesentliches Anliegen der neutestamentlichen Autoren bei der Lektüre des AT.
Damit erscheint das Christusgeschehen als Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen. Mit dem Begriffspaar »Verheißung und Erfüllung« werden bis heute nicht nur Bezüge zw. einzelnen Schriftstellen schon innerhalb des AT (vgl. 1. Mose 12,1-3 mit 1. Mose 18,9-15; 21,1-7 oder Jes 7,14 mit Jes 36–39 und Jes 9,1-6; 11,1-9), sondern auch das Verhältnis von AT und NT insg. beschrieben. Dabei ist bemerkenswert, dass die Verbindung dieser beiden Begriffe in der Bibel so nicht vorkommt, sondern das Ergebnis späterer geschichtstheol. Systematisierungen ist (Johann Christian Konrad von Hofmann; 1810–1877). Matthäus spricht bei seinen Erfüllungszitaten nicht von »Verheißungen«, sondern von dem, »was durch die Propheten gesagt ist«, die dann zitiert werden (Mt 1,22-23 u. ö.). Und für Paulus hat Christus die Verheißungen an die Väter nicht »erfüllt«, sondern »bestätigt«, »bekräftigt«, als fest und zuverlässig erwiesen (Röm 15,8; vgl. Röm 4,16; 2. Petr 1,19-21), um sie bei seiner endzeitlichen Wiederkunft zur Vollendung zu bringen (Röm 11,26-27).
V. a. aber gilt es bei diesen Hinweisen auf die Schrift zu beachten, dass sie aus einer christlichen Perspektive erfolgen. Sie ergeben sich nicht von vornherein zwingend unmittelbar aus den Schriften des AT. Vielmehr sind sie erst später, im Rückblick formuliert, nämlich hist. gesehen nach dem Auftreten Jesu und theol. betrachtet von einem christl. Standpunkt aus. Von hier schauen die ersten Christen auf die Überlieferung des AT zurück und durchforschen die Schrift von Christus herkommend nach Aussagen, die sie als Weissagungen auf Christus hin interpretieren können (Joh 5,39; Apg 17,11). Ihr Ausgangspunkt ist immer das Christusgeschehen. Es gibt keine einfache Fortsetzung, keine direkte Kontinuität des NT zum AT, das ein eigenständiges Gegenüber bleibt (Mt 5,21-48; Lk 16,16; Röm 10,4). Und doch wird gerade aus christl. Sicht erklärt, dass dieses unerhört Neue eine endgültige, die für die Endzeit gültige und entscheidende Offenbarung des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, den das AT bezeugt (2. Mose 3,6; Mk 12,26; Apg 3,13; 7,32). Gerade diese wechselseitige Beziehung von Verheißung und Erfüllung macht deutlich, dass es derselbe Gott ist, von dessen Reden und Handeln AT und NT als Ganzes Zeugnis geben. Anknüpfung und Widerspruch bleiben unlöslich aneinander gebunden. Deshalb ist festzuhalten, dass sich der eigtl. Verheißungscharakter der alttestamentlichen Texte in seiner tieferen Bedeutung als Weissagung auf Christus erst aus der Rückschau, also im Lichte der Erfüllung erschließt.
Nun hat die neuzeitliche Bibelauslegung seit der Aufklärung hist. herausgearbeitet, dass das AT nicht nur vom NT her gedeutet werden darf, sondern als solches einen Eigen-Sinn hat, d. h. zunächst einmal in seinem urspr. Sinn und hist. Kontext der Geschichte Israels zu verstehen ist. Nach der Shoa (Holocaust, Auschwitz) hat der jüdisch-christliche Dialog zudem das Problembewusstsein weiter geschärft, dass das AT die Heilige Schrift der Juden ist, die in ihrem Eigenwert gewürdigt werden muss. Deshalb gilt es stets zu bedenken, dass das heutige AT in Gestalt der Hebr. Bibel – nicht der von Christen benutzten Septuaginta – eine eigenständige jüd. Auslegungstradition besitzt und im Judentum bis heute eine eigene Wirkungsgeschichte entfaltet.
Daraus folgt für die heutige Auslegung des Alten Testaments: Sowohl für Juden als auch für Christen ist die jüd. Bibel, das christl. AT, die gem. Heilige Schrift. Dies gilt trotz mancher Unterschiede zw. der Hebr. Bibel und der Septuaginta in Schriftenanordnung (v. a. Propheten), Textumfang (z. B. im Jeremiabuch), Kapitelzählung (Esra; Nehemia; Psalmen; Jeremia) und Wortbedeutung (Jes 7,14; Am 9,11-12). Dennoch hat sie als Heilige Schrift für beide Seiten nicht die gleiche Bedeutung. Es ist weitgehend derselbe Text, aber er steht für beide in einem unterschiedlichen Kontext. Für Juden ist diese Schriftensammlung als solche bis heute ihre Heilige Schrift. Für Christen steht sie im Kontext des Kanons in einem unauflöslichen Zusammenhang mit dem Evangelium von Jesus Christus. Hier ist sie Teil der christl. Bibel, in der AT und NT durch diese beiden Bezeichnungen ebenso unterschieden wie verklammert sind.
Für die christliche Bibelauslegung bedeutet dies, dass das AT zunächst in seinem urspr. Textsinn zu erfassen, in seinem hist. Kontext wahrzunehmen und in seiner jüd. Auslegungs- und Wirkungsgeschichte zu respektieren ist. In einem zweiten Schritt will es dann aber auch gemäß der christl. Auslegungstradition im Horizont der Christusbotschaft vom NT her in seiner Bedeutung für das Christusgeschehen bedacht sein. Die neutestamentlichen Verf. kamen nicht vom AT her auf Christus zu sprechen, sondern fanden in der Schrift Worte, die ihnen halfen sachgemäß zu erschließen, was Jesus als Christus für sie bedeutet. Zugleich machten sie die Erfahrung, dass ihre Heilige Schrift, das heutige AT, im Licht Jesu Christi ganz neu zu reden begann. Für sie ist Jesus Christus die Mitte der Schrift (vgl. Joh 14,6; Apg 4,12; 1. Kor 3,11; Kol 2,2-3), die freilich nicht ohne Bezug zu Israel und seinem Gott zur Sprache kommen kann.
Im christlichen Gottesdienst (Apg 2,42-47; 1. Kor 11; 14), der vom jüd. Synagogengottesdienst – einem reinen Wortgottesdienst ohne kultische Opfer – geprägt ist, erhalten die alttestamentlichen Schriftlesungen und Psalmgebete von Anfang an neben ihrem urspr. Eigen-Sinn einen weiteren Gebrauchs-Sinn. Nun werden sie gehört im Zusammenspiel mit den neutestamentlichen Lesungen (Mk 13,14; → 1. Thess 5,27) und der Evangeliumsverkündigung (Mk 1,1; Röm 1,1-2; 1. Kor 15,1-5), mit Lobgesängen (Lk 1,46-55; 1,68-79; 2,29-32), Christusliedern (Phil 2,6-11; Kol 1,15-20 u. ö.) und trinitarischen Formulierungen (Mt 28,19; → Joh 14,16; → 1. Kor 12,3-6; 2. Kor 13,13). Dieses intertextuelle Hören wird noch verstärkt durch die spätere Ausgestaltung des Kirchenjahrs mit seinen Höhepunkten und Festzeiten.
Von Jesus zum Neuen Testament
Das NT ist keine Fortsetzung des Alten, sondern ein komplementäres Gegenüber. Es deutet nicht nur die Schriften des AT, sondern verkündigt v. a. das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes (Mk 1,1; Röm 1,1-4; Hebr 1,1-2). Er ist das Wort Gottes, in dem Gott selber Fleisch, d. h. Mensch geworden ist (Joh 1,1.14). Jesus predigte das Evangelium vom Reich Gottes und rief zum Glauben (Mk 1,14-15). Aber er hat seine Botschaft nicht aufgeschrieben.
Um möglichst viele Menschen für diesen Glauben zu gewinnen und die Rückbindung an die Person Jesu zu gewährleisten, war es notwendig, seine Geschichte festzuhalten, immer wieder in Erinnerung zu rufen und neu zu vergegenwärtigen (Joh 14,26; 16,13-15; vgl. Joh 2,22; 12,16). Deshalb wurden seine Worte und Taten von Augenzeugen und Dienern des Wortes zunächst mündlich überliefert und schließl. in den Evangelien aufgeschrieben (Lk 1,1-4; Apg 1,1-2). Das Evangelium, das Jesus vom Reich Gottes verkündigte (Mk 1,14-15), wurde zum Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes (Mk 1,1), das Markus rund vierzig Jahre nach dem Wirken Jesu, also um 70 n. Chr., erstmals in einen fortlaufenden Erzählzusammenhang gebracht hat. Matthäus, Lukas und Johannes haben dessen Text aufgenommen und weitere Stoffe ergänzt, um von Jesus Zeugnis zu geben (Lk 24,48; Apg 1,8.22; Joh 19,35; 21,24; 1. Joh 1,1-4). Auch Paulus zitiert Worte Jesu (1. Thess 4,15; 1. Kor 7,10; 9,14), die Abendmahlsüberlieferung (1. Kor 11,23-26; vgl. die Lehre bei der Taufe in Röm 6,3-4.17) sowie alte Bekenntnisformeln (Röm 1,3-4; 4,24.25; 10,9; 2. Kor 4,14; Gal 1,1.4; 1. Thess 1,10), Hymnen (Phil 2,6-11) und Glaubenssätze über Jesu Tod und Auferstehung (1. Kor 15,3-5; 1. Thess 4,14). So argumentiert bereits Paulus nicht nur mit der – Juden und Christen vertrauten – Heiligen Schrift (Röm 1,2), d. h. dem heutigen AT, sondern auch mit Jesusüberlieferungen und dem gem. urchristlichen Bekenntnis (1. Kor 15,11).
Die ältesten schriftlichen Quellen sind die Paulusbriefe, die in den 50er-Jahren des 1. Jh. n. Chr. geschrieben wurden (zur Überlieferung der Handschr. s. Anhang »Zur Textüberlieferung der Bibel«). Es folgt das Markusevangelium, dann bis zur Jahrhundertwende die anderen Evangelien. Die Evangelien waren für das Vorlesen im Gottesdienst bestimmt (Mk 13,14), ebenso die Briefe des Paulus (1. Thess 5,27; Kol 4,16). Denn der Glaube kommt aus der Predigt, d. h. aus dem Hören auf das Wort Christi (Röm 10,17), welches in der gottesdienstlichen Versammlung geschieht (1. Kor 11,17-34; 14,26) – noch nicht durch die private Lektüre der Glaubenden (Apg 8,28-35), die in einem größeren Umfang erst im 18. Jh. durch preiswerte Bibeldrucke mögl. wurde. Darum wird selig gepriesen, »der da (vor-)liest und die da hören die Worte« aus der Johannesoffenbarung im Gottesdienst der Gemeinde (Offb 1,3). Hier haben diese Schriften ihren urspr. Sitz im Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen als einer Vorlese- und Hörgemeinschaft. Darum gehören bereits in neutestamentlicher Zeit zur Lesung aus der »Schrift« nicht nur das AT, sondern auch schon schriftlich vorliegende Jesusüberlieferungen (→ 1. Tim 5,18). Bis zum Anfang des 2. Jh. wurden die übrigen der insg. 27 Schriften des NT abgefasst, zuletzt der 2. Petrusbrief (s. Einf. dort). Damit lagen die einzelnen Schriften vor, aber was noch fehlte, war ihre Zusammenstellung in einem einzigen Buch, d. h. die Entstehung der christl. Bibel als eines Kanons heiliger Schriften für die Kirche.
Die Entstehung der zweiteiligen christlichen Bibel
Von der endgültigen Festlegung des bibl. Kanons im 4. Jh. n. Chr. ist die Geschichte der Kanonisierung zu unterscheiden, d. h. der Prozess der Kanonbildung, in dem die einzelnen Bücher gesammelt wurden und sich in der Kirche durchgesetzt haben. Mit großer Selbstverständlichkeit haben die ersten Christen das AT als Heilige Schrift Israels übernommen, doch dabei konnte es nach der Offenbarung Gottes in Jesus Christus nicht bleiben. Schon sehr bald wurden die Paulusbriefe gesammelt (2. Kor 10,10; 2. Petr 3,16: »alle«) und zw. Gemeinden ausgetauscht (Kol 4,16). Die Pastoralbriefe bringen mit dem 2. Timotheusbrief als Testament des Apostels Paulus die Sammlung seiner Briefe zum Abschluss. Bis zur Mitte des 2. Jh. bei Justin, dem christl. Philosophen und Märtyrer, bildete sich ein weitgehender Konsens über den Kernbestand einer christl. Heiligen Schrift heraus, der die vier Evangelien und die Paulusbriefe umfasste. Bei dem Kirchenvater Irenäus, Bischof von Lyon (um 180 n. Chr.), war für die Schriftlesungen im Gottesdienst und für die theol. Argumentation bereits ein normierter Umfang einer autoritativen Sammlung heiliger Schriften anerkannt. Dazu gehörten das AT in Gestalt des Septuaginta-Kanons, die vier Evangelien, die Apostelgeschichte, dreizehn Paulusbriefe, der 1. Petrus- und der 1. Johannesbrief, während bei den übrigen Briefen noch lange Unsicherheit bestand (Jakobus; 2. Petrus; 2. und 3. Johannes; Judas). Noch bis ins 4. Jh. wurde die Johannesoffenbarung im Osten abgelehnt, der Hebräerbrief im Westen. Maßgebliches Auswahlkriterium war der apostolische Charakter, durch den eine Schrift als authentisch galt. Gemeint ist damit ihre Ursprungsnähe und Ursprungsgemäßheit, d. h. zum einen hist. die zeitliche Nähe zum Kreis der Jünger und Apostel Jesu, zum anderen theol. die Übereinstimmung mit der Lehre der Apostel (Apg 2,42) in der gem. Glaubensüberlieferung, der Wahrheit des Evangeliums (Röm 12,6; 1. Kor 15,1-11; Gal 2,5.14).
Die endgültige förmliche Festlegung des Kanons erfolgte im 4. Jh. n. Chr. Das Wort »Kanon« ist ein griech. Ausdruck, der »Schilfrohr« bedeutet, aus dem Semitischen abgeleitet ist und dort schon im Sinne von »Messrohr, Messrute, Maßstab« verwendet wurde (Hes 40,3 u. ö.). Bereits Paulus gebraucht das Wort nicht einfach in der Bedeutung »Richtschnur, Maßstab«, sondern beschreibt damit den unaufgebbaren Kern des Evangeliums als grundlegende Norm (Gal 6,16). Seit dem 4. Jh. bezeichnet der Begriff den normierten Umfang der Sammlung der alt- und neutestamentlichen Schriften, die als urspr. und maßgeblich anerkannt waren. Die Provinzialsynode von Laodizea legte um 370 n. Chr. fest, dass beim Gottesdienst in der Kirche keine nichtkanonischen Bücher vorgelesen werden dürfen, sondern »allein die kanonischen Bücher Alten und Neuen Testaments«, die in einer später hinzugefügten Liste aufgeführt werden. Die erste vollständige Aufzählung der Schriften des heutigen Kanons bietet der 39. Osterfestbrief des Bischofs Athanasius von Alexandrien (367 n. Chr.), der die 22 Bücher des (hebr.) AT (ohne das Buch Ester; die 39 Schriften sind hier nur anders gezählt) und die 27 Bücher des NT als »Quellen des Heils« bezeichnet. Außerdem nennt er noch andere Bücher, die zwar nicht kanonisiert wurden, aber von den Vätern als Lektüre bestimmt worden sind für die Unterweisung in der Lehre der Frömmigkeit (aus der Septuaginta: Weisheit; Sirach; Ester; Judit; Tobit; zudem die frühchristl. Schriften: Didachē – griech. für »Lehre« – der Apostel; Hirte des Hermas). Die kirchl. Autoritäten haben den Umfang des Kanons also nicht durch die willkürliche Setzung irgendeines Gremiums vorgegeben, sondern am Ende eines längeren Prozesses erst formell festgestellt, welche Schriften sich durch ihren faktischen Gebrauch bei der Schriftlesung im Gottesdienst der Gemeinden selbst legitimiert und als normativ durchgesetzt hatten. Aus der Sicht der heutigen Forschung hat die Alte Kirche mit ihrer Auswahl hist. und theol. insg. ein gutes Gespür und Urteilsvermögen bewiesen.
Damit hat die Alte Kirche die Bibel als die eine zweiteilige Heilige Schrift der Christen festgelegt, indem sie einerseits an der Heiligen Schrift Israels im AT festhielt, andererseits die neutestamentlichen Schriften mit dem Evangelium von Jesus Christus für die Schriftlesung im Gottesdienst anerkannte. Dadurch erklärte sie beide gem. zur verbindlichen Grundlage, Quelle und Norm aller christl. Verkündigung und Lehre. Die Zitate aus der Schrift sollten die Evangeliumsverkündigung als Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen legitimieren, doch die theol. entscheidende Autorität blieb der auferstandene und lebendige Herr. Was aus dem AT über die Schöpfung (Mt 6,30-33; Mk 10,6-7; Apg 17,24-28; Röm 1,20; 4,17) und das Menschenbild (Röm 5,12-21; 1. Kor 15,35-49), die Geschichte Israels (Mt 1,1-17; Apg 7; 13,17-25; Röm 4; 9–11; 1. Kor 10,1-13; 2. Kor 3; Gal 3–4; 1. Petr 2,1-10; Hebr 11; Jak 2,23) und die Zehn Gebote (s. o.) geläufig war, brauchten die neutestamentlichen Autoren nur bei Gelegenheit in Erinnerung zu rufen, ausführlicher entfalten mussten sie aber das Neue, die Botschaft vom Heil, das Christus der Welt gebracht hat. Diese Spannung zw. Kontinuität und Diskontinuität kommt durch die Zweiteilung der christl. Bibel zum Ausdruck. Doch werden beide Teile durch die Bezeichnungen »Altes Testament« und »Neues Testament« nicht nur begrifflich unterschieden, sondern zugleich dauerhaft miteinander verbunden. Alt, aber nicht veraltet sind die Schriften, mit denen schon Jesus selber lebte, neu die Schriften der Christen, die die Geschichte Jesu Christi im Licht des AT zu verstehen versuchten. Christen können nicht vom AT reden, ohne auf das NT einzugehen, und auch nicht vom NT, ohne auf das AT Bezug zu nehmen. So bezeugt die spannungsvolle Einheit der einen zweigeteilten christl. Bibel aus AT und NT, dass es ein und derselbe, der eine Gott ist, der Schöpfer, der in der Geschichte Israels ebenso gehandelt hat wie im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Er ist es, der die ganze Welt erneuern und vollenden wird.
Bibel und Wort Gottes
Nach der Entstehungsgeschichte kommen wir nun zu Fragen, die das Verständnis der Bibel betreffen. Von bes. Gewicht ist die Frage, wie Bibel und Wort Gottes sich zueinander verhalten. Die Bücher der Bibel sind von Menschen geschrieben (Jes 1,1; Jer 1,1; Lk 1,1-4; 1. Kor 1,1; 16,21; 1. Petr 1,1 u. ö.). Aber sie beanspruchen eine göttl. Autorität. Schon die bibl. Autoren unterscheiden zw. dem Wort Gottes und ihren eigenen Worten.
Im Alten Testament erzählen die fünf Bücher Mose von Anfang an von dem, was Gott gesprochen hat (1. Mose 1,3 u. ö.; 1. Mose 12,1-3; 2. Mose 3,4-10; 20,1-17 u. ö.). Die Propheten berichten, was Gott ihnen bei ihrer Berufung gesagt hat (Jes 6; Jer 1,3-19; Hes 1–3; Offb 1,11), als er ihnen seine Worte in den Mund legte (Jer 1,9; Hes 2,8–3,11; Offb 10,9-11). Gottesworte machen sie kenntlich durch Boten- und andere Zitationsformeln: »So spricht der Herr …« (Am 1,3 u. ö.).
Im Neuen Testament





























