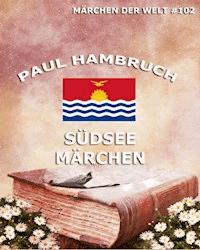
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: Australien 1. Der Kranich und die Krähe 2. Der Emu Dinewan und die Krähen Wahn 3. Die Fliegen Bunnyyarl und die Bienen Wurrunnunnah 4. Die Blutblume 5. Balu und die Dens 6. Die Entstehung der Sonne 7. Die sieben Schwestern Meamei 8. Woher der Frost kommt 9. Byamee's Versammlung 10. Wie die Blumen wieder in die Welt kamen 11. Der Ibis und der Mond Melanesien 12. Warum der Kasuar keine Flügel hat 13. Der Tanz der Vögel 14. Die Sonne 15. Warum wir sterben 16. Drei Geschichten von den Brüdern To Kabinana und To Karwuwu 1. Der Fisch 2. Das Häuten 3. Die Brotfrucht 17. Das Huhn und der Kasuar oder der Ursprung des Muschelgeldes 18. Die Ratte und der Schmetterling 19. Kukuku und Waima 20. Die Geburt der Sonne 21. Die Entstehung des Feuers 22. Das lahme und das schlafende Bein 23. Der Feigenbaum 24. Der Ursprung der Weißen 25. Der Fischer und der Geist 26. Die Heldenzwillinge 27. Vom Manne, der ausging, sich eine Frau zu suchen 28. Die Entdeckung der Spiegelung im Wasser 29. Die Schlange 30. Das Sonnenkind 31. Wie die Fidji-Leute den Bootbau erlernten 32. Die Geschichte von Longa-Poa 33. Matanduas Abenteuer 34. Napoleon ist ein Tonga-Mann Mikronesien 35. Das Ei der weißen Seeschwalbe 36. Der arme und der reiche Hahn 37. Der Vogel Peaged arsai 38. Die Mandelsammlerin 39. Klubud singal 40. Das Bündel von Ngeraod 41. Die Herkunft des Geldes 42. Der Chaifi 43. Die Geschichte von Jat und Jol 44. Das Wettschwimmen zwischen dem Hornhecht und der Krabbe 45.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Südseemärchen
Paul Hambruch
Inhalt:
Geschichte des Märchens
Südseemärchen
Einleitung
Australien
1. Der Kranich und die Krähe
2. Der Emu Dinewan und die Krähen Wahn
3. Die Fliegen Bunnyyarl und die Bienen Wurrunnunnah
4. Die Blutblume
5. Balu und die Dens
6. Die Entstehung der Sonne
7. Die sieben Schwestern Meamei
8. Woher der Frost kommt
9. Byamee's Versammlung
10. Wie die Blumen wieder in die Welt kamen
11. Der Ibis und der Mond
Melanesien
12. Warum der Kasuar keine Flügel hat
13. Der Tanz der Vögel
14. Die Sonne
15. Warum wir sterben
16. Drei Geschichten von den Brüdern To Kabinana und To Karwuwu
1. Der Fisch
2. Das Häuten
3. Die Brotfrucht
17. Das Huhn und der Kasuar oder der Ursprung des Muschelgeldes
18. Die Ratte und der Schmetterling
19. Kukuku und Waima
20. Die Geburt der Sonne
21. Die Entstehung des Feuers
22. Das lahme und das schlafende Bein
23. Der Feigenbaum
24. Der Ursprung der Weißen
25. Der Fischer und der Geist
26. Die Heldenzwillinge
27. Vom Manne, der ausging, sich eine Frau zu suchen
28. Die Entdeckung der Spiegelung im Wasser
29. Die Schlange
30. Das Sonnenkind
31. Wie die Fidji-Leute den Bootbau erlernten
32. Die Geschichte von Longa-Poa
33. Matanduas Abenteuer
34. Napoleon ist ein Tonga-Mann
Mikronesien
35. Das Ei der weißen Seeschwalbe
36. Der arme und der reiche Hahn
37. Der Vogel Peaged arsai
38. Die Mandelsammlerin
39. Klubud singal
40. Das Bündel von Ngeraod
41. Die Herkunft des Geldes
42. Der Chaifi
43. Die Geschichte von Jat und Jol
44. Das Wettschwimmen zwischen dem Hornhecht und der Krabbe
45. Der Kampf der Vögel und Fische
46. Die angeführte Menschenfresserin
47. Taile
48. Tolojäla und seine Tochter
49. Wie Schau Etietsch sich seine Frau wiederholte
50. Wie das Flugschiff nach Ponape kam
51. Die Geschichte von der Rohrdrossel
52. Die Geschichte von den Tieren, die sich ein Boot bauten
53. Erauarauin und das Ungeheuer
54. Das Mädchen im Monde
Polynesien
55. Die Seegurke
56. Die Strafe für den Diebstahl
57. Du sollst deine Schwiegermutter ehren
58. Die Ratte und der Fliegende Hund
59. Der Drachenfisch
60. Die Krokodilshöhle
61. Die Liebe der Schlange
62. Der angeführte Menschenfresser
63. Die Reise in die Unterwelt zur Strudelhöhle Fafá
64. Sina
65. Der Rattenfänger Pikoi
66. Iwa der Meisterdieb von Oahu
67. Der Häuptling mit den wunderbaren Dienern
68. Das Lebenswasser des Ka-ne
69. Das Wasser des Kane
70. Maui
71. Tawhaki
72. Das verzauberte Holzbild
73. Hine-moa und Tutanekai
Quellennachweise und Anmerkungen
Verzeichnis und Erklärung der Abbildungen.
Südseemärchen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849603342
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Geschichte des Märchens
Ein Märchenist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht« (s. d.), jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchen-forschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Südseemärchen
Herrn und Frau Prof. Dr. G. Thilenius zugeeignet
Einleitung
Das Märchen ist ein unentbehrlicher Helfer, der tief in die Dichtung und in das geistige, religiöse und sittliche Werden der Menschheit hineinleuchtet.
von der Leyen
Seitdem das Deutsche Reich sich in der Südsee seinen Kolonialbesitz gründete und ihn in den letzten fünfzehn Jahren ausbaute und festigte, hat sich auch die Allgemeinheit immer mehr den Inseln und Menschen dort unten zugewendet. Die von dort hergeholten Landesprodukte gehörten bald zu den unentbehrlichen Dingen für unseres Leibes Notdurft und Nahrung und steigerten das wachgerufene Interesse; und das vermehrte sich noch durch Werke, die eine Kenntnis von Land und Leuten vermittelten, und durch Museen, die dem Beschauer die Schätze der stofflichen Kultur der Südsee-Eingeborenen vor Augen führten. Doch der größte Teil der geistigen Kultur blieb uns verschlossen oder verborgen. Nur wenige, die von Berufs wegen solchen Dingen sich zu widmen haben, lernten etwas von diesem eigensten, besten Besitz der Eingeborenen kennen, konnten in die Geheimnisse ihrer Literatur eindringen und sie würdigen.
Literatur? Haben denn die "Wilden", wie sie von uns Kulturmenschen in überhebendem Sinn und Ton so gern bezeichnet werden, haben die überhaupt eine Literatur? Wir wissen doch, daß sie weder lesen noch schreiben können, und wenn sie es jetzt verstehen, hat man es sie doch in Missions- und Regierungsschulen gelehrt. Der Einwurf ist berechtigt; allerdings haben die Wilden keine Literatur in unserem Sinne, die littera fehlt. Aber man darf nicht vergessen, daß dort, wo diese Künste unbekannt sind und nicht gepflegt werden, etwas anderes um so lebendiger wirkt, das gesprochene Wort, und daß eine ausgezeichnete Schulung des Gedächtnisses ihm zu Hilfe kommt. Erzählungen liebt der Eingeborene sehr; mitteilsam ist er, allerdings nicht immer gerade dem Europäer gegenüber; und reich ist sein Schatz an Liedern, Sagen, Mythen, Märchen, Schnurren usw. Und ihr Bestand wird ungeschwächt erhalten, wo gerade Lesen und Schreiben, und damit Kultur, nicht hindringen. Mündlich von Geschlecht zu Geschlecht wird die Sage übermittelt und bewahrt; dort wo Schreiben und Lesen nahezu Allgemeingut geworden sind, fördert man die Schulung des Gedächtnisses nicht mehr. Und das Alte, die schönen Denkmäler der Eingeborenen-Literatur, verschwindet schnell und für immer; was sich erhält, bekommt den Mantel der Kultur umgehängt und ist dann in dieser Verunstaltung selten wieder zu erkennen1.
Systematische Forschungen zur Ergründung und Sammlung der Eingeborenen-Literatur in der Südsee sind bisher sehr wenige unternommen worden. Die größte ist die von Sir George Grey in Neu-Seeland angelegte Sammlung der dort lebendigen Mythen und Sagen; in Australien sammelten Howitt, Spencer, Gillen und Frau Langloh-Parker; die ersten Sagen aus der Südsee überhaupt wurden von Chamisso herausgebracht, der in seiner "Reise um die Welt" einiges aus den Karolinen mitteilt; nach ihm beschäftigten sich keine deutschen Forscher mehr mit diesen Dingen, Kubary ausgenommen, der manche Geschichten aus Palau niederschrieb. Erst in den letzten Jahren traten Deutsche wiederum mit größeren und wertvolleren Sammlungen auf den Plan: Krämer und Sierich sammelten in Samoa, P. Meier im Bismarckarchipel, P. Erdland auf den Marshall-Inseln, Thurnwald auf den Salomonen usw. Die ausgesandten Expeditionen zur Erforschung der landes- und volkskundlichen Verhältnisse in der Südsee legten ein Hauptgewicht auf das sichere Einbringen einer reichen Sagen- und Märchenernte. Deutsche und Engländer wetteiferten hier miteinander und trugen große Schätze zusammen, die erst zu einem kleinen Teil veröffentlicht sind. Das gilt auch von den Sammlungen, welche die Missionen aller Zungen anlegten; früher waren sie der Eingeborenen-Literatur gegenüber abhold, heute zeigen sie ihr ein freundliches Gesicht und haben ein großes wertvolles Material aus allen Gebieten der Südsee aufgebracht. Alles in allem mögen heute ungefähr zweitausend Literaturdenkmäler Ozeaniens und Australiens bekannt sein; leider sind sie arg verstreut in den verschiedensten Werken und Zeitschriften, um welche die Allgemeinheit sich wenig kümmert, so daß ihre Kenntnis, damit auch ihre Eigenart und Schönheit, bisher fremd blieb.
Die genannten Sammlungen waren nur möglich, weil ihre Verfasser sich eingehend mit der Sprache der Eingeborenen befaßten. Sie erlernten, studierten sie, schufen sich nicht allein die rein sprachlichen, sondern auch die gedanklichen Übersetzungen, erschlossen sich damit den Weg zum Herzen der Leute und gewannen ihr Vertrauen. Sollen Erfolge erreicht werden, so müssen die Eingeborenen im Weißen nicht ein Wunderwesen sehen, sondern ihn als Menschen erfassen lernen; und derselbe Gedanke, dasselbe Bestreben muß den Weißen ebenfalls beherrschen, dann kommt man sich einander näher. Ist aber das angeborene Mißtrauen der Eingeborenen als hinderlichste Schranke niedergelegt, so fließen die Quellen reich und unerschöpflich. Die ganze Frage der Märchensammlung wird damit sehr oft zur reinen Frage nach der Zeit, die für die Sammlung und Niederschrift der Geschichten der Eingeborenen zur Verfügung steht. Von Reisenden, die zufällig ein solches Gebiet berühren, ist daher nicht viel zu erwarten; der Ethnologe, dem die Leitlinien im Leben und Denken der Eingeborenen vertrauter sind, wird eher und leichter brauchbares Material einheimsen, dessen Güte und Wert wachsen, je länger er sich in einem bestimmten Gebiet aufhalten kann. Das beste und schönste Material ist von den Missionaren zu erwarten, die gerade über die Zeit als wertvolles Hilfsmittel unbeschränkt verfügen. Was sie bis jetzt leisteten, berechtigt zu den schönsten Hoffnungen.
Wie sammelt man unter Eingeborenen Märchen? Erfahrungen habe ich nur aus den Karolinen und mit meinen melanesischen Begleitern. Obschon allemal die Art des Sammelgebietes in Betracht kommt – unter den lebensfreudigen, munteren Mikronesiern und Polynesiern geht diese Arbeit viel leichter und angenehmer vonstatten als unter den verschlossenen, schwerfälligeren, mißtrauischen Melanesiern und Australiern –, dürfen die Grundzüge der Sammelweise in den drei Gebieten dieselben sein. Man wird wohl die Beobachtungen unter Würdigung der jedesmaligen besonderen Umstände verallgemeinern dürfen, die ich machte, als ich in ungefähr dreiviertel Jahren rund fünfhundert Sagen, Märchen, Lieder usw. niederschrieb.
Die spärlichen Mitteilungen Chamissos bildeten den Ausgangspunkt. Leider sind sie mit den religiösen Anschauungen der Eingeborenen verknüpft; und danach zu fragen, ist eine heikle Sache, die meist auf beiden Seiten große Unbefriedigung hervorruft. Gelegentliche Nebenfragen, neue Namen, weitere Erkundigungen führten jedoch weiter und bald auf den Weg, den man mit den Eingeborenen wandern wollte. Der Anreiz und die Lockung, welche in den vielen neuen, unbekannten und doch so begehrten Dingen stecken, die der Weiße für den Eingeborenen mitbringt, kleine Geschenke an Geld, Tabak, Pfeifen, Zündhölzer, Bonbons, Angelhaken, Messer u.a. öffnen ihnen den Mund. Allerdings muß man im Beginn sicher damit rechnen, allerlei Lügen aufgetischt zu bekommen. Durch Kontrollfragen und das Beobachten des Gebärden- und des Mienenspiels des Erzählers kommt man aber bald dazu, dem wahren und echten Kern einer Erzählung näher zu rücken. Man unterbreche jedoch den Eingeborenen nicht, man lasse ihn berichten, was er weiß. Fragen ermüden, langweilen ihn, wecken sein Mißtrauen; am Schluß der Erzählung kann man meist die Lücken ergänzen oder bekommt die Leute nachgewiesen, welche darüber nähere Auskunft und Ergänzungen erteilen können. Die Pfeife des Erzählers muß dauernd in Brand gehalten werden, kleine Erfrischungen, Bonbons u.a. helfen über unvermeidliche Pausen hinweg und lassen für den Erzähler das Gefühl der Langeweile weniger aufkommen. Aus sich selber heraus ist kein Eingeborener mitteilungsfroh, alles muß sozusagen aus ihm herausgepumpt werden. Nur selten begegnet man Leuten, die mit einem heiligen Interesse an der Sache selbst, freiwillig ihr Wissen von sich geben. Weniger eine Hochschätzung des Weißen, der sich mit einemmal dieser eigensten Dinge der Eingeborenen annimmt, schließt ihm den Mund; vielmehr ist es eine abergläubische Furcht, durch die Mitteilung einer Geschichte, welche nicht als Geheimnis angesehen und betrachtet wird, den Zorn oder das Mißfallen der Geister und Dämonen auf sich herabzuladen, so daß der Erzähler von Mißgeschick, Krankheit und Tod betroffen wird. Auf Ponape stand mir so während der letzten Zeit meiner Anwesenheit der Tod eines meiner Hauptgewährsleute, des Nanaua en Tolakap, bei der Märchensammlung sehr hinderlich im Wege, denn die Eingeborenen schrieben ihn ohne weiteres seinen Mitteilungen zu, die, durch meine Geschenke herausgefordert, von den Geistern nicht gebilligt waren.
Teilt der Eingeborene sein Wissen, seine Geschichten mit Vorbedacht mit, so will er allein sein; seine Landsleute dürfen nicht zuhören; und bei Kontrollfragen muß man sich anderen gegenüber hüten, nicht etwa den Namen des Erzählers zu verlautbaren. Lauscht man jedoch abends ihren Erzählungen im großen Männer- oder Versammlungshause – dann erzählt man sich am liebsten –, so sind solche Vorsichten unnötig. In der Allgemeinheit schwindet die Scheu, der gute Erzähler wird geschätzt, und fremde Ohren dürfen ruhig zuhören. Doch nicht jeder Eingeborene kann erzählen; viele, die ich befragte, lehnten ab und antworteten, sie wüßten nichts, wiesen mir alsdann jedoch stets einen Gewährsmann nach oder holten ihn herbei. Ich machte dabei die Erfahrung, daß Sagen und Märchen wohl ziemlich allen dem Inhalt nach bekannt waren – damit gewann man die Stichworte –, regelrecht erzählen konnten sie nur wenige, gelegentlich nur ein einziger. Bruchstücke der "Geschichte von Jat und Jol" (Nr. 43) erhielt ich auf den verschiedensten Inseln der Karolinen; die ganze Schachtelerzählung wurde mir aber nur an einer einzigen Stelle, auf Elato, mitgeteilt. Diese Beobachtung machte ich immer und immer wieder; neben der Sprachkenntnis ist also ein erfolgreiches Suchen nach den rechten Märchenbewahrern nötig, von denen einzelne unter Umständen nur zwei bis drei Erzählungen wirklich kennen, wissen und auch mitteilen können. Die Darstellung selbst läßt bald erkennen, ob der Betreffende den Stoff tatsächlich beherrscht oder ihn nur vom Hörensagen kennt; manche, die ihre Aufgabe ernst nahmen, teilten mir mit, sie kennten die Geschichte wohl, doch wollten sie sich nochmals gründlich erkundigen, um sie mir dann zu erzählen. Die meisten kamen auch wieder, Tage verstrichen oft, und berichteten so gut sie es konnten; fragte man nach ihren Quellen, so stellte sich allgemein heraus, daß die alten Frauen die eigentlichen Bewahrerinnen der Traditionen, Sagen, Märchen und Legenden sind. Sie hüten diesen Schatz, geben ihn aber selten an den Weißen direkt ab, sondern nur stückweise und auf dem eben geschilderten Umwege. Schon als kleine Kinder werden die Mädchen mit diesen Schätzen vertraut gemacht; unermüdlich, immer wieder müssen sie die ihnen erzählten Geschichten usw. den Frauen, ihren Lehrmeisterinnen, wieder und wieder erzählen, um ihrerseits später selber als Frauen ihrem Nachwuchs die Erzählungen in derselben Weise zu übermitteln. Diese mündliche Lebenderhaltung des Sagen-und Märchenschatzes hat die weitgehendste Bedeutung. Die Erzählweise ist erstarrt; vergleiche ich meine Niederschriften mit denen von Chamisso vor hundert Jahren niedergelegten, so weichen beide Darstellungen nicht im geringsten voneinander ab. Das mag noch seine zweite Ursache haben: was man erzählt bekommt, sind vielfach die Inhaltsangaben großer Epen, die von den Einzelnen auswendig gelernt werden müssen, an denen nichts verdreht oder gedeutelt wird, die in der alten Form auf Kind und Kindeskinder vererbt werden.
Und doch (s. Nr. 34) panta rei, nichts steht still; die Völker der Südsee sind produktiv, sie sind es, oder waren es wenigstens, bis unsere Kultur wie ein Mehltau über sie fiel.
Aus der Fülle dieser größtenteils bei uns ungekannten Eingeborenen-Literatur ordnen sich die in diesem Bändchen mitgeteilten Stücke zu einem bescheidenen Kränzchen. Es paßt sich dem Raum an; und die Auswahl wurde so getroffen, daß wir ihm gegenüber unsere eigene Empfindungs- und Denkweise nicht allzusehr um- und neu einzustellen brauchen. Die primitiven Erzählstücke kommen zuerst; die größeren, fast novellenartigen Geschichten der Polynesier (siehe Nr. 73) bilden den Schluß. Es sind die Stücke ausgesucht, welche die Eingeborenen sich am liebsten erzählen, so daß hier gewissermaßen die Lieblingskinder der Eingeborenen-Muse vorgestellt werden. Ich legte dabei besonderen Wert darauf, möglichst den Stoff herauszusuchen und zu bringen, für den die Eingeborenen-Texte vorliegen (s. Inhaltsverzeichnis), um eine Nachprüfung zu ermöglichen, und mich bei der hier nicht zu umgehenden freien Übertragung doch auf das gewissenhafteste an diese Urtexte zu halten und ihnen gerecht zu werden.
Nur eins vermag ich nicht mitzuteilen und dem Leser nahe zu bringen; die Art und Weise, wie der Eingeborene erzählt. Das muß man selber erleben. Ein Märchen wird nicht allein mit dem Munde erzählt und spricht uns nur in Worten an; damit ist unbedingt noch das Mienen-, Gebärden- und Gestenspiel des Erzählers verbunden. Beides gehört zusammen und vermittelt erst den rechten Eindruck, den man erzielen will. Dies stumme Spiel paßt sich dem Inhalt des Erzählten an – bei den regsameren Mikro- und Polynesiern ist es von Natur schon lebhaft, aber auch die Gesichter der anscheinend stumpferen Australier, und Melanesier beleben sich, wenn sie eine Geschichte erzählen. Da spricht ihr ganzer Körper, und andächtig, gespannt lauschen die Zuhörer – ihr Gesichtsausdruck gibt den anzulegenden Maßstab ebenfalls für unsere Kritik ab. Man erzählt behaglich und breit, nebensächliche Dinge werden in beinahe ermüdenden Einzelheiten geschildert, kleine Scherze (s.S. 118) und Wortspiele eingeflochten. Manche Erzählungen nimmt man als einen selbstverständlichen Bericht entgegen, andere, die mehr das Fremdartige, Ungewohnte, Übersinnliche darstellen und erklären, nimmt man halb erstaunt, halb verwundert und gelegentlich auch verschämt auf. Beifallsbezeugungen kennt man nicht; der Erzähler wird in der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer belohnt; gefällt etwas einmal ganz besonders, so äußert man sein Wohlbehagen, wie man es nach einem wohltuenden reichlichen Mahl gewohnt ist, durch wiederholtes und kräftiges Rülpsen. Soviel von den Menschen selbst. Die Liebenswürdigkeit und das besondere Entgegenkommen des Herrn Verlegers erspart mir ihre Beschreibung; die beigegebenen Tafeln sprechen für sich selbst und sagen dem Leser, wie er sich Erzähler, Zuhörer und die in den Geschichten handelnden Personen vorzustellen hat.
Die "Märchen der Weltliteratur" wollen in den Bänden, die sich den Naturvölkern widmen, zu den Anfängen des Märchens zurückführen. Die nachfolgende Auswahl soll damit den Anfang machen. Wenn man gleichzeitig den Zustand der stofflichen Kultur ihrer Verfasser und auch ihrer heutigen Erzähler berücksichtigt, so ist sie gewissermaßen eine Auswahl aus "Steinzeitdichtungen". Wohl harrt der so arg verstreute Stoff noch seiner systematischen Behandlung, aber bei dem konservativen Sinn der Eingeborenen und der für sie einzig möglichen Art der Lebenderhaltung ihrer Dichtungen von Mund zu Mund, läßt sich der Gedanke schwerlich zurückweisen, daß man es im Grunde bei den meisten in diesem Bändchen vorgelegten Dichtungen mit sehr alten Mythen, Legenden und Märchen zu tun hat. Für die völkerpsychologischen Erkenntnisse werden sie mit dem vielen hier nicht zu veröffentlichenden Stoff einmal eine reiche Fundgrube bilden. Sie werden auch, da die Gegenwart, in der sie gesammelt wurden, wenig oder gar nicht verschieden ist von der Zeit, in der sie entstanden, uns Fingerzeige geben, in welchen Bahnen sich die dichterischen Gedanken unserer eigenen Altvorderen in grauer Urzeit bewegten. Das dürfte niemand schwer werden, der sich nach einer eingehenden Lesung dieser Auswahl in die Grimmschen Märchen der Sammlung oder die Griechischen Märchen von Hausrath und Marx vertieft. Wir "Kulturmenschen", die von den einfachsten, natürlichsten Lebensbedingungen losgelöst sind, können uns dann beim Lesen dieser und der genannten Erzählungen leichter in eine für uns längst vergangene Denkweise versetzen, sie nachempfinden; wir werden dabei in die einfachsten Lebensverhältnisse zurückversetzt; den überlegenden und erklärenden Verstand ausschaltend, kann unsere Seele die alten Heimlichkeiten wieder aufsuchen und die Geheimnisse der Natur in ihrer ganzen Schönheit, Ursprünglichkeit und Gewalt auf sich einwirken lassen. Weiter wird man merken, daß manche Erzählungen trotz ihrer eigentümlichen Einkleidung, die durch die Umwelt der Eingeborenen bedingt ist, mancherlei gleichartige und vereinende Züge mit den Volksmärchen anderer Völker aufweisen. Meumann wies mich darauf, daß sie in ihrem Aufbau an unsere eigenen Volksdichtungen erinnern. Er betonte den raschen, und oft unvermittelt, unvorbereitet und unmotiviert erscheinenden Wechsel des Vorstellungskreises und das gelegentlich plötzliche Abbrechen der Erzählung. "So bricht auch unsere Volksdichtung oft plötzlich ab, wenn eine Pointe erreicht oder ein besonders gelungener Witz ausgesprochen ist; dies erscheint uns dann allemal damit motiviert, daß man mit dem Abbrechen der Erzählung die Wirkung des Witzes nicht abschwächen will, während uns das Abbrechen des Gedankens in der Dichtung der primitiven Völker oft ganz unmotiviert erscheint. Vielleicht hatte sich bisweilen die Phantasie des Erzählers an ihrem Stoffe erschöpft, manchmal wird auch der Schluß vergessen worden sein, und das Abspringen des Gedankens im Laufe der Erzählung scheint bisweilen auf eine Vermischung verschiedener Stoffe von verschiedener Herkunft hinzuweisen, die durch die langdauernde mündliche Überlieferung herbeigeführt wurde."
Es verlockt, den Vergleich zwischen der Eingeborenen- und unserer eigenen Dichtung weiter auszuspinnen. Aber der Raum reicht dafür hier nicht, so daß diese interessanten Probleme nur gelegentlich gestreift werden können. Zwischen den primitiven und unseren Märchen bestehen nicht wegzuleugnende Zusammenhänge (Beispiele siehe unten), welche die künftige Märchenforschung noch aufzudecken haben wird, während wir sie nur spekulativ ahnen. Ich greife das Tiermärchen heraus; wir hegen es noch immer in seinem ursprünglichen Geiste, ich meine in der unschuldigen Lust an der Poesie, die keinen anderen Zweck hat, als sich an der Sache zu ergötzen und nicht daran denkt, eine andere Lehre hineinzulegen, als die frei aus der Dichtung hervorgeht. (Grimm.) Nicht anders ist es in den Märchen des Äsop, Babrios, Phädrus, Aelian (s. Hausrath und Marx); dem Südsee-Eingeborenen erscheinen die Tier- und Pflanzenmärchen in einem andern Lichte. Ihm ist der Glaube an das Erzählte ebenso selbstverständlich, wie für uns Kinder die Wahrheit im Märchen von Dornröschen, Schneewittchen oder Aschenbrödel ausgemacht war. In seiner Denkweise stellt der Eingeborene sein "Ich" in den Mittelpunkt, und aus dieser Denkart heraus schreibt er dem ihm fernerstehenden Dinge seine eigenen Beweggründe zum Handeln zu, oder er sieht sie in die Bestandteile seiner Umgebung hinein, die ihm besonders geläufig sind. Daher sind ihm die Tiere so klug wie Menschen und ursprünglich mit denselben Kulturgütern versehen, die sie dann später aus irgendwelchen Zufälligkeiten, meist Ungehorsam gegen die Gottheiten, einbüßten. Ebenso spiegeln die andern Märchen vorzüglich die einfache Denkweise der Eingeborenen wider, die ihr eigenes Innenleben auf ihre Umwelt, den Himmel, die Gestirne usw. projizieren, und sich so in natürlicher Weise die Entstehung der Dinge und ihre Entwicklung zurechtlegen. Ihre Märchen und Erzählungen find der Ausdruck wirklich gemachter Beobachtungen, die zusammen mit ihren Anschauungen verarbeitet werden; dichterische Phantasien sind ihnen zunächst fremd und treten erst bei den höher entwickelten Völkern der Südsee in Samoa, Hawaii und Neu-Seeland auf. Dort begegnen wir auch den Anfängen des Kunstmärchens (Nr. 73).
Etwas haben die Volksmärchen der Südsee den unsern voraus: das Zeitgewand. Es ist immer dasselbe gewesen; die Märchengestalten erscheinen als dieselben Menschen, unverändert, in Form, Gestalt, Gebaren, Gewohnheiten, Bekleidung usw., so wie sie der Eingeborene täglich unter seinesgleichen begegnet. Damit wird dem Märchen eine Hauptstütze erhalten; Busch, Wasser und Luft sind voll von Geistern, Dämonen, männlichen und weiblichen, guten und bösen. Zu diesen bodenständigen Wesen tritt noch das Heer der Seelen verstorbener Angehöriger. Sie können wie die Geister jegliche Form annehmen, als Mensch, als Tier, als Pflanze, als Stein, als Naturereignis ihre Wirkung auf den Eingeborenen ausüben, der von ihnen in furchtsamer Abhängigkeit gehalten wird. Die Dunkelheit, die Zeit zwischen Sonnenunter-und -aufgang, ist die Zeit ihrer Wirksamkeit, und kein Eingeborener traut sich daher so leicht allein während dieser Stunden selbst in die ihm bekannte nächste Umgebung hinaus. Vertraut aber wie der Eingeborene mit der Natur ist, widmet er ihr nun noch mehr Aufmerksamkeit, beobachtet ihre Erscheinungen und sucht sie mit den Beobachtungen an sich selber in Einklang zu bringen, sie vor allem aus seiner eigenen Person heraus zu erklären. Wunderliche Dinge kann man da bisweilen erleben, und nur zu häufig muß man es leider bedauern, daß der kritisch nüchterne Verstand nicht den vielfach schöneren Wegen im Gedanken- und Vorstellungslabyrinth des Eingeborenen zu folgen vermag. Da wünscht man sich mehr Herzenseinfalt und ließe sich den Blick gern durch ein wenig Urteilsmangel trüben. Hatte mir ein Eingeborener treuherzig und geheimnisvoll "seine" Geschichte erzählt, dann klang es einem um so härter in die Ohren, wenn der Dolmetscher oder ein anderer "Aufgeklärter" nüchtern hinzusetzte: "Herr, du mußt nun nicht etwa denken, daß auch ich all den Unsinn glaube." Denn das halte man fest, der Eingeborene glaubt größtenteils an seine Geschichten, ihm sind sie wahr und wirklich; die Wirkung ist darob in ihrer Einfalt um so rührender. Zurückliegende Ereignisse, die tatsächlich einmal eintraten, erhalten ebenfalls für uns häufig das Gesicht und Gewand des Märchens (s. Nr. 34), aber für den Eingeborenen durchaus nicht. In den Strom der Ereignisse und Naturerscheinungen, der ihr Märchen trägt, fließt noch eine andere, unerschöpfliche Quelle ein: die Traum- und Seelenvorstellungen. Das Groteske, die Romantik, das Zauber-Wundervolle ruht in ihnen. Die Traumseele, die (Spiegelbild)seele (Nr. 46) sind für den Eingeborenen wiederum so wahr und wirklich, wie er selbst, sein eigener Körper; unabhängig von seinen eigenen Handlungen führt sie ihr eigenes Dasein (Nr. 72).
Sind nun ihre Handlungen selbständig, so unterliegen sie doch denselben Gesetzen wie die Eingeborenen selber; wie man an ihre Wirklichkeit glaubt, so glaubt man auch an die Wirklichkeit ihrer Handlungen und Erlebnisse. Traum und Wirklichkeit sind eben dem Eingeborenen eins. Das geht aus dem Inhalt dieses Büchleins zur Genüge hervor; für die Bedeutung des Traums und seinen Einfluß auf das Märchen überhaupt lese man die Ausführungen nach, die von der Leyen in seinem Buche "Das Märchen" gibt.
Diese Auffassung des Eingeborenen von seinen Erzählungen ist begründet durch seine einfache Anschauungs- und egozentrische Denkweise und erklärt sich auch daraus, daß sie in der Gegenwart spielen. Wir können unsere Märchen nur selten in die Gegenwart hineinstellen; täten wir es, sie würden an ihrer Schönheit Einbuße erleiden, unnatürlich erscheinen; in die Vergangenheit aber verlegt, gewinnen sie wieder körperliche, greifbare Formen. Wir haben nur wenige Märchen, die in der jüngsten Zeit entstanden, wie z.B. die "Hamburgischen Märchen" von Spiero, die in ihrer Schilderung und Erzählkunst die Wirklichkeit vergessen lassen und nachhaltigen Eindruck auf die ausüben, für welche sie bestimmt sind, die Kinder, deren Auffassungsart und Denkweise denen der Eingeborenen so um viel, viel mehr näher stehen als unsere. Die Märchenwelt, welche uns stets die andere ist, ist dem Eingeborenen die Umwelt, die selbst erlebte Welt, die Gegenwart. Gewiß haben seine Märchen ihren Schauplatz auch in der Vergangenheit, doch die Umwelt bleibt in dem einen und im andern Fall dieselbe, unverändert; seine Märchengestalten können ihm täglich begegnen, ihre Erlebnisse seine Erlebnisse werden.
Aus der Naturbeobachtung abgeleitet, sind die Eingeborenen-Märchen die Vorläufer unserer eigenen Märchen. Sie sind nicht Erbgut der Tradition und der Toten, sondern Blumen und Blüten des lebenden und wirkenden Verstandes. Die Natureindrücke sind die Lehrmeister des Eingeborenen für seine Anschauungen von Welt und Leben; sie formen seine religiösen Empfindungen, deren Betrachtung und Kult er gut zwei Drittel seines Lebens widmet. Es ist damit leicht begreiflich, weshalb gerade diese Dinge in den Märchen einen großen Platz einnehmen. Ist es bei uns viel anders? Ich glaube nicht; man lese einmal z.B. in Dähnhardts Natursagen nach, was er dort an Beiträgen zu den Sagen und Märchen des alten und neuen Testaments gesammelt hat. Die Eingeborenen-Märchen sind ein Abbild seines eigenen Lebens; sie schildern (s. die australischen Märchen) den Kampf um das Dasein, die Nahrung, das Wasser, die Schlauheit bei den Jagden, seine Feste usw. Den Märchen ist ohne weiteres zu entnehmen, ob der Erzähler auf einem großen Festland, an Küsten, auf kleinen Inseln lebt, ob er gewohnt ist, weite Reisen auf See zu unternehmen usw. Völlig verständlich wird daher das Märchen erst auf seinem ethnischen Untergrund und in seinen Beziehungen zu den Kulturverhältnissen verschiedener Kulturgruppen. Im Märchen, namentlich im religiösen, läßt sich am ehesten erkennen, was an verstreuten Samenkörnchen aus der Anschauung und Erkenntnis anderer Völker zu den Erzählern gelangte und umgestaltend, fortbildend neben dem Alten weiterwirkte. Kurz, im Märchen finden wir naturgetreue Bilder aus dem Eingeborenen-Leben; und sie entsprechen den Tatsachen und der Wirklichkeit.
Die Erzählweise ist meistens einfach, anspruchslos und ungekünstelt; nur die gröbsten Gefühls- und Sinneseindrücke werden vermittelt; doch greift die Sprache selbst gelegentlich zu Schilderungen in Bildern, die sich ähnlichen Leistungen bei uns zur Seite stellen können; einzelne Worte lassen auf Tiefergehende Empfindungen schließen, die sich uns allerdings noch wenig offenbarten. Eigentümlichen Gegensätzen begegnet man da; so bezeichnet z.B. einer der ärgsten menschenfressenden Stämme Neu-Guineas den Tau als "Tränen der Sterne". An der Hand der Märchen wird einem nebenbei klar, daß man den landläufigen Begriff, der Eingeborene sei gedankenlos und stumpfsinnig, aufzugeben hat. Weder bei den niedrig stehenden Australiern und Melanesiern oder den schon "gebildeteren" Mikro- und Polynesiern wird man diese Eigenschaften finden, wie sie ihnen von uns so oft und gern angehängt werden. Der Eingeborene geht nicht gedankenlos durchs Leben; er ist ein kritischer Beobachter mit recht gesundem Urteil, der z.T. für sich recht brauchbare Lebensweisheiten herausgefunden hat. Dafür sprechen die Märchen, und findet man Widersprüche, so entspricht das ebenfalls dem Wesen des Eingeborenen, der sich in seinem täglich erneuten harten Kampf ums Dasein, mit der Natur, seiner Umgebung, den Menschen noch nicht zu einem abgeklärten Denken durchringen konnte. Herrlich ist das Heimatsgefühl, das aus den Märchen spricht, die Liebe und Anhänglichkeit zur Scholle, wo er geboren wurde und aufwuchs. Für seine geistige Regsamkeit zeugen auch die Wortspiele, die gern von ihm verwendet, von uns aber schwer wiedergegeben werden können. Daß die Naturkräfte als solche personifiziert sind, ist verständlich; doch die reichste Phantasie stellt sich uns in den freigeschaffenen Gestalten vor, die der Eingeborene aus losgelösten Eigenschaften und Organen vorhandener Wesen oder aus Teilen solcher zu einem neuen Wesen zusammenstellt, und die er dann als Einheit empfindet. Seine abergläubischen Vorstellungen kommen ihm dabei zu Hilfe. Gedachtes und Erlebtes wird kombiniert, und es offenbart sich daraus eine neue Welt, der eigenen ähnlich, doch von andersgearteten Wesen belebt: guten und bösen Zauberern, Ungeheuern, Fabelwesen, Riesen, Zwergen usw., wobei man gelegentlich die Erfahrung macht, daß auch diese letzteren auf recht reale Vorbilder, z.B. frühere Bewohner der Inseln oder angetriebene Verschlagene, Europäer u. dgl. zurückgehen, an die das Erinnerungsbild so verblaßte, daß sie zu den Fabelwesen der Märchen wurden. Andererseits verbirgt der Eingeborene in den Erzählungen auch niemals die Schattenseiten seines Charakters. Seine Grausamkeit, Verlogenheit, Rachsucht usw. verhehlt er keineswegs; und seine Derbheit ist auch nicht gering. Ihm sind naturalia non turpia. Wohl besitzt er ein ausgeprägtes Schamgefühl. Nur die Grenze liegt an anderer Stelle wie bei uns. Aus seiner Nacktheit erklärt sich vieles. Und so dürfen wir unsere Anschauungen über das, was wir obszön nennen, hier nicht zur Anwendung bringen. Seine Denk- und Gefühlsempfindungen sind dort weniger gehemmt, der Eingeborene ist den Affekten stärker hingegeben. Auch in diesen Märchen sind manche Anstößigkeiten vorhanden, aber sie sind weit davon entfernt, als solche wirken zu wollen – im übrigen sind sie an den betreffenden Stellen erheblich in unserm Sinn gemildert worden.
So einfach wie die Erzählweise ist der Aufbau des Märchens nicht. Überschrift und Titel fehlen meistens; sie wurden von mir hinzugefügt. Der Eingeborene benennt sie gewöhnlich nach den beiden ersten Gestalten der Erzählung, die durchaus nicht die Hauptpersonen zu sein brauchen (s. Nr. 43). Die handelnden Personen werden der Reihe nach vorgestellt, dabei wird eine möglichst genaue Familiengeschichte gegeben, Personen werden aufgezählt, Nebendinge berichtet, die mit dem eigentlichen Kern der Geschichte nichts zu tun haben. Das ist eine von den vielen Eigenarten des Eingeborenen: einmal die Lust am Erzählen selbst, dann das Vertiefen und Abschweifen in Kleinigkeiten. Zum Unterschied von unseren Märchen besitzt das Eingeborenen-Märchen nicht immer eine innere Einheit, sondern stellt nur ein äußeres Aneinanderreihen von einzelnen Begebenheiten dar, die locker miteinander verbunden werden und sich um eine oder mehrere Personen gruppieren; Bestandteile verschiedenster Herkunft werden miteinander vermischt, die Lieblingsgedanken eines oder mehrerer Erzähler zu einer nach außen hin oberflächlich als Einheit sich darstellenden Geschichte vermengt. Scharf gezogene Grundlinien, nach denen der Aufbau des Märchens sich zu richten hätte, gibt es nicht; in diesem Büchlein mögen die vorgelegten Märchen gelegentlich solche vortäuschen, sie sind aber auch aus der großen Fülle nach Gesichtspunkten ausgewählt, die mehr unserem Geschmack entsprechen. Wirre Wege, die nun einmal die Phantasie einschlägt, lassen sich nicht in ein System bringen; das wird man trotz der Auswahl immer wieder festellen können (z.B. Nr. 63). Dazu kommt, daß die Phantasie in unsern Märchen frei im Erdichten ist, während bei den Eingeborenen-Märchen das Entgegengesetzte zutrifft. Hier stimmt die Phantasie mit der herrschenden Weltanschauung überein, sie glaubt im Grunde an ihre Vorstellungen und wird durch die Grenzen der Möglichkeit bestimmt (im Eingeborenen-Sinn), die ihr durch die Natur- und Lebensauffassung gezogen sind. Bemerkenswert bleibt schließlich auch, daß zum Unterschied von unseren Märchen die direkte Rede sehr viel seltener von den Eingeborenen verwendet wird. Er gibt der indirekten entschieden den Vorzug und wirkt damit freilich auf den Hörer leicht ermüdend. Selten werden längere Reden eingestreut; erstens beschränkt sich die Verwendung der direkten Rede auf kurze eingestreute Sätze, Fragen, Antworten, die dann allerdings von den Eingeborenen besonders hervorgehoben werden sollen.
Frobenius nennt einmal mit vornehmlicher Berücksichtigung des Eingeborenen-Märchens: das Märchen "in Geschichtenform konzentrierte Anhäufung von Naturerfahrung". Befragen wir unsere Märchen danach, so bestätigen sie dies Urteil in den meisten Fällen. Man muß dabei beachten, daß das primitive Bewußtsein überhaupt eine Neigung zur konkreten Auffassung, zur Beziehung des Allgemeinen auf ein Konkretes besitzt. Sie berichten, wie z.B. ein Tier seine eigentümliche Form oder besondere Eigenschaften erhielt (Nr. 12), sie erzählen ähnliches von den Pflanzen (Nr. 4), über die Entstehung eigenartiger Geländeformen (Nr. 9), Berge, Bäche, Flüsse, Seen, Inseln usw., sie stellen die Beziehungen zwischen Mensch, Tier und anderen Objekten (Nr. 17) dar, die sich zunächst gleichwertig gegenüberstehen, denn für den Primitiven gibt es nichts Unmögliches, und lassen schließlich den Menschen siegreich zur Herrschaft kommen; Verwandlungen in Tiere, Bäume, Steine gelten dann als Strafe. Vorzüglich teilen die Märchen Vorgänge am Himmel mit; als handelnde Personen stellen sich Sonne (Nr. 70), Mond (Nr. 54), Sterne (Nr. 43), Blitz, Donner usw. vor. Zum Teil sind diese Märchen rein ätiologischer Natur, dann wollen sie auch den Einfluß auf das Eingeborenenleben dartun. Sie stehen vielfach im Zusammenhang mit dem Kultus (Nr. 9), dem Zauber, den Stammesüberlieferungen usw. Weiter läßt sich das Märchen aus über den Ursprung auffälliger biologischer Erscheinungen, wie z.B. den Tod, (Nr. 5, 15, 40, 70); überhaupt geht man gern der Ursache für die Entstehung der Dinge nach, die den Einzelnen unmittelbar angehen, und kleidet die gewonnenen Anschauungen in das Märchengewand. Sie sind dabei schon an bestimmte Orte, Zeitalter, Personen gebunden, unter denen bestimmte Helden, z.B. die "Heilbringer", welche das Feuer bringen (Nr. 70), neues Geld verschaffen (Nr. 41), von Plagen erlösen (Nr. 65) usw. beliebte Gestalten sind. Auf der tieferen Stufe ist dieser Heilbringer meistens ein Fabelwesen, während er auf der höheren einen historischen Kern in sich birgt. Zu solchen Heldensagen, in denen vielfach eine oder mehrere übermenschliche Persönlichkeiten mehr oder weniger deutliche stern-, mond- und sonnenähnlichen Charakter besitzen, sind auch die Weltschöpfer- und Sintflutsagen (Nr. 31) zu zählen, an denen die Südsee so reich ist, und die bei den meisten Inseln mit ihren besonderen Ortseigentümlichkeiten, eigenartigen und interessanten Abweichungen von der einheitlichen Grundgeschichte auch bemerkenswert sind. Beliebt sind die Märchen mit moralischem Inhalt (Nr. 3), die praktische Nutzanwendungen hervortreten lassen – überwiegend sind diese negativer Natur und erläutern, wie man etwas nicht machen soll (Nr. 16, 30), dann erklären sie Sprichwörter (Nr. 55) oder heben einfache Gegensätze hervor: Schlauheit gegen Dummheit (Nr. 58), Gewandtheit gegen Ungehorsam usw. Gelegentlich führt auch die Sprachmetapher zur Entstehung des Märchens, das um dieselbe herum aufgebaut wird (Nr. 22). Dem Wettmärchen begegnen wir in Nr. 44 u. 66, dem Glücksmärchen in Nr. 62 und dem Scherzmärchen in Nr. 13 u. 18.
Es führt zu weit, alle Motive und besonders gefallenden Ausdrucksformen im einzelnen anzuführen. Beim Lesen der Märchen, deren aus äußeren Gründen notwendig gewordene Anordnung nach geographischen Gesichtspunkten gleichzeitig auch gewissermaßen die innere Entwicklung des Eingeborenen-Märchens in der Südsee zeigt, werden außer den eben genannten Bestimmungen und Motiven noch andere auffallen. Ich möchte jedoch hier nur kurz einige den Südseemärchen besonders eigentümliche Ausdrucksformen erwähnen, und dann zum Schluß auf die Berührungspunkte und Ähnlichkeiten dieser Märchen mit unsern hinweisen.
In unsern Märchen spielt zum Beispiel die Dreizahl eine große Rolle; zweimal versucht der Held meistens vergeblich, sein Ziel zu erreichen, beim drittenmal gelingt das Vorhaben. In der Südsee tritt die Vier an ihre Stelle2: z.B. in Nr. 27 erhält der Mann erst beim vierten Versuch die rechte Frau, macht in Nr. 47 der böse Taile vier Verwandlungen und vier Rückverwandlungen durch, werden in Nr. 70 die vier "heiligen Fragen" gestellt, die sich in ähnlicher Weise in Nr. 63 wiederholen. Bemerkenswerten Variationen des Motivs "übernatürliche Geburt" begegnen wir in Nr. 48 (Ponape) Nr. 30 und Nr. 41. Die Anwesenheit des begehrten Mädchens wird dem fernen Liebhaber, der es noch nie gesehen hat, durch das vom Körper beim Baden ins Wasser abfließende Öl verraten (Nr. 48 u. 49). Bäumen, die in den Himmel wachsen und den Aufstieg von der Erde ermöglichen, treten uns in Nr. 7 u. 54 entgegen. Aufsteigender Rauch oder die Schleuder sind ebenfalls als Verkehrsmittel zum Himmel in den Südseemärchen sehr beliebt. Eine besondere sprengende und hinderniswegräumende Zauberkraft wird dem Flatus zugeschrieben (Nr. 13, 18 u. 46), dessen ursprüngliche Bedeutung jedoch in seiner Wirkung als Geisterschreck und Tod liegt, wie aus manchen Märchen der Salomon-Inseln hervorgeht. Die hier genannten wenigen besonderen Ausdrucksformen in den Südseemärchen sind, wie die Hinweise auf die verschiedenen Stücke zeigen, nicht auf einzelne Gebiete und Örtlichkeiten eng beschränkt, sondern haben zum Teil eine weite Verbreitung erfahren. Mit ihnen auch viele Märchen. Sie verwenden allerdings durchaus nicht immer dieselben Ausdrucksformen; sie verwenden und verquicken sie mit den Motiven nach Belieben; es kommen damit die verschiedensten Lesarten zum Vorschein, die einander in der Erzählweise bald mehr, bald weniger ähnlich, doch stets das gleiche gewählte Thema behandeln. Zum Beispiel die Sintflut (Nr. 11, 31, 71) oder die Fahrt der Tiere auf dem Wasser, die in der mitgeteilten Form (Nr. 52) in der gleichen Form auf Samoa, Neu-Hebriden und den Marshall-Inseln wiederkehrt, und von der Nr. 18 eine andere Lesart aus der Torres-Straße wiedergibt.
Damit berühre ich die Wanderungen des Märchens in der Südsee. Die sprachlichen und anthropologischen Eigenschaften, zum Teil auch die stoffliche Kultur weisen für die Südseevölker auf ein einheitliches Ausgangsgebiet hin, dessen genaue Lage heute noch nicht festzulegen ist, das man sich jedoch zumeist in Nordost-Indien und Hinter-Indien zu denken hat, und das sich im Laufe der Zeit weiter nach Süden auf die indonesische Inselwelt verschob, von wo aus dann in geschichtlicher Zeit die Abwanderungen der heutigen Südseebewohner nach Osten erfolgten. Damals mag auch eine große Menge von Urformen der Märchen mitgenommen sein, die später zu den verschiedensten heute zu erhaltenen Geschichten zusammengeschlossen wurden. Den regen Verkehr der Südseebewohner mögen einige Beispiele dartun. So bestand ehemals zwischen Tahiti und Hawaii, Samoa und Neu-Seeland ein regelmäßiger Verkehr; Schiffsverbindungen bestanden ferner in Etappen vom äußersten Südosten der Südsee bis nach den Philippinen, Indonesien und Südost-Asien (Paumotu – Tahiti – Tonga – Fidji – Ellice-Gruppe – Gilbert-Inseln – Karolinen sei als ein Verbindungsweg mit seinen wichtigsten Verkehrspunkten genannt); sie führten dazu, daß sich die stofflichen Kulturerrungenschaften ebenso wie die geistigen Fortschritte von Volk zu Volk mitteilten und verbreiteten. Die Berücksichtigung dieser ethno-geographischen Verhältnisse wird der Märchenforschung ihre Arbeit wesentlich erleichtern, da ihr damit zureichende Aufschlüsse über die Wanderung eines Märchens oder seiner Varianten gegeben werden, die meist den lokalen Verhältnissen angepaßt sind. Es sind keine Zufälligkeiten, wenn z.B. (aus den vielen Motiven herausgegriffen) das Sintflutmärchen (Chinesische Märchen Nr. 10) in Nr. 11, 31 u. 71 wiederkehrt, der Krieg der Tiere in Nr. 45 u. 55 beschrieben wird, die Worte des den versteckten Menschen witternden Menschenfressers "ich rieche Menschen" (50 u. 54) auch in andern Märchen (Zaunert, S. 130, Balkan-Märchen Nr. 12, Chinesische Märchen Nr. 8) in ähnlicher Weise und Umständen erscheinen; in vielen Erzählungen der Südsee spielt das Märchen vom Lebenswasser eine große Rolle (Nr. 43 u. 68), so auch bei Grimm Nr. 39, Nordische Märchen (Schweden) Nr. 9; ja das Märchen vom Lebenswasser des Kane (Nr. 68) mutet fast wie eine Übertragung des Grimmschen Märchens an, und kann es auf Grund der alten Quelle doch nicht sein. Dasselbe gilt auch von dem Märchen "Der Herr mit den wunderbaren Dienern" (Nr. 67), das dem Grimmschen Märchen Nr. 81. gleicht. Andere Motive, wie z.B. das der zusammenschlagenden Felsen (S. 191) oder der Kopfgeburt eines Gottes (S. 185), der Doppelnatur der Fledermaus im Tierkriege (Nr. 45), Tischlein deck dich (Nr. 37), besitzen entfernte Ähnlichkeiten mit den gleichen Motiven aus griechischen Märchen; dem Motiv vom blutrotgefärbten Wasser als Verkünder des Todes und der nachfolgenden Aufforderung an den Überlebenden, den Verstorbenen zu suchen und zu erlösen (Nr. 64 aus Samoa) begegnen wir z.B. in den Nordischen Märchen (Schweden) Nr. 6 wieder, ebenso dem Geldstücke von sich gebenden Hahn (Nr. 36 aus Palau), ebenda (Schweden) Nr. 62. Sind diese Motive Zufälligkeiten? Oder entspringen sie einem einmaligen Nachdenken, einmaliger Erfindung? Das wird die vergleichende Märchenforschung, wenn zu dem bekannten europäisch-indischen Material die reichen indonesischen, australischen und ozeanischen Märchenschätze veröffentlicht sind, beantworten können.
Ein Zweck dieses Büchleins ist vollauf erfüllt, wenn es den Märchen gelingt, den Leser dem Verständnis der "Wilden" näherzurücken, auf die angesichts seiner Leistungen hochmütig herabzublicken wir durchaus kein Recht haben. Das wäre ein idealer und gleichzeitig praktischer Zweck! Doch der Eingeborene soll hier nicht allein als "Erzähler" vorgestellt werden, auch als "Bildner" soll er sein Können zeigen. Von den Tafeln abgesehen, ist der übrige Buchschmuck (Initialen, Leisten, Textbilder) nach Vorlagen hergestellt, die der Eingeborene in der Form von Verzierungen an seinem Gerät, Schmuck, Häusern usw. anbrachte oder selbständig zeichnete. Die näheren Angaben darüber sind in den Anmerkungen enthalten.
Manche Stücke werden an dieser Stelle zum erstenmal veröffentlicht. Es sind die Nrn. 25–27, für deren Überlassung ich Herrn Kunstmaler Hans Vogel in Hamburg, und die Nr. 35–41, für die ich Herrn Prof. Dr. Augustin Krämer in Stuttgart zu herzlichem Dank verpflichtet bin. Die Nr. 43–50 (54) sind meinen eigenen Aufzeichnungen entnommen.
Hamburg, am 1. August 1916
Dr.Paul Hambruch
Fußnoten
1 Vgl.Caesar: de B.G. VI. 14.
2 Im Kult, beim Orakel, in der sozialen Gliederung usw. trifft man die Vier oft als wichtige Bestimmungszahl.
Australien
1.Der Kranich und die Krähe
Der Kranich war ein großer Fischer. Er pflegte die Fische unter den Baumstämmen im Flusse mit den Füßen herauszujagen und eine große Anzahl auf diese Weise zu fangen.
Als er eines Tages wieder eine große Menge Fische am Ufer beisammen hatte, kam die Krähe herbei, welche damals noch ganz weiß war. Sie bat den Kranich um einige Fische.
"Warte noch ein wenig," sagte der Kranich, "bis sie gar sind." Aber die Krähe war hungrig und ungeduldig; sie quälte den Kranich fortwährend, doch der antwortete immer wieder: "Warte, warte ein wenig!"
Einmal wandte der Kranich sich um und kehrte der Krähe den Rücken. Da schlich sie beiseite und wollte gerade einen Fisch fortnehmen, als der Kranich sich wieder umwandte. Ärgerlich nahm er einen Fisch auf und schlug der Krähe damit links und rechts welche um die Ohren. Sie war einen Augenblick wie betäubt und konnte nichts sehen. Sie fiel in das verbrannte Gras der Kochstelle und wälzte sich vor Schmerzen. Als sie wieder zu sich kam und davonging, waren nur ihre Augen weiß; ihr Gefieder war schwarz geworden. Und seitdem sehen alle Krähen schwarz aus.
Die Krähe wollte dem Kranich den Streich heimzahlen, weil sie nun weiße Augen und schwarze Federn hatte.
Sie wartete eine Gelegenheit ab. Und als der Kranich eines Tages am Ufer eingeschlafen war und schnarchte, schlich sie sich ganz leise mit einer Fischgräte herbei und steckte sie ihm unter das Zungenbein. Dann machte sie sich ebenso leise wieder davon; ganz vorsichtig, um kein Geräusch zu verursachen.
Schließlich wachte der Kranich auf. Als er den Schnabel öffnete und recht herzhaft gähnen wollte, spürte er ein unangenehmes Gefühl im Halse. Er versuchte den eingedrungenen Fremdkörper durch Räuspern loszuwerden. Es war vergeblich; er vermochte nur sonderbar kratzende Geräusche und Töne von sich zu geben. Die Gräte blieb stecken. Daher ruft der Kranich bis heute mit heiserer Stimme: "Ga-ra-ga, ga-ra-ga!" und die Eingeborenen benennen ihn nun danach.
2.Der Emu Dinewan und die Krähen Wahn
Der Emu Dinewan machte einmal mit seinen beiden Frauen, den Krähen Wahn, einen Ausflug. Unterwegs bemerkten sie, daß die Wolken sich zusammenballten und es bald Regen geben würde. Da trugen sie schnell einige Rindenstücke herbei und machten sich eine kleine Hütte. Und als es anfing zu regnen, schlüpften sie hinein, um nicht naß zu werden. Dinewan wollte seinen Frauen aber einen Possen spielen. Als sie gerade nicht hinsahen, stieß er gegen ein Stück Rinde, so daß es umfiel. Dann sagte er seinen Frauen, sie sollten doch hinausgehen und es wieder aufsetzen. Als sie es taten und draußen waren, stieß er ein anderes Rindenstück um; und kaum waren die Frauen wieder in der Hütte, da konnten sie auch schon wieder hinausgehen. So machte er es viele Male, bis die Frauen schließlich Verdacht schöpften und verabredeten, daß eine aufpassen sollte. Die sah nun, wie Dinewan stets die Rindenstücke wieder umstieß, die sie gerade aufgestellt hatten, und wie er sich bei dem Gedanken vor Lachen bog, daß seine Frauen in die Nässe und Kälte hinaus mußten, um den Schaden zu kurieren, während er trocken und behaglich sein Abendbrot verzehren konnte. Sie erzählte dies der anderen; und nun wollten beide ihm eine gehörige Lektion erteilen. Sie krochen in die Hütte hinein, und jede trug ein Stück Rinde mit glühenden Kohlen. Dinewan wälzte sich gerade vor Lachen; sie gingen aber geradenwegs auf ihn los und sagten: "So, nun sollst du einmal so schwitzen, wie es uns gefroren hat," und damit schütteten sie die Kohlen über ihn. Da sprang Dinewan in die Höhe und schrie laut auf vor Schmerz, denn er hatte sich tüchtig verbrannt. Er fiel über seine eigenen Füße und lief in den Regen hinaus. Diesmal blieben die Frauen in der Hütte und lachten über ihn.
3.Die Fliegen Bunnyyarl und die Bienen Wurrunnunnah
Die Bunnyyarl und Wurrunnunnah waren Verwandte und lebten zusammen im selben Orte. Die Wurrunnunnah waren fleißig und arbeiteten tüchtig, um rechtzeitig viele Vorräte einzusammeln und sie für die böse Zeit der Hungersnot aufzuspeichern. Die Bunnyyarl bekümmerten sich jedoch nicht um die Zukunft; sie vergeudeten die Zeit mit Spielen und Possentreiben und dachten gar nicht daran, ebenfalls Vorräte einzusammeln. Eines Tages sagten die Wurrunnunnah: "Kommt mit und holt den Honig aus den Blumen! Bald ist der Winter da, dann gibt es keine Blumen, und ihr könnt keinen Honig mehr einsammeln!" "Nein," antworteten die Bunnyyarl, "wir haben uns hier um andere Dinge zu kümmern." Sie gingen fort und überlegten sich, was sie nun wohl für neue Dummheiten aufstellen können; sie glaubten ja, daß die Wurrunnunnah nachher doch ihre Vorräte mit ihnen teilen würden. Die Wurrunnunnah taten also die Arbeit allein und überließen die Bunnyyarl ihren Nichtsnutzereien. Sie besuchten alle Blumen, trugen den Honig ein und kehrten nicht wieder zu den Bunnyyarl zurück. Sie waren es überdrüssig geworden, stets alle Arbeit für diese Faulpelze zu tun.
Und später wurden die Wurrunnunnah in kleine, wilde Bienen und die faulen Bunnyyarl in Fliegen verwandelt.
4.Die Blutblume
In der Nacht war Wimbakobolo geflohen und hatte Purleemil, die Verlobte des Tirlta, mitgenommen. Nun war das Geschrei im Lager des Fluß-Stammes groß; die Alten versammelten sich und beratschlagten, wie sie ihn wohl wieder einsangen könnten. Während sie so beisammen saßen, kamen die jungen Leute herbei und erzählten, daß die Spuren der Flüchtigen nach dem großen Boulka-See führten, wo sich gerade eine Jagdgesellschaft aufhielt, die von einem Stamme aus dem Hinterlande entsandt war. Zu diesem Stamme hatte einst auch der Vater von Wimbakobolo gehört.
Da meinten die Alten mit Recht, daß die Flüchtlinge bei diesem Stamm Schutz suchen würden. Sie riefen die waffenfähige Mannschaft herbei und sagten: "Holt eure Waffen, wir wollen zu diesem Stamm ziehen und von ihm die Herausgabe der Flüchtigen verlangen. Wimbakobolo wollen wir erschlagen; Purleemil überlassen wir dem Tirlta; der mag sie dann nach seinem Gefallen töten oder behalten."
In voller Kriegsbemalung und bis an die Zähne bewaffnet zogen sie los. Zwei Tage lang folgten sie der Spur. Am dritten erblickten sie die Lagerfeuer. Sie sandten Boten zum Stamm, die von den Alten empfangen wurden. Sie forderten die Auslieferung von Wimbakobolo und Purleemil.
"O, schickt mich bitte nicht zurück," sagte Purleemil, "schickt mich nicht zum alten Tirlta zurück. Zwei Frauen hat er schon mit seiner Keule erschlagen; ich will nicht die dritte sein." Und sie schluchzte laut.
"Hör auf mit Schreien," sagte Wimbakobolo, "ich gebe dich an niemand heraus, eher töte ich dich selbst mit meinem Speer. Wenn Tirlta ein Mann ist," er wandte sich zu den Alten, "dann soll er mit mir kämpfen. Ich bin bereit dazu, doch er ist ein Feigling. Leute vom Stamme meines Vaters! Bei euch fanden wir Schutz, und ihr gabt uns zu essen, als wir hungrig waren; denkt daran, daß einst mein Vater zu euch gehörte, daß er ein gewaltiger Krieger war und eure Feinde wie Ameisen vernichtete. Wie er für euch kämpfte, wird es sein Sohn in kommenden Tagen tun, wenn ihr ihm nur jetzt helft. Ich habe Purleemil mit den Sternenaugen seit langem geliebt, und ihr Herz hat mir immer gehört. Soll ein Mädchen auf Geheiß von Graubärten sein Herz einem Weibermörder schenken? soll es den Geliebten verlassen? soll es den lahmen Krüppel einem jungen, kräftigen, gutgewachsenen Mann vorziehen? Denkt an meinen Vater, ehe ihr eure Hand von seinem Sohne und den kommenden Enkeln abzieht! Niemals wollen wir wieder zu Tirltas Stamm zurückkehren, nein, eher soll mein Speer Purleemil, meinen Herzensschatz, durchbohren, und mein Blut mit ihrem sich vereinen."
Wimbakobolo richtete sich auf und machte als Krieger, mit den Waffen in der Hand, einen so mächtigen Eindruck auf die Alten, daß sie sagten: "Wir wären ja Narren, wenn wir den Sohn unseres alten Anführers den Feinden auslieferten. Er soll unser Führer sein wie einst sein Vater, und Purleemil wird die Mutter tapferer Krieger; die Sippe des Wimbakobolo ist stark, wie ihr Name es schon besagt, sind es Männer wie Berge."
Dann wandte ein Alter sich zu den Boten und sagte: "Bestellt dem Tirlta, er möge auf das Feld kommen, dort wird er dem Wimbakobolo begegnen, und sie können ihren Zwist auskämpfen. Will Tirlta nicht, dann soll der Feigling nach Hause gehen und dort bleiben. Wimbakobolo bleibt bei uns, und wir liefern ihn an niemand aus."
Die Boten kehrten zu ihrem Stamm zurück; doch kein Tirlta erschien und nahm die Herausforderung an; er ging mit den anderen an den großen Fluß zurück.
Wimbakobolo und Purleemil lebten in Frieden und waren beim ganzen Stamm beliebt, denn er war ein tüchtiger Jäger und sie eine Sängerin lieblicher Lieder.
Nach einiger Zeit, als schon die kalten Winde über den Boulka strichen, brach der Stamm das Lager ab und schlug es weit entfernt davon wieder auf, wo die Bäume mehr Schutz boten und Feuerholz vorhanden war, denn der Winter stand vor der Tür.
Noch vor Winters Ende wurde dem Wimbakobolo und der Purleemil ein Sohn geboren. Als der Stamm sah, was es für ein dickes Kerlchen war, nannte er es scherzhaft "den kleinen Häuptling" und brachte ihm allerlei Geschenke, Spielbumerangs, Wurfbretter und anderes mehr, so daß die Augen der Mutter vor Stolz leuchteten; und der Vater begann schon mit der Anfertigung von Waffen, die der Junge später gegen die Feinde des Stammes gebrauchen sollte, der sie aufgenommen hatte.
Und Purleemil sang neue Lieder, welche die Geister sie gelehrt hatten, von ihrem Söhnchen, das ewig leben und der Schönste in den Gefilden des Hinterlandes sein sollte.
Wenn Purleemil Lieder sang und der Säugling kreischte und lachte, dann sagte der Vater nur wenig; aber er setzte eine so frohe Miene auf, sobald er vom Schnitzen der Waffen mit dem Opossumzahn aufsah und von Zeit zu Zeit nach Weib und Kind hinblickte, daß alle über seinen glücklichen Stolz lächelten, und sich von Herzen freuten, daß die Alten Purleemil nicht ausgeliefert hatten, um die Frau des Weibermörders Tirlta zu werden.
Der Winter ging vorüber; und als der Sommer nahte, machten sich alle fertig, um zu den Jagdplätzen zurückzukehren, wo damals die Flüchtlinge zu ihnen gestoßen waren.
Doch Purleemil sang nicht mehr. Die Geister hatten ihr verkündet, daß bald ein großes Unglück geschehen würde.
"Laß uns hier im Winterlager bleiben," sagte sie zu ihrem Gatten, "wo wir so glücklich gewesen sind. Ich fürchte, wir verlieren unseren kleinen Häuptling, wenn wir fortziehen. Lieber Mann, wir wollen hierbleiben."
"Liebe Frau, das ist unmöglich; der Stamm würde mich einen Feigling schelten, der Angst vor Tirlta hat."
"Und doch, lieber Mann, ist es besser, ein Feigling genannt zu werden – und alle wissen es ja, daß du es nicht bist –, als unsern kleinen Häuptling zu verlieren. Ohne ihn würde unser Leben einsam sein; er ist die Sonne, die unsere Tage erhellt, ohne ihn würden sie ewig dunkel wie das Grab sein."
"Liebe Frau, du hast recht; wo der kleine Häuptling bei uns ist, würde ein noch so langes Leben ohne ihn schrecklich sein. Doch weshalb sollten wir ihn verlieren? Haben die Geister nicht gesagt, er solle ewig auf den Feldern leben? Nun, Geliebte, weshalb wollen wir uns da groß um ihn bangen?"
"Ich vermag es dir nicht zu sagen. Die Geister haben gewiß die Wahrheit gesprochen, und doch sagen sie jetzt – in jedem Lufthauch vernehme ich ihre Stimme –, daß uns ein Unglück bevorsteht."
"Aber doch nicht dem kleinen Häuptling, Purleemil. Vielleicht dem Stamm, der uns aufgenommen hat; und den können wir doch nicht verlassen; und der soll dem drohenden Unglück nicht allein entgegentreten. Komm nur mutig mit, Mutter vom kleinen Häuptling, sonst trinkt er noch Furcht an deiner Brust!"
Da drückte Purleemil das Kind an sich und sprach nicht mehr von ihren Befürchtungen. Und als die Tage fröhlich in dem neuen, und doch alten Lager dahin flossen, waren bald alle Ängste vergessen, und die Geister stellten die Warnungen ein.
Als eines Nachts der ganze Stamm, der die drohende Gefahr nicht ahnte, fest eingeschlafen war, da umzingelten die Feinde, die nur auf eine gute Gelegenheit gewartet hatten, das Lager. Näher und immer näher schlichen sie sich unter der Führung des Tirlta heran. Er war ein zu großer Feigling, um den offenen Kampf zu wagen; er schlich sich nachts wie ein Dingo ins Lager und wollte die hinterrücks töten, die ihm seine Beute, die Purleemil, entrissen hatten. Ja, sie sollte erschlagen werden, und mit ihr die übrigen Männer, Frauen und Kinder; alle, alle, sollten sie seinem Haß geopfert werden. Er hatte sich seinen Plan gut ausgedacht; er hatte so lange gewartet, bis alle Befürchtungen vor einer Rache eingeschläfert und die Wachsamkeit vernachlässigt worden waren.
Ganz lautlos krochen sie näher und immer näher heran ...
Der kleine Häuptling fuhr im Schlaf auf. Purleemil beruhigte ihn wieder und erzählte ihm von den Geistern, die gesagt hatten, daß er ewig auf den Feldern leben und der Herrlichste, Schönste sein sollte; da war er bald wieder still, und auch die Mutter schlief wieder ein und schmiegte sich näher an den so heißgeliebten Wimbakobolo heran. Sie ahnte nichts von der drohenden Gefahr.
Zu ihren Füßen heulte ein Hund, und Wimbakobolo fuhr aus dem Schlaf in die Höhe; und wieder heulte der Hund; da stand Wimbakobolo auf; doch kaum hatte er sich erhoben, da fällte ihn ein tödlicher Schlag von Tirlta zu Boden. Der Feind fiel in das Lager ein und erschlug die meisten Schläfer an Ort und Stelle; nur einige fanden noch Zeit, ihre Waffen zu ergreifen, doch sie verteidigten sich vergeblich.
Tirlta hatte schon seit Tagen die Hütte von Purleemil ausgekundschaftet. Er hatte sich ihren Gatten zum Opfer auserlesen. Als er ihn getötet hatte, durchbohrte der Teufel den kleinen Häuptling mit seinem zackigen Speer.
Als Purleemil, die liebliche Sängerin, ihren Gatten und das Kind vom Speer des Feindes durchbohrt tot neben sich erblickte, versagte ihr die Stimme im Halse. Sie entwandte dem Tirlta den Speer und stieß sich die Spitze, die den Leib ihres Kindes durchdrungen hatte, in das eigene Herz. Mit dem kleinen Häuptling so fest verbunden fiel sie tot über den Leichnam ihres Gatten hin, und das Blut der drei floß zu einer Lache zusammen.
So vollzog sich die Rache des Tirlta. Keiner vom Stamme, der den Flüchtlingen Obdach gewährt hatte, war am Leben geblieben. Tirlta und sein Stamm überließen die Erschlagegen den Habichten und Krähen und kehrten nach Kallawalla zurück.
Im Jahr darauf wollten sie auf den Jagdgründen ihrer toten Feinde jagen. Als sie dort ankamen, schlugen sie ihr Lager in einiger Entfernung von dem Platze auf, wo das Gemetzel stattgefunden hatte, damit die Geister der Toten sie nicht belästigten.
Nachts sah man seltsame Lichter an der Stelle, und sie dachten, daß die Geister abwesend wären.





























