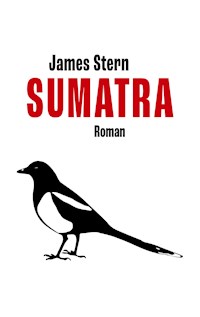
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Rucksack und Wanderstab macht sich der Ich-Erzähler im Frühsommer des Jahres 1976 zu Fuß auf den Weg zu seinem Idol, dem zurückgezogen lebenden Schriftsteller Gadamer, dabei stets die ruhigen Feldwege und Schatten der Waldränder suchend, weit abseits tosender Autobahnen und lärmiger Großstädte. Die Begegnung mit einer Gruppe asiatischer Puppenspieler beeinflusst seine Reise dabei mehr, als er ahnt, und während er sich auf seinem Weg alleine wähnt, führt ihn dieser vielleicht sogar über einen doppelten Boden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
I
"Der Sechsundsiebziger wird ein Jahrhundertjahrgang", schloss der Professor seinen Vortrag über die zu erwartende diesjährige Weinlese. Seine Fingerspitzen tänzelten über den Rand seines Glases, in dem der Rebensaft strohgelb schimmerte. "Es ist keinesfalls noch zu früh, dies vorauszusagen", setzte er noch wie rechtfertigend hinzu, und ich nickte nur, nickte kurz und stumm, froh darüber, dass dieses Thema, das mich nicht interessierte, beendet schien, widmete mich hingegen dem Ausblick von der Hotelterrasse hinunter über die Weinberge, zwischen denen der Fluss mit der untergehenden Sonne zu einer flüssigen Glut verschmolz. Die Frau des Professors studierte darüber ohne falsche Scheu und in Erwartung, dass ich mich ihr zuwenden würde, mein Profil – ich sah dies nicht, spürte es dafür umso deutlicher, während ich aus den Augenwinkeln wahrnahm, dass sie beiläufig den Stiel ihres Glases zwischen den Fingern drehte, so wie er und sie überhaupt die Angewohnheit hatten, mit den jeweils vor ihnen stehenden Trinkgefäßen zu spielen.
Allein unter Weinkennern: Wie befremdlich für jemanden wie mich, der sich aus Alkohol nichts macht und der immer mit leiser Geringschätzung auf jene Mitmenschen hinunterzusehen pflegt, die ohne nicht leben können. Aber dieses Beisammensein schien unvermeidlich, seit ich den beiden zum ersten Mal begegnet war, unmittelbar nachdem ich gestern Nachmittag das Hotel betreten hatte und mich im schwitzgrauen Hemd, schmutzblauer Jeans und verkrusteten Wanderstiefeln an der Rezeption der Gnade und den pikierten Blicken des diensthabenden Mitarbeiters ausgeliefert fand, während sie und er gerade ihren Schlüssel holten und sie mich mit amüsiert hochgezogener Augenbraue und dem natürlichen Selbstverständnis der mondänen, eleganten Endvierzigerin unverhohlen gemustert hatte. Schon am gleichen Abend war es im Restaurant zu einer erneuten Begegnung gekommen, aber nicht sie, sondern er machte überraschenderweise den Anfang, stand mit einem Mal an meinem Tisch, entschuldigte sich, stellte sich vor, erkundigte sich, ob ich der sei, den er glaubte schon an der Rezeption erkannt zu haben, und ich ward, nachdem ich dies bejahen konnte, an ihren Tisch eingeladen. An diesem ersten Abend war er noch der Gesprächigere von beiden gewesen, hatte die zunächst lau plätschernde Unterhaltung sanft, aber mit unverkennbarem Nachdruck, auf den von ihm gewünschten Kurs manövriert, war schließlich in sein Fahrwasser gelangt, hatte ausdauernd und mit sichtlichem Genuss am Klang der eigenen Stimme über Künstlerisches, Wissenschaftliches, und natürlich, um mich mit seinem fachlichen Durch- und Überblick zu beeindrucken, auch über meine Disziplin, die Literatur, doziert, fürderhin über seine Karriere, seinen Lebensweg, seine Jugend, hatte insbesondere bei Letzterem immer ausgiebiger dem Wein zugesprochen und mich dabei offensichtlich im Lauf des Abends so sehr ins Herz geschlossen, dass er sich schließlich, kaum dass man sich drei Stunden und noch mehr Flaschen Wein lang kannte, zu dem Geständnis verrannte, dass ich der Sohn sein könnte, der ihm nie vergönnt war. Das darauffolgende Schweigen war von durchaus betretener Natur gewesen – hauptsächlich ihres und meines –, es war danach höchste Zeit, die Runde aufzulösen, und nach einem feierlichen Eid, auch am nächsten Abend wieder bei Tisch präsent zu sein, war ich als Sohn zunächst entlassen. Sie packte ihn mit sicherem Griff am Arm und manövrierte ihn aufs Zimmer, ich trollte mich auf meines, und die junge Familie begab sich zur wohlverdienten Nachtruhe. Meinen Schwur konnte ich trotz der unangenehmen Offenbarung kaum brechen; ich musste notgedrungen zwei Tage im Hotel bleiben, um meine Wanderausrüstung zu säubern und Kleidung zu reinigen, also hätte ich mich vor den beiden verstecken oder eine Ausrede erfinden müssen. Zwar verspürte ich wenig Drang danach, die Monologe des Professors sowie seine Sitten und Unsitten des Trinkens nochmals einen ganzen Abend lang zu ertragen, aber wenn ich zugesagt hatte, dann nur, weil ich höflich sein wollte, weil ich auf meiner Wanderung bislang nicht viel Bekanntschaften geschlossen hatte, und weil mir die sporadischen Blicke seiner Frau einfach Spaß machten.
Er war jedoch heute weit zurückhaltender als am Vortag, entweder war ihm sein gestriges Geständnis, sofern er sich daran erinnern konnte, peinlich, oder er begann die Blicke seiner Frau, die nicht ihm galten, zu bemerken. Nicht, dass sie schamlos flirtete, im Gegenteil, sie arbeitete sehr subtil, aber gerade deswegen musste er es als doppelt gemein empfinden, und ich gab mir Mühe, nicht darauf einzugehen, es lag mir fern, eine – immerhin, wie mir stolz zugetragen wurde, im silbernen Jubiläum stehende – Ehe zu gefährden, übte mich also in ritterlicher Zurückhaltung und gab vor, ihre Avancen nicht lesen zu können. Vielleicht maß ich dem allem auch zu viel Gewicht bei, vielleicht dachte sie sich gar nichts bei ihrem Tun – was ich selbst nicht glaubte, sie dachte sich wohl etwas –, und ich überlegte, ob dies nur eine achtlose Gewohnheit von ihr war, und ob er, lang verheiratet und weitgereist wie sie waren – und im Hinblick auf den Altersunterschied –, sich damit nicht schon grundsätzlich abgefunden hatte. Unglücklich wirkten sie oberflächlich betrachtet keineswegs, sie gaben sich als eingespieltes Team, welches sich mit Reisen die Zeit vertrieb – aber man fragt sich natürlich, wieviel Reiz, wieviel Anziehung, wieviel Zuneigung noch besteht, wenn ein Paar im Lauf der Jahre zu einem Team zur Bewältigung der Aufgaben des Alltags gefroren war, in dem jeder nur noch die ihm zugedachten Tätigkeiten verrichtete und alles auf kaltes Funktionieren und fehlerfreie Routine hinauslief.
Der Professor musste fünfundzwanzig Jahre und einige Hektoliter Riesling jünger durchaus einmal passabel ausgesehen haben, jetzt allerdings gab er im ausgeleierten Fischgrätsakko, mit dünnem Haarkranz und von zu viel praktischer Beschäftigung mit seinem Steckenpferd dauergerötetem Gesicht eine eher drittklassige Figur ab. Warum man so oft nette, jüngere Frauen sich an komische, ältere Männer ketten sieht, war mir seit jeher und auch in diesem Fall ein Rätsel: Junge Studentin schmeißt kurz vor dem Abschluss für ihren Professor das Studium hin, es wird geheiratet, und sie konzentriert sich fortan auf die Rolle der Dame des Hauses. Ihn stellte ich mir zu jener Zeit vor als den stets väterlich Mahnenden, mit sonorer Stimme und gönnerhaftem Wohlwollen die Hand liebevoll schützend über ihre mädchenhafte Ausgelassenheit haltend, bis sich im Weggang der Zeit die Pole umgekehrt hatten und sie es nun war, welche schützte, führte und kontrollierte. Anzeichen von Zärtlichkeit oder einfach nur leise glimmende Reste ehemals glühender Liebe vermochte ich keine zu erkennen: kein Kuss, keine Umarmung, keine Herzlichkeit, kein verliebter, geschweige denn freundlicher Blick, nicht mal eine Berührung, nichts. Und doch: Irgendwann musste es einmal Liebe gewesen sein.
"Was glauben Sie, wird Gadamer machen, wenn Sie an seine Tür klopfen?" fragte sie, mit ihren langen schlanken Fingern das Weinglas liebkosend.
"Ich hoffe, er öffnet sie und wird mich hineinlassen", antwortete ich.
"Und wenn er Sie nicht hineinlässt? Was machen Sie dann?"
"Ich sage ihm, dass ich nicht wochenlang durch das halbe Land renne, um mir am Ende die Tür vor der Nase zuschlagen zu lassen."
"Rufen Sie ihn doch an. Warnen Sie ihn vor."
"Damit erschrecke ich ihn nur. Er würde sich verbarrikadieren."
"Er hat sich doch längst verbarrikadiert! Es heißt, er hätte Mauern und Stacheldraht ums Haus."
"Das habe ich auch gehört. Und er frisst Journalisten und kleine Kinder."
Sie setzte das Glas an die Lippen, trank langsam, ließ mich dabei nicht aus den Augen und lächelte durch das Glas hindurch. Ein paar Strähnen ihres rotbrünett flimmernden Haars fielen ihr in die Stirn.
"Aber wenn er wirklich nicht öffnet", sagte sie dann, "sind Sie wochenlang für nichts durch Wälder und Wiesen gestapft."
Der Professor rutschte unruhig auf seinem Platz hin und her, wusste nicht wohin mit seinen Händen, legte die eine auf die Tischplatte, die andere aufs Knie, stierte nervös hinaus in die Landschaft, tat es schließlich seiner Frau gleich und fingerte am klebrigen Stiel seines Weinglases herum. Dann fand er neue Ablenkung, griff zum Salz- und Pfefferstreuer und ließ die beiden Gefäße im Zweivierteltakt aneinanderklacken. Sie missbilligte sein Tun mit einem giftigen Seitenblick, den er ignorierte.
"Wissen Sie, was das Faszinierendste ist an Gadamer?" wandte sie sich wieder mir zu. "Seine Stimme. Haben Sie mal seine Rundfunkaufnahmen aus den fünfziger Jahren gehört? Was für ein wunderbarer, warmer Bariton. Er sollte Platten aufnehmen. Ich würd' sie alle kaufen und mich nur am Klang berauschen."
Der Professor vergaß für einen Moment den Zweivierteltakt, ließ die Perkussionsinstrumente ruhen und mischte sich lautstark ein: "Platten aufnehmen, was ist das denn für ein Unsinn. Er ist doch Schriftsteller, kein Sänger."
"Ich meine Sprechplatten!" wehrte sie sich. "Er könnte seine Romane doch auf Platte sprechen. Mit dieser Stimme…"
"Nein, nein, nein. Bedenke doch, so ein Roman hat vielleicht fünf- oder achthundert Seiten, das dauert ja Stunden, wenn nicht Tage, bis das alles vorgelesen ist. Und das passt doch alles gar nicht auf eine einzige Platte. Eine Schallplatte hat doch kaum mehr als eine Dreiviertelstunde oder höchstens eine knappe Stunde Spielzeit."
"Na und? Dann soll er halt fünf oder acht Platten besprechen. Mir wäre das egal. Je mehr, desto besser."
"Es gibt Autoren, die das gemacht haben, so ungewöhnlich ist das ja nicht, aber nicht mit ganzen Romanen, sondern mit Erzählungen und Gedichten. Das hat alles durchaus seine Berechtigung. Ich hingegen glaube – und du kannst mich dafür gern altmodisch nennen –, dass die Schriftsteller auch heutzutage, in diesem technischen Zeitalter, immer noch darauf vertrauen, dass die Leserschaft genau das kann, was ihren Namen ausmacht, nämlich lesen, und nicht darauf angewiesen ist, sich vorlesen zu lassen. Dir sitzt ein Schriftsteller gegenüber, bitte frag ihn."
Er vermied es, mich bei diesen Worten anzusehen, schenkte sich Wein nach, hob das Glas ins Licht, schwenkte es mit prüfendem Blick. "Sprechplatten, was für ein Unsinn", setzte er noch unwillig nach und trank in großen Schlucken.
"Ach was", sagte seine Frau, "du wirst sehen, in zehn oder zwanzig Jahren gibt es keine Bücher mehr, und wir haben alle nur noch Sprechplatten zuhause. Goethe, Schiller, Gadamer. Gesamtausgabe. In Stereo. Und die Umwelt profitiert auch davon, wenn kein Baum mehr für Fontane sterben muss."
"In zehn oder zwanzig Jahren", brummelte der Professor und setzte das geleerte Glas ab, "wenn ich da noch auf diesem Planeten weilen sollte, dann werde ich genau wie heute mit einem zwischen Buchdeckeln gebundenen Packen Papiers ins Bett gehen, und nicht mit einer Scheibe aus Vinyl. Punktum."
Sie zischte irgendwas, wischte seinen Kommentar mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite und rückte näher zu mir. "Und Sie wollen wirklich den ganzen Weg bis vor Gadamers Haustür zu Fuß gehen? Nicht mal ein bisschen schwindeln zwischendrin und den Zug nehmen? Auch wenn‘s regnet?"
"Zu Fuß", bestätigte ich. "Auch im Regen."
"Warum machen Sie es sich denn so schwer? Suchen Sie immer die schwierigen Wege im Leben? Wenn ich mir das so vorstelle, zu Fuß über hunderte Kilometer bei jeder Witterung… Sie machen das doch nicht nur aus Spaß. Was für eine Art von Sinnsuche ist das?"
"Eine Sinnsuche ist es überhaupt nicht. Ich wollte immer schon eine lange Wanderung unternehmen."
"Und schreiben Sie ein Buch darüber? Ihr Verlag ist doch bestimmt schon ganz gierig darauf."
"Der Verlag weiß davon nichts, bislang ist das alles nur zu meinem privaten Vergnügen. Aber ich führe ein kleines Notizbuch und fotografiere. Vielleicht wird es ja ein schönes Fotoalbum."
"Aber Sie werden sich doch nicht jeden Tag ein Hotel wie dieses leisten können?"
"Das ist auch gar nicht meine Absicht. Billige Gasthöfe oder eine Scheune ab und zu reichen mir, und wenn‘s gar nicht anders geht, dann eben im Schlafsack."
"Hörst du das?" Sie stupste begeistert ihren Mann an, doch eigentlich war es kein Anstupsen, es war ein Anrempeln, eine durchaus grobe, gemeine Bewegung mit dem Ellenbogen, die ihn nicht nur wachrütteln sollte, sondern auch sagte: Sieh dir an, was dieser junge Kerl alles macht, und dann schau dich an, du lahme Ente, mit der schon lange nichts mehr los ist. Der Professor jedoch erging sich lediglich in stoischer Miene und trotzigem Schweigen.
"Sie sind ein Romantiker", sagte sie sanft, ihr Knie an meinem Oberschenkel reibend.
"Ich habe von Gadamer nichts gelesen", polterte der Professor dazwischen, sich in weingetränkter Entrücktheit wacklig nachschenkend, und es war ihm anzuhören, dass er beim Sprechen mittlerweile deutlich Mühe hatte, seine Zunge zu finden. "Oder ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht… und Sie wandern zu ihm, weil Sie ihn verehren?… Das sind biblische Dimensionen, wahrhaftig: Der Jünger sucht seinen Meister, nimmt dafür eine lange, entbehrliche Reise auf sich… eine Wallfahrt, und wird zum letzten Wanderer dieses Landes… der Wanderer, eine aussterbende Art… nein, eine ausgestorbene Art! In unserer Zeit ein Unikum, ein Anachronismus, ein Ding von gestern… ein Ding fürs Museum eigentlich. Und deswegen so schützenswert. Auf Ihr Wohl!"
Er hob das Glas, starrte verhangenen Blickes durch mich hindurch und rief: "Ein Prosit dem letzten Wanderer. Mögen Sie stets auf dem richtigen Weg bleiben." Er trank, trank aus, lehnte sich zurück und sackte mit geschlossenen Augen, das Glas im schlaff werdenden Griff, leise schnarchend zur Seite.
II
Einmal noch hielt ich inne, als ich am frühen Morgen vor dem Hotel stand, ließ Gedanken und Blick hinunter über Fluss und Weinberge wandern, trottete dann die Hotelzufahrt hinunter, immer hügelabwärts, und gelangte auf die Straße, die in den Ort hineinführte. Keineswegs schritt ich eilig aus, eher im gewohnten, gemächlichen Takt des Wanderers, der Zeit, Muße und ein Auge für die Details am Wegesrand hat, erreichte bald die Ortsmitte, wo ich mich nach Norden, meiner Zielrichtung, wandte, und auf den Ortsausgang zusteuerte. Noch am Ortsschild verließ ich den gepflasterten Untergrund und wanderte auf Feldwegen zwischen schossendem Weizen, immer die Sonne im Blick behaltend, um auf Kurs zu bleiben. Ein starker Ast, den ich mir am Waldrand brach, leistete mir als Wanderstab Dienst. Die Witterung gab sich mild, der Himmel glänzte, das Land lag still und menschenleer. Gesellschaft leisteten mir nur lärmige Sperlingsschwärme oder ein paar Krähen, die auf den Feldern zwischen den Schösslingen tänzelten und scheinbar gleichgültig abzogen, wenn man ihnen zu nahe kam. Die Landschaft spannte sich vor mir wie ein Aquarell: vorne kräftige, deckende, am Horizont dunstige, flüchtige Farben. Das einzige konstante Geräusch war das meiner Schritte auf wechselnden Untergründen: Mahlend auf Kies, knisternd im Gras, knirschend auf Asphalt. Dazwischen störte ab und an das Dröhnen einer Autobahn oder einer Landstraße, welche ich wie immer so weit wie möglich zu umgehen suchte, keine Trübung meiner Vorstellung einer makellosen, nur aus Wegen, Hecken, Wäldern und grünen Ebenen zusammengesetzten Landschaft duldend.
Zwei Dörfer lagen am Weg. Im ersten erstand ich eine Flasche Wasser, das zweite ließ ich buchstäblich links liegen und visierte einen Ort an, den ich nach Kartenstudium und überschlagener Kopfrechnung zur Mittagszeit erreichen würde. Hinter einer Baumgruppe verborgen fand ich einen idyllisch schilfumrankten Weiher vor – doch die Idylle war nur Illusion, denn eine Abteilung Stahlfachwerkriesen, dem Stromtransport dienend, beherrschte mit ausgebreiteten Armen den Horizont, und unsichtbar, aber in Hörnähe, tuckerten Züge über einen Bahndamm. Ließ man all dies außer Acht und konzentrierte sich auf die unmittelbaren Gegebenheiten, wurde aus diesem Platz doch wieder eine beschauliche, in sich geschlossene Oase, Körper und Geist als Rasthaus dienend. Den Rucksack abstellend, hockte ich mich ins Gras, an den Stamm eines gramgebeugten Baumes gelehnt, dessen herabhängende Äste das glasgrüne Wasser streichelten, und blickte ins Land.
Eine Landschaft ist nie unbeweglich, sie tut nur so: Baumwipfel tänzeln losgelöst im Wind, Wolken wandern leise, Wasser wirft stille Wellen, zwitscherndes Flugvolk zieht am Himmel, alles im steten Licht des Tages mit sich drehenden und dehnenden Schatten. So saß ich in wohliger Harmonie mit mir selbst und mit diesem Landstrich, der mich so freundlich aufgenommen hatte, spürte alsbald Müdigkeit mir die Augen verkleben, war bereit, mich der Ruheforderung des Körpers hinzugeben, hatte aber vorher noch das unbedingte Verlangen, an diesem beschaulichen, für etwas lyrisches Pathos wie geschaffenen Platz, ein paar Zeilen Gadamer zu lesen. Schwer war der Entschluss gewesen, welches seiner zahlreichen Werke mir auf der Reise zu ihm Last und Lust gleichzeitig sein sollte, und ich hatte mich dann aus praktischen Gründen – es galt schließlich, das Gewicht des Rucksacks niedrig zu halten – für einen schmalen Band mit Erzählungen und Gedichten entschieden, den ich mir schon vor längerer Zeit besorgt, bislang es aber nicht geschafft hatte, mich ihm zu widmen, und die Reise schien mir jetzt der passende Anlass, mich dem Autor im doppelten Sinn zu nähern: zunächst über sein Werk und zuletzt räumlich. (Dazu sei an dieser Stelle noch gesagt, dass der Wunsch, sein Idol – welch schweres, gewichtiges Wort! – persönlich kennenlernen zu wollen, so wie ich es vorhatte und was letztlich auch der Zweck meiner Reise war, mir durchaus natürlich und nachvollziehbar scheint, gleichzeitig jedoch auch unvernünftig und naiv. Im Vorfeld hatte ich mir laienhaft psychologisierend zusammengereimt, dass, allgemein formuliert, dahinter ultimativ immer nur der unbewusste Drang steht, durch die Bekanntschaft mit Prominenz sein eigenes Ich zu erweitern, zu erhöhen, schließlich zu überhöhen. Zwar hatte mir das Verlangen, mich mit dem Menschen Gadamer auseinanderzusetzen, einerseits immer widerstrebt, weil mich prinzipiell das Werk eines Schaffenden interessiert und nicht der Schaffende selbst, jedoch hatte ich andererseits erkennen müssen, dass der Drang zur Heldenverehrung samt seiner innewohnenden Irrationalität auch in mir tiefer und fester verwurzelt schien, als ich hätte ahnen können und zugeben wollen. Aber natürlich war ich in meinem Tun nicht allein, denn Künstler, egal ob Schreiber, Tonsetzer oder Pinsler, ziehen bekanntermaßen seit jeher eine entsprechende Gemeinde aus Anhängern und Verehrern an, welche nicht nur vom Werk, sondern immer auch von dessen Schöpfer fasziniert ist. Es ist, offensichtlich, nur menschlich.)
Im Rucksack wühlte ich nach dem in eine durchsichtige, mit einem klackenden Druckknopf verschließbare Plastikhülle verstauten Büchlein. Zu kostbar war mir der Band, als dass ich ihn einfach so schmutziger Wäsche und Keksbröseln ausgesetzt hätte, und ich wollte ihn am Ende der Reise in der gleichen Makellosigkeit vorfinden, in der ich ihn eingepackt hatte: mit dem strahlweißen Leineneinband, den die Fingerspitzen so gern fühlten, der eleganten schwarzen Prägeschrift auf Buchdeckel und -rücken, dem kompakten Block aus zartem, dünnem Papier, und dem metallisch fliederlila glänzenden Lesebändchen, an dem ich so gern herumzupfte und das farblich so wunderbar mit dem purpurnen Kopfschnitt des Buches korrespondierte. Schon mit schlafschwerem Haupt begann ich zu blättern, fand ein Gedicht von ihm, ihm, dem Prosagiganten, der es nicht lassen konnte, sich gelegentlich an Lyrik zu üben, ungeachtet der darob oft so hämischen Urteile all jener leider meist unüberhörbaren Meinungstrompeter, den Kritikern der Sonntagszeitungsfeuilletons, die als selbsternannte Chefdenker in Sachen Literatur den Denkenlassern, ihren Lesern, in Permanenz und Ungefragtheit einhämmerten, dass Dichtung in Versform nicht Gadamers forte sei. Selbst lese ich selten Gereimtes und hätte mich keineswegs als Auskenner in diesem Feld bezeichnet, kann mich aber dem Reiz allem, was Gadamer, Lautmaler, Sprachkomponist und syntaktischer Drechslermeister, der er nun mal ist, in Schrift verewigt hat, ob nun gereimt oder geradeaus, nur schwer entziehen. Als Gelegenheitslyriker versuchte er keineswegs übermäßig zu schillern oder zu goethen, sondern bewegte sich im Reich der Reime inhaltlich mannigfaltig zwischen Überwirklichem bis leicht Boshaftem. Bevor ich einnickte, fand ich dieses nur vier schmale Ströphchen kurze Gedicht:
Flickerlicht bricht
im Gedankendickicht
auf den Spuren
des Nirgendwo.
Worte regnen
aus deinem Lächelgesicht
hinein ins Farbendoppel
des Irgendwo.
Meeresaugen
erzählen Feengeschichten,
die im Windmühlspiel
sich selber dichten.
Zwischen Trauerweidenträumereien
und sich windendem Wind
Ein neues Leben
Ein Sonnenkind.
*





























