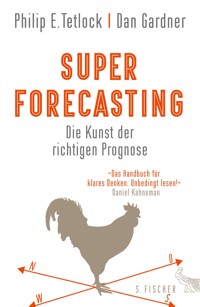
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Psychologe und Politikwissenschaftler Philip Tetlock gibt in seinem leichtverständlichen Wissenschafts-Sachbuch ›Superforecasting. Die Kunst der richtigen Prognose‹ eine Anleitung für treffsichere Prognosen in einer unsicheren Zeit. »Superforecaster« sind Menschen, denen erstaunlich gute Vorhersagen in allen Bereichen gelingen – bessere als den Experten. Was macht sie so besonders? In einem großangelegten Forschungsprojekt ist Philip Tetlock dieser Frage nachgegangen und hat das Erfolgsgeheimnis der Superprognostiker gelüftet. Anhand anschaulicher und unterhaltsamer Beispiele zeigt er, wie wir alle bessere Prognosen für unser Leben machen können – denn wenn wir darüber nachdenken, eine neue Stelle zu suchen, zu heiraten, ein Haus zu kaufen, Geld zu investieren, ein Produkt auf den Markt zu bringen oder uns zur Ruhe zu setzen, dann hängen unsere Entscheidungen davon ab, was wir von der Zukunft erwarten. Ein wichtiges und nützliches Buch, um sich in einer immer komplexeren Welt besser zurechtzufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Philip E. Tetlock | Dan Gardner
Superforecasting
Die Kunst der richtigen Prognose
Über dieses Buch
»Superforecaster« sind Menschen, denen erstaunlich gute Vorhersagen in allen Bereichen gelingen – bessere als den Experten. Was macht sie so besonders? In einem groß angelegten Forschungsprojekt ist Philip Tetlock dieser Frage nachgegangen und hat ihr Erfolgsgeheimnis gelüftet. Anhand anschaulicher und unterhaltsamer Beispiele zeigt er, wie wir alle bessere Prognosen für unser Leben machen können – denn wenn wir darüber nachdenken, eine neue Stelle zu suchen, zu heiraten, ein Haus zu kaufen, Geld zu investieren, ein Produkt auf den Markt zu bringen oder uns zur Ruhe zu setzen, dann hängen unsere Entscheidungen davon ab, was wir von der Zukunft erwarten. Ein wichtiges und nützliches Buch, um sich in einer immer komplexeren Welt besser zurechtzufinden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philip E. Tetlock ist Professor für Psychologie und Politikwissenschaft an der Universität von Pennsylvania. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Verlässlichkeit von Prognosen. Als erster Wissenschaftler hat er bewiesen, dass Experten die Börsenkurse nicht besser vorhersagen als ein Dart spielender Affe. Gemeinsam mit seiner Frau hat er das »Good Judgment Project« durchgeführt, ein großes Forschungsprojekt zur Kunst der Vorhersage, das auch Prognose-Turniere zwischen Laien und Experten beinhaltete. Die Erkenntnisse daraus sind in ›Superforecasting‹ eingeflossen.
Dan Gardner ist Journalist, Sachbuchautor und Zeitungsredakteur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de.
Impressum
Erschienen bei FISCHER Ebooks
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel:
»Superforecasting. The Art and Science of Prediction«
im Verlag Crown Publishers, New York
© 2015 by Philip Tetlock Consulting, Inc., and Connaught Street, Inc.
Abbildungen: Joe LeMonnier
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
ISBN 978-3-10-402959-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Kapitel 1 Ein optimistischer Skeptiker
Der Schimpansen-Witz
Der Skeptiker
Der Optimist
Eine Prognose zur Prognose
Kapitel 2 Eine Pseudowissenschaft?
Ein Cargo-Kult der Wissenschaft
Die Medizin auf dem Prüfstand
Denken über Denken
Köder und Haken
Blinzeln und Denken
Kapitel 3 Messen und Zählen
»Es wird zu einem Holocaust kommen«
Urteile über Urteile
Was die Mathematik kann
Die Prognosen politischer Experten
Das Ergebnis
Mit den Augen der Libelle
Kapitel 4 Superprognostiker
Kampf gegen die Schwerkraft
Kapitel 5 Superhirne?
Fermisieren Sie
Ein rätselhafter Todesfall
Zuerst die Außensicht
Die Innensicht
These, Antithese, Synthese
Prognostizieren wie die Libelle
Kapitel 6 Superrechner?
Wo steckt Osama bin Laden?
Zwischen Ja und Nein
Wahrscheinlichkeit in der Steinzeit
Wahrscheinlichkeit im Informationszeitalter
Superungewiss
Und was bedeutet das alles?
Kapitel 7 Supernewsjunkies?
Zu viel oder zu wenig
Unterbewertung
Überbewertung
Kapitän Minto
Kapitel 8 Immer im Entwicklungsstadium
Beständig unbeständig
Versuchen
Scheitern
Analysieren und korrigieren
Zähigkeit
Der protoypische Superprognostiker
Kapitel 9 Superteams
Team oder nicht?
Superteams
Kapitel 10 Das Dilemma der Führungskraft
Moltkes Erbe
I like Ike
Auftragstaktik in Unternehmen
Eine sonderbare Art der Bescheidenheit
PS
Kapitel 11 Wirklich super?
Der Schwarze Schwan
Aber …
Kapitel 12 Ein Blick in die Zukunft
Kto kogo? oder Warum sich nichts ändert
Veränderung
Einwände der Humanisten
Was zählt
Ein letzter Gedanke
Epilog
Einladung
Anhang
1.Wählen Sie geeignete Fragen
2.Brechen Sie scheinbar unlösbare Problemeauf lösbare Unterprobleme herunter
3.Finden Sie das richtige Gleichgewichtzwischen Innen- und Außensicht
4.Finden Sie die richtige Mischungaus Unter- und Überbewertung von Beweisen
5.Suchen Sie in jeder Fragestellungnach widerstreitenden Kräften
6.Stufen Sie Wahrscheinlichkeiten ab,soweit es die Frage zulässt, aber nicht weiter
7.Finden Sie das richtige Gleichgewichtzwischen Vorsicht und Entschlossenheit
8.Suchen Sie die Ursachen Ihrer Fehlprognosen,aber hüten Sie sich vor dem Rückschaufehler
9.Holen Sie das Beste aus anderen heraus, und erlaubenSie anderen, das Beste aus Ihnen herauszuholen
10.Übung macht den Meister
11.Sehen Sie die Gebote nicht als Gebote an
Dank
Phil Tetlock
Dan Gardner
Für Jenny,
die in den Herzen ihrer Eltern immer lebendig bleiben wird, als wäre es erst gestern gewesen.
Kapitel 1Ein optimistischer Skeptiker
Wir stellen andauernd Prognosen auf. Wenn wir darüber nachdenken, eine neue Stelle zu suchen, zu heiraten, ein Haus zu kaufen, Geld zu investieren, ein Produkt auf den Markt zu bringen oder uns zur Ruhe zu setzen, dann hängen unsere Entscheidungen davon ab, was wir von der Zukunft erwarten. Diese Erwartungen sind nichts anderes als Prognosen. Oft blicken wir selbst in die Glaskugel. Aber wenn es um große Ereignisse geht – wenn Börsen abstürzen, Kriege drohen und Politiker zittern –, fragen wir Experten um Rat. Wir wenden uns an Menschen wie den Starjournalisten Thomas Friedman.
Sollten Sie zufällig im Weißen Haus arbeiten, dann könnten Sie Friedman im Oval Office antreffen, wo er sich mit dem Präsidenten über die Lage im Nahen Osten unterhält. Sollten Sie einem internationalen Großkonzern vorstehen, dann könnten Sie ihm in Davos über den Weg laufen, wo er im Salon mit Hedgefonds-Milliardären und saudischen Prinzen plauscht. Und wenn Sie weder im Weißen Haus noch in vornehmen Schweizer Hotels ein und aus gehen, dann können Sie seine Kommentare in der New York Times oder seine Bestseller lesen, in denen er aktuelle Entwicklungen erläutert und uns verrät, wie die Geschichte weitergeht.[1]
Auch Bill Flack sagt weltpolitische Ereignisse voraus. Doch seine Prognosen werden deutlich seltener nachgefragt als die von Thomas Friedman.
Viele Jahre lang arbeitete Bill für die Außenstelle des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums in Arizona – »mit Spaten und Rechner« –, aber heute lebt er in Kearney in Nebraska. Er ist ein gebürtiger »Cornhusker«, ein »Maisschäler«, wie man die Einwohner von Nebraska liebevoll nennt, und wuchs in einer Kleinstadt namens Madison auf. Seine Eltern waren Eigentümer der Tageszeitung Madison Star-Mail, die vor allem über Sportereignisse und Landwirtschaftsmessen berichtete. Bill war ein fleißiger Schüler, und nach seinem Abschluss studierte er Naturwissenschaften an der University of Nebraska. Von dort wechselte er an die University of Arizona, um in Mathematik zu promovieren, doch er musste sich eingestehen, dass seine Fähigkeiten nicht ganz ausreichten. »Man hat mich mit der Nase auf meine Grenzen gestoßen«, sagt er. Also brach er das Studium schließlich ab. Es war trotzdem keine verlorene Zeit. Nebenher hatte Bill ein wenig Ornithologie studiert und war ein begeisterter Vogelgucker geworden, und weil Arizona ein wahres Vogelparadies ist, begleitete er die Vogelkundler auf ihren Exkursionen. Schließlich bekam er eine Stelle im Landwirtschaftsministerium und blieb.
Inzwischen ist Bill 55 Jahre alt und pensioniert, doch er meint, wenn ihm jemand eine Stelle anbieten sollte, dann könnte er es sich noch einmal überlegen. Er hat eine Menge Freizeit, und diese Zeit verbringt er unter anderem damit, Prognosen zu erstellen.
Bill beschäftigt sich mit Fragen wie »Wird Russland innerhalb der kommenden drei Monate weitere ukrainische Gebiete besetzen?« oder »Wird im kommenden Jahr ein Land die Eurozone verlassen?« – alles Themen von weltpolitischer Tragweite. Inzwischen hat er an die dreihundert solcher Fragen beantwortet. Es sind knifflige Fragen, wie sie Unternehmen, Banken, Botschaften und Geheimdienste dauernd in Atem halten. »Wird Nordkorea im Laufe dieses Jahres einen Atomtest durchführen?« »Aus wie vielen Ländern werden in den kommenden acht Monaten Ebola-Erkrankungen gemeldet werden?« »Wird Indien oder Brasilien in den kommenden zwei Jahren ständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen?« Einige dieser Fragen könnten in Ihren Ohren sehr exotisch klingen: »Wird die NATO in den kommenden neun Monaten weitere Länder in den Aktionsplan für Beitrittskandidaten aufnehmen?« »Wird die Regierung der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak in diesem Jahr ein Referendum zur nationalen Unabhängigkeit abhalten?« »Wenn in der Freihandelszone Schanghai innerhalb der kommenden zwei Jahre ein nicht-chinesisches Telekommunikationsunternehmen eine Zulassung zum Aufbau von Internetdienstleistungen erhält, werden chinesische Bürger dann freien Zugang zu Facebook und Twitter haben?« Wenn Bill diese Fragen sieht, hat er oft nicht die geringste Ahnung, wie er sie beantworten soll. Was zum Kuckuck ist die Freihandelszone Schanghai?, dachte er sich zum Beispiel. Aber dann macht er sich an die Arbeit. Er sammelt Daten, wägt widersprüchliche Positionen gegeneinander ab und gibt schließlich eine Prognose ab.
Niemand konsultiert Bill Flacks Prognosen, um Entscheidungen zu treffen, und kein Fernsehsender bittet ihn, vor der Kamera eine Einschätzung der Zukunft abzugeben. Er ist nie nach Davos eingeladen worden, um in einem Forum mit Thomas Friedman zu diskutieren. Was schade ist, denn Bills Vorhersagen sind erstaunlich korrekt. Das wissen wir, weil unabhängige Wissenschaftler jede seiner Prognosen ausgewertet und auf ihre Korrektheit überprüft haben. Bill hat eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz.
Und Bill ist nicht der Einzige. Neben ihm beantworten Tausende andere dieselben Fragen. Es sind Freiwillige. Die meisten sind nicht ganz so gut wie Bill, aber 2 Prozent von ihnen können durchaus mithalten. Darunter sind Ingenieure und Anwälte, Künstler und Naturwissenschaftler, Banker und Kleinanleger, Professoren und Studenten. In diesem Buch werden wir einigen dieser Menschen begegnen, zum Beispiel einem Mathematiker, einem Filmemacher und einigen Rentnern, die sich freuen, ihr brachliegendes Talent zu nutzen. Ich bezeichne sie als Superforecaster beziehungsweise Superprognostiker, denn genau das sind sie. Wissenschaftler haben ihre Erfolge nachgewiesen. In diesem Buch erkläre ich, warum sie künftige Entwicklungen so gut vorhersagen und wie andere von ihnen lernen können.
Es wäre interessant zu sehen, wie unsere unbekannten Superprognostiker im Vergleich mit Starjournalisten wie Thomas Friedman abschneiden. Leider lässt sich das nicht beantworten, da niemand je wissenschaftlich nachgeprüft hat, wie gut Friedmans Prognosen sind. Natürlich haben seine Fans und Kritiker ihre Meinung – »er hat den Arabischen Frühling vorhergesehen« oder »er hat die Irak-Invasion 2003 falsch eingeschätzt« oder »er hat die NATO-Erweiterung richtig geahnt«. Aber wie seine Erfolgsbilanz tatsächlich aussieht, das können wir sagen.[2] Das ist typisch. Tag für Tag überhäufen uns die Medien mit Prognosen, aber sie fragen nie nach, wie gut die Vorhersagen ihrer Leitartikelschreiber tatsächlich sind. Tag für Tag zahlen Unternehmen und Regierungen für Zukunftsszenarien, die irgendwo zwischen genial und wertlos sein könnten. Und Tag für Tag treffen wir alle – Politiker, Manager, Anleger und Wähler – wichtige Entscheidungen auf Grundlage von Prognosen, deren Qualität wir nicht beurteilen können. Kein Fußballmanager käme auf den Gedanken, sein Scheckbuch zu zücken und einen Spieler zu verpflichten, dessen Leistungen er nicht genau analysiert hat. Selbst Fans hantieren inzwischen mit Statistiken über Vorlagen und Torschüsse. Aber bei wirklich wichtigen Entscheidungen scheinen wir uns nicht dafür zu interessieren, wie zuverlässig unsere Prognosen sind.
So gesehen wäre es also nur vernünftig, wenn wir uns auf die Vorhersagen von Bill Flack verlassen würden. Und genauso vernünftig könnte es sein, wenn wir uns auf die Vorhersagen vieler Leser dieses Buchs verlassen würden, denn wie wir noch sehen werden, ist der Blick in die Zukunft kein Talent, das man hat oder nicht hat. Es ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und dieses Buch wird Ihnen zeigen, wie.
Der Schimpansen-Witz
Da ich den Witz verderben will, nehme ich die Pointe gleich vorweg: Der durchschnittliche Experte war ungefähr so treffsicher wie ein Schimpanse, der auf eine Dartscheibe wirft.
Vielleicht kennen Sie den Witz. Er hat eine gewisse Berühmtheit erlangt, und in einigen Kreisen ist er berüchtigt. In der New York Times war er genauso zu lesen wie im Wall Street Journal, in der Financial Times, im Economist und in vielen anderen Zeitungen in aller Welt. Er geht so: Ein Wissenschaftler lud eine große Gruppe von Experten ein – Akademiker, Leitartikelschreiber und so weiter – und bat sie, Tausende Prognosen zu Wirtschaft, Börse, Wahlen, Kriegen und anderen aktuellen Themen abzugeben. Als besagter Wissenschaftler später überprüfte, wie korrekt diese Prognosen waren, musste er feststellen, dass die Experten im Durchschnitt genauso gut waren wie jemand, der zufällig geraten hatte. Wobei »zufällig raten« nicht so witzig klingt. Deshalb die Pointe mit den Schimpansen, die auf eine Dartscheibe werfen. Das klingt witziger.
Dieser Wissenschaftler war ich, und eine Zeitlang störte ich mich nicht an dem Witz. Meine Untersuchung war bis dato die umfassendste wissenschaftliche Überprüfung von Expertenprognosen. Sie fand über einen Zeitraum von zwanzig Jahren statt, und die Ergebnisse waren deutlich vielschichtiger und konstruktiver, als die Pointe vermuten lässt. Aber ich konnte mit dem Witz leben, weil er ein Bewusstsein für meine Arbeit schuf (und ja, auch Wissenschaftler genießen ihre fifteen minutes of fame). Außerdem hatte ich das Bild von den Darts werfenden Schimpansen selbst verwendet, also durfte ich mich nicht allzu laut beklagen, dass es nun überall in der Presse breitgetreten wurde.
Ich konnte auch deshalb mit dem Witz leben, weil er eine wichtige Tatsache unterstreicht. In jeder Tageszeitung und jeder Nachrichtensendung melden sich Experten zu Wort und sagen kommende Entwicklungen vorher. Einige sind vorsichtig. Viele verkünden ihre Prognosen mit dem Brustton der Überzeugung. Und einige verkaufen sich als Propheten, die Jahrzehnte weit in die Zukunft blicken können. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen stehen sie nicht etwa deshalb vor der Kamera, weil sie sich durch hervorragende Weitsichtigkeit ausgezeichnet hätten. Ob sie mit ihren Prognosen richtigliegen oder nicht, scheint gar niemand wissen zu wollen: Die Vorhersagen von gestern sind ein alter Hut, weshalb sich Experten nur selten an der Wirklichkeit messen lassen müssen. Diese Fernsehorakel haben vor allem ein Talent: Sie können selbstbewusst auftreten und eine überzeugende Geschichte erzählen. Mehr müssen sie gar nicht können. Viele verdienen sich eine goldene Nase damit, ihre Prognosen an Unternehmen, Regierungen und Privatleute zu verkaufen – Menschen, denen es nie einfallen würde, ein Medikament zu schlucken, das nicht auf seine Wirksamkeit geprüft wurde, die aber regelmäßig eine Menge Geld für Expertisen ausgeben, die so seriös sind wie die Wundersalben eines Marktschreiers. Diese Leute und ihre Kunden hatten einen Denkanstoß nötig, und ich war froh, mit meiner Untersuchung dazu beitragen zu können.
Aber als meine Arbeit bekannter wurde, musste ich die Erfahrung machen, dass sich die Interpretation veränderte. Meine Studie hatte nachgewiesen, dass Experten in vielen der politischen und wirtschaftlichen Fragen, die ich ihnen gestellt hatte, mit ihren Vorhersagen im Durchschnitt so gut lagen, als hätten sie nur geraten. »In vielen Fragen« heißt jedoch nicht »in allen Fragen«. Bei Fragen zur näheren Zukunft, bei denen die Experten nur ein Jahr in die Zukunft blicken mussten, zeigten sie oft bessere Ergebnisse; aber je weiter das vorherzusehende Ereignis in der Zukunft lag, umso schlechter wurden die Vorhersagen, und nach drei bis fünf Jahren waren die Experten bei den Darts werfenden Schimpansen angekommen. Diese Erkenntnis ist entscheidend. Sie verrät uns nämlich etwas über die Grenzen der Vorhersage in einer komplexen Welt und auch über die Grenzen dessen, was Superprognostiker leisten können. Aber wie im Spiel »Stille Post«, in dem ein Satz von einem Kinderohr zum anderen weitergeflüstert wird und alle darüber erschrecken, was am Ende aus der Botschaft wird, wurde die ursprüngliche Erkenntnis meiner Studie in der ständigen Nacherzählung vollkommen verdreht, und sämtliche Nuancen gingen verloren. Letztlich reduzierte sich die Botschaft auf den Satz »Experten taugen nichts«, und das ist natürlich Unsinn. Es kamen sogar noch plumpere Botschaften heraus, etwa »Experten sind so dumm wie Schimpansen«. Meine Untersuchung wurde zum Beleg für Skeptiker, die die Zukunft für grundsätzlich unvorhersehbar halten, und für ahnungslose Populisten, die dem Wort »Experte« grundsätzlich ein »sogenannt« voranstellen.[1]
Irgendwann fand ich den Schimpansen-Witz deshalb gar nicht mehr komisch. Diese extremen Schlussfolgerungen wurden nicht durch meine Untersuchung gestützt, und sie entsprachen auch nicht meiner Absicht. Das trifft heute mehr zu denn je.
Zwischen den absoluten Befürwortern und den Kritikern der Expertenkultur gibt es eine Menge Spielraum für vernünftige Standpunkte. Natürlich haben die Kritiker recht: Auf dem Prognosemarkt gibt es viele Scharlatane, die äußerst zweifelhafte Erkenntnisse feilbieten. Außerdem stoßen wir mit unseren Möglichkeiten zur Vorhersage tatsächlich an Grenzen, die sich nicht überwinden lassen. Es wird wohl immer so sein, dass wir mehr Fragen an die Zukunft haben, als wir beantworten können. Deshalb sollte man Prognosen nicht als Zeitverschwendung abtun. Ich glaube sehr wohl, dass wir in die Zukunft blicken können, zumindest in bestimmten Situationen und innerhalb bestimmter Grenzen. Und vor allem glaube ich, dass jeder intelligente, offene und engagierte Mensch in der Lage ist, sich die erforderlichen Fähigkeiten anzueignen. Nennen Sie mich einen »optimistischen Skeptiker«.
Der Skeptiker
Um zu verstehen, warum ich ein Skeptiker bin, stellen Sie sich einen jungen Tunesier vor, der einen Holzkarren mit Obst und Gemüse durch die staubigen Straßen seiner Heimatstadt Sidi Bouzid zum Markt schiebt. Dieser Mann hat seinen Vater verloren, als er drei Jahre alt war. Um seinen Karren mit Waren zu füllen, muss er sich Geld leihen und hoffen, dass er genug verkauft, um seine Schulden bezahlen und seine Familie ernähren zu können. Es ist jeden Tag dieselbe Schinderei. Aber an diesem Morgen halten Polizisten den Mann an und nehmen ihm die Waage weg, weil er angeblich gegen eine Verordnung verstoßen hat. Er weiß, dass das nur eine Lüge ist. Sie wollen Geld von ihm. Aber er hat keins. Eine Polizistin gibt ihm eine Ohrfeige und beleidigt seinen toten Vater. Die Beamten nehmen seinen Karren und seine Waage mit. Der Mann geht zur Stadtverwaltung, um sich zu beschweren. Dort teilt man ihm mit, der zuständige Beamte sei in einer Besprechung. Gedemütigt, wütend und hilflos geht der Mann nach Hause.
Als er wiederkommt, bringt er einen Kanister mit. Vor dem Verwaltungsgebäude übergießt er sich mit dem Benzin, entzündet ein Streichholz und verbrennt sich selbst.
Nur das Ende dieser Geschichte ist ungewöhnlich. In Tunesien und in der ganzen islamischen Welt gibt es zahllose arme Straßenhändler. Die Polizei ist korrupt, und Schikanen wie die eben geschilderte gehören zum Alltag. Außer den Polizisten und ihren Opfern interessiert sich niemand dafür.
Doch diese spezielle Demütigung veranlasste den 26-jährigen Mohamed Bouazizi am 17. Dezember 2010, sich selbst zu verbrennen, und dieses Fanal löste Proteste aus. Die Polizei reagierte mit der üblichen Brutalität. Die Proteste weiteten sich aus. In der Hoffnung, die Öffentlichkeit zu beschwichtigen, suchte der tunesische Diktator Zine El Abidine Ben Ali das Krankenhaus auf, um Bouazizi einen Besuch abzustatten.
Bouazizi starb am 4. Januar 2011. Die Unruhen wurden größer. Am 14. Januar floh Ben Ali in ein angenehmes Exil in Saudi-Arabien und beendete seine 23-jährige Kleptokratie.
Fassungslos sah die islamische Welt zu. Dann gingen auch in Ägypten, Libyen, Syrien, Jordanien, Kuwait und Bahrain die Menschen auf die Straße. Nach drei Jahrzehnten an der Macht wurde der ägyptische Diktator Hosni Mubarak aus dem Amt gejagt. Anderswo wuchsen sich die Proteste zu Aufständen aus und die Aufstände zu Bürgerkriegen. Das war der Arabische Frühling, und er wurde angestoßen von einem armen Mann, der von der Polizei schikaniert worden war – wie so viele andere, deren Leid nicht die geringste Veränderung bewirkt hatte.
Es ist eine Sache, wie ich zurückzublicken und eine Geschichte zu erzählen, die Mohamed Bouazizi mit all den Ereignissen verknüpft, die sich aus seinem einsamen Protest ergaben. Wie so viele Experten hat Thomas Friedman ein besonderes Händchen für Rekonstruktionen wie diese, besonders wenn es um den Nahen Osten geht, den er als langjähriger Libanon-Korrespondent der New York Times gut kennt. Aber hätte selbst dieser Thomas Friedman, wenn er an jenem fatalen Morgen dabei gewesen wäre, in die Zukunft blicken und die Selbstverbrennung, die Proteste, den Sturz des tunesischen Diktators und alles Weitere vorhersehen können? Natürlich nicht. Das hätte niemand gekonnt. Vielleicht hätte sich der Nahostkenner Friedman Gedanken über die Armut und Arbeitslosigkeit machen können, über die wachsende Zahl der verzweifelten jungen Menschen, über die grassierende Korruption, über die erbarmungslose Unterdrückung, die Tunesien und andere islamische Staaten zu einem Pulverfass machte. Aber zu exakt diesem Schluss hätte ein anderer Beobachter auch schon ein Jahr zuvor kommen können und im Jahr davor auch schon. Schon seit Jahrzehnten konnte man all das in Tunesien, Ägypten und vielen anderen Ländern der Region beobachten. Jedes dieser Länder war ein Pulverfass, das nie explodierte – bis zu jenem 17. Dezember 2010, an dem die Polizei diesen einen armen Mann einen Schritt zu weit trieb.
Im Jahr 1972 veröffentlichte der amerikanische Meteorologe Edward Lorenz einen Fachartikel über Vorhersagbarkeit, in dem er die faszinierende Frage aufwarf, ob der Flügelschlag eines Schmetterlings im brasilianischen Regenwald eine Windhose in Texas provozieren kann. Ein Jahr zuvor hatte Lorenz zufällig festgestellt, dass bei der Computersimulation des Wetters winzigste Veränderungen bei der Dateneingabe – etwa die Rundung des Werts 0,506127 auf 0,506 – dramatische Unterschiede bei langfristigen Wettervorhersagen bewirken konnten. Diese Erkenntnis sollte einer der Anstöße zur Chaostheorie sein, die besagt, dass in nichtlinearen Systemen wie der Erdatmosphäre selbst kleinste Veränderungen bei den Ausgangsbedingungen gewaltige Auswirkungen nach sich ziehen können. Theoretisch könnte also tatsächlich ein einsamer Schmetterling in Brasilien mit seinem Flügelschlag in Texas einen Tornado provozieren – während gleichzeitig Schwärme von Schmetterlingen ihr Leben lang wild mit den Flügeln schlagen können, ohne dass sich ein paar Kilometer weiter auch nur ein Lüftchen regt. Lorenz wollte damit natürlich nicht behaupten, dass ein Schmetterling die »Ursache« für eine Windhose ist, so wie der Hammer, mit dem ich auf ein Glas schlage, die Ursache dafür ist, dass dieses Glas zu Bruch geht. Er meinte lediglich, wenn dieser bestimmte Schmetterling nicht just in diesem Moment mit den Flügeln geschlagen hätte, dann hätte das undurchschaubar komplexe Zusammenspiel von Aktion und Reaktion in der Atmosphäre eine etwas andere Wendung genommen, und die Windhose wäre vielleicht nie zustande gekommen. So wie es vielleicht nie zum Arabischen Frühling gekommen wäre, zumindest nicht so und zu diesem Zeitpunkt, wenn die Polizisten an diesem Dezembermorgen des Jahres 2010 Mohamed Bouazizi in Ruhe gelassen hätten.
Nach Edward Lorenz kam die Wissenschaft zu dem Schluss, dass die Vorhersagbarkeit an feste Grenzen stößt. Das ist ein zutiefst philosophisches Thema.[1] Jahrhundertelang waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass wir die Zukunft immer besser vorhersagen können, je mehr Wissen wir haben. Sie glaubten, dass die Welt im Prinzip genauso funktioniere wie ein Uhrwerk; je besser sie das Innenleben dieses Uhrwerks verstanden und erkannten, wie die Rädchen ineinandergreifen, umso besser konnten sie es mit deterministischen Gleichungen erfassen und ihr künftiges Verhalten vorhersagen. Der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace trieb diesen Gedanken auf die Spitze, als er 1814 schrieb:
Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines früheren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennt, mit denen die Welt begabt ist, und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen, und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss, Zukunft und Vergangenheit lägen klar vor ihren Augen.
Diese imaginäre Intelligenz bezeichnete Laplace als »Dämon«. Wenn wir alles über die Gegenwart wüssten, so Laplace, dann könnten wir die Zukunft umfassend vorhersagen. Wir wären allwissend.[2]
Lorenz verpasste diesem Traum eine kalte Dusche. Wenn das Uhrwerk das Symbol für die Laplace’sche Vorhersagbarkeit ist, dann ist die Lorenz’sche Wolke das Gegenteil. In der Schule lernen wir, dass Wolken entstehen, wenn Wasserdampf an Partikeln in der Luft kondensiert. Das klingt einfach, doch die tatsächliche Entwicklung einer Wolke hängt von komplexen Rückkopplungen im Zusammenspiel der Tröpfchen ab. Um dieses Zusammenspiel zu simulieren, benötigen Meteorologen Gleichungen, die bei der Datensammlung extrem sensibel auf diese winzigen Schmetterlingseffekte reagieren. Selbst wenn wir also alles wissen, was es über die Wolkenbildung zu wissen gibt, werden wir nie in der Lage sein vorherzusehen, welche Form eine bestimmte Wolke annehmen wird. Wir können nur abwarten und zusehen. Es ist eine der großen Ironien der Geschichte, dass Wissenschaftler heute sehr viel mehr wissen als ihre Kollegen vor einem Jahrhundert und dass sie über beispiellose Rechenkapazitäten verfügen, dass sie aber die Möglichkeiten der Vorhersage deutlich skeptischer beurteilen.
Deshalb bezeichne ich mich als »Skeptiker«. Wir leben in einer Welt, in der die Handlung eines machtlosen Menschen Wellen schlägt, die noch auf der anderen Seite des Erdballs zu spüren sind und uns alle ganz unterschiedlich beeinflussen. Eine Frau, die in einem Vorort von Kansas City lebt, könnte glauben, dass sich Tunesien auf einem anderen Planeten befindet und nichts mit ihr zu tun hat. Doch wenn sie mit einem Piloten verheiratet ist, der in der nahegelegenen Whiteman Air Force Base stationiert ist, dann müsste sie vielleicht plötzlich erfahren, dass die Tat eines unbekannten Tunesiers Proteste provozierte, die sich zu Unruhen ausweiteten, die den Sturz des Diktators bewirkten, was Proteste in Libyen auslöste, die sich zu einem Bürgerkrieg auswuchsen, der 2012 die NATO zum Eingreifen zwang, weshalb ihr Mann plötzlich über Tripolis Flugabwehrraketen ausweicht. Dieser Zusammenhang lässt sich noch leicht nachvollziehen. Andere sind schwieriger zu erkennen, aber sie sind überall zu spüren, an der Zapfsäule genauso wie in den Entlassungen in der Fabrik im Ort. In einer Welt, in der ein Schmetterling in Brasilien darüber entscheidet, ob über einer Ortschaft in Texas die Sonne lacht oder ob sie von einer Windhose heimgesucht wird, wäre es ein Irrtum anzunehmen, dass wir allzu weit in die Zukunft blicken können.[3]
Der Optimist
Aber es ist eine Sache, die Grenzen der Vorhersagbarkeit anzuerkennen, und eine ganz andere, jeden Versuch der Vorhersage als sinnlos zu bezeichnen.
Sehen wir uns einmal einen Tag im Leben der Frau in Kansas City unter dem Mikroskop an: Morgens um 6.30 Uhr packt sie ihre Papiere in ihre Aktentasche, steigt ins Auto und fährt auf ihrem üblichen Weg in die Innenstadt, wo sie ihr Auto auf einem Parkplatz abstellt. Wie jeden Morgen geht sie an den Löwenstatuen vorüber in das neoklassizistische Gebäude der Lebensversicherung Kansas City Life, wo sie arbeitet. Dort erstellt sie ein paar Kalkulationen, nimmt um 10.30 Uhr an einer Telefonkonferenz teil, surft ein paar Minuten durchs Internet und beantwortet bis 11.50 Uhr E-Mails. Dann trifft sie sich mit ihrer Schwester zum Mittagessen in einem kleinen italienischen Restaurant.
Das Leben dieser Frau wird von zahllosen unberechenbaren Faktoren beeinflusst, vom Lottoschein in ihrer Tasche bis zum Arabischen Frühling, der ihren Mann nach Libyen führt und den Benzinpreis um 5 Cent steigen lässt, weil in einem Land, das sie nur aus den Nachrichten kennt, ein Staatsstreich stattgefunden hat. Aber vieles in ihrem Leben ist auch ziemlich vorhersehbar. Warum ist sie um 6.30 Uhr aus dem Haus gegangen? Weil sie den morgendlichen Berufsverkehr vermeiden wollte. Oder anders ausgedrückt, sie sah vorher, dass sich der Verkehr später stauen würde, und damit hatte sie vermutlich recht, denn die Stoßzeiten sind ausgesprochen gut vorhersehbar. Auf der Fahrt stellte sie dauernd Prognosen über das Verhalten anderer Fahrer an: Sie halten an dieser Kreuzung, weil die Ampel rot ist; sie bleiben in ihrer Spur und blinken, wenn sie die Fahrbahn wechseln. Sie ging davon aus, dass die Teilnehmer der Telefonkonferenz, die für 10.30 Uhr verabredet war, sich daran halten würden, und sie behielt recht. Sie verabredete sich mit ihrer Schwester um 12 Uhr zum Mittagessen, weil das Schild mit den Öffnungszeiten an der Tür des Restaurants die Vermutung zuließ, dass es um diese Zeit öffnen würde, und weil Schilder dieser Art in der Regel zuverlässig sind.
Im Alltag machen wir unentwegt solche und ähnliche Vorhersagen. Und andere machen Vorhersagen, die sich wiederum auf unseren Alltag auswirken. Als die Frau im Büro ihren Computer einschaltete, ließ sie den Stromverbrauch in Kansas City ein winziges bisschen ansteigen, genau wie all die anderen fleißigen Ameisen, die an diesem Morgen in ihre Büros gingen; gemeinsam sorgten sie für einen gewaltigen Anstieg der Nachfrage, genau wie an jedem anderen Werktag um diese Zeit. Dass dies keine Probleme verursacht, liegt daran, dass die Stromerzeuger diesen Anstieg vorhersehen und ihre Produktion entsprechend anpassen. Als die Frau im Internet eine Shoppingseite besuchte, zeigte ihr der Anbieter Produkte, die ihr gefallen könnten, eine Prognose, die auf ihren früheren Einkäufen und dem Verhalten Millionen anderer Nutzer basierte. Im Internet begegnen wir dauernd solchen Vorhersagen. Suchmaschinen personalisieren zum Beispiel unsere Suchergebnisse und führen als Erstes diejenigen auf, die uns am meisten interessieren könnten. Das passiert so reibungslos, dass wir es meist gar nicht bemerken. Die Lebensversicherung Kansas City Life, der Arbeitgeber der Frau, sagt Behinderungen und Todesfälle vorher, und zwar sehr gut. Sie kann zwar nicht vorhersagen, wann ich das Zeitliche segne, aber sie hat eine gute Vorstellung davon, mit welcher Lebenserwartung ein Mann in meinem Alter und mit meinem Einkommen und Lebensstil rechnen kann. Kansas City Life wurde 1895 gegründet. Wenn die Versicherungsgesellschaft nicht in der Lage wäre, gute Vorhersagen zu treffen, wäre sie längst pleite.
Vieles in unserer Welt lässt sich so gut oder besser vorausberechnen. Gerade habe ich im Internet gesucht, wann morgen in Kansas City die Sonne auf- und untergeht, und habe eine auf die Minute genaue Uhrzeit gefunden. Diese Prognosen sind verlässlich, egal ob für morgen, übermorgen oder in fünfzig Jahren. Das gilt auch für die Gezeiten, Sonnenfinsternisse und Mondphasen. Mit Hilfe von Naturgesetzen lässt sich das alles genau genug vorhersagen, um den Laplace’schen Dämon zufriedenzustellen.
Natürlich können sich diese Nischen der Vorhersagbarkeit jederzeit wieder schließen. Ein gutes Restaurant öffnet mit einiger Wahrscheinlichkeit zu den angekündigten Uhrzeiten, doch es kann durchaus passieren, dass es geschlossen bleibt, zum Beispiel weil der Koch verschlafen hat, weil die Küche von einem Brand zerstört wurde, weil in der Stadt eine Epidemie grassiert, weil ein Atomkrieg ausgebrochen ist oder weil bei einem physikalischen Experiment zufällig ein schwarzes Loch entstanden ist, das unser Sonnensystem verschluckt. Das trifft auch auf alles andere zu. Selbst die Vorhersage der Sonnenauf- und -untergangszeiten in fünfzig Jahren können leicht von der Realität abweichen, wenn die Erde von einem riesigen Asteroiden getroffen und ein wenig aus ihrer Bahn geschoben wird. In diesem Leben ist nichts sicher – nicht einmal der Tod und die Steuern, wenn eine Technik erfunden wird, mit der sich das menschliche Gehirn in eine Datenwolke laden lässt, oder wenn künftige Gesellschaften derart wohltätig werden sollten, dass sich der Staat allein durch Spenden finanziert.
Ist die Wirklichkeit also eher wie ein Uhrwerk oder eher wie eine Wolke? Das ist ein Beispiel für einen Scheingegensatz, von denen wir in diesem Buch noch einige kennenlernen werden. Wir leben in einer Welt der Uhren und der Wolken und einem bunten Strauß anderer Metaphern. Unvorhersehbarkeit und Vorhersehbarkeit existieren nebeneinander in den komplexen, miteinander verzahnten Systemen unseres Körpers, unserer Gesellschaften und unseres Universums. Wie vorhersehbar etwas ist, hängt davon ab, was wir vorhersehen wollen, wie weit in der Zukunft und unter welchen Umständen.
Sehen wir uns das Spezialgebiet von Edward Lorenz an. Wettervorhersagen sind unter den meisten Bedingungen recht zuverlässig, wenn sie auf ein oder zwei Tage angelegt sind. Auf drei, vier oder fünf Tage hinaus werden sie immer schlechter. Wenn wir wissen wollen, wie das Wetter nächste Woche wird, könnten wir genauso gut einen Schimpansen befragen. Deshalb können wir nicht sagen, dass das Wetter grundsätzlich berechenbar oder unberechenbar ist. Wir können nur sagen, dass es unter bestimmten Umständen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorhersagbar ist. Wenn wir präzisere Aussagen treffen wollen, müssen wir sehr vorsichtig sein. Nehmen wir einen vermeintlich einfachen Zusammenhang wie den zwischen Zeit und Vorhersagbarkeit: Grundsätzlich ist es richtig, dass wir die Zukunft umso unschärfer sehen, je weiter wir blicken wollen. Aber es gibt auch Ausnahmen. Die Vorhersage eines anhaltenden Bullenmarkts an der Börse kann jahrelang richtig und lohnend sein, bis sie uns eines Tages ins Verderben reißt. Und die Vorhersage, dass Dinosaurier am oberen Ende der Nahrungskette stehen, war über Jahrmillionen hinweg eine sichere Wette – bis plötzlich ein Asteroid eine unvorstellbare Katastrophe auslöste und ökologische Nischen für ein kleines Säugetier öffnete, dessen Nachfahren die Zukunft vorhersehen möchten. Von den Naturgesetzen abgesehen, gibt es keine allgemeingültigen Konstanten, weshalb es ein hartes Stück Arbeit ist, das Vorhersehbare vom Unvorhersehbaren zu unterscheiden.
Das wissen Meteorologen vielleicht besser als alle anderen. Sie erstellen gewaltige Mengen von Vorhersagen und überprüfen deren Richtigkeit – deshalb wissen wir, dass Wettervorhersagen für die kommenden ein oder zwei Tage meist recht brauchbar sind, aber darüber hinaus eher nicht. Dank dieser Auswertungen verstehen Meteorologen besser, wie das Wetter funktioniert, und korrigieren ihre Modelle. Dann unternehmen sie einen neuen Versuch. Vorhersage, Überprüfung, Korrektur. Und wieder von vorn. Es ist ein endloser Prozess der schrittweisen Optimierung, der erklärt, warum Wettervorhersagen gut sind und langsam immer besser werden. Diese Verbesserungen werden allerdings irgendwann an eine Grenze stoßen, denn das Wetter ist ein klassisches Beispiel der Nicht-Linearität. Je weiter die Wetterfrösche in die Zukunft blicken wollen, umso mehr Gelegenheit bekommt das Chaos, mit seinen Schmetterlingsflügeln zu schlagen und sämtliche Erwartungen fortzuwehen. Mit immer leistungsfähigeren Computern und immer feineren Modellen lässt sich diese Grenze vielleicht noch ein bisschen weiter in die Zukunft hinaus- schieben, doch jede weitere Verbesserung wird immer schwieriger, und irgendwann geht der Lohn neuer Anstrengungen gegen null. Wie gut können Wettervorhersagen werden? Das weiß niemand. Aber es ist schon ein Erfolg, dass wir überhaupt die heutige Grenze kennen.
Auf vielen anderen Gebieten stochern die Wissenschaftler nämlich im Dunkeln. Sie haben keine Ahnung, wie gut ihre kurz-, mittel- und langfristigen Prognosen sind oder werden könnten. Das liegt daran, dass das Verfahren der schrittweisen Überprüfung und Verbesserung nur auf dem begrenzten Gebiet der technischen Prognose angewendet wird, etwa von den Volkswirtschaftlern der Zentralbanken, von Marketing- und Finanzabteilungen in Konzernen oder von Meinungsforschungsinstituten.[1] In den meisten Fällen werden Vorhersagen abgegeben, und dann passiert gar nichts. Es wird selten überprüft, wie korrekt sie waren, und schon gar nicht mit ausreichender Regelmäßigkeit und Wissenschaftlichkeit, um daraus irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen zu können. Woran das liegt? Vor allem an den Kunden, den Behörden, Unternehmen und der Öffentlichkeit, die keinen Nachweis für die Zuverlässigkeit verlangen. Also wird sie auch nicht ermittelt. Deshalb kommt es nicht zu einer Korrektur, und ohne diese Korrektur ist keine Verbesserung möglich. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Menschen gern rennen, aber keine Vorstellung davon haben, wie schnell Läufer im Durchschnitt sind oder wie schnell die Besten laufen, weil die Läufer sich nie auf Grundregeln geeinigt haben – sie laufen nicht auf ein Signal hin los, sie bleiben nicht in der Bahn, sie beenden das Rennen nicht nach einer bestimmten Strecke, und es gibt keine unabhängigen Schiedsrichter und Zeitnehmer, die die Ergebnisse festhalten. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich in dieser Welt die Zeiten der Läufer verbessern? Nicht sonderlich. Erreichen diese Läufer die Grenzen des physisch Möglichen? Vermutlich auch nicht.
»Mir fällt auf, wie wichtig Messungen für die Verbesserung des menschlichen Lebens sind«, schrieb Bill Gates. »Man kann unglaubliche Fortschritte erzielen, wenn man sich klare Ziele setzt und ein Maß findet, das die Entwicklung zu diesem Ziel hin forciert … So einfach das klingt, es wird erstaunlich oft nicht gemacht und ist erstaunlich schwer richtig umzusetzen.«[2] Und genauso erstaunlich ist es, wie selten es in der Vorhersage der Zukunft angewendet wird. Oft wird nicht einmal dieser einfache erste Schritt unternommen: Es wird kein klares Ziel vorgegeben.
Vielleicht denken Sie jetzt, dass das Ziel der Prognose doch darin besteht, die Zukunft korrekt vorherzusehen. Aber das ist oft gar nicht das Ziel oder zumindest nicht das einzige. Im Fernsehen dienen Prognosen oft der Unterhaltung, ein Moderator schwingt den Zauberstab oder fordert die Teilnehmer einer Diskussionsrunde auf, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses »auf einer Skala von null bis zehn« einzuschätzen. Oft dienen Prognosen auch einer politischen Agenda, etwa wenn Aktivisten Horrorszenarien auffahren für den Fall, dass wir das Ruder nicht herumreißen. Andere Prognosen sind nichts als Marketing, zum Beispiel wenn Banken renommierte Experten anheuern, die ihren reichen Anlegern die Lage der Weltwirtschaft im Jahr 2050 ausmalen. Und dann gibt es noch die Wohlfühlprognosen, die ihr Publikum in der Gewissheit wiegen sollen, dass ihre Überzeugungen zutreffen und die Zukunft genauso eintritt, wie von ihnen erwartet. All diese Prognosen haben ihre Anhänger, aber sie dienen lediglich der angenehmen Berieselung des Publikums.
Natürlich werden diese Ziele nie genannt, was es nur umso schwerer macht, die Qualität von Prognosen zu messen und zu verbessern. Die Situation ist unübersichtlich, und Besserung ist nicht in Sicht.
Doch gerade wegen dieses Stillstands bezeichne ich mich als optimistischen Skeptiker. Wir wissen, dass in vielen Bereichen, in denen wir uns Vorhersagen wünschen würden – in Politik, Wirtschaft, Börse, Unternehmen, Technologie und Alltag –, Vorhersagen unter bestimmten Umständen und in einem bestimmten Maß möglich sind. Für Wissenschaftler ist das Nichtwissen eine Chance: Es ist eine Möglichkeit, etwas zu entdecken. Je weniger wir wissen, umso größer die Chance. Dank des erstaunlichen Schlendrians auf vielen Gebieten der Vorhersage ist diese Chance sogar riesig. Und um sie zu nutzen, müssen wir uns nur ein klares Ziel setzen, nämlich die Exaktheit, und mit ihrer Überprüfung Ernst machen.
Und genau das ist mein Beruf. Die Untersuchung, an deren Ende die Darts werfenden Schimpansen standen, war lediglich die erste Phase. Die zweite Phase begann im Sommer 2011, als meine Kollegin und Partnerin Barbara Mellers und ich das Good Judgment Project ins Leben riefen und Freiwillige baten, Prognosen über die Zukunft zu erstellen. Bill Flack war einer dieser Freiwilligen. Im ersten Jahr meldeten sich rund zweitausend Personen, in den folgenden vier Jahren folgten Tausende weitere. Insgesamt versuchten mehr als 20000 wissbegierige Laien herauszufinden, ob sich die Proteste in Russland ausweiten würden, wie sich der Goldpreis entwickelt, ob der Nikkei-Index auf über 9500 Punkte steigt, ob auf der koreanischen Halbinsel ein Krieg droht und wie sich viele andere komplexe globale Zusammenhänge weiter entwickeln. Mit wechselnden Versuchsbedingungen wollten wir herausfinden, welche Faktoren zur Optimierung der Vorhersagen beitragen, in welchem Maße, über welche Zeiträume, und wie gut Vorhersagen werden können, wenn man die jeweils besten Methoden kombiniert. So einfach das klingen mag, so schwierig war es in Wirklichkeit. Es war ein anspruchsvolles Programm, das die Intelligenz und den ganzen Einsatz eines interdisziplinären Teams an der University of California in Berkeley und der University of Pennsylvania forderte.
Doch bei allem Umfang war auch das Good Judgment Project (GJP) nur ein Teil eines größeren Projekts der Forschungseinrichtung IARPA, die dem Direktor der Nationalen Nachrichtendienste untersteht. Eine wichtige Aufgabe der Nachrichtendienste besteht darin, wirtschaftliche und politische Entwicklungen in aller Welt vorherzusehen. Grob geschätzt beschäftigen die amerikanischen Nachrichtendienste rund 20000 Analysten, um alles Erdenkliche zu prognostizieren, von kleinen Puzzleteilchen bis zu großen Ereignissen wie der Wahrscheinlichkeit eines israelischen Angriffs auf iranische Atomanlagen oder des Ausstiegs Griechenlands aus der Eurozone.[3] Wie gut sind diese Prognosen? Diese Frage lässt sich kaum beantworten, vor allem weil die Nachrichtendienste wie so viele andere Einrichtungen im Prognosegeschäft nur ungern Geld ausgeben, um das herauszufinden. Das hat verschiedene Gründe, manche seriöser als andere, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das Entscheidende ist, dass diese Prognosen zwar wichtig für die nationale Sicherheit sind, dass aber niemand weiß, wie gut sie sind und ob sie die vielen Milliarden Dollar wert sind, die ein Betrieb mit 20000 Mitarbeitern kostet. Um das zu ändern, schrieb die IARPA einen Prognosewettbewerb aus, an dem fünf Teams unter der Leitung führender Wissenschaftler des Gebiets gegeneinander antraten und knifflige Fragen beantworteten, mit denen Nachrichtendienste täglich konfrontiert werden. Eines dieser fünf Teams war das Good Judgment Project. Jedes Team war ein eigenes Forschungsprojekt mit eigenen Methoden, und das Experiment dauerte von September 2011 bis Juni 2015. Jeden Tag um 9 Uhr morgens mussten die Teams ihre Ergebnisse einreichen. Auf diese Weise wurden gleiche Bedingungen geschaffen, und es entstand ein reichhaltiger Pool von Daten darüber, was unter welchen Umständen wie gut funktioniert. Über einen Zeitraum von vier Jahren stellte die IARPA fast fünfhundert Fragen zu aktuellen Themen. Die Zeitspannen waren kürzer als in meiner Untersuchung der politischen Experten, die meisten Prognosen bezogen sich auf Zeiträume zwischen einem Monat und einem Jahr. Insgesamt sammelten wir auf diese Weise mehr als eine Million Zukunftsprognosen.
Im ersten Jahr schlug das Good Judgment Project die Kontrollgruppe um 60 Prozent, im zweiten Jahr um 78 Prozent. Das Good Judgment Project war auch deutlich besser als die Mitbewerber von der University of Michigan und dem MIT, die sie um 30 bis 70 Prozent übertraf. Wir waren sogar besser als die professionellen Analysten der Nachrichtendienste, obwohl diese Zugang zu geheimen Informationen haben. Nach nur zwei Jahren war das Good Judgment Project so gut, dass die IARPA die übrigen Wettbewerber ausschloss.[4]
Auf die Einzelheiten des Wettbewerbs komme ich später noch zu sprechen, an dieser Stelle möchte ich nur zwei wichtige Schlussfolgerungen erwähnen. Erstens: Vorhersage ist möglich. Einige Menschen wie Bill Flack sind besonders gut. Sie sind keine Propheten oder Orakel und können nicht Jahrzehnte weit in die Zukunft blicken, aber sie verfügen über reale, messbare Fähigkeiten einzuschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte wichtige Ereignisse über einen Zeitraum von drei, sechs, zwölf oder achtzehn Monaten eintreten. Und zweitens: Es hat Gründe, warum manche Menschen gute Vorhersagen treffen. Es ist allerdings keine Frage des Talents, denn Vorhersage ist nichts, was einem in die Wiege gelegt wird. Es ist vielmehr das Resultat bestimmter Denk- und Vorgehensweisen, die sich mit etwas Einsatz erlernen lassen. Der Anfang ist gar nicht schwer. Ich war erstaunt, wie schnell schon eine knappe Einführung in die Grundlagen Wirkung zeigte; diese Einführung stelle ich in diesem Buch dar und fasse sie im Anhang in den Zehn Geboten der guten Prognose zusammen. Diese Einführung ließ sich innerhalb von nur einer Stunde lesen und verbesserte die Qualität der Vorhersage über ein Testjahr hinweg um 10 Prozent. Das mag bescheiden klingen, doch der Preis dafür war minimal. Bedenken Sie außerdem, dass sich selbst bescheidene Verbesserungen im Laufe der Zeit summieren. Darüber sprach ich mit Aaron Brown, Buchautor, Börsenveteran und Risikomanager des Hedgefonds AQR Capital Management, der Anlagen im Wert von 100 Milliarden Dollar verwaltet. »Der Unterschied ist nicht dramatisch«, meinte er. »Aber langfristig ist das der Unterschied zwischen jemandem, der durchgehend erfolgreich ist und seinen Lebensunterhalt verdient, und einem Verlierer, der dauernd pleite ist.«[5] Dem stimmt auch eine professionelle Pokerspielerin zu, die wir später kennenlernen werden: Der Unterschied zwischen Profis und Amateuren ist, dass Profis zwischen einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 60 Prozent und einer von 40 Prozent unterscheiden können, Amateure nicht.
Aber wenn sich unsere Vorhersagen allein durch eine konsequente Überprüfung verbessern lassen und wenn die verbesserte Vorhersage so deutliche Vorteile bringt, warum überprüfen wir sie dann nicht standardmäßig? Die Antwort ist vor allem eine psychologische: Wir glauben, Dinge zu wissen, die wir gar nicht wissen, zum Beispiel ob die Prognosen von Thomas Friedman gut sind oder nicht. Auf diesen psychologischen Aspekt gehe ich im nächsten Kapitel ein. In der Medizin behinderte dieser Glaube jahrhundertelang jeden Fortschritt. Als sich Ärzte schließlich eingestanden, dass sich die Wirkung einer Behandlung nicht allein aufgrund ihrer Erfahrungen und mit subjektiven Beobachtungen überprüfen ließ, gingen sie zu wissenschaftlichen Tests über, und mit einem Mal machte die Medizin rasche Fortschritte. In der Prognose brauchen wir eine ähnliche Revolution.
Das wird nicht einfach. Im dritten Kapitel sehen wir uns an, was nötig ist, um an Prognosen dieselben wissenschaftlichen Maßstäbe anzulegen wie an medizinische Behandlungen. Diese Herausforderung ist größer, als sie klingt. Ende der 1980er Jahre entwickelte ich eine Testmethode und führte den seinerzeit größten Qualitätstest der politischen Expertenprognose durch. Ein Ergebnis war der Schimpansen-Witz, den ich heute gar nicht mehr witzig finde. Ein anderes Ergebnis erhielt nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit, obwohl es eigentlich viel wichtiger war: Ein Teil der Experten verfügte über bescheidene, aber reale Prognosefähigkeiten. Worin bestand der Unterschied zwischen diesen Experten und denen, die so schlecht waren, dass sie den Durchschnitt auf das Niveau eines Darts werfenden Schimpansen herunterzogen? Sie verfügten weder über eine göttliche Gabe noch über Zugang zu geheimen Informationen. Sie vertraten auch keine besonderen Ansichten oder Überzeugungen. Es war nicht entscheidend, was sie dachten, sondern vielmehr, wie sie dachten.
Diese Erkenntnis war einer der Anstöße für den Wettbewerb der IARPA. In Kapitel 4 geht es um dieses Projekt und die Entdeckung der Superprognostiker. Wie lassen sich ihre Erfolge erklären? Dieser Frage gehen wir in den Kapiteln 5 bis 9 nach. Bei der Begegnung mit den Superprognostikern wird Ihnen sicher auffallen, dass es sich um intelligente Menschen handelt, und Sie könnten zu dem Schluss kommen, dass ihre Intelligenz der Grund für ihre guten Vorhersagen ist. Aber so ist es nicht. Oder Sie könnten meinen, dass man ein Zahlenmensch sein muss wie der studierte Mathematiker Bill Flack – liegt das Geheimnis in exotischen mathematischen Formeln? Auch das nicht. Selbst mathematisch versierte Superprognostiker greifen nur äußerst selten auf die Mathematik zurück. Weil diese Leute Zeitungen lesen, über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden bleiben und ihre Vorhersagen ständig aktualisieren, könnten Sie vielleicht zu dem Schluss kommen, dass sie endlos viel Zeit in ihre Vorhersagen investieren. Aber auch das ist es nicht.
Gute Prognose erfordert zwar ein gewisses Maß an Intelligenz, Mathematik und Weltwissen, aber wer in der Lage ist, Bücher über psychologische Forschung zu lesen, bringt jede dieser Voraussetzungen mit. Was macht also Superprognostiker aus? Wie im Fall der politischen Experten, die in meiner früheren Untersuchung korrekte Prognosen abgaben, ist das Entscheidende die Vorgehens- und Denkweise. Diese Denkweise beschreibe ich auf den folgenden Seiten im Einzelnen, aber ich kann schon ganz allgemein vorwegnehmen, dass gute Vorhersage ein offenes, sorgfältiges, neugieriges und vor allem selbstkritisches Denken erfordert. Und Konzentration. Bessere Urteilsfähigkeit will gelernt sein. Dauerhaft gute Prognose verlangt Einsatz: Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die Bereitschaft zur konstanten Arbeit an sich selbst die wichtigste Voraussetzung zur Verbesserung der Vorhersage ist.
In den letzten Kapiteln gehe ich auf den vermeintlichen Widerspruch zwischen den Anforderungen an eine gute Urteilsfähigkeit und guter Führung ein, erörtere die wichtigsten Kritikpunkte an meiner Arbeit und – wie es sich für ein Buch über Vorhersagen gehört – gebe einen Ausblick auf die Zukunft.
Eine Prognose zur Prognose
Vielleicht glauben Sie, dass dieses Thema inzwischen hoffnungslos veraltet ist. Schließlich leben wir doch in einer Zeit von unglaublich leistungsstarken Computern, hochkomplexen Algorithmen und Big Data. Im Kern geht es bei der hier beschriebenen Prognose immer um subjektive Urteile – um Menschen, die abwägen und entscheiden, nicht mehr. Gehört diese subjektive Raterei nicht längst der Vergangenheit an?
Im Jahr 1954 schrieb der Psychologe Paul Meehl ein kleines Buch, das großen Wirbel machte.[1] Er verglich zwanzig Untersuchungen, die zeigten, dass Experten künftige Ereignisse – zum Beispiel ob ein Student an der Universität Erfolg haben oder ein vorzeitig aus der Haft Entlassener wieder straffällig werden würde – weniger korrekt vorhersagten als einfache Algorithmen, die objektive Daten wie Testergebnisse oder die Vorgeschichte verarbeiteten. Mit seiner Behauptung stieß Meehl viele Experten vor den Kopf, aber mehr als zweihundert nachfolgende Untersuchungen bestätigten, dass Algorithmen in den allermeisten Fällen dem menschlichen Urteil überlegen sind, und wo sie es nicht waren, waren sie zumindest gleichwertig. Da Algorithmen schneller und billiger sind als das subjektive Urteil, sind sie bei gleichem Ergebnis im Vorteil. Wir brauchen uns nicht zu streiten: Wenn wir einen bewährten statistischen Algorithmus haben, dann sollten wir ihn auch nutzen.
Diese Erkenntnis stellt allerdings keine Bedrohung für das subjektive Urteil dar, denn für die allermeisten Fragen gibt es keinen bewährten statistischen Algorithmus. Deswegen ist es heute genauso unmöglich wie 1954, das gute alte Denken durch die Mathematik zu ersetzen.
Spektakuläre Erfolgsmeldungen aus der Informationstechnologie vermitteln zwar den Eindruck, dass unser Verhältnis zur Maschine an einem Wendepunkt steht. Im Jahr 1997 besiegte der Schachcomputer Big Blue von IBM den Schachweltmeister Garri Kasparow. Heute sind schon handelsübliche Schachprogramme in der Lage, jeden Großmeister an die Wand zu spielen. Im Jahr 2011 besiegte der IBM-Rechner Watson die Jeopardy!-Meister Ken Jennings und Brad Rutter. Das war eine deutlich größere Herausforderung für die Ingenieure von IBM, aber sie schafften es. Inzwischen könnte man sich durchaus einen Supercomputer vorstellen, der bessere Prognosen ausspuckt als die besten Experten. Wenn es so weit kommt, wird es zwar immer noch menschliche Prognostiker geben, aber wie die menschlichen Jeopardy!-Spieler werden sie nur noch der Unterhaltung halber antreten.
Darüber unterhielt ich mich mit David Ferrucci, dem Chefingenieur von Watson. Ich war mir sicher, dass Watson eine Wissensfrage wie »Welche zwei russischen Politiker tauschten in den vergangenen zehn Jahren die Ämter?« spielend beantworten würde. Vor allem aber wollte ich wissen, wie lange es seiner Ansicht nach dauern würde, bis Watson oder einer seiner digitalen Nachfahren Zukunftsfragen wie »Werden in den kommenden zehn Jahren zwei russische Politiker die Ämter tauschen?« beantworten könnte.
Schon 1965 behauptete der Sozialwissenschaftler Herbert Simon, in nur zwanzig Jahren würden Maschinen »jede menschliche Tätigkeit« übernehmen können. Diese naive Technikgläubigkeit war damals in Mode, weshalb Ferrucci, der seit dreißig Jahren auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz forscht, heute vorsichtiger ist.[2] Die Computertechnologie komme mit Riesenschritten voran, erklärt er mir. Sie mache spektakuläre Fortschritte bei der Mustererkennung. Und auf dem Gebiet der lernenden Maschinen und der Interaktion zwischen Mensch und Maschine seien in Zukunft gewaltige Entwicklungen zu erwarten. »Wir stehen heute am Anfang einer exponentiellen Kurve«, meint er.
Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen der Frage »Welche Politiker haben die Rollen getauscht?« und »Werden Politiker wieder die Rollen tauschen?«. Die erste Frage bezieht sich auf eine historische Tatsache. Der Computer kann die Antwort nachschlagen. Die zweite Frage erfordert eine intelligente Einschätzung der Absichten von Wladimir Putin, der Persönlichkeit von Dmitri Medwedjew und der Kausalzusammenhänge innerhalb der russischen Politik sowie eine Synthese all dieser Einschätzungen in einem Urteil. Menschen tun dies andauernd, aber das macht es nicht einfacher. Es bedeutet, dass das menschliche Gehirn ein Wunderwerk ist, denn diese Aufgabe ist unglaublich schwierig. Trotz der gewaltigen Fortschritte der Computer sind Vorhersagen, wie sie Superprognostiker treffen können, noch ferne Zukunftsmusik. Und Ferrucci glaubt nicht, dass wir jemals einen Menschen in einer Museumsvitrine mit der Aufschrift »subjektives Urteil« sehen werden.
Maschinen werden besser darin, »menschliche Sinnkonstruktionen nachzuahmen« und damit auch vorherzusehen. »Aber es ist eine Sache, Sinnkonstruktionen nachzuahmen, und eine andere, selbst Sinn zu schaffen«, meint Ferrucci. Dieser Raum bleibt dem menschlichen Urteil vorbehalten.
In der Prognose werden Menschen zwar weiter zurückgedrängt werden, sehr zum Entsetzen der Arbeitnehmer, aber es werden auch immer mehr Synthesen entstehen. Ein Beispiel ist das »Freistilschach«, bei dem Mensch und Maschine gemeinsam antreten und der Mensch die Stärken der Maschine nutzt, aber selbst urteilt. Das Ergebnis ist eine Kombination, die (manchmal) sowohl Menschen als auch Maschinen schlagen kann. Der Gegensatz zwischen Mensch und Maschine könnte aufgehoben werden, und ein Team aus Garri Kasparow und Deep Blue könnte sich als einem rein maschinellen oder rein menschlichen Ansatz überlegen erweisen.
Was nach Ansicht von Ferrucci sehr wohl der Vergangenheit angehört, sind Gurus, die viele politische Debatten in eine kindische Schneeballschlacht verwandeln: »Ich erwidere Ihre Paul-Krugman-Polemik mit meiner Niall-Ferguson-Gegenpolemik und widerlege Ihren Thomas-Friedman-Kommentar mit meinem Bret-Stephens-Blog.« Aber Ferrucci sieht Licht am Ende des Tunnels. Wir werden immer seltener auf Experten hören, die sich allein auf ihr subjektives Urteil verlassen. Erst seit einigen Jahrzehnten erkennen wir, wie leicht das menschliche Denken in psychologische Fallen tappt. »Deswegen sollten menschliche Experten mit Computern gepaart werden, um die kognitiven Schwächen und Verzerrungen zu überwinden.«[3]
Wenn Ferrucci recht hat – und ich würde ihm zustimmen –, dann werden in Zukunft computergestützte und subjektive Prognosen Hand in Hand gehen. Deshalb ist es an der Zeit, mit beiden Ernst zu machen.
Kapitel 2Eine Pseudowissenschaft?
Als der Hautarzt die Flecken auf dem Handrücken seines Patienten sah, wurde er misstrauisch und entfernte einen Teil der Haut. Ein Pathologe bestätigte, dass es sich um ein Basaliom handelte: Hautkrebs. Der Patient blieb ruhig. Er war selbst Arzt. Er wusste, dass sich diese Art von Krebs selten ausbreitet. Das Basaliom wurde entfernt, und als Vorsichtsmaßnahme suchte der Arzt einen renommierten Krebsspezialisten auf.
Der Spezialist entdeckte einen Knoten unter der rechten Achsel des Patienten. Wie lang war der schon da? Das konnte der Patient nicht sagen. Der Spezialist erklärte, der Knoten müsse sofort entfernt werden. Der Patient stimmte zu. Der Spezialist war schließlich eine Koryphäe. Wenn er sagte, das muss weg, dann musste es weg. Der Operationstermin wurde festgelegt.
Als der Patient aus der Narkose erwachte, stellte er überrascht fest, dass seine gesamte Brust bandagiert war. Der Spezialist trat ans Bett. Sein Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes. »Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen«, erklärte er. »Ihre Achselhöhle ist von Krebsgewebe durchsetzt. Ich habe mein Bestes getan, es zu entfernen, und ich habe ihren kleinen Brustmuskel entfernt. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich Ihnen damit das Leben gerettet habe.«[1] Der letzte Satz war ein hilfloser Versuch, die Wahrheit ein wenig zu verpacken. Die Botschaft war unmissverständlich: Der Patient hatte nicht mehr lange zu leben.
»Einen Moment lang dachte ich, die Welt geht unter«, schrieb der Patient später. »Nach dem ersten Schock legte ich mich, so gut ich konnte, auf die Seite und schluchzte hemmungslos. An den Rest des Tages erinnere ich mich nicht mehr.« Am nächsten Morgen war sein Kopf klarer. »Ich stellte einen einfachen Plan auf, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen wollte … Danach überkam mich ein sonderbar friedliches Gefühl, und ich schlief ein.« In den folgenden Tagen kamen Besucher, um den Patienten zu trösten, so gut sie konnten. Das war ihm ein wenig peinlich. »Es war schnell klar, dass sie betroffener waren als ich«, schrieb er.[2] Er lag im Sterben. Es galt, Ruhe zu bewahren und der Tatsache ins Auge zu sehen. Jammern war zwecklos.
Dieser traurige Vorfall ereignete sich im Jahr 1956. Doch der Patient, ein Schotte namens Archie Cochrane, starb nicht, was ein Glück war, denn er sollte auf dem Gebiet der Medizin noch Großes leisten. Der renommierte Spezialist hatte sich geirrt. Cochrane hatte keinen tödlichen Tumor. Er hatte überhaupt keinen Tumor, aber das erkannte erst der Pathologe, der das in der Operation entfernte Gewebe untersuchte. Diese neue Mitteilung schockierte Cochrane genauso wie das Todesurteil. »Man hatte mir zwar gesagt, dass der Befund des Pathologen noch nicht vorlag«, schrieb er viele Jahre später. »Doch ich zweifelte das Urteil des Chirurgen keinen Moment lang an.«[3]
Und genau das war das Problem. Cochrane zweifelte das Urteil des Spezialisten nicht an, und der Spezialist zweifelte sein eigenes Urteil nicht an. Keiner von beiden zog die Möglichkeit in Betracht, dass die Diagnose falsch sein könnte und dass man vielleicht den Befund des Pathologen abwarten sollte, ehe man das Todesurteil über Archie Cochrane sprach. Aber wir sollten nicht voreilig urteilen. Das ist nur allzu menschlich. Wir sind viel zu schnell mit Urteilen bei der Hand und brauchen dann viel zu lange, um sie wieder zu korrigieren. Und wenn wir uns nicht ansehen, wie wir diese Fehler machen, dann werden wir sie immer wieder machen. Über Jahre hinweg. Unser ganzes Leben lang. Oder sogar jahrhundertelang, wie die lange und traurige Geschichte der Medizin zeigt.
Ein Cargo-Kult der Wissenschaft
Dass die Geschichte der Medizin lang ist, wird vermutlich niemand bestreiten. Seit Menschen krank werden, haben andere versucht, sie wieder gesund zu machen. Aber »traurig«? Das ist schon weniger bekannt, selbst unter Menschen, die sich mit der Geschichte der Medizin beschäftigen. »Die meisten Medizingeschichten sind auffällig schief«, meint der britische Arzt und Autor Druin Burch.[1] »Sie beschreiben, was die Menschen zu tun glaubten, aber sie sagen kaum etwas darüber aus, ob sie damit recht hatten.« Konnten ägyptische Mediziner mit ihren Straußenei-Packungen tatsächlich Kopfverletzungen heilen? Trugen die Behandlungen des königlich-mesopotamischen Rektumbewahrers wirklich dazu bei, das königliche Hinterteil bei Gesundheit zu halten? Und wie steht es mit dem Aderlass? Von den alten Griechen bis ins 18. Jahrhundert schworen Ärzte auf die heilende Wirkung dieser Behandlung, aber was bewirkte sie wirklich? Die Geschichtsbücher schweigen sich aus, aber wenn wir frühere Behandlungsmethoden mit modernen Methoden überprüfen, dann wird deprimierend klar, dass sie überhaupt nicht wirkten oder sogar schadeten. Bis vor recht kurzer Zeit war ein Patient besser bedient, keinen Arzt zu rufen, weil die Krankheit weniger gefährlich war als die Behandlung, die ihr der Arzt angedeihen ließ. Und die Behandlungsmethoden wurden selten besser, egal wie viel Zeit verging. Als George Washington im Jahr 1799 krank wurde, ließen ihn seine renommierten Ärzte erbarmungslos zur Ader, sie verabreichten Quecksilber, um Durchfall zu provozieren, sie führten Erbrechen herbei und schröpften den alten Mann, indem sie ihm heiße Gläser auf den Rücken setzten. Ein Arzt aus dem Athen der Antike oder dem London der Renaissance hätte angesichts dieser qualvollen Behandlung zustimmend genickt.
George Washington starb. Man sollte meinen, dass ein Ergebnis wie dieses seine Ärzte veranlasst hätte, ihre Methoden zu hinterfragen. Aber der Fairness halber muss man zugestehen, dass Washingtons Ende lediglich beweist, dass sie seinen Tod nicht verhindern konnten. Es ist vieles denkbar: Es könnte sein, dass die Behandlungen in anderen Fällen wirkten und nur in diesem wirkungslos blieben; es könnte sein, dass sie völlig wirkungslos waren; und es könnte sogar sein, dass sie seinen Tod verschuldeten. Wenn man die Behandlungen nur vom Ergebnis her betrachtet, lässt sich nicht sagen, welche dieser Möglichkeiten zutrifft. Selbst nach vielen Beobachtungen lässt sich die Wahrheit kaum feststellen. Es gibt zu viele Faktoren, zu viele Erklärungen und zu viele Unbekannte. Und wenn die Ärzte bereits von der Wirksamkeit ihrer Behandlungen überzeugt waren – und das mussten sie ja gewesen sein, denn sonst hätten sie sie ja nicht verschrieben –, dann hatten sie nur eine Antwort auf alle Unklarheiten: Natürlich wirkt die Behandlung. Um diese Vorurteile zu überwinden, sind starke Beweise nötig, und es müssen gründlichere Experimente durchgeführt werden als »lass den Patienten zur Ader und schau was passiert«. Aber diese Experimente wurden nie durchgeführt.
Ein gutes Beispiel ist Galen, der im zweiten Jahrhundert Leibarzt der römischen Kaiser war. Niemand hat mehr Generationen von Medizinern beeinflusst als er. Mehr als ein Jahrtausend lang waren seine Schriften die unumstößliche Autorität auf dem Gebiet der Heilkunst. »Ich und nur ich allein habe den wahren Weg der Medizin aufgetan«, schrieb er in der ihm eigenen Bescheidenheit. Dabei führte Galen nie etwas durch, was auch nur im entferntesten an ein modernes Experiment erinnern würde. Wozu auch? Experimente sind etwas für Leute, die sich der Wahrheit nicht sicher sind. Aber ein Galen kannte solche Zweifel nicht. Jedes Ergebnis bestätigte, dass er recht hatte, egal wie zweideutig die Beweislage anderen erscheinen mochte, die nicht über die Weisheit des Meisters verfügten. »Diejenigen, die von dieser Medizin trinken, genesen binnen kurzer Zeit, mit Ausnahme derer, denen sie nicht hilft – diese sterben alle«, schrieb er. »Es ist daher offensichtlich, dass sie nur in unheilbaren Krankheiten versagt.«[2]
Galen mag ein Extremfall sein, doch Leute wie er tauchen in der Medizingeschichte immer wieder auf. Es sind Männer (es sind immer Männer) mit unerschütterlichen Überzeugungen und einem tiefen Zutrauen in ihr eigenes Urteil. Sie verschreiben Behandlungen, errichten gewaltige Theoriegebäude, verunglimpfen Konkurrenten als Quacksalber und Scharlatane und verbreiten ihre Thesen mit missionarischem Eifer. Diese Tradition reicht von den alten Griechen über Galen und Paracelsus bis zu dem Deutschen Samuel Hahnemann und dem Amerikaner Benjamin Rush. In den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts lieferten sich orthodoxe Mediziner heftige Kämpfe mit einer Reihe charismatischer Gestalten. Letztere vertraten abstruse Theorien wie den Thomsonianismus, dem zufolge die meisten Krankheiten auf ein Übermaß an Kälte im Körper zurückzuführen waren, oder die Öffnungschirurgie von Edwin Hartley Pratt, der behauptete, »das Rektum sei das Zentrum der Existenz, enthalte die Essenz des Lebens und übernehme Funktionen, die gewöhnlich dem Herzen und dem Hirn zugeschrieben werden«, wie es ein Kritiker mit leiser Übertreibung formulierte.[3] Aber egal ob die Lehre orthodox oder abseitig war, das meiste war falsch, und die meisten Behandlungen waren wirkungslos bis lebensgefährlich. Einige Ärzte ahnten dies zwar, aber das hinderte sie nicht daran, weiterzumachen wie gehabt. Die Medizin zeichnete sich durch eine fatale Mischung aus Unwissenheit und Selbstvertrauen aus. Wie die Chirurgin und Historikerin Ira Rutkow schrieb, erinnerten die Ärzte, die ihre Theorien und Behandlungsmethoden in heftigen Debatten vertraten, an »Blinde, die sich über die Farben des Regenbogens streiten«.[4]





























