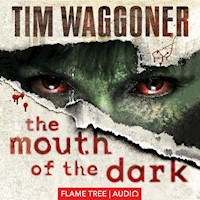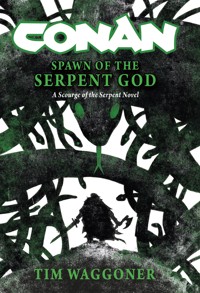Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
EIN NEUES ABENTEUER DER BEIDEN DÄMONEN-JAGENDEN WINCHESTER-BRÜDER. Wiederholte Sichtungen eines Höllenhundes und die Entdeckung einer völlig dehydrierten Leiche im Ohio-Städtchen Brennan rufen Sam und Dean auf den Plan. Doch als die Winchesters den monströsen Vierbeiner einfangen, entpuppt sich die Bestie als eine Art Frankensteinhund – ein Monster, geschaffen aus diversen Leichenteilen. Schon bald bekommen es die Brüder mit verrückten Wissenschaftlern, Biotechnologie, jahrhundertealten Alchemisten, wandelnden Leichen und einer uralten, äußerst bösartigen Macht zu tun … Dieser Roman ist zeitlich während der 7. Staffel angesiedelt. Basierend auf der fantastischen Welt der erfolgreichen TV-Serie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
AUSSERDEM ERHÄLTLICH VON PANINI
SUPERNATURAL: Frischfleisch
Ein Abenteuer der 7. Staffel, exklusiv als Roman
Alice Henderson – ISBN 978-3-8332-3268-8
SUPERNATURAL: Das Herz des Drachen
Die Verbindung der TV-Staffeln 4 und 5, exklusiv als Roman
Keith R.A. DeCandido – ISBN 978-3-8332-2251-1
SUPERNATURAL: Die Judasschlinge
Die Verbindung der TV-Staffeln 4 und 5, exklusiv als Roman
Joe Schreiber – ISBN 978-3-8332-2252-8
SUPERNATURAL: Comicband 1: Der verlorene Sohn
ISBN 978-3-86607-988-5
SUPERNATURAL: Comicband 2: Origins
ISBN 978-3-86201-004-2
SUPERNATURAL: Comicband 3: Der Anfang vom Ende
ISBN 978-3-86201-078-3
Infos zu weiteren Romanen und Comics unter:www.paninibooks.de
IN FLEISCH GEMEISSELT
Tim Waggoner
SUPERNATURAL wurde erschaffen von Eric Kripke
Aus dem Amerikanischenvon Timothy Stahl
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Titel der Englischen Originalausgabe: „Supernatural: Carved in Flesh“ by Tim Waggoner, published by Titan Books, UK, April 2013.
Copyright © 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Supernatural and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Cover imagery: Cover photograph © Warner Bros. Entertainment Inc. Shadow Puppet © Shutterstock. Mountain range © Shutterstock.
Deutsche Ausgabe 2017 by Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Timothy Stahl
Lektorat: Robert Mountainbeau
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDSUPR004E
ISBN 978-3-8332-3566-5
Gedruckte Ausgabe: 1. Auflage, Juni 2017
ISBN 978-3-8332-3448-4
Findet uns im Netz:
www.paninibooks.de
PaniniComicsDE
ZEITLICHE EINORDNUNG
Dieser Roman spielt während der siebten Staffelzwischen den Episoden „Die Zeit heilt keine Wunden“ und „Vatertag“.
Eins
„Ich wundere mich, dass sie noch nicht zum Überwintern in den Süden geflogen sind.“
Joyce Nagrosky warf ihrem Begleiter einen Seitenblick zu. Er stand am Rand des Teiches, riss kleine Stücke von einer Brotscheibe ab und warf sie ins Wasser. Ein halbes Dutzend Enten hatte sich dicht am Ufer versammelt, und wann immer ein Brocken in ihrer Nähe landete, streckten sich ihre Hälse, die Köpfe schossen wie angreifende Schlangen nach vorn und mit ihren gerundeten Schnäbeln schnappten sie sich den Happen. War das Brot dann weg, glotzten sie die Menschen wachsam an, gierig auf den nächsten Leckerbissen.
„Nicht alle Enten fliegen im Winter nach Süden“, erklärte Joyce. „Solange es nicht so kalt wird, dass ihre Füße erfrieren, halten sie es bis zum Frühjahr gut aus.“
Ted wandte sich ihr mit einem amüsierten Lächeln zu. „Ich dachte, als Lehrerin wärst du in Pension gegangen. Außerdem hast du doch Englisch unterrichtet, nicht Biologie.“
Sie musste lachen. „Tja, einmal Besserwisserin, immer Besserwisserin.“
Auch mit über sechzig war Ted Boykin noch ein gut aussehender Mann mit vollem, dichtem weißem Haar, entsprechendem Kinnbart und beeindruckend blauen Augen. Zu seiner Zeit als Rektor der Schule, an der Joyce unterrichtet hatte, war er noch ohne Bart gewesen, und obgleich ihr die Gesichtsbehaarung von Männern eigentlich gleichgültig war, verlieh ihm der Bart etwas Spitzbübisches, das ihr gefiel. Über zwanzig Jahre lang hatte sie an seiner Seite gearbeitet, und sie hatte ihn respektiert und in mancherlei Hinsicht sogar als Freund betrachtet, doch zu ihm hingezogen hatte sie sich nicht gefühlt. Jetzt hingegen … Das Leben konnte bisweilen wirklich komisch sein. Mehr noch, absolut zum Totlachen.
Die Dämmerung hatte an diesem frühen Novemberabend bereits eingesetzt. War es tagsüber auch eher warm gewesen, wurde es nun, da die Sonne dem Horizont entgegensank, allmählich kalt. Ted schien davon in seiner braunen Jacke nichts zu spüren, aber Joyce hatte, als sie ihre Wohnung verließ, nur ihre blaue Windjacke übergezogen, und die hielt die kühle Luft kaum ab, zumal sie darunter nur ein T-Shirt trug. Hätte sie doch wenigstens daran gedacht, sich eine Mütze oder einen Schal zu greifen, bevor sie zur Tür hinausgegangen war.
Was bist du denn auf einmal so zerstreut, meine Liebe?, fragte sie sich. Kann es sein, dass du vor deinem Rendezvous mit Mr Boykin am Ententeich ein bisschen nervös gewesen bist? Sie wollte sich einreden, dass dieser Gedanke albern sei. Herrgott noch mal, sie war ein großes Mädchen! Ehrlich gesagt sogar übergroß, vielleicht nicht der Länge nach, aber in der Breite. Und der Teich war schließlich kein typischer Treffpunkt für Liebespaare. Trotzdem musste sie sich ein gewisses Unbehagen eingestehen. Seit dem Tod ihres Mannes vor ein paar Jahren war sie allein, und auch wenn er ihr immer noch fehlte, hatte sie in all der Zeit doch nie das Bedürfnis verspürt, sich einen Ersatz zu suchen. Aber dann, vor einer Woche, hatte sie Ted getroffen – beinahe buchstäblich. Sie war mit ihrem Volvo rückwärts aus der Parkbucht vor ihrer Wohnung gestoßen und Ted war im selben Moment am Haus vorbeigefahren. Er hatte es gerade noch geschafft, seinen Bronco zum Stehen zu bringen, bevor er sie von hinten rammte (na, das nenn ich doch mal eine eindeutig zweideutige Formulierung!), und da hatten sie festgestellt, dass sie beide nach dem Tod ihrer Ehepartner ihre Häuser verkauft hatten und in die Arbor-Vale-Apartments gezogen waren. Ted wohnte tatsächlich im Gebäude nebenan und das schon seit fast zwei Jahren, ohne dass sie voneinander gewusst hatten. Die Welt war ein Dorf.
Am nächsten Tag hatten sie sich zum Mittagessen verabredet, am übernächsten zum Abendessen. Sie hatten sich in den vergangenen sieben Tagen etliche Male gesehen, und in all der Zeit hatte Ted sich als vollkommener Gentleman erwiesen und weder versucht, sie zu küssen, noch auch nur ihre Hand zu halten. Und offen gestanden hatte sie das allmählich satt. Sie wünschte, er möge sich endlich ein Herz fassen und etwas tun. Sie war alles andere als schüchtern und hätte selbst den ersten Schritt getan, wenn er sich ihr gegenüber nicht so zögerlich verhalten hätte. Das Letzte, was sie wollte, war, ihn zu verschrecken, indem sie zu direkt war: Findest du nicht, es wäre an der Zeit, dass wir miteinander ins Bett gehen? Wir werden schließlich nicht jünger. Irgendwie glaubte sie nicht, dass das funktionieren würde.
Sie strich sich ihr schwarzes Haar hinters Ohr, obwohl es gar nicht nötig war. Es wehte immer noch kein Wind, und so kurz, wie sie ihr Haar trug, geriet es kaum einmal in Unordnung. Seit ihrer Kindheit war sie ein ziemlicher Wildfang gewesen, und nun, da sie nicht mehr zur Arbeit ging und sich entsprechend zurechtmachen musste, hatte sich dieser Charakterzug wieder durchgesetzt. Sie bevorzugte schlichte Kleidung wie T-Shirts und Jeans und verzichtete auf Make-up. Vor einiger Zeit hatte sie angefangen, Schmuck zu sammeln, den sie bei Auktionen und Haushaltsauflösungen erstand, aus Gründen, die sie sich nicht einmal selbst genau erklären konnte, zumal sie kaum einmal eines der Stücke trug. Heute wünschte sie allerdings, sie hätte daran gedacht. Wenn sie auf Ted einen feminineren Eindruck machte, würde er vielleicht weniger Distanz wahren. Vielleicht ist er über den Verlust seiner Frau noch nicht hinweg, überlegte sie. Oder vielleicht sieht er in mir immer noch eine seiner Lehrerinnen anstatt einer Frau. Es überraschte sie, wie sehr letztere Möglichkeit sie bedrückte.
Der Teich lag hinter den Arbor-Vale-Häusern am Fuß eines sanft abfallenden, mit Gras bewachsenen Hügels. Auf der anderen Seite befand sich ein Wald aus Eichen, Ulmen und Eschen, deren Laub eine prachtvolle Mischung aus Gelb, Rot und Braun bildete. Noch trugen die Bäume die meisten ihrer Blätter, doch Joyce wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis sie zu Boden segeln würden. Eine Woche noch, vielleicht zwei. Der Herbst war ihre liebste Jahreszeit, zum Teil, weil da die Schule wieder anfing. In erster Linie lag es jedoch an der Energie, die zu dieser Zeit die knackig frische Luft erfüllte. Es war so wunderbar paradox, dass der Herbst, obwohl die Welt sich auf den einstweiligen Tod vorbereitete, den der Winter mit sich brachte – und auf den im Frühling die Wiederauferstehung folgte –, dennoch die lebendigste Zeit des Jahres zu sein schien, jedenfalls in ihren Augen.
Zum Teufel damit, dachte sie. Das Leben ist zum Leben da. Sie trat einen Schritt auf Ted zu, streckte die Hand aus und ergriff die seine.
Sie spürte, wie er erstarrte, und fürchtete schon, er würde ihr seine Hand entziehen, doch dann entspannte er sich und umfasste ihre Finger fester. Joyce sah ihn nicht an, und er sah sie nicht an, aber sie lächelten beide und blickten aufs Wasser. Ted warf den Rest des Brotes hinein, und als es aufgefressen war, schwammen die Enten in der vergeblichen Hoffnung auf mehr hin und her. Joyce bewunderte, wie sich die Bäume am anderen Ufer im Teich spiegelten – als sei das Bild mit dunkler Tinte auf das sich kräuselnde Wasser gemalt.
Sie fragte sich, wie ihre Chancen standen, dass Ted sie später küsste und vielleicht nicht nur küsste, als sie ein leises Knurren hörte. Angst durchzuckte sie und sie verstärkte ihren Griff um Teds Hand.
Die Enten bäumten sich erschrocken quakend auf, breiteten die Flügel aus und flohen heftig flatternd der Reihe nach himmelwärts.
Der Laut erklang abermals. Ein tiefes Grollen wie ein Lastwagenmotor, der dringend der Reparatur bedurfte, nur war es diesmal lauter. Und näher. Das Geräusch kam von rechts, und als Joyce und Ted sich in diese Richtung wandten, sahen sie eine große dunkle Gestalt aus dem Wald auftauchen und auf allen vieren herankommen.
Das Ding bewegte sich mit der langsamen, bedrohlichen Bedächtigkeit eines Raubtiers, und im ersten Moment dachte Joyce, es könne ein Kojote sein. Die Tiere hatten in den vergangenen Jahren Einzug in Ohio gehalten, und wenn sie auch keineswegs weitverbreitet waren, gab es doch mehr von ihnen, als die meisten Leute glaubten. Joyce hatte Kojoten bisher nur im Fernsehen und im Zoo gesehen, lebende jedenfalls. Die Tiere waren Meister darin, sich zu verbergen, und mieden nach Möglichkeit die Menschen. In freier Natur hatte sie bislang nur einen Kojoten gesehen, und der hatte tot am Highwayrand gelegen, nachdem er von einem Wagen erfasst worden war. Es hatte sie gewundert, dass er viel größer war, als sie es erwartet hatte. Die Kojoten in Ohio hatten zottigeres Fell als ihre in der Wüste lebenden Vettern, was der Grund für den scheinbaren Größenunterschied sein mochte.
Rasch verwarf Joyce jedoch den Gedanken, dass dieses Tier ein Kojote sein könnte. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Die Düsternis der Dämmerung hüllte es ein und machte es zu einem wandernden Schatten, der sich mit torkelndem, ungleichmäßigem Gang bewegte, als wäre er verletzt. Sein Knurren jedoch war nicht Ausdruck von Schmerz, sondern vielmehr von Hunger, gepaart mit beinahe menschlich anmutender Wut. Konnte es sich um einen Wolf handeln? Soweit Joyce wusste, waren in Ohio keine Wölfe heimisch, zumindest nicht in der Wildnis. Vielleicht war dieser als Haustier gehalten und entwichen oder aus irgendeinem Grund freigelassen worden. Doch seiner Gestalt fehlte die animalische Grazie eines Wolfes. Sie wirkte eher hündisch als wölfisch.
Dann nahm Joyce den Geruch wahr. Er traf sie wie eine dichte Wolke aus Moschus und Verwesung, die Übelkeit in ihr aufsteigen ließ.
Lieber Gott, was war das für ein Ding?
„Ist schon gut“, sagte Ted. Seine Stimme bebte, aber er zögerte nicht, als er Joyces Hand losließ und zwischen sie und das näher kommende Geschöpf trat. Normalerweise hätte es ihr nicht gepasst, wenn ein Mann – irgendein Mann – sie behandelte wie ein kostbares Etwas, das seines Schutzes bedurfte, aber irgendetwas an dieser … dieser Kreatur löste tief in ihr eine irre Angst aus, und sie war dankbar für Teds Geste. Außerdem glaubte sie, dass er wusste, was er tat. Als früherer Rektor war er es gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen und Probleme direkt anzugehen. Das war sozusagen seine Standardeinstellung, eine vertraute Rolle, auf die er in Krisenzeiten zurückgreifen konnte.
Trotzdem, sosehr sie auch zu schätzen wusste, was er da zu tun versuchte, ihr Instinkt sagte ihr, dass es eine schlechte Entscheidung war. Eine ganz schlechte Entscheidung.
Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Bitte nicht.“
Ted gab ihr durch nichts zu verstehen, dass er sie gehört hatte. Stattdessen ging er einen Schritt auf die Kreatur zu und richtete sich zu voller Größe auf, die Arme nach beiden Seiten ausgestreckt, die Hände zu Fäusten geballt.
Er versucht größer auszusehen, erkannte Joyce. Bedrohlicher. Sie fragte sich, ob er das auch in der Schule so gemacht hatte, wenn er mit potenziell gewalttätigen Teenagern umgehen musste. Aber hatte sie nicht irgendwo gelesen, dass Hunde es als Provokation auffassten, wenn man ihnen direkt gegenübertrat und Blickkontakt zu ihnen aufnahm? Wenn das der Fall war …
Die Kreatur stürmte vorwärts, ihre scheinbar ungleichen Glieder bewegten sich überraschend schnell, ihr Knurren war so laut, dass es fast zum Brüllen wurde. Das Ding war so schnell, dass Joyce im schwindenden Licht der Dämmerung nur die grundlegendsten Details der grotesken Gestalt ausmachen konnte – unterschiedlich lange Beine, ein einzelnes zerfetztes Ohr, blanke Haut, die sich mit bepelzten Stellen abwechselte, und was am schlimmsten war, eine schiefe Schnauze voller scharfer Zähne, viel mehr als im Maul eines gewöhnlichen Hundes Platz finden konnten.
Als es bis auf einen Meter an Ted heran war, sprang das Biest. Die verfärbte Zunge hing flatternd seitlich aus dem missgestalteten Maul. Seine Vorderpfoten trafen auf Teds Brust. Der Schwung stieß ihn nach hinten und ließ ihn hart zu Boden gehen. Der Aufprall trieb ihm die Luft aus den Lungen, und Joyce hörte ein Knacken, das, so vermutete sie, vom Brechen einer oder mehrerer Rippen herrührte.
Sie schaffte es, rechtzeitig auszuweichen, um nicht selbst mit zu Boden gerissen zu werden, und nun stand sie praktisch direkt neben Ted, der mit dem monströsen Hund kämpfte. Das Vieh war groß und massig wie ein Bernhardiner. Davon abgesehen hatte es jedoch keine Ähnlichkeiten mit dieser Rasse. Es knurrte und schnappte, versessen darauf, seine Zähne in Teds Kehle zu schlagen, und Ted krallte seine Hände um den Hals der Kreatur, um sie auf Abstand zu halten. Die Hinterläufe – von denen einer größer war als der andere – scharrten über den Boden, während das Hundewesen darum rang, nahe genug zu kommen, um die Zähne in seine Beute zu bohren. Teds Gesicht war zur Grimasse verzerrt, seine Arme zitterten unter dem anstrengenden Versuch, sich das Tier vom Hals zu halten. Angesichts der gewaltigen Größe des Dings wäre es für die meisten Männer zu stark gewesen, um mit ihm fertigzuwerden, und die körperliche Kraft, die Ted in seiner Jugend besessen haben mochte, war längst dahin. Im Moment baute er ganz auf Adrenalin und pure Willensstärke, doch Joyce wusste, dass dies letztlich nicht genügen würde. Sie fürchtete, dass ihm nur noch Augenblicke blieben, vielleicht auch nur ein paar Sekunden, ehe der Monsterhund ihn überwältigte, die Kiefer um seinen Hals schloss und ihm die Luftröhre zermalmte, bis das Blut spritzte.
Ein Teil von ihr – der primitive, animalische Teil, den nur die Selbsterhaltung um jeden Preis interessierte – wollte nichts mehr, als sich umzudrehen und davonzulaufen, so schnell, wie ihre alles andere als grazilen Beine sie trugen. Tatsächlich hatte sie sich schon, ohne sich dessen ganz bewusst zu sein, halb herumgedreht und sich einen Schritt vom Teich entfernt. Aber sie zwang sich kehrtzumachen. Sie hätte es sich nie verziehen, wenn sie weggerannt wäre und Ted seinem Schicksal überlassen hätte. Sie musste etwas unternehmen, um ihm zu helfen – aber was? Sie konnte sich nicht auf einen Kampf mit dem verdammten Biest einlassen, und an Waffen führte sie allenfalls ihre bisweilen zu scharfe Zunge bei sich, mit der sie im Laufe der Jahre so manchen faulen Schüler filetiert hatte. Weil also nichts anderes zur Hand war, worauf sie sich hätte verlassen können, holte sie tief Luft und nutzte, was ein Kollege einmal als „die Stimme der unwiderstehlichen Autorität“ bezeichnet hatte, und brüllte ein einziges Wort:
„Stopp!“
Das Wort schnitt hart wie ein Peitschenhieb durch die kühle Herbstluft und hallte über den Teich. Das Hundewesen hörte auf zu knurren und drehte sich zu ihr um, Verwirrung und vielleicht einen Hauch von Furcht in den Augen. Joyce hatte das Gefühl, mit diesem einen Wort irgendetwas tief im Innern der Bestie erreicht zu haben, einen tief liegenden Kern, der anerkannte, dass Menschen auf einer höheren Stufe der Evolutionsleiter standen und somit Herr über sie waren. Die Kreatur senkte ihren Blick und kniff den Schwanz – ein haarloses Anhängsel, das aussah, als gehöre es eigentlich ans Ende einer Riesenratte – zwischen die Hinterbeine. Dazu ließ sie ein leises Winseln vernehmen.
Ted, den Joyces Befehl ebenso überrascht hatte wie den Hund, lockerte seinen Griff um den Hals des Tieres. Augenblicklich schob sich die Oberlippe des bizarren Geschöpfs nach oben, entblößte die Zähne, und die Verwirrung in den Augen wurde von lodernder Wut ersetzt. Die Kreatur riss sich von Ted los und machte knurrend gleich wieder einen Satz auf ihn zu.
Joyce schrie, als der Monsterhund seine Zähne in Teds Kehle schlug und ihn hin und her schüttelte, als wäre er nichts weiter als ein Spielzeug. Teds Augen weiteten sich vor Angst und Schmerz, doch obgleich sein Mund weit aufklaffte, drang kein Ton hervor. Im nächsten Augenblick begriff Joyce, warum das so war, weil nämlich dickes Blut daraus hervorschoss wie ein Geysir. Es lief Ted links und rechts übers Gesicht und färbte seine weißen Haare rot, bevor es im Boden unter ihm versickerte.
Joyce öffnete den Mund zu einem weiteren Schrei, doch der Laut erstarb ihr im Hals. Etwas Seltsames geschah. Erst dachte sie, es sei eine Täuschung des schwindenden Lichts, aber dann sah sie, dass es wirklich so war: Teds rosiges Gesicht verlor seine Farbe und nahm ein stumpfes Schiefergrau an. Mehr noch, seine Haut zog sich zusammen, spannte sich um seine Knochen, Muskeln und Fett schrumpften zusammen. Vor Joyces Augen verwandelte er sich in einen mumifizierten Leichnam. Verrückterweise fühlte sie sich an einen der letzten Ausflüge erinnert, den sie mit ihrem Mann unternommen hatte, bevor der Krebs sich so weit ausbreitete, dass er nicht mehr reisen konnte. Sie waren zum Campen in die Hocking Hills gefahren, und anstelle von Schlafsäcken hatten sie eine große Luftmatratze dabei, die sich mittels eines batteriebetriebenen eingebauten Ventilators im Nu aufblasen ließ. Der Ventilator hatte einen Umkehrschalter, der die Luft aus der Matratze auch wieder abließ, sodass sie am Schluss vollkommen flach war und nur noch ein paar Falten aufwies, die sich kreuz und quer über ihre Oberfläche zogen. Und so sah Ted jetzt aus – wie eine leere graue Luftmatratze, in der ein Skelett steckte.
Der Monsterhund hielt Teds Kehle noch einen Moment lang fest, und Joyce beobachtete, wie das Blut an der Schnauze der Kreatur trocknete und abbröckelte. Das Untier hatte Teds Lebensenergie in sich hineingesogen und war entschlossen, ihn nicht loszulassen, bis es auch das letzte Quäntchen davon intus hatte. Als es endlich fertig war, zog es seine Zähne aus Teds vertrocknetem Fleisch und richtete sein Augenmerk auf Joyce.
Sie hörte jemanden „Lauf!“ flüstern und brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass sie das selbst gewesen war. Ihre eigene Stimme zu hören, hob ihre Lähmung auf, und sie drehte sich um und rannte los.
Der Hügel, der zur Wohnanlage hinaufführte, war nicht steil, aber Joyce war alles andere als in Topform. Als sie jünger gewesen war, hatte sich ihre Vorstellung von Sport in einem gemütlichen Spaziergang durch den Park erschöpft, und heute beschränkten sich ihre körperlichen Aktivitäten in erster Linie darauf, durch Antiquitätenläden zu bummeln. Adrenalin konnte eine überwiegend sitzende Lebensweise nur in begrenztem Maße ausgleichen, und Joyce konnte hören, wie ihr Herz ungleichmäßig klopfte, und sie spürte, wie ihre Lungenflügel brannten, als stünden sie in Flammen. Ihre Beine fühlten sich schwer und unsicher an, und dieser Eindruck nahm mit jedem Schritt, den sie tat, noch zu. Schließlich gab in ihrem rechten Knie etwas nach, ihr Bein knickte ein und sie fiel hin. Sie landete auf der Seite und rutschte den Hang ein Stück weit hinunter. Da lag sie dann, mit hämmerndem Puls und pumpender Lunge, und wusste, dass sie unmöglich darauf hoffen konnte, dem Monsterhund jetzt noch zu entkommen – wenn sie überhaupt je eine Chance gehabt hatte. Sie schloss die Augen und wartete darauf, zu spüren, wie sich die Zähne der Kreatur in ihren Hals senkten.
Aber sie spürte nichts.
Sie öffnete die Augen und stemmte sich hoch. Als sie saß, wandte sie sich um, schaute zum Teich zurück und fragte sich, was geschehen war. Hatte irgendetwas das Hundewesen verscheucht? Oder war es einfach zu satt gewesen, um noch nach einer zweiten Mahlzeit zu hungern? Einen Augenblick lang gestattete Joyce sich die Hoffnung, dass sie diese Sache überleben könnte, aber dann sah sie die Kreatur. Sie hockte neben Teds Leichnam, schaute zu ihr herüber, den Kopf zur Seite gelegt, ganz wie ein richtiger Hund. Joyce begriff sofort, was geschehen war, und die Erkenntnis erfüllte sie mit Verzweiflung. Der Monsterhund hatte sie nicht gejagt, weil es gar nicht nötig war. Sie war zu langsam, zu alt und zu übergewichtig, um ihm zu entkommen. Die Kreatur hatte nur warten müssen, bis sie irgendwann stürzte, und genau das war eingetroffen.
Sie sah, wie das gewaltige missgestaltete Biest auf seinen unförmigen Beinen herankam, das schiefe Maul halb offen, sodass die verfärbte Zunge heraushing. Und in den Augen brannte eine schreckliche, unmenschliche Gier.
Joyce schrie. Aber nicht lange.
Zwei
„Ich hasse dieses verdammte Auto“, schimpfte Dean.
„Du hasst jedes Auto außer dem Impala“, entgegnete Sam.
„Ja, aber das hier ist besonders schlimm. Und es stinkt nach Schweißfüßen.“
Sie hatten das braune „Drecksmobil“ – das war nur einer der Namen, die Dean ihm gegeben hatte – hinter einer Bar in Canton, Ohio, aufgegabelt. Dean hätte lieber irgendetwas mit ein bisschen mehr Klasse „ausgeliehen“, oder wenigstens etwas, das sich nicht fuhr wie ein Scheißhaufen auf Rädern, aber seit sie untergetaucht waren, damit die Leviathane nicht auf sie aufmerksam wurden, mussten sie unauffällig bleiben, und das hieß: kein Impala. Es hieß außerdem, dass sie sich wider Willen als Autodiebe betätigen mussten – natürlich alles zum Wohle der Allgemeinheit. Wenn es ihnen nicht gelang, Dick Roman zur Strecke zu bringen, und sie stattdessen als Happy Meals für ihn und seine Mitmonster endeten, dann stand als Nächstes der Rest der Welt auf der Speisekarte.
Sie achteten darauf, Autos zu nehmen, die niemand sonderlich vermissen würde. Schrottkisten, die leicht zu ersetzen waren und nach denen die Polizei nicht allzu angestrengt fahnden würde. Dean hatte alle Hände voll damit zu tun, die Rosthaufen, die sie klauten, am Laufen zu halten, aber zaubern konnte er auch nicht. Ständig drückte er die Daumen, dass sie nicht in eine Verfolgungsjagd gerieten. So unrund, wie das Drecksmobil lief, würden die Kolben wahrscheinlich wie Raketen aus dem Motor schießen, sobald er richtig aufs Gas trat.
„Da wären wir“, sagte Sam und zeigte auf ein hölzernes Schild am Straßenrand. „Brennan, Ohio, laut diesem Schild die Heimat der Battling Brennan Brahmans.“
Dean runzelte die Stirn, während sie die Stadtgrenze überfuhren. „Brahmans? Sind das nicht so was wie Wasserbüffel?“
„So was Ähnliches. Es handelt sich um eine Rinderart, die nach der heiligen Kuh im Hinduismus benannt ist.“
„Schlechte Wahl für ein Schulmaskottchen, wenn du mich fragst. Man kann es auch übertreiben mit Stabreimen, weißt du?“
Nachdem sie „höflichkeitshalber“ im Büro des örtlichen Sheriffs vorbeigeschaut hatten, um Bescheid zu sagen, dass zwei FBI-Agenten in der Stadt waren, um nach Möglichkeit weitere Informationen über die Todesfälle zu sammeln, gondelten sie durch Brennan, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Nicht, dass es nötig gewesen wäre. Sie mochten zwar aus dem Nordosten von Ohio in den Südwesten gefahren sein, aber trotz der Entfernung, die sie zurückgelegt hatten, war es, als hätten sie sich nicht vom Fleck bewegt. Nach all den Jahren, die er nun praktisch schon auf der Straße lebte, sahen die Städte des Mittleren Westens für Dean alle gleich aus, und Brennan machte da keine Ausnahme. Ein Stadtzentrum, das aus kleinen Geschäften in alten Gebäuden bestand, Außenbezirke, die mit Einkaufspromenaden und Filialen von Restaurantketten durchsetzt waren, und ein verfallendes Industrieviertel, wobei es sich im Falle Brennans um eine stillgelegte Fahrradfabrik am südlichen Rand der Stadt handelte.
„Man braucht eine ganze Fabrik, um Fahrräder zu bauen?“, staunte Dean. Sam hob nur die Schultern.
Nicht weit von der Fabrik entfernt fanden sie ein billiges Motel namens Wickline Inn, auch wenn Dean keine Ahnung hatte, wer oder was eine „Wickline“ war. Sie parkten vor dem Büro, und Sam ging hinein, um sie einzuschreiben. Sie verlangten immer nach einem Zimmer, das möglichst weit von der Rezeption entfernt war. Noch besser war es, wenn die Zimmer links und rechts davon nicht belegt waren. Sie waren im Laufe der Jahre mehr als nur einmal in Hotelzimmern angegriffen worden, und das Letzte, was sie wollten, war die Gefährdung von Unschuldigen.
Nachdem Sam mit dem Zimmerschlüssel zurück war, fuhren sie zur Rückseite des Motels, parkten und luden ihr Gepäck aus dem Wagen – zwei Rucksäcke mit Kleidung und Toilettensachen, Sams Computer sowie zwei Seesäcke, in denen sich Waffen befanden. Dann betraten sie das Zimmer.
Drinnen rümpfte Dean die Nase. „Mann, hier stinkt’s wie Mottenkugeln und Arsch.“
„Da kann ich dir nicht widersprechen“, meinte Sam.
Sie legten ihre Sachen auf die Betten und inspizierten kurz das Zimmer, warfen einen Blick ins Bad sowie unter die Betten und prüften die Verriegelung der Fenster. Erst als sie mit allem zufrieden waren, schlossen sie die Tür ab. Jeder Jäger, der seine Steinsalzflinte wert war, würde einen Teufel tun und sich einen potenziellen Fluchtweg blockieren, ehe er sich nicht davon überzeugt hatte, dass er ihn nicht brauchte.
Die Brüder verzichteten darauf, ihre Sachen auszupacken. Es war jederzeit möglich, dass sie sich ihr Gepäck schnappen und schleunigst verschwinden mussten. Nicht zum ersten Mal dachte Dean darüber nach, wie sehr sein Leben dem eines Verbrechers auf der Flucht ähnelte. Er hatte es Sam nie erzählt, aber seit einiger Zeit erinnerte er sich jedes Mal, wenn sie ein Hotelzimmer bezogen, an seine Zeit mit Lisa und Ben, und wie verdammt schön es gewesen war, Tag für Tag am selben Ort schlafen zu gehen und aufzuwachen.
Am Fenster des Zimmers stand ein kleiner Schreibtisch. Sam stellte seinen Laptop darauf, öffnete ihn und fuhr ihn hoch. Als der Bildschirm zum Leben erwachte, sagte er: „Und einmal mehr hat der Laden der Winchesters geöffnet.“ Er nahm vor dem Computer Platz und fing an zu tippen.
Dean setzte sich aufs Fußende eines der Betten, zog Bobbys Flachmann aus der Tasche seiner braunen Lederjacke, schraubte den Deckel auf und nahm einen Schluck. Keinen großen, nur ein Schlückchen zur Instandhaltung. Als er den Deckel wieder zugeschraubt hatte, behielt er den Flachmann, anstatt ihn einzustecken, noch in der Hand und betrachtete ihn einen Augenblick. Er erinnerte sich, wie er das Einschussloch in Bobbys Mütze bemerkt hatte, wie er sich im Van umgedreht hatte und das dazugehörige Loch in Bobbys Stirn entdeckte. Wieder sah er das Blut vor sich … „Das ist doch Kacke, Sammy.“
„Wovon redest du?“ Sam wandte den Blick nicht vom Monitor ab. Wenn er erst einmal in die virtuelle Welt eingetaucht war, war er schwerer abzulenken als ein nach Seelen hungernder Dämon, der darauf aus war, einen Pakt zu schließen.
„Das“, sagte Dean und machte eine allumfassende Handbewegung. „In Ohio herumzugammeln während wir eigentlich Dick Roman das Fell über die Ohren ziehen sollten.“
Sam hörte auf zu tippen und wandte sich zu seinem Bruder um. „Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin genauso scharf auf Dick wie du.“ Er zog die Stirn kraus. „Moment, so hab ich das nicht gemeint.“
„Ha, ha. Zum Totlachen. Hör auf mit dem Quatsch, Sam. Ich mein’s ernst.“
„Ich auch. Also, nicht dass ich scharf auf Dick wäre … Aber ich will die Leviathane auch stoppen. Nicht nur, um zu verhindern, dass sie die Menschheit in Hamburger Royal verwandeln, sondern weil ich will, das Bobby Gerechtigkeit widerfährt. Genau wie du.“
Bobby Singer hatte sich bei einer Auseinandersetzung mit den Leviathanen einen Kopfschuss eingefangen, und zwar von Dick Roman höchstpersönlich. Wenig später war er in einem Krankenhaus gestorben.
Die Leviathane gehörten zu Gottes ersten Schöpfungen. Sie waren noch vor den Menschen und selbst den Engeln entstanden, doch hatten sie sich als zu wild und unbeherrschbar erwiesen. Es ging ihnen nur um die Befriedigung ihres barbarischen Hungers, und deshalb hatte Gott sie ins Fegefeuer verbannt. Das hast du mal gut gemacht, Gott, dachte Dean. Ihr Freund und Verbündeter Cass – auch als der Engel Castiel bekannt – hatte die Leviathane versehentlich befreit, als er sämtliche Seelen aus dem Fegefeuer absorbiert hatte, damit er genug Macht gewann, um den Erzengel Raphael zu bezwingen. Kaum aus ihrer seit Urzeiten währenden Gefangenschaft befreit, hatten die Leviathane auch schon Pläne geschmiedet, um die Welt zu übernehmen und die Menschen nur noch als Nahrungsquelle am Leben zu lassen. Unter anderem verfügten diese Kreaturen über die Fähigkeit, die DNS eines Menschen zu analysieren und ihn in ein exaktes Duplikat ihrer Zielperson zu verwandeln. Auf diese Weise schlüpfte der Anführer der Leviathane in die Rolle des milliardenschweren Geschäftsmanns Dick Roman und benutzte die beträchtlichen Finanzmittel und politischen Möglichkeiten des Mannes, um ein geheimes Imperium aufzubauen, das die ganze Welt umspannte.
Die Brüder wussten, dass der letztendliche Plan der Leviathane in der Unterwerfung der Menschheit bestand, aber wie sie das genau bewerkstelligen wollten – und wie sie selbst das verhindern sollten –, wussten sie nicht. Diese Unwissenheit nagte an ihnen wie tollwütige Ratten, vor allem an Dean. Bobby war mehr gewesen als nur eine enzyklopädische Informationsquelle, ein nie versiegender Brunnen nützlicher Kontakte und eine immerzu mürrische Nervensäge. Er war sogar mehr gewesen als nur ein enger Freund der Familie. Bobby war wie ein Onkel für Dean und Sam gewesen. Verdammt, er war praktisch ein zweiter Vater für sie gewesen, zumal ihr eigener Dad die meiste Zeit unterwegs und auf Monsterjagd gewesen war, als sie aufwuchsen. Beide Brüder vermissten ihn höllisch.
Es gab in diesem Leben nichts, was Dean mehr wollte, als Dick Roman zu erledigen, und jede Sekunde, die er und Sam mit etwas anderem zubrachten als damit, dem haifischzahnigen Hurensohn auf die Pelle zu rücken, war seiner Meinung nach eine vergeudete Sekunde. Aber nun waren sie einmal hier, also konnten sie sich auch an die Arbeit machen.
Er musste an etwas denken, das kürzlich jemand zu ihm gesagt hatte: Genießen Sie es, solange es noch geht, Junge. Denn Jagen ist die einzig wahre Beschäftigung in diesem Leben. Und sie macht Sie glücklicher als viele andere.
Du sagst es, Bruder Ness,dachte Dean. Und außerdem mochte sich der Abstecher nach Brennan vielleicht auch nicht als völlige Zeitverschwendung erweisen. Wer weiß? Vielleicht gibt’s hier sogar einen anständigen Stripclub …
„In Ordnung.“ Er seufzte und nahm noch einen Schluck aus Bobbys Flachmann. „Hat sich irgendetwas Neues ergeben, seit wir in Canton losgefahren sind?“
Sam sah ihn noch einen Moment lang an, und Dean dachte schon, sein Bruder würde eine Bemerkung über seine Trinkerei machen, aber stattdessen wandte er sich wieder dem Laptop zu. Er tippte eine Weile, dann hielt er inne, beugte sich vor und starrte auf den Bildschirm. Das hatte Dean ihn schon tausendmal tun sehen, und er wusste, was es bedeutete.
„Du hast etwas.“
„Ja. Sieht so aus, als hätte es noch zwei Tote gegeben, einen älteren Mann und eine Frau diesmal. Laut der Lokalzeitung, dem Brennan Broadsider, hat man sie in der Nähe eines Teiches hinter der Apartmentanlage gefunden, in der sie gewohnt haben. Das war vor zwei Tagen.“
Dean stand auf, ließ den Flachmann zurück in seine Jackentasche gleiten, trat hinter Sam und schaute über dessen Schulter auf den Bildschirm.
„Steht da was darüber, ob sie’s gerade miteinander getrieben haben, als sie gestorben sind?“
Sam bedachte ihn mit einem Seitenblick.
„Hey, wenn man schon abtreten muss, dann doch wenigstens mit einem Lächeln.“
Sam schaute wieder auf den Bildschirm. „Sie waren mumifiziert, genau wie die anderen. Außer Haut und Knochen war buchstäblich nichts von ihnen übrig.“
„Chronos haben wir vernichtet, also wissen wir, dass er es nicht war, auch wenn es sich sehr nach seinem Stil anhört.“
„Ja, aber das Muster ist anders. Chronos tötete immer drei Menschen im Abstand von mehreren Jahren. In Brennan sind bisher vier Personen umgekommen und alle in der vergangenen Woche.“
„Ich nehme an, dass sie alle ausgesehen haben, als hätten sie eine Höllendiät gemacht.“
„Genau.“ Sam las weiter. „Die Verantwortlichen der Stadt sind ziemlich kopfscheu. Sie befürchten, die Todesfälle könnten die Folge einer giftigen Chemikalie oder einer exotischen Krankheit sein. Man hat Gewebeproben der Opfer an die Seuchenschutzbehörde geschickt.“
„Wenn es da keine Leute gibt, die auf Übersinnliches spezialisiert sind, wird man wahrscheinlich nicht viel finden.“
Sam klappte den Laptop zu. „Sieht also so aus, als wären wir dran.“
Dean schenkte seinem Bruder ein schiefes Lächeln. „Sind wir das nicht immer?“
***
„Sind Sie sicher, dass wir keine Schutzanzüge brauchen? Sie wissen schon, wie man sie in Filmen über Seuchen sieht?“
Sam musterte den jungen Kerl aus dem Büro der Wohnanlage. Er war Anfang zwanzig, kam wahrscheinlich frisch vom College und hatte gerade seinen ersten richtigen Job angetreten. Er war von durchschnittlicher Größe, dünn und hatte ordentlich geschnittenes schwarzes Haar sowie einen eckigen Kinnbart, der ihn ein bisschen idiotisch aussehen ließ. Er trug eine halbwegs teure Krawatte und auf Hochglanz polierte Schuhe – beides sah brandneu aus –, dazu eine dunkelblaue Windjacke. Im Hauptbüro der Anlage hatte er sich als David Irgendwas vorgestellt, Stephenson vielleicht. Ganz sicher war Sam sich nicht. Sein Hirn lief momentan nicht auf allen Töpfen und ab und zu drehte es einmal hohl. Immer noch besser als völliger Wahnsinn, dachte er.
Nachdem er und Dean Luzifer besiegt und das Armageddon abgewendet hatten, waren Sams Körper und Seele voneinander getrennt worden. Sein Körper blieb auf der Erde, während seine Seele mit Luzifer und dem Erzengel Michael in einen Käfig gesperrt worden war. Sams Körper hatte seine Erinnerungen behalten, aber ohne Seele war er quasi ein Soziopath, bar aller menschlichen Gefühle. In vielerlei Hinsicht hatte er sich ohne Seele als effizienterer Jäger erwiesen. Er war entschlossener gewesen, hatte schneller gehandelt und keine Skrupel gekannt. Bedauerlicherweise hatte es ihn auch nicht gekümmert, wenn auf der Jagd Kollateralschäden entstanden waren. Wenn unschuldige Menschen starben, während er ein Monster jagte – na und? Das war der Preis, den dieses Geschäft verlangte.
In der Hölle hatten Luzifer und Michael derweil mit seiner Seele wie zwei Katzen gespielt, die sich um ein Garnknäuel streiten, und diese Katzen besaßen verdammt scharfe Krallen. Sie hatten seine Seele wie Seidenpapier zerfetzt, und als sie schließlich in Sams Körper zurückgekehrt war – was er ausgerechnet dem Tod höchstselbst zu verdanken hatte –, drohte ihn der Schaden, den sie genommen hatte, in den Wahnsinn zu treiben. Deshalb hatte der Tod eine psychische Mauer errichtet, um Sam vor dem Irrsinn zu schützen, der in ihm wohnte, doch diese Mauer war gefallen, und jetzt war es an Sam selbst, den Wahnsinn im Zaum zu halten. Meistens gelang es ihm ganz gut, ihn zu verbergen, aber das kostete ihn viel Kraft, und er war nicht immer sicher, ob er seinen Sinnen und Erinnerungen trauen konnte.
Also war der Name des Jungen vielleicht Stephenson, vielleicht aber auch nicht. Zumindest war er sicher, dass der Junge real war. Nun … einigermaßen sicher.
„In der momentanen Situation brauchen wir die nicht“, antwortete Sam auf Vielleicht-Stephensons Frage. „Wir sind überzeugt, dass die Gefahr minimal ist.“
„Aber es ist gefährlich“, beharrte der Junge. „Stimmt’s?“
Sam und Dean trugen ihre besten „Wir sind Mitarbeiter der Regierung“-Anzüge und hatten sich als Agents Smith und Jones vorgestellt. Sie hatten dem Jungen kurz ihre gefälschten FBI-Ausweise gezeigt und behauptet, dass sie hier wären, um die Seuchenschutzbehörde bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Das hatte er ihnen alles abgekauft, und jetzt führte er sie, wenn auch widerstrebend, zu dem Ententeich hinter dem Apartmentkomplex.
Dean sah ihn von der Seite her an. „Wenn auch nur ein geringes Risiko einer Kontamination bestünde, würden mein Partner und ich doch solche Dinger tragen, diese, na …“ Er verstummte und sah Sam Hilfe suchend an.
„ABC-Schutzanzüge“, sagte Sam.
„Genau die.“ Dean nickte.
„Kann schon sein“, meinte der Junge. „Aber kriegen solche Leute wie Sie nicht spezielle Impfungen zum Schutz vor tödlichen Krankheiten, Strahlungen und all so üblem Zeug? Sie wissen schon, Klasse-A-Medikamente, die Art von Arzneimitteln, von denen die Regierung behauptet, es gebe sie gar nicht.“
„Lassen Sie mich raten“, erwiderte Dean. „Sie surfen viel auf Internetseiten über Verschwörungstheorien, hab ich recht?“
„Ja. Und?“
„Nichts. War nur so eine Ahnung.“ Er warf Sam einen Blick zu, der besagte: Wir haben es hier mit einem echten Spezialisten zu tun. Und Sam verkniff sich ein Grinsen.
Arbor Vale war eine schon etwas ältere Wohnanlage, die irgendwann in den Siebzigern erbaut worden sein musste, vermutete Sam. Aber sie war sauber und das Gelände gepflegt. Jedenfalls sah es hier nicht aus wie an einem Ort, wo das übernatürliche Böse lauerte. Doch wenn ihn das Leben als Jäger etwas gelehrt hatte, dann das: Der Augenschein hatte einen Dreck zu bedeuten. Monster, Dämonen, Geister und andere Scheußlichkeiten mochten sich zwar grundsätzlich zu Dunkelheit und Verfall hingezogen fühlen, aber ebenso wie auf einem verlassenen Friedhof schnüffelten sie auch in gut situierten Vororten hinter potenzieller Beute her. Das Böse – das wahre Böse, das Böse mit einem großen, fetten B am Anfang – konnte jederzeit und überall auftauchen.
Der Teich lag am Fuß eines sanft abfallenden Hügels, und die Polizei von Brennan hatte oben Absperrband gespannt, um Neugierige zu warnen und fernzuhalten. Das Band war an einer Reihe von Metallpflöcken befestigt, die in orangefarbenen Leitkegeln steckten und ins Erdreich geklopft worden waren. Aber allen Bemühungen der Beamten zum Trotz hing das Band so weit durch, dass man bequem darüber hinwegsteigen konnte.
„Ernsthaft?“, meinte Dean mit Blick auf die Absperrung. „Glauben die Deputys in dieser Stadt wirklich, davon ließe sich jemand aufhalten?“
„Ich nehme an, dass man es hier nicht oft mit Tatorten von größeren Verbrechen zu tun hat“, sagte Sam.
Die Winchesters gingen ohne zu zögern weiter, der Junge ließ sich allerdings ein wenig zurückfallen.
„Brauchen Sie mich da unten überhaupt?“, fragte er.
Dean wies in Richtung des Teichs. „Sehen Sie die Enten, die da herumschwimmen? Glauben Sie, die würden hierbleiben, wenn es in der Gegend irgendwelchen giftigen Glibber gäbe?“
„Enten könnten von Natur aus immun sein gegen das, was diese beiden alten Leute umgebracht hat.“ Die Augen des Jungen wurden schmal. „Oder vielleicht war das, woran sie gestorben sind, genetisch so manipuliert, dass es nur für Menschen tödlich ist.“
„Mann, Sie müssen wirklich mal die Finger vom Internet lassen“, stöhnte Dean.
„Außerdem will ich nicht in die Nähe von diesem Wald.“
Sam und Dean wechselten einen Blick.
„Warum denn nicht?“, fragte Sam.
„Wilde Hunde“, antwortete der Junge. „Gerüchteweise wimmelt es in den Wäldern rund um die Stadt von ihnen. Ich habe selbst noch keine gesehen, aber viele andere schon. Einer soll ein besonders fürchterliches Biest sein. Groß und schwarz.“
„Ein schwarzer Hund.“ Dean warf seinem Bruder einen weiteren Blick zu. „Was Sie nicht sagen.“
„Sie können zurück in Ihr Büro“, erklärte Sam. „Wenn wir noch Fragen an Sie haben, wissen wir, wo Sie zu finden sind.“
Der Junge fasste in seine Hemdtasche, zückte eine Visitenkarte und reichte sie Sam, der zufrieden sah, dass der Nachname, der darauf stand, Stephens lautete. Dicht dran.
„Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie mich an. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich möchte mir von Ihnen nichts holen. Ich will nicht als menschliche Trockenpflaume enden, verstehen Sie?“
Ohne auf eine Erwiderung zu warten, kehrte Stephens um und machte sich auf den Weg zurück zum Büro. Und fast rannte er dabei.
Sam steckte die Karte in die Innentasche seines Jacketts, dann ging er gemeinsam mit Dean den Hügel hinunter zum Teich.
„Das nenn ich mal paranoid“, meinte Dean.
„Man kann es ihm kaum verübeln. Hier ist etwas Schlimmes passiert.“
„Glaubst du, es hat irgendetwas mit dem schwarzen Hund zu tun, den Braveheart erwähnte?“
Sam hob die Schultern. „Ich weiß es nicht. Könnte sein.“
Sichtungen gespenstischer schwarzer Hunde gab es seit Jahrhunderten, das war die Legende, auf die Arthur Conan Doyles Der Hund von Baskerville basierte. Aber es gab keine definitive Antwort auf die Frage, worum es sich bei diesen Kreaturen handelte. Die meisten Jäger glaubten an eine von zwei Möglichkeiten: Entweder waren es Geschöpfe dämonischen Ursprungs oder Erscheinungsformen von Gestaltwandlern. Sam sah keinen Grund dafür, warum nicht beide Erklärungen zutreffen sollten. Schließlich war das Ökosystem der übersinnlichen Welt auf seine Art genauso vielfältig wie das der natürlichen.
„Könnte etwas sein, das im Teich haust“, fuhr Sam fort.
„Vielleicht“, räumte Dean ein. „Aber wenn da irgendetwas drin lebt, dann scheint es die Enten nicht zu stören.“
Als sie sich dem Teich näherten, sahen sie zwei kleinere, mit Absperrband markierte Bereiche, einen dicht am Ufer, den anderen etwas weiter oben am Hang. Beide von grob rechteckiger Form.
„Die örtliche Polizei scheint ja sehr gründlich zu sein“, befand Dean. „Wundert mich, dass sie kein großes Schild aufgestellt haben, auf dem steht: Ich würde umkehren, wenn ich du wäre!“
„Ein Musical-Zitat?“, staunte Sam. „Ich hätte eher etwas aus Blutgericht in Texas oder vielleicht Porky’s II erwartet.“
„Ich versuch nur, das Repertoire zu erweitern.“
Während sie flachsten, ließen sie die Blicke wachsam umherschweifen. Als Jäger musste man vor allem auf seine Umgebung achten. Alles, was man sah, hörte oder roch, konnte Hinweise auf eine übernatürliche Manifestation liefern. Der wichtigste Sinn von allen jedoch hatte keinen Namen. Es war kein wirklich übersinnlicher. Eher so etwas wie ein gesteigerter Instinkt. Wenn man lange genug jagte, wenn man lange genug überlebte, dann entwickelte man die Fähigkeit, einfach zu wissen, wenn etwas nicht stimmte. Es war ein unterbewusster Prozess, kein bewusster, aber sowohl Sam als auch Dean hatten schon vor langer Zeit gelernt, darauf zu vertrauen, und jetzt verriet dieser Sinn Sam, dass das, was hier passiert war und den Tod von zwei Menschen verursacht hatte, nicht natürlichen Ursprungs gewesen war.
Als Erstes erreichten sie das Rechteck aus Absperrband an dem Hang. Sam zog seinen EMF-Detektor aus der Außentasche seines Jacketts, schaltete ihn ein und hielt ihn dicht über den Boden. Die elektromagnetischen Werte in diesem Bereich waren normal. Er schaltete das Gerät aus und steckte es wieder ein.
„Damit wissen wir also, dass hier kein Geist am Werk war“, stellte Dean fest.
„Die Sache ist zwei Tage her“, erinnerte Sam. „In der Zwischenzeit könnte elektromagnetische Energie, die zurückgeblieben ist, auch einfach verflogen sein.“
„Das stimmt natürlich.“
Sie gingen beide in die Hocke, um sich den Boden genauer anzuschauen. Das Absperrband zerrissen sie jedoch nicht. Sie zogen es vor, Tatorte möglichst unberührt zu lassen, nur für den Fall, dass ein normaler menschlicher Drecksack für die Tat verantwortlich war und nicht irgendein Ding, das nachts umging.
„Laut dem Broadsider wurde an dieser Stelle die Leiche der Frau gefunden.“ Sam zog ein kleines Notizbuch aus seiner Hemdtasche und schlug den jüngsten Eintrag auf. „Ihr Name war Joyce Nagrosky, eine pensionierte Englischlehrerin. Das andere Opfer hieß Ted Boykin. Er war ebenfalls im Ruhestand und früher Rektor der Schule, an der Joyce unterrichtet hatte.“
„Außerschulische Leibesübungen, ich sag dir, deshalb waren die hier unten“, meinte Dean. „Nur weil er im Herbst des Lebens stand, heißt das ja nicht, dass Teddy nicht auch noch seinen Mann gestanden hat.“
Sam sah ihn nur an.
„Ich fand’s witzig“, brummte Dean.
Trotz des lausigen Scherzes, den sein Bruder gemacht hatte, wusste Sam, dass eine ernsthafte Frage dahintersteckte. Übernatürliche Wesen machten aus verschiedenen Gründen Jagd auf Menschen, aber der häufigste war, dass sie fressen wollten. Manche, wie zum Beispiel die Leviathane, ernährten sich buchstäblich von Menschen. Vampire tranken menschliches Blut. Einige fraßen nur bestimmte Teile des Körpers, der Kitsune etwa, der es nur auf die Hypophyse abgesehen hatte.
Amys Gesicht erschien kurz vor Sams innerem Auge, und einen Moment lang glaubte er, ihre Stimme in sein Ohr flüstern zu hören: Die coolsten Leute sind alle Freaks … Er verscheuchte die Erinnerung an sie, zusammen mit dem Anflug von Schuldgefühl, der damit einherging. Er hatte zu arbeiten.
Manche Monster entzogen ihren Opfern die Lebenskraft. Andere, die Sukkuben und Inkuben zum Beispiel, ernährten sich von sexueller Energie. Wenn Joyce und Ted hier am Teich irgendwelche wilden Dinge getrieben hatten, mochten sie damit die Aufmerksamkeit von einem noch wilderen Ding erregt haben.
„Das glaube ich nicht“, sagte Sam, nachdem er kurz überlegt hatte. „Sie waren vielleicht zusammen – darüber stand in der Zeitung nichts –, aber diese Stelle ist doch ein bisschen zu nah an der Wohnanlage, als dass man sich hierher zurückziehen würde, um ungestört zu sein.“
„Vielleicht standen sie ja darauf, womöglich erwischt zu werden“, entgegnete Dean, wenn auch nicht sonderlich überzeugt. „Ich wittere nichts Außergewöhnliches. Keinen Geruch von Schwefel, faulem Fisch oder verwesten Blumen.“ Er schnüffelte. „Und auch keinen Dämonenhundegestank.“
„Es ist nicht kalt hier“, sagte Sam. „Jedenfalls nicht kälter, als es für die Jahreszeit normal ist.“
„Der Boden ist ziemlich aufgewühlt“, fand Dean. „Das könnte aber die hiesige Polizei gewesen sein. Wie du schon gesagt hast, man hat hier wahrscheinlich nicht viel Erfahrung mit größeren Tatorten.“
„Vielleicht“, meinte Sam. „Aber ein Hund könnte es auch gewesen sein.“
„Angesichts des Ausmaßes dieser Spuren hätte er ziemlich groß sein müssen.“
„Stimmt. Aber ich sehe kein Blut. Ein Tier von dieser Größe hätte, wenn es jemanden angreift, eine ganz schöne Sauerei angerichtet.“
Dean drückte einen Zeigefinger ins Erdreich. „Es hat in letzter Zeit nicht geregnet. Wenn also Blut da gewesen wäre, dann wäre es nicht fortgespült worden.“
Sie erhoben sich. Dean wischte sich die schmutzige Fingerspitze am Hosenbein ab.
„Sehen wir uns mal die Stelle an, wo der Rektor gefunden worden ist“, sagte Sam.
Die Brüder gingen hinunter ans Ufer des Teichs und nahmen die zweite abgesperrte Stelle in Augenschein. Dort wuchs weniger Gras und der Boden war weicher. Es waren Spuren zu erkennen, die meisten wahrscheinlich von der Polizei und den Sanitätern, aber es gab auch eine Reihe von, wie es aussah, Krallenspuren im Boden sowie einen einzelnen deutlichen Pfotenabdruck. Und zwar einen verdammt großen.
Die Brüder standen schweigend da und dachten einen Moment lang nach. Die Enten auf dem Teich wahrten Abstand, beäugten sie aber aufmerksam.
Nach einer Weile sagte Dean: „Ich glaube, es hat sich folgendermaßen abgespielt: Ted und Joyce kommen an den Teich. Vielleicht haben sie einen Spaziergang gemacht, wollen die Enten füttern und später dann zur Sache kommen, was auch immer. Dann taucht von dort drüben unser Killerhund auf.“ Er zeigte auf den Waldrand. „Er greift sie an, und Ted, ein verlässlicher Mann und treuer Freund, versucht das Vieh lange genug aufzuhalten, damit Joyce davonlaufen kann. Sie rennt los, aber Cujo macht kurzen Prozess mit dem alten Ted, jagt hinter Joyce her und das war’s dann.“
Sam nickte. „So sehe ich es auch. Aber wie genau hat der Hund die beiden umgebracht? In der Zeitung stand nichts davon, dass die Leichen von einem Tier zerfetzt worden wären.“
„Ja, ich weiß. Sie waren mumifiziert. Hey, sag mal, du glaubst nicht zufällig, dass sie einfach nur echtalt waren?“
„Ich glaube, wir müssen uns diese Leichen einmal ansehen.“
***
Als Sam und Dean den Hang wieder hinaufgingen, bemerkte keiner von ihnen die schemenhafte Gestalt, die zwischen den Bäumen am Rand des Teiches hervortrat und ihnen nachschaute.
Drei
Ein paar Stunden später kehrten Sam und Dean zum Teich zurück. Sie hatten ihre Anzüge gegen normale Straßenkleidung getauscht, wofür Dean zutiefst dankbar war. Er trug seine Lederjacke, Sam seinen blauen Mantel, darunter hatten sie beide Kapuzenpullis und Flanellhemden an. Selbst wenn es kalt war, trugen die Brüder kaum einmal etwas Wärmeres. Dicke Kleidung machte langsam, und ein langsamer Jäger war nur allzu oft ein toter Jäger. Also trug man besser mehrere dünne Lagen übereinander. Die konnte man nach Bedarf ablegen, und seine Jacke abzustreifen, war auch eine gute Möglichkeit, sein Erscheinungsbild zu verändern, falls man von jemandem – den Bullen zum Beispiel – gesucht wurde.
Dean fühlte sich nie wohl in einem Anzug, abgesehen vielleicht von seinem Zwirn aus den Vierzigerjahren, aber er musste zugeben, dass Anzüge auch ihre Vorteile hatten. Sie erleichterten es einem nicht nur, die Cops zum Reden zu bringen, nein, sie beeindruckten auch Krankenhausangestellte. Es hatte ihnen keinerlei Probleme bereitet, den zuständigen Mitarbeiter zu bewegen, ihnen Zugang zu den Leichen von Joyce Nagrosky und Ted Boykin zu gewähren. Aber es kam noch besser. Weil der Rechtsmediziner des Bezirks vermutete, dass irgendeine Infektion hinter den Todesfällen steckte, hatte er keine vollständigen Autopsien vorgenommen. Er wartete auf den Bericht der Seuchenschutzbehörde zu den Gewebeproben, die er eingeschickt hatte, und das hieß, dass Sam und Dean zwei makellose Leichen untersuchen konnten. Manchmal war das entscheidende Detail in einem Todesfall mit übernatürlicher Ursache ein ganz unauffälliges, und ein Arzt konnte wichtige Beweise zerstören, ohne es zu wollen. Doch darüber brauchten sie sich diesmal keine Sorgen zu machen.
Beide Leichname hatten gleich ausgesehen. Sie erinnerten Dean an die leeren Hüllen, die Zikaden hinterließen, wenn sie ihre ausgewachsene Gestalt annahmen. Verdammt unheimliche Biester, diese Krabbelviecher! Laut dem vorläufigen Bericht des Rechtsmediziners verfügten die Toten noch über all ihre inneren Organe, aber es war, als sei ihnen jeder Tropfen Flüssigkeit entzogen worden. Und zwar nicht nur das Blut. Sämtliche Flüssigkeiten waren verschwunden – Wasser, Rückenmarksflüssigkeit, Verdauungssäfte, einfach alles. Und deshalb sahen Joyce und Ted aus wie Skelette, die mit dünnem grauem Pergamentpapier bespannt waren. Leichen-gami, dachte Dean. Die Toten teilten aber noch eine Auffälligkeit: Hässliche Schnittwunden an der Kehle. Der Rechtsmediziner hatte festgestellt, dass sie post mortem von irgendeinem Raubtier verursacht worden waren. Er und Sam gingen allerdings davon aus, dass die Verletzungen von dem Monsterhund stammten, den Dean dementsprechend Dogula nannte.