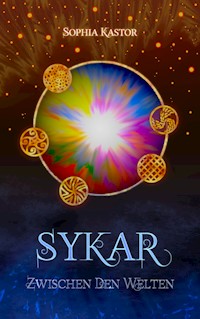
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein ehrgeiziges Schulmädchen. Ein stummer Überlebenskünstler. Ein erbitterter Krieger. Eine allmächtige Schöpferin. Eine zarte Prinzessin. Sie alle haben etwas gemeinsam: ihre Seele. Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie es wäre, wenn es andere Welten gäbe? Wenn es andere Möglichkeiten gäbe, du zu sein? Diese Vorstellung wird für Thessa zur Realität, denn sie ist eine Sykar. Sie hat die seltene Gabe, in jede der fünf Parallelwelten springen zu können und dabei jeweils eine neue Identität anzunehmen. Doch nicht alles ist so zauberhaft, wie es zunächst scheint, denn den Sykar droht große Gefahr. Thessa wird in eine riskante Mission verwickelt, ohne die genauen Hintergründe der Aufgabe zu kennen. Nicht einmal der erfahrene Partner, der ihr zur Seite steht, kann sie vor der Bedrohung in den Welten schützen. Als sie der Wahrheit auf die Spur kommt, ist es längst zu spät: Thessa und ihr Gefährte finden sich inmitten eines durch Verrat, Machtgier und Lügen geprägten Krieges wieder und werden zur entscheidenden Gewalt über dessen Ausgang... Der Auftakt der Urban-Fantasy-Dilogie über die Facetten einer Persönlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für alle, die ich liebe.
Playlist
Nobody‘s Home – Avril Lavigne
Faded – Alan Walker
Believer – Imagine Dragons
Survivor – Destiny‘s Child
Paper Hearts – Tori Kelly
Head Above Water – Avril Lavigne
Shameless – Camila Cabello
East of Eden – Zella Day
Wings – Birdy
Natural – Imagine Dragons
Fight Song – Rachel Platten
Waves – Dean Lewis
Princesses Don‘t Cry – Aviva
Chasing Cars – Snow Patrol
Heroes – Måns Zelmerlöw
I‘m Still Here – Sia
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
Alan
Thessa
Lucien
Ebony
Thessa
Adriane
2. Teil
Ebony
Alan
Lucien
Thessa
Ebony
Thessa
Adriane
Alan
Thessa
Lucien
Adriane
Ebony
Adriane
Thessa
Ebony
Lucien
Ebony
Lucien
Adriane
Alan
3. Teil
Thessa
Adriane
Ebony
Lucien
Alan
Adriane
Lucien
Alan
Adriane
Thessa
4. Teil
Thessa
Talea
Das Erste, was Alan wahrnahm, war der stechende Schmerz im Kopf. Er benebelte seine Sinne und schickte ein unerträgliches Kribbeln durch seinen gesamten Körper. Wie viel Zeit verging, während Alan nur halb bei Bewusstsein auf dem Rücken dalag, wusste er im Nachhinein nicht. Doch schließlich waren die Schmerzen so weit abgeklungen, dass er die verklebten Augen öffnete und sich stöhnend aufsetzte.
Er befand sich auf einer kalten, harten Plattform. Sie thronte auf schrägen Pfeilern, die mit riesigen Bolzen an einer Wand aus schwarzem Metall verankert waren. Nach links erstreckten sich bis zum Horizont fahle Lichter, breite, fensterlose Türme erhoben sich durch den Nebel gen Himmel und stinkende Straßen schlängelten sich in der Luft zwischen ihnen hindurch. Hinter dem diffusen Rauch ließ sich der Himmel nur erahnen. Durch die trostlose Stahlwüste donnerten unnatürliche Geräusche, gnadenloses Hämmern, Bohren, Jaulen, wie ein maschineller Herzschlag der Stadt.
Was mache ich hier? Sein Herz flatterte wie ein ängstlicher Schmetterling, obwohl Alan nicht wusste, was ein Schmetterling war.
Was zur Hölle ist passiert?
Er hatte keinerlei Erinnerungen. Sein Gehirn war ausgesaugt und auf Null zurückgesetzt. Das Einzige, was klar und deutlich in seinem Gedächtnis festgebrannt war, war sein Name.
Vorsichtig, denn in seinem Kopf wummerten noch immer Überbleibsel der Ohnmacht, rutschte Alan vor an den Rand des Plateaus, um in die Tiefe spähen zu können.
Er schauderte. Sein Blick verlor sich in aschgrauem Dunst, der um die Füße der Türme waberte wie flüssiges Gift. Einzelne, schwache Lichtstrahlen kämpften sich durch den Nebel, um gleich darauf erstickt zu werden.
Die graue Atmosphäre griff auf Alans Gemüt über. Trostloser Stahl hinter verpesteter Luft, wohin das Auge reichte. Asphalt, Beton, Gestank nach brennendem Motoröl und Teer, Töne der unbarmherzigen Zerstörung. Hätte er gewusst, was Farben waren, hätte er sich nach ihnen gesehnt.
Irgendwas muss ich doch tun können. Warum bin ich hier? Wie komme ich weg? Und warum weiß ich all das nicht?
Alan rutschte zurück, bis er mit dem Rücken an die Metallwand stieß, und zog die Beine an seine Brust. Er durchforstete seine wirbelnden Gedanken nach einer Erinnerung aus der Vergangenheit, kramte in allen Registern, die ihm zur Verfügung standen und biss die Zähne zusammen, als die Kopfschmerzen zurückkehrten, quälend und lärmend.
Ein verschwommenes Bild flackerte vor seinem geistigen Auge auf und Alan griff blitzschnell danach, bevor es wieder in die Tiefen seines Bewusstseins abtauchte. Es war das Bild eines Mädchens. Sie lächelte breit und ihre Lippen bewegten sich, als wolle sie ihm etwas sagen. Ein Funken von Erkennen glomm in ihm auf, als hätte er sie vor langer Zeit schon einmal gesehen. Aber wo?
Allmählich kamen weitere Bilder zum Vorschein. Schnipsel, die keinen Sinn ergaben, bis sie sich mit dem Gesicht des fremdvertrauten Mädchens zu einem klaren Puzzle zusammensetzten.
Keuchend schnappte Alan nach Luft. Obwohl es kalt war, brach ihm Schweiß aus und er zitterte am ganzen Leib. Konnte das sein? Seine schmutzigen Finger bohrten sich in den dicken Stoff seines Hoodies. War das Mädchen... er selbst?
Er wusste, wer sie war.
Er kannte ihren Namen: Thessa.
Aber er war nicht sie – zumindest im Moment nicht. Thessa gab es in diesem Augenblick nicht. Er war sie einmal gewesen, an einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Nun war er Alan, dachte wie Alan, fühlte wie Alan, obwohl er und Thessa eine gemeinsame Seele teilten.
„Ich bin Alan“, sagte er rau, testete seine klanglose Stimme aus. Es schmerzte höllisch und brannte wie Feuer in seiner Kehle. Ein stummer Schrei grollte in ihm, doch er erstickte ihn sofort, um seinen verbrannten Hals zu schonen.
Ich bin zur Stummheit verdammt.
Vor Zorn lief er rot an und schlug mit der Faust auf den Boden, der natürlich härter war als seine Hand.
Frustriert und getrieben von Schmerzen in Kehle und Hand donnerte Alan seinen Kopf nach hinten, mit voller Wucht gegen die Eisenwand. Das Wummern in seinem Schädel, das noch immer nicht abgeklungen war, wuchs ins Unermessliche und vermischte sich mit dem Gestank und Lärm der Metallstadt. Alan beobachtete hilflos, wie Schwärze sein Blickfeld in Beschlag nahm, dann kippte er seitlich weg und verlor wieder das Bewusstsein.
Thessa zitterte wie Espenlaub, als sie zu sich kam. Die Erinnerung an den erschreckend realen Traum war so frisch und deutlich, dass sie sich einbildete, noch immer stechende Schmerzen im Kopf und in der Kehle zu spüren. Das Echo der Stahlwüste hallte noch in ihren Ohren und sie hatte den Gestank des Motoröls in der Nase, als wäre sie tatsächlich als Alan in dieser futuristischen Science-Fiction-Stadt gewesen.
So lebhaft hatte Thessa noch nie geträumt. Sie bezweifelte keine Sekunde, dass es sich um einen Traum handelte. Eine andere Person an einem fiktiven Ort zu sein, war physikalisch schlichtweg unmöglich. Dennoch schlug ihr Herz wie verrückt, als sie wagte, die Decke zurückzuschlagen und an sich herabzuschauen. Ihre schlanken, weiblichen Beine, die in einer dünnen Schlafanzughose steckten, ließen sie erleichtert aufatmen. Sie war ganz sie selbst. Kein bisschen Alan war zu sehen.
Aber was war das?
Gerade, als Thessa das Erlebnis endgültig als verrückten Traum abtun und sich mit der Vorfreude auf ihren Geburtstag am nächsten Tag schlafen legen wollte, erregte etwas Fremdes ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Knorpel unter ihrem linken Handgelenk befand sich ein schwarzer Fleck, den Thessa nicht kannte. Bei genauerem Hinsehen entpuppte er sich als ein kleines Tattoo.
Ein filigran geschwungenes T.
Thessas Herz setzte einen Schlag aus.
Dann holte sie tief Luft und erstickte ihren Schrei in einem Kissen.
Am nächsten Morgen wäre Thessa am Liebsten im Bett geblieben. Sie war erschöpft von der Nacht, in der sie kaum ein Auge zugetan, sondern sich mit heftig pochendem Herzen und Schweißausbrüchen hin- und hergewälzt hatte. Was genau war passiert? Wo war sie gewesen? Wer war Alan und wieso war sie er? Ihrer Erinnerung nach war sie nicht mehr sie, Thessa, gewesen, sondern voll und ganz Alan. Thessa hatte es in diesem Moment nicht gegeben, ihre gemeinsame Seele hatte nur Alan gehört. Aber was war in dieser Zeit mit ihr geschehen? Wie konnte es passieren, dass sie… ein anderer Mensch wurde?
Als das frühe Sonnenlicht durch die halb heruntergelassenen Jalousien sickerte und das schwarze T an Thessas Handgelenk selbst im Tageslicht nicht verschwand, wusste sie, dass ihr Albtraum noch lange nicht vorbei war. Auf keine der Fragen hatte sie eine Antwort gefunden, doch es war Zeit, aufzustehen und die Gedanken beiseite zu schieben.
Es war der Tag ihres achtzehnten Geburtstages.
Während sie sich aus dem Bett quälte, beschloss sie, niemandem etwas über die vergangene Nacht zu sagen. Selbst Helena, der sie sonst alles erzählte, würde sie sich nicht anvertrauen. Insgeheim hoffte sie, das Erlebnis totschweigen zu können, wenn sie es für sich behielt.
Aber was, wenn es erneut passiert? Schnell vertrieb Thessa den Gedanken.
Zum Glück war ihre kleine Schwester selbst zu aufgeregt wegen eines wichtigen Tests, um zu merken, dass Thessa nicht so fröhlich war wie sonst. Niemand kannte Thessa so gut wie Helena, denn obwohl zwischen den Schwestern drei Jahre Altersunterschied lagen, standen sie sich so nah wie Zwillinge. Auch ihre Eltern schienen ihr die gespielt gute Laune abzunehmen. Trotzdem war Thessa erleichtert, als sie die Geschenke ihrer Familie entgegengenommen hatte und mit Helena das Haus verlassen konnte, ohne besorgte Fragen ihrer Eltern beantworten zu müssen.
Auch in der Schule wahrte sie den Schein. Ihre Freunde wünschten ihr alles Gute, Thessa bedankte sich und saß die Zeit tapfer aus. Niemand bemerkte, dass sie geistig abwesend war und sich nicht so fleißig am Unterricht beteiligte wie üblich. Nach sieben quälenden Stunden ertönte der Gong, der das Ende der letzten Unterrichtsstunde verkündete und Thessa aus ihrer Anspannung erlöste. Endlich konnte sie nach Hause gehen und hatte ihre Ruhe.
„Hey, Thessa“, ertönte eine vertraute Stimme hinter ihr, als sie in Gedanken versunken über den Schulhof eilte. „Wo rennst du denn hin?“
Oh, verdammt, fluchte sie stumm. Das hatte ihr gerade noch gefehlt.
Trotzdem drehte sie sich um und fand sich ihrem Freund Jonas gegenüber. Seit er Thessa im Kindergarten vor Jungs beschützt hatte, die sie mit Sand bewarfen, waren sie unzertrennlich. An ihrem sechzehnten Geburtstag hatte er ihr den ersten Kuss geschenkt und war zu ihrem ersten Freund geworden. Obwohl er anderthalb Jahre älter war und sein Abitur bereits in der Tasche hatte, verbrachten sie jede freie Minute miteinander. Sie galten als das Traumpaar schlechthin. Viele Mädchen beneideten Thessa um ihn und sie konnte das nur zu gut nachvollziehen. Jonas war mit seinen haselnussbraunen Augen und dem umwerfenden Lächeln nicht nur wahnsinnig attraktiv, sondern auch warmherzig und aufmerksam. Für Thessa war er mehr als perfekt – auch, weil er respektierte, dass sie sich mit allem Zeit ließ, was über das Küssen hinausging.
Er strahlte sie an, bevor er sie fest in den Arm nahm.
„Alles Gute“, murmelte er in ihr Ohr. Sein Atem kitzelte warm. Thessa holte tief Luft, während ihr Gesicht an seinem Hals ruhte, und ließ den vertrauten, warmen Duft in ihre Lunge strömen. Automatisch entspannte sie sich. Sie war so aufgewühlt, dass sie vergessen hatte, dass er sie zur Feier ihres Geburtstages von der Schule abholen wollte.
„Danke“, flüsterte sie zurück. Ein flüchtiges Lächeln hatte sich auf ihre Lippen gestohlen und für einen kurzen Moment verblassten tatsächlich ihre Sorgen. In seiner Nähe fühlte sie sich geborgen, unabhängig von dem Chaos in ihrem Kopf. Oder gerade deswegen.
„Ich hab was für dich“, lächelte Jonas, nachdem er sich von ihr gelöst hatte, und reichte ihr ein in grünes Papier eingewickeltes Päckchen. „Ich wollte es dir heute an deinem richtigen Geburtstag geben und nicht erst zur Feier.“
Neugierig riss Thessa das Papier auf und öffnete die Schatulle, die darin lag. Ein silbern glänzendes, zartes Armband ruhte auf scharlachrotem Samt. Bewundernd hob sie es heraus und betrachtete die winzigen Elemente, die daran befestigt waren: Ein Kleeblatt, ein Herz, ein Ring, ein Schlüssel und eine Blume, fein und filigran. Noch nie hatte Jonas ihr Schmuck geschenkt. Thessa war begeistert und zugleich war es unmöglich, ihre Freude zu zeigen. Warum kam dieses Geschenk gerade an dem Tag, an dem sie die ganze Welt voller Argwohn betrachtete?
„Gefällt es dir?“, fragte Jonas unsicher, als Thessa nicht reagierte. „Ich wusste nicht, welches von den Motiven dir am besten gefallen würde, also habe ich gleich mehrere Anhänger...“
„Es ist total schön“, unterbrach Thessa ihn und schlang erneut die Arme um seinen Hals, um ihn sanft zu küssen. „Danke.“
Es war nicht Jonas' Schuld, dass Thessa verrückt geworden war. Das Armband war ein Beweis seiner Liebe, kein spöttisches Symbol des Schicksals.
„Gern geschehen.“ Seine Lippen verzogen sich wieder zu dem unbeschwerten Lächeln, das sie so sehr liebte.
„Machst du es mir um?“, fragte Thessa und hielt ihm ihr Handgelenk hin.
Als Jonas den Verschluss zuschnappen ließ, entdeckte er das T auf Thessas Haut. Verwundert runzelte er die Stirn und strich mit dem Daumen über das Zeichen.
„Was ist das denn? Ein Tattoo?“
Augenblicklich schlug Thessas erheiterte Laune wieder in Missmut um. Für einen Moment war sie versucht, sich Jonas anzuvertrauen, erinnerte sich jedoch an ihren Entschluss am Morgen und schluckte die Wahrheit hinunter. Sie war zu unfassbar, um sie zu erklären. Abgesehen davon fürchtete Thessa, Jonas könnte sie für verrückt halten. Was sie vermutlich auch war.
„Das habe ich mit Filzstift gemalt, vorhin. Der Unterricht war so langweilig.“
Jonas grinste. „Ach so.“
Drei Tage später war der Abend von Thessas Feier gekommen. Seit ihrem Geburtstag war sie von merkwürdigen Ereignissen verschont geblieben. Um zusätzlich Ordnung über ihr plötzlich zerpflücktes Leben herrschen zu lassen, hatte sie sich jeden Tag noch intensiver mit ihrem strukturierten Alltag beschäftigt als zuvor. Essen, Hausarbeit, Schulaufgaben. Etwas zu machen, über das sie nicht nachdenken musste, verlieh ihr das Gefühl von Sicherheit. Sie wusste genau, was sie zu tun hatte, sah einen Sinn darin und es war normal.
Tatsächlich zeigte diese Verbissenheit eine Wirkung und Thessa war froh, sich am Samstagabend allein auf ihre Geburtstagsfeier konzentrieren zu können.
Gäste strömten in den Garten, in dem Thessas Familie ein Zelt aufgestellt hatte, und redeten wild durcheinander.
„Happy Birthday!“
„Wo geht’s lang?“
„In den Garten.“
„Cool, ein Zelt!“
In weniger als einer halben Stunde war das Zelt erfüllt von Stimmengewirr und Lachen. Thessa stand fröhlich inmitten ihrer Freunde und nahm Glückwünsche und Geschenke entgegen. Es waren auch Leute gekommen, die sie nicht eingeladen hatte, aber jeder von ihnen stellte sich vor und erklärte, mit wem er gekommen war. Da Thessa nichts anderes erwartet hatte, war es für sie völlig in Ordnung und sie freute sich, dass alle so freundlich und höflich waren.
Nach einer weiteren Stunde war die Party voll im Gange. Die Menge bediente sich an der Bar und am Buffet und laute Musik schallte durch das Zelt. Erhitzt vom Tanzen ignorierten die Gäste die stickige Luft und genossen die ausgelassene Atmosphäre.
Inzwischen war Thessa schon so lange auf der improvisierten Tanzfläche gewesen, dass ihre Füße schmerzten. Sie drängte sich mit Jonas im Schlepptau zur Bar und stellte dort ihren Becher ab, um anschließend das Zelt zu verlassen. Ihr Gesicht glühte vom Tanzen, von der Hitze und von der Freude, die durch ihre Adern schoss – und vielleicht auch ein bisschen vom Alkohol. Ein Gefühl, dass sie so nicht kannte.
Über den Himmel spannte sich ein blassschwarzer Schleier, geziert von funkelnden Pünktchen, die vor ihren Augen in einem wirbelnden Strudel versanken. Den Versuch, Silhouetten in der Nacht auszumachen, erstickte Jonas sofort, indem er Thessa eng an sich zog und küsste, kaum dass sie an die erfrischende Luft getreten waren. Seine Hände schmiegten ihren Körper an seinen und Thessa spürte die Hitze unter seinem Shirt, die nach ihr rief und sich mit ihrer eigenen verband. Ungestüm erwiderte sie Jonas' Kuss und presste sich an seine Brust. Er schmeckte nach Bier und Leidenschaft, eine Mischung, die Thessa zum ersten Mal schmeckte. Doch sie gefiel ihr überraschend gut.
Das ist es also, was Achtzehnjährige tun, dachte Thessa glücklich. Knutschend vor einem Partyzelt stehen.
Es dauerte eine Weile, bis sich die beiden voneinander lösten. Nur selten kam es vor, dass sie Zeit für eine andere Art von Liebe außer gegenseitige Unterstützung aufbringen konnten, denn Thessas erste Priorität war immer die Schule gewesen.
Ich sollte definitiv öfter Alkohol trinken, beschwor sie ihr nüchternes Ich in Gedanken.
Aber der Rausch war bereits verflogen und das Verlangen, Jonas' Liebe zu spüren, verschwunden.
Gemeinsam betraten Jonas und Thessa wieder das Zelt, steuerten jedoch nicht auf die tanzende Menge zu sondern auf eine kleinere Gruppe, die sich in der Sitzecke niedergelassen hatte. Mithilfe ihres Vaters hatte Thessa am Vorabend die zwei alten Sofas aus dem Keller hoch getragen und sie in eine Ecke gestellt. Fünf von Thessas Freunden aus ihrem Tanzverein hatten sich dort mit ihren Bechern hingesetzt und spielten Flaschendrehen.
„Trink das hier auf Ex“, verlangte ein rothaariges Mädchen namens Elenor gerade von dem stillen Mischa und reichte ihm einen roten Becher. Er war bis über die Hälfte gefüllt. Ohne mit der Wimper zu zucken nahm Mischa den Becher und leerte ihn in einem Zug.
„Hey“, rief Thessa und zog Jonas mit sich. „Wir spielen mit.“
Jonas verdrehte die Augen, widersprach aber nicht.
„Mischa ist dran“, verkündete Anh und öffnete den Kreis, damit sich die beiden dazu setzen konnten. Der blonde Junge überlegte kurz, drehte die Flasche und sagte, während sie um ihre eigene Achse wirbelte: „Derjenige muss seinem linken Nachbarn erklären, dass er oder sie schwanger ist.“
Der Flaschenkopf blieb bei Paolo stehen, woraufhin alle losprusteten. Paolo war definitiv derjenige, der am ehesten schwanger werden würde, wenn es biologisch möglich wäre. Es gab fast keine weibliche Person im Tanzverein, mit der er noch nichts hatte. Grinsend wandte er sich an Anh, zog eine ernste Schnute und verkündete mit Grabesstimme: „Schwesterherz, Mischa hat mich geschwängert. Es tut mir leid, aber er liebt jetzt mich und wir werden unsere eigene Familie gründen.“
Die Angesprochene lachte nach diesen Worten so sehr, dass ihr die Tränen kamen, und auch den anderen tat bald der Bauch weh vor Lachen. Als sie sich erholt hatte, boxte Anh Paolo gegen den Oberarm und küsste Mischa auf den Mund. Paolo nahm die Flasche, drehte und verdonnerte damit Lea dazu, ihr Lieblingslied vorzutragen, woraufhin diese Elenor das Geständnis entlockte, schon acht verschiedene Personen geküsst zu haben.
„Wo wir schon beim Küssen sind“, schmunzelte Elenor und drehte die Flasche, „der oder diejenige, auf die die Flasche zeigt, muss die Person küssen, mit der er sich am ehesten etwas vorstellen kann.“
„He, Thessa!“, übertönte auf einmal einer ihrer Klassenkameraden die Musik und das Gelächter der Menge, seine Stimme klang verschwommen, er war offensichtlich angetrunken. „Das Bier ist leer.“
Missmutig schälte Thessa sich aus Jonas' Arm, dieser sah sie gespielt enttäuscht an.
Sie grinste nur. „Ich bin gleich wieder da, ich hole nur einen neuen Kasten aus dem Keller.“
„Soll ich mitkommen?“, fragte er und machte Anstalten, aufzustehen. Sie drückte ihn zurück auf seinen Platz.
„Nein, geht schon, alleine bin ich schneller.“
„Na gut“, gab er nach. „Aber beeil dich.“
Mit einem Nicken lief Thessa zum Zeltausgang und schlüpfte durch die Terrassentür ins Haus. Ihr Kopf brummte von all den Dingen, die sich soeben ereignet hatten. Der Alkohol, das ausgelassene Tanzen, Jonas' wilder Kuss, denn sie noch immer auf ihren Lippen spürte. Kurz blieb Thessa stehen, um tief Luft zu holen, bevor sie in den Keller trat. Das Licht war schon länger defekt, aber sie wusste auch im Dunkeln, wo sich die Getränkekasten befanden. Doch als sie sich wieder aufrichtete, stieß sie plötzlich mit dem Kopf an etwas hartes und ein dumpfer Schmerz breitete sich in ihrem Körper aus. Er wurde immer stärker, ließ ihre Beine unter ihr wegknicken und sie mit einem Stöhnen auf den Boden sacken.
Das beschissene Regalbrett, dachte Thessa nur noch, dann wurde die Welt um sie herum schwärzer, als es die Dunkelheit davor schon gewesen war.
Während Lucien unter Schmerzen um sein Bewusstsein kämpfte, wagte er nicht, die Augen zu öffnen. Sein Kopf pochte dumpf, wie er es aus einer weit entfernten Zeit und Welt noch in Erinnerung hatte, und seine Lippen fühlten sich rau und rissig an, als er mit der Zunge darüber fuhr. Hitze presste sich in jede Pore seines Körpers und staubige Luft füllte seine Lungen, um ihn von innen auszutrocknen.
Durst.
Seltsamerweise konnte er sich genau daran erinnern, was Thessa vor wenigen Minuten passiert war. Er war sich bewusst, dass sie und er nicht die gleiche Person waren, aber die gleiche Seele in sich trugen. Er wusste sogar, dass er einmal Alan gewesen war. Nur über sich selbst wusste er genauso wenig wie Alan vor ein paar Tagen.
Warum kann ich mich an Thessas Leben erinnern, obwohl Alan es nicht konnte?
Was ihn noch mehr verwirrte, war, dass er den plötzlichen Identitätswechsel so gleichgültig hinnahm. Er konnte sich genau daran erinnern, wie entsetzt Thessa nach Alans erstem Erwachen gewesen war, Lucien jedoch akzeptierte seine anderen Identitäten problemlos.
Durst.
Er würde nicht ewig hier liegen bleiben können und sich vor dem verstecken, was ihn erwartete, wenn er die fremd-vertrauten Augen öffnete. Früher oder später würde er Wasser suchen müssen und Luciens Körper verlangte immer energischer nach Flüssigkeit. Aber noch überlagerte Angst den quälenden Durst.
Um sich abzulenken, tastete Lucien den Boden ab, auf dem er lag. Er fühlte sich rau wie Stoffleinen an.
Durst.
Lucien streckte seine Hände weiter aus. Kurz hatte er das Gefühl, so etwas wie Stroh gesteift zu haben und tastete die Stelle gründlich ab. Tatsächlich, es war trockenes Gras. Hoffnung machte sich in ihm breit, denn er hatte seine Umgebung vor dem inneren Auge schon gesehen: Eine einsame Wüstenlandschaft, weit und breit nichts Essbares und kein Wasser.
Durst.
Der Hoffnungsschimmer trieb Lucien an, die Augen aufzuschlagen. Licht stach in seine Pupillen wie kleine Nadeln und sofort kniff er sie wimmernd wieder zusammen. Nachdem sich seine Augen von dem blendenden Lichtbiss erholt hatten, wagte er, sie im Schutze seiner Hände erneut zu öffnen. Es dauerte eine Weile, bis er sich umschauen konnte, ohne zu blinzeln. Doch dann erkannte er, dass er sich bezüglich der Wüstenlandschaft getäuscht hatte, und zwar gewaltig.
Der Garten, in dem er erwacht war, war kaum größer als ein Balkon, und das gelbe Gras von der Sonne völlig versengt. Er wurde begrenzt von weißen Mauern, die in niedrigen, flachen Dächern endeten. Zu seiner linken Seite führte eine schmale Treppe in die Tiefe und ein Pfad kreuzte die Stufen direkt unter der Terrasse. Nicht nur die Gewächse, auch die Menschen hier schienen unter der Hitze zu leiden, denn hin und wieder waren Tücher als Sonnenschutz aufgespannt, die als einzelne bunte Tupfer in der verwinkelten Häuserlandschaft auszumachen waren. Lucien spähte auf den weißen Weg hinunter, aber sein Blick verlor sich hinter einem Torbogen. Außer hellen Mauern, Treppen und Wegen, Terrassen und Tüchern konnte er nichts Außergewöhnliches erkennen. Obwohl er gerne gewusst hätte, wo er gelandet war, verdrängte der Durst die Neugier.
Wo Häuser waren, waren auch Menschen und wo Menschen waren, war Wasser.
So schnell es seinem ausgetrockneten Körper möglich war, stand Lucien auf und schlüpfte durch eine angelehnte Luke hinter der Terrasse. Im Inneren des Hauses hüllte ihn angenehme Frische ein, die die widerlich trockene Hitze der unbarmherzigen Sonne vertrieb. Wachsam sah Lucien sich im Zimmer um. Es befanden sich keine Menschen darin, nur dunkelgraue Polster und Regalbretter an den weißen Wänden, die von verschiedenen Kakteen gesäumt wurden. Lucien tappte auf leisen Sohlen den Flur entlang.
Da kam ihm in den Sinn, dass er möglicherweise gar kein Eindringling war – er war im Garten dieses Hauses aufgewacht, also wohnte er wahrscheinlich hier.
Ein goldener Schimmer in seinem Augenwinkel erweckte seine Aufmerksamkeit. Als er genauer hinsah, stand er einer Person gegenüber. Es dauerte eine Weile, bis Lucien begriff, dass er in einen Spiegel starrte.
Er sah einen großen jungen Mann mit blondem, verstrubbeltem Haar und einem schmalen Gesicht. Sofort fielen ihm die bronzefarben schimmernde Haut und die mandelförmigen, kleegrünen Augen auf, die Thessa sich immer gewünscht hatte. Im Gegensatz zu Alans Statur zeugten seine wohl proportionierten Muskeln nicht von hartem Überlebenskampf, sondern von guten Genen.
Dann ließ Lucien den Blick über seinen Körper wandern. Das Schimmern, das seine Aufmerksamkeit im Spiegel erregt hatte, war die Reflexion vom Goldschmuck, den er überall am Körper trug. Seine Schienbeine und Unterarme steckten bis zu den Gelenken in goldenem Metall. Auf seiner Brust lag eine mit Gravuren verzierte Platte und um den Hals, die Oberschenkel und -arme schlangen sich dicke, goldene Reifen. Unter all dem Schmuck – zumindest vermutete Lucien, dass es Schmuck war – trug er einen engen, weißen Overall.
Stirnrunzelnd wandte er sich von seinem Spiegelbild ab und ging weiter den Flur entlang.
Vermutlich kann ich mich an Thessa und Alan erinnern, weil Alan herausgefunden hat, dass wir mehr oder weniger eins sind. Die Erinnerungen, die unsere Seele gesammelt hat, bleiben offenbar bestehen. Das bedeutet, dass weder ich noch Alan jemals bewusst existiert haben, bevor wir zu uns kamen. Aber was waren wir dann davor?
Am Ende des Flurs öffnete Lucien eine weitere Tür und fand sich tatsächlich in einer Küche wieder. Genau wie im Wohnzimmer schmückten unzählige grüne Pflanzen den Raum, es gab einen gefliesten Boden und graues Mobiliar.
Plötzlich erstarrte Lucien. Am Tresen lehnte, mit dem Rücken zu ihm, ein Mädchen. Sie trug die gleiche weiße Unterkleidung wie er, darüber zarteren goldenen Schmuck. Der fest geflochtene, platinblonde Zopf reichte beinahe bis zum Steißbein. Ihre Statur war schlank und hochgewachsen und Lucien war sicher, dass sie auf der Straße viel Aufmerksamkeit erregte.
„Hey, Lucien“, sagte sie, als sie ihn bemerkte, und drehte sich herum. Lucien kniff die Augen zusammen, während sein Herz aufgeregter schlug. Selbst aus der Entfernung konnte er erkennen, dass sie seine Augen und Gesichtszüge hatte. Das Mädchen vor ihm war zweifellos seine Schwester.
Lucien wurde übel.
Er fühlte sich zwar wohl als er selbst, doch er hatte noch nie von seiner Stadt, seiner Familie oder seinem Haus gehört. Seine Schwester würde sofort merken, dass er sich nicht normal benahm.
Nervös räusperte sich Lucien. „Ich wollte etwas trinken.“
„Mach das“, sagte sie, während sie sich wieder ihrer Beschäftigung widmete. Im Vorbeigehen sah Lucien, dass sie hellgelbes Obst aß. Als er vor der Spüle stand, rutschte ihm das Herz in die Hose. Vor seiner Schwester konnte er unmöglich alle Küchenschränke nach einem Glas durchsuchen.
Der Durst drängte ihn zu einer einfachen Lösung. Mit den Händen als Schale trank er aus den gewölbten Handflächen.
Aber ich werde es nicht immer so einfach haben.
„Lucien?“, fragte das Mädchen in seinem Rücken.
Wasser tropfte von seinem Kinn. „Ja?“
„Würdest du mir bitte meine Mentla aus meinem Zimmer holen? Ich will gleich los.“
„Klar.“ Das Wort war schneller über Luciens Lippen geschlüpft, als er nachdenken konnte, und er biss sich frustriert auf die Zunge. Doch es war bereits ausgesprochen.
Mit zusammengebissenen Zähnen verließ er die Küche und schlug auf gut Glück eine Abzweigung im Flur ein. Sie führte hinaus auf einen Balkon mit einer Treppe. Kaum war Lucien sie hinaufgestiegen, schlüpfte er zurück ins Innere des Hauses.
Er hatte Glück, sogar mehr als das. Im Obergeschoss fand er sich vor einer Tür wieder, auf der in großen, goldenen Buchstaben der Name LUCIEN prangte. Erfreut zuckten seine Mundwinkel hoch. Er würde nicht nur das Zimmer seiner Schwester finden, sondern womöglich sogar ihren Namen erfahren. Doch bevor er den Korridor weiter verfolgte, warf Lucien einen Blick in sein Zimmer. Es war nicht sonderlich groß und Staub wirbelte durch die honiggelben Lichtbalken, die durch die flachen Fenster in den Raum fluteten, sah aber einladend und bequem aus. Im Gegensatz zur Küche und dem Wohnzimmer dominierte hier nicht dunkelgrau, sondern ockergelb.
Zufrieden nickte Lucien. Wenn er noch eine Weile bleiben müsste, würde er es hier gut aushalten. Komischerweise machte ihm das nichts aus, obwohl er wusste, dass Thessa bei der Vorstellung Tränen in die Augen schießen würden.
Die zweite Tür führte Lucien in einen geräumigen Waschraum. Gegenüber befand sich wieder eine beschriftete Tür, die laut den goldenen Buchstaben KHALI gehörte. Khali, das musste der Name seiner Schwester sein. Eine Woge der Zuneigung durchfuhr Lucien und plötzlich wusste er, dass sie sich sehr nahestanden. Khali kannte ihn schon ihr ganzes Leben, trotzdem war er das erste Mal in diesem Haus und hatte sie noch nie zuvor gesehen. Wie sollte das funktionieren? Sein Kopf begann durch das Paradoxon seiner Existenz wieder zu schmerzen.
Um den verworrenen Gedanken zu entkommen, öffnete Lucien die Tür und betrat Khalis Zimmer. Die Farbe, die ihn begrüßte, war sonnengelb. In einer Ecke des Zimmers lag ein dicker Teppich mit unzähligen Kissen, daneben ein niedriger Tisch. Lucien betrachtete das Bild darauf. Er selbst war zu sehen, daneben seine Schwester und hinter ihnen ein Mann und eine Frau, die wie ältere Ausgaben der Geschwister aussahen. Alle lachten fröhlich in die Kamera. Lucien stellte das Bild zurück auf den Tisch. Zumindest wusste er nun, dass er keine weiteren Geschwister hatte. Aber die Fragen in seinem Kopf verlangten nur noch dringlicher nach Antworten.
Nachdem er das erste Problem gelöst hatte, stand er nun vor einem größeren. Was war eine Mentla?
„Wie lange brauchst du denn?“, ertönte Khalis missmutige Stimme hinter ihm.
Lucien stockte. „Ich – ich hab sie nicht gefunden.“
Khali verdrehte die Augen und hob ein Stück weißen Stoff von einem Haken. Ein Mantel. Natürlich.
„Khali?“, fragte Lucien zögernd.
Als sie sich zu ihm drehte, atmete er erleichtert aus. Khali war tatsächlich ihr Name.
Da er nicht wusste, was er sonst tun sollte, bat er: „Darf ich mit dir kommen?“
Khali zog die Augenbrauen hoch. „Zum Training? Du hattest doch gestern schon. Kriegst wohl nicht genug.“ Belustigt nickte sie. „Klar. Hol noch schnell deine Mentla, dann können wir los.“
Erleichtert steuerte Lucien auf sein Zimmer zu und pflückte einen Mantel, der Khalis sehr ähnlich sah, von den Kissen. Der einzige Unterschied war, das sein Kragen komplett aus goldenem Metall bestand und ihrer bloß einen golden bestickten Saum besaß. Die Geschwister liefen die Treppe herab und legten sich vor dem großen Spiegel ihre Mentlas an.
„Wo sind eigentlich Mama und Papa?“, fragte Lucien beiläufig, während er die Fäden festzog.
„Auf dem Schiff natürlich“, antwortete Khali.
Lucien runzelte die Stirn. Schiff? Vorhin hatte er nichts außer der Häuserlandschaft gesehen. War er etwa an der See zuhause? Das würde den goldenen Schmuck erklären: Vielleicht benutzten die Seeleute ihn, um sich durch die Reflexion der brennenden Sonne auf dem Metall zu orten. Aber als die beiden das Haus verließen und über Treppen und Dächer aus dem Wohnkomplex kletterten, verschlug es Lucien den Atem. Nein, kein Wasser. Im Gegenteil.
Hinter den letzten Torbögen war nichts.
Nichts.
Nur Luft.
Er zwang sich, sich seine Verblüffung nicht anmerken zu lassen und folgte Khali die letzte Treppe hinab.
Die weißen Häuser standen gedrängt bis an die Ufer einer großen Insel. Und die Insel schwebte.
In nächster Nähe befanden sich drei weitere Inseln, an deren Felsen sich weiße Häuser schmiegten. Bis zum Ufer drängten sie sich, so weit, dass sie sich über dem Abgrund am Erdboden festzuklammern schienen. Unter der bewohnten Fläche brachen schroffe Klippen ins Nichts. Ein Brückennetz verband die Inseln miteinander. Vom azurblauen Himmel brannte die Sonne auf den staubigen Fels hinab und die Luft war flirrend heiß.
In diesem Moment wurde Lucien eines klar: Er hatte nicht nur eine neue Identität angenommen, sondern war auch in eine völlig andere Welt eingetaucht. Schwebende Inseln – so etwas konnte es in Thessas Welt einfach nicht geben.
Khali führte ihn an den Rand der Insel, dem er sich nur vorsichtig näherte. Tief unter ihm glitten Wolken wie träges Wasser vorbei. Trotz der Hitze fröstelte Lucien.
„Was passiert, wenn ich hier runterfalle?“, murmelte er leise zu sich, aber Khali hatte es trotzdem gehört, denn sie lachte laut auf.
„Dann, Bruderherz, fällst du für immer. Aber du fällst nicht, das wissen wir beide.“
Lucien war sich nicht so sicher, ob er es tatsächlich wusste.
Khali griff nach seiner Hand und zerrte ihn zu einem der vielen Holzpflöcke, die tief in der rissigen Erde steckten. Sie bückte sich und zog an einer Schnur. Luciens Augen weiteten sich. Ein Boot kam zum Vorschein und drängte sich ans Ufer der schwebenden Insel. Es schaukelte hin und her, als würde es im Wasser liegen. Das tut es aber nicht.
Es kam Lucien vor, als würde sein Kopf gleich zerplatzen. Die Türme in der Stahlstadt waren schon unglaublich gewesen, doch das hier war strikt unmöglich. Er reiste tatsächlich zwischen Parallelwelten umher.
„Alles okay?“ Er hatte gar nicht gemerkt, wie Khali ins Boot geklettert war. Sie stand auf den Planken und sah ihn mit schief gelegtem Kopf an.
„Äh, klar.“ Obwohl sich alles in ihm dagegen sträubte, stieg er über die Reling und setzte sich Khali gegenüber. Seine Beine zitterten. Er war nur einen halben Meter vom Tod entfernt.
Seine Schwester schien sich der Gefahr gar nicht bewusst zu sein. Fröhlich lachend kletterte sie ans andere Ende des Bootes, ohne sich um sein wildes Schaukeln und Luciens schreckensbleiches Gesicht zu kümmern, und rief: „Ich fahre!“
Lucien nickte nur.
Khali löste das Seil, mit dem sie am Ufer befestigt waren, und öffnete eine Holztruhe am Heck des Bootes. Sie war randvoll gefüllt mit einem goldbraunen Pulver, das im Schein der Sonne wie Geschmeide glänzte. Khali ließ zwei volle Hände des Pulvers in ein trichterförmiges Gefäß hinter dem Boot rieseln, während sie fremd klingende Worte murmelte. Lucien wunderte sich kein bisschen, als sich das Boot daraufhin in Bewegung setzte, während es eine golden glitzernde Spur hinter sich her zog. Wieso sollten die Schiffe in einer Welt voller schwebender Inseln mit Motoren angetrieben werden?
„Gut, dass wir neulich den Sternensand nachgefüllt haben“, bemerkte Khali und steuerte das Boot von der Insel weg. Lucien schwieg. Er war zu sehr damit beschäftigt, seine Fingernägel ins Holz zu graben und zu beten, dass sie nicht kenterten.
Aber schon nach den ersten zehn Minuten entspannte er sich ein wenig. Das Boot glitt sicher durch die Luft und schaukelte friedlich vor sich hin. Ab und zu glitten andere Schiffe an ihnen vorbei, kleine Nussschalen wie sie eine hatten, und sogar größere Yachten.
Irgendwann passierten sie langsam die letzte Wohninsel und vor ihnen eröffnete sich weite Leere. Khali sprach ein paar weitere Worte und juchzte, als das Boot beschleunigte und pfeilschnell durch die Luft schoss. Die riesige Inselgruppe, sie sie soeben verlassen hatten, entfernte sich rasch. Hier, in der freien Luft, fuhren sehr große Schiffe. Aber Khali hielt sich von ihnen fern und daher sah er sie nur aus einiger Entfernung.
Trotz allem fand Lucien allmählich Gefallen am Fliegen in dem Boot. Genial, dachte er grinsend und ließ sich mit geschlossenen Augen den Fahrtwind um die Nase wehen, der eine willkommene Kühle nach der glühenden Hitze am Land mit sich brachte.
Er öffnete sie erst wieder, als Khali das Tempo verlangsamte. Vor ihnen breiteten sich weite und hohe Inseln aus, Gebäude, die im strahlenden Licht der Sonne glänzten und mit kunstvoll geschmückten, breiten Brücken verbunden waren. Auf den Pfaden der Inseln sah Lucien ein paar Menschen herumlaufen, die lachten und sich unterhielten. Sie alle trugen die weißen Kleider und darüber goldenen Schmuck.
Aber all das wurde von einem einzigen Gebäude in den Schatten gestellt.
Hinter einigen anderen Inseln, die prunkvolle Häuser und blühende Parks trugen, schwebte die größte Insel, auf der ein Schloss thronte. Es hatte kurze, dicke Türme aus gelben Mauersteinen und war mit wildem Efeu überwuchert. Lucien sah geschäftige Leute über die Treppen und Pfade des Schlosses eilen, denn es hatte weder Fenster noch Türen, nur Mauern und Pavillons. Zwischen gezackten Erdbrocken rauschte knapp unter der Oberfläche der Insel ein Wasserfall in die Tiefe und verlor sein Wasser in Wolken.
Khali steuerte das Boot unter den hohen Brücken hindurch in Richtung Schloss und plapperte ununterbrochen, während er seine Umgebung gebannt musterte. Das gesamte Zentrum, wie sie es beim Erzählen nannte, wirkte trotz seines majestätischen Leuchtens kriegerisch und erinnerte Lucien an die Darstellung vom alten Griechenland. Würde die ganze Welt nicht auf Inseln schweben, würde er denken, er sei in einer Mischung aus Athen und dem Olymp gelandet. Bald hatte seine Schwester hinter der Schlossinsel angelegt, sie liefen gemeinsam über eine Brücke und betraten das Schloss über eine der vielen Treppen. Luciens Neugier auf die ihm bevorstehende Trainingsstunde stieg stetig.
Er war nicht vorbereitet auf die Speere, Schwerter und Schilder, die in dem Raum aufgereiht waren, in den seine Schwester ihn führte. In der Mitte des großen Saals befand sich eine kreisrunde Fläche aus Quarz. Lucien schätzte den Durchmesser auf zehn Meter. Links standen die Schwerter vor einem Spiegel und rechts saßen auf Bänken Jungen und Mädchen, die etwa so alt wie die Geschwister sein mussten.
„Da seid ihr ja“, begrüßte sie ein muskulöser junger Mann mit ernstem Gesicht und straffen Gesichtszügen. „Du auch, Lucien? Nun gut, wir sind sowieso eine ungerade Zahl heute.“
„Hallo, Bailey“, sagte Khali.
Lucien nickte nur schweigend und musterte mit wachsendem Unbehagen die Waffen. Würde der Mann von ihnen verlangen, gegeneinander zu kämpfen?
Er wollte Khali zu den anderen Jugendlichen folgen, doch Bailey hielt ihn zurück.
„Willst du heute nicht wie immer den ersten Kampf fechten?“
Lucien schluckte und zuckte zögernd mit den Schultern. Bailey deutete aufforderd auf die Waffen. „Bitte sehr.“
Oh nein.
„Colin, möchtest du den ersten Kampf für heute übernehmen?“
Ein breitschultriger Junge mit dunklen Locken und Sommersprossen erhob sich von der Bank und schlenderte zu den Geschwistern und Bailey hinüber. „Gerne.“
Kampf.
Lucien schauderte. Bailey hatte seine naheliegende Vermutung deutlich ausgesprochen, er würde wirklich kämpfen. Colin musterte ihn mit einem herablassenden Lächeln. Lucien zog verärgert die Brauen zusammen und straffte die Schultern. Er musste aussehen wie ein scheues Reh, das Angst vor Wasser hatte. Den Stolz, der ihn plötzlich durchfuhr, kannte er von seinen anderen Identitäten nicht.
„Dann wollen wir mal“, platzte es kühn aus Lucien heraus, bevor er darüber nachdachte. Er hasste den Blick, den Colin ihm zuwarf und beschloss, sowohl Thessa als auch Alan hinter sich zu lassen. Hier war er Lucien, der zu kämpfen wusste, und nicht der Schatten eines anderen.
Mit langen Schritten ging er hinüber zu den Waffenständern, ergriff ein Schwert und einen Schild und wandte sich Colin zu. Dieser betrat mit den gleichen Waffen den Quarzkreis und wartete, bis Lucien sich vor ihm aufgebaut hatte. Bailey platzierte sich mit einer an einem Seil hängenden Kupferplatte neben die jungen Männer.
„Bereit?“, fragte er und schlug einen Stab gegen die Platte, ohne auf eine Antwort zu warten. Es schallte so laut, dass Lucien kurz zusammenzuckte und Colins ersten Schlag nur knapp abwehren konnte. Wachsam sprang er einen Schritt zurück, sammelte sich und schärfte seine Sinne. Er selbst hatte einen solchen Kampf noch nie miterlebt, geschweige denn geführt, aber sein Körper beherrschte die Bewegungen im Schlaf. Es war spürbar nicht das erste Mal, dass er kämpfte. Und somit gab sich Lucien seinen Instinkten vollkommen hin.
Colin schob seinen Schild vor die Brust und erhob das Schwert zum zweiten Angriff. Mit einem lauten Klirren stießen die Waffen aneinander, diesmal hatte Lucien schnell genug reagiert. Zwei weitere harte Schläge, begleitet vom kämpferischen Gebrüll der Kontrahenten, dann schwang Lucien sein Schwert schneller. Er täuschte einen Hieb auf Colins linke Schulter vor, schwenkte aber blitzschnell hinüber zur rechten und erwischte ihn mit der abgestumpften Klinge am Schlüsselbein. Schlag für Schlag gewann Lucien die Oberhand, ohne zu wissen, wie ihm geschah.
Gerade sah es so aus, als würde Bailey den Kampf beenden, als Colin zum letzten, verzweifelten Hieb ausholte. Er hob den Griff seines Schwertes in die Höhe seines Kopfes und automatisch schützte Lucien den seinen mit dem Schild.
Und da sah er es.
Das Tattoo auf seinem Handgelenk war nicht mehr dasselbe.
Vor Überraschung keuchte er auf und bemerkte zu spät, wie sein Gegner das Schwert mit einem lauten Schrei herumschwang. Lucien hielt den Schild nicht mehr mit ausreichend Widerstand, um den Schlag abzufangen, sodass dessen Härte ihn von den Füßen riss.
Bevor Lucien realisierte, dass Khali erschrocken aufschrie, verfärbte sich die Umgebung so schwarz wie das L auf seinem Handgelenk.
Wer bin ich jetzt?
Die Qualen ihres Weltensprungs benebelten noch immer ihre Sinne, dennoch spürte Ebony angenehme Frische durch die radikale Änderung des Klimas. Luciens Schweiß und die Staubschicht auf seiner Haut waren im Trainingspavillon zurückgeblieben. Ihre gemeinsame Seele hatte Luciens Körper abgestreift und wieder eine neue Identität angenommen.
Es kostete Ebonys gesamte Beherrschung, um nicht frustriert aufzuschreien. Wie lange würde das noch so weitergehen? Ein neues Ich, ein neues Zuhause, immer und immer wieder? Nur schwer ließ sich das brodelnde Temperament in ihrem Inneren bändigen.
Tief durchatmend musterte sie die neue Welt.
Gewaltige Baumstämme ragten in schwindelerregende Höhen, dazwischen spannten sich Lianen und Flechten. Krumme Äste trugen Blätter, die sich als Dach über dem Unterholz behaupteten und es vor der Sonne schützten. Einzelne Sprenkel des Lichts erreichten dennoch mühevoll den farnüberwucherten Boden. An diesen Stellen schienen Lichtsäulen schräg aus dem Boden zu wachsen.
Diese Umgebung kam ihr vertrauter vor, nicht wie bei den schwebenden Inseln oder der monströsen Metallstadt. Den Wald kannte Thessa auch und hier gab es nichts, das Ebony fremd vorkam. Aber das hatte Lucien anfangs auch gedacht, als er zum ersten Mal erwacht war, und seine Welt hatte sich noch fantastischer herausgestellt als die Metallstadt, die Thessa schon für unmöglich gehalten hatte.
Was, wenn sich diese Erfahrung fortsetzte und der wilde, aber harmonisch wirkende Urwald eine noch größere Überraschung bereit hielt als die Inseln? Beunruhigt zog Ebony die Augenbrauen zusammen, als ihr ein neuer Gedanke kam. Bisher hatten alle drei Welten, die sie kannte, einigermaßen friedlich gewirkt. Nirgendwo wurde sie gejagt oder musste ihr Leben verteidigen. Aber wenn sie jetzt inmitten eines Krieges gelandet war? Wenn sie in dieser Welt verfolgt wurde und andere sie vernichten wollten?
Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch erhob sich Ebony.
Herumzusitzen und abzuwarten, bis der Zufall sie in eine weitere Welt brachte, kam nicht in Frage. Vor allem, wenn sich ihre unheilvolle Vermutung als wahr erwies und sie an Ort und Stelle getötet wurde, nur weil sie sich nicht bewegt hatte.
Kopfschüttelnd lief Ebony los und drängte sich durch hohe Farne und widerspenstige Sträucher. Abgesehen von Thessa wussten sich alle ihre Identitäten zu verteidigen. Grimmig ballte sie ihre Hände zu Fäusten.
Vor allem ich lasse mich sicher nicht von ein paar harmlosen Blättern einschüchtern.
Die letzten Momente als Lucien tauchten plötzlich in ihrem Kopf auf. Die wenigen Sekunden, bevor er vom Schmerz getrieben die Augen schloss, liefen immer und immer wieder vor ihrem geistigen Auge ab. Als Ebony diese Bilder im Gedächtnis eingeschlossen hatte, tauchten die letzten Szenen aus anderen Welten auf, bevor ihre Identitäten verschwanden und ihre Seele in eine neue Welt eintauchte.
Alan, der seinen Kopf an die Stahlwand des Turmes donnerte. Thessa, die sich am Regalbrett stieß. Jedes Mal, wenn sie von einer Welt in die nächste gewechselt hatte, war es mit Schmerz verbunden gewesen. Nur das allererste Mal passte nicht ins Bild: Thessa hatte im Bett gelegen und war plötzlich ohnmächtig geworden, sie hatte sich in keiner Weise verletzt. Trotzdem – konnte es sein, dass Schmerz der Auslöser für einen Weltensprung war? Es gab nur eine Möglichkeit, dies herauszufinden.
Morsches Holz knackte, als sie ungeschickt über einen umgefallenen Baumstamm stieg. Genau wie Lucien beim Kämpfen wusste ihr Körper, wie er sich lautlos im Urwald zu bewegen hatte, aber weil ihr Geist so unerfahren war, trampelte sie herum wie eine Herde Wildschweine.
So ein Mist.
Zum ersten Mal sah Ebony an sich hinab. Ihre Kleidung unterschied sich stark von der, die Lucien soeben noch getragen hatte. Sie war beinahe komplett in Schwarz gehüllt, die Jacke und die Stiefel aus Leder, ebenso wie der Gürtel, der einige Beutel und lange Messer an ihrer Hüfte hielt. Nur das Oberteil war olivgrün. Ebony rätselte nicht lange, warum die Kleidung so schlicht und dunkel war, denn die Messer und die Umgebung verrieten, dass sie zum Tarnen taugte. Sie vermutete, dass das Volk, zu dem sie gehörte, von der Jagd leben musste.
Aus dem Augenwinkel sah sie etwas Kupferfarbenes in der Sonne leuchten. Staunend holte Ebony den schlichten Zopf, aus dem sich eine Strähne gelöst hatte, hervor und betrachtete das rötliche Haar. Gern hätte sie auch ihr Gesicht gesehen. In der Welt der schwebenden Inseln hatte Lucien das Glück gehabt, sich in einem Spiegel betrachten zu können, Alan und ihr war das bisher noch nicht möglich gewesen.
Dann bemerkte Ebony etwas, das sie irritierte. Um ihr Handgelenk lag noch immer das Kettchen, das Jonas Thessa geschenkt hatte. Sie verengte die Augen.
Wie konnte das sein? Seit sie es angelegt hatte, hatte sie schon zweimal komplett ihre Kleidung, ja sogar ihren Körper und ihre Welt gewechselt. Wieso trug sie immer noch das Kettchen?
Verwirrt zählte Ebony nach. Alle fünf Anhänger hingen unverändert am Band.
Gerade, als sie angefangen hatte zu verstehen, wie dieses Wandeln zwischen den Welten funktionierte, passte ein kleines Detail plötzlich nicht mehr und brachte alles durcheinander. Da sah sie unter dem silbernen Ring des Kettchens die vertraute schwarze Farbe des Tattoos, mit der Ausnahme, dass das Motiv weder ein T noch ein L darstellte, sondern ein geschwungenes E.
Und endlich begriff Ebony.
Dieses Tattoo zeigte stets den Anfangsbuchstaben des Namens, den sie in der dazugehörigen Welt trug. Ihre Mundwinkel zuckten hoch. Warum hatte sie das nicht schon früher bemerkt?
Das Knurren ihres Magens lenkte Ebony ab. Wann hatte sie zuletzt gegessen? Es kam ihr vor, als hätte Thessa die Party vor Monaten verlassen, obwohl es sich nur um einige Stunden handeln konnte. Nach etwa einer halben Stunde Marschzeit spürte Ebony, wie der Hunger ein immer tieferes Loch in ihren Bauch fraß.
„Ich wünschte, ich würde hier so einfach etwas zu essen finden wie Lucien trinken gefunden hat“, seufzte sie.
Ein sanfter Windhauch streifte den Wald und zerzauste die Blätter an ihren Ästen. Missmutig stapfte Ebony weiter. Allmählich hatte sie genug von den Bäumen und Sträuchern, den Farnen und Tümpeln.
Plötzlich rutschte der Boden unter Ebonys Füßen ab, sie stolperte und stürzte mit einem Aufschrei einen Abhang hinunter. Zweimal überschlug sie sich, spürte, wie ein spitzer Ast ihre Wange aufriss und hörte erst auf zu fallen, als sie von Büschen abgefangen wurde.
Der kleine Erdrutsch, den sie im Sturz verursacht hatte, kam langsam zum Stillstand, während Ebony Sand aus ihrer Lunge hustete und stöhnend versuchte, sich aus dem dornigen Gestrüpp zu befreien. Immer wieder stach sie sich in die Hände und ihr Körper schmerzte so sehr, dass sie beinahe erwartete, sich gleich in einer neuen Welt wiederzufinden. Als sie endlich aufrecht stand, sah sie das dunkelrote Blut an ihren Händen.
Erschrocken sog Ebony Luft ein. Durch das blutige Geschmiere konnte sie kaum noch ihre Haut erkennen. Doch dann erkannte sie, dass die rote Farbe an ihren Händen nicht von Blut stammte, sondern von Beerensaft.
Sie war überrascht, wie viele riesige Brombeeren an dem Gestrüpp hingen. In kürzester Zeit hatte sie sich mit Beeren vollgestopft. Am liebsten wäre Ebony dort geblieben, wäre da nicht dieses beharrliche Pochen in ihrem Hinterkopf, dass sie zum Weiterlaufen ermahnte, um etwas – irgendetwas – zu finden. Genau wie Lucien verspürte sie nicht den dringenden Drang, in Thessas Welt zurückzukehren; etwas passieren sollte trotzdem.
Also ließ sie den Hang mit den Brombeeren schweren Herzens hinter sich und lief weiter der untergehenden Sonne entgegen. Sie wollte möglichst schnell ein sauberes Gewässer finden, um sich zu waschen, oder noch besser eine Möglichkeit, sich zu stoßen, um ihre Theorie zu überprüfen.
Das klang total verrückt. Sie wollte sich nicht absichtlich verletzen, um an einen anderen Ort zu gelangen. Selbst wenn momentan nichts so war, wie sie es kannte.
„Ich wünschte, ich hätte jemanden an meiner Seite, der versteht, wie beschissen diese Situation ist“, überlegte sie verärgert. „Ich weiß noch nicht einmal, wo ich bin. Das kann doch nicht nur ein gewöhnlicher Urwald ohne Anfang und Ende sein.“
„Ist es auch nicht.“
Ebony zuckte zusammen. Ihr Herz blieb für eine Sekunde stehen. Ein Junge, den sie zuvor nicht bemerkt hatte, trat hinter einem Baum hervor und ging lächelnd auf sie zu. Instinktiv wanderte ihre Hand zu dem Jagdmesser an ihrem Gürtel.
„Wer bist du? Wie kommst du hierher?“
Stirnrunzelnd betrachtete sie den Fremden. Er wirkte nicht gefährlich, sein Lächeln schien echt und seine leuchtend blauen Augen funkelten. Sein Gesicht war über und über mit Sommersprossen besprenkelt. Zögernd ließ sie ihre Hand sinken, doch ihre Anspannung wich nicht komplett.
„Ich bin Nicolas“, stellte er sich vor und schüttelte mit einem unwiderstehlichen Lächeln Ebonys Hand. „Schön, dich kennenzulernen.“
„Gleichfalls“, erwiderte sie überrumpelt. „Ich heiße Ebony.“
Die Situation wurde immer schräger.
Ebony konnte sich bei bestem Willen nicht vorstellen, wie der Zufall sie und Nicolas in diesem schier unendlichen Wald zusammengebracht hatte. Sie wusste nicht, warum er so freundlich war und warum sie beide so gepflegt aussahen, obwohl um sie herum nichts als Wildnis wucherte. Sie verstand nicht, wie die riesigen Brombeeren aus dem Nichts aufgetaucht waren und wieso der Wald sich selbst nach Stunden kaum veränderte.
Inzwischen fand Ebony die Umgebung abstruser als jemals zuvor, obwohl auf den ersten Blick alles harmlos wirkte. Zu ihrer Überraschung erlöste Nicolas sie von ihrem Unwissen.
„Du bist an einem Ort, an dem du dir dein Schicksal selbst zurechtwünschen kannst“, verkündete er und warf theatralisch die Arme in die Luft. „Willkommen auf der Ebene des Eigenwunsches.“
Es dauerte einen Moment, bis bei Ebony der Groschen fiel. Ihre Augen weiteten sich auf die Größe von Untertassen. Sie hatte sich etwas zu essen gewünscht und war prompt in einen Brombeerbusch gefallen. Sie hatte sich eine Person gewünscht, die ihre Situation verstand und sofort war ihr Wunsch mit Nicolas erfüllt worden.
„Meinst du damit, dass alles, was ich mir wünsche, in Erfüllung geht?“, fragte Ebony fassungslos.
„Nicht ganz, aber alles, was mit der Umgebung zu tun hat. Ja.“ Nicolas lächelte.
Wie zum Beweis rief er: „Ich wünsche mir, dass der Boden gepflastert ist und uns zu einem See führt.“
Erwartungsvoll sah Ebony sich um und war sehr enttäuscht, dass sich nichts veränderte. Nicolas lachte, ergriff sie am Ärmel und zog sie mit sich.
„Du musst schon ein Stück laufen.“
Nach kurzer Zeit betraten die beiden tatsächlich einen Pfad aus Steinen, der so überwuchert war, als würde es ihn schon seit Jahren geben.
„Siehst du?“, sagte Nicolas zufrieden, nachdem sie eine Viertelstunde gelaufen waren und der Wald sich lichtete, um den Blick auf einen kleinen See preiszugeben. Begeistert lief Ebony ans Ufer, um die Beerenreste von ihren Händen abzuwaschen.
„Genial!“, rief sie und versuchte es selbst. „Ich wünsche mir, dass am nahen Waldrand ein kleines Dörfchen ist.“
Nicolas zwinkerte ihr zu. „Ja, so erreicht man hier Städte und Dörfer. Wenn wir jemanden besuchen wollen, wünschen wir den Ort oder das Haus einfach zu uns. Deswegen ist es unmöglich, Landkarten anzufertigen, wenn sich die Landschaft sowieso ständig verändert.“
Ebony lachte. Die Vorstellung, dass ganze Städte von einem Ort verschwanden, war zu komisch.
„Ist das nicht paradox?“
Nicolas zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung“, gab er zu. „Wenn ich mich zu dir wünsche, ist es ja nicht so, dass du von einer Stelle zur anderen gezaubert wirst, ich bin einfach plötzlich wie durch Zufall in deiner Nähe.“
Ebonys Wissensdurst war immer noch nicht gestillt. „Wenn ich gerade zum Beispiel am Meer bin und du in den Bergen und ich mich zu dir wünsche, wie kann das dann funktionieren?“
Ihr Begleiter blinzelte nachdenklich. „Die Dünen werden wohl nahtlos in die Berge übergehen. Sag mal...“
Jetzt, endlich, begriffen beide, was für einen gewaltigen Fehler sie begangen hatten. Der Blick, den sie einander zuwarfen, war gefüllt von plötzlichem Misstrauen. Ebony hatte mit ihren vielen Fragen zur Welt offenbart, dass sie diese nicht kannte und Nicolas damit, dass er sie kommentarlos beantwortete, gezeigt, dass er von den anderen Welten wusste.
Obwohl beide den anderen durchschaut hatten, sprachen sie es nicht aus. Vorsichtig wich Ebony zurück, schritt für Schritt. Ihre rechte Hand lag an dem Jagdmesser und zog es langsam aus dem Gurt. Sie hatte keine Ahnung, was es bedeutete, dass ein anderer von dem Wandeln zwischen Welten wusste. War er ein Freund oder ein Feind? Nicolas wirkte nicht gefährlich, aber sie wollte nichts riskieren.
„Ich schau mal, ob mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist“, sagte Ebony ruhig. Als sie sich weit genug von Nicolas entfernt hatte, wirbelte sie herum und rannte zurück in den Urwald. Den erstbesten Baum, den sie sah, kletterte sie hinauf bis zur Spitze.
Hinter einigen Baumwipfeln sah sie das kleine Dörfchen, das sie sich gewünscht hatte. Trotz der bedrohlichen Situation lächelte Ebony. Diese Welt war ihre liebste, abgesehen davon, dass ihre Seele in Thessas Welt aufgewachsen war. Die Möglichkeit, Herr einer ganzen Welt zu sein, war faszinierend.
„Ebony!“, rief Nicolas scharf von unten.
Ebony sah zwischen den Lianen hindurch zum Boden. Er stand am Stamm des Baumes und erwiderte ihren Blick drohend.
„Komm runter oder ich wünsche dich her!“
„Das kannst du nicht“, platzte sie heraus, so viel hatte sie inzwischen verstanden. Sie konnte nicht in der Luft verpuffen und woanders wieder erscheinen.
Nicolas schwieg kurz und antwortete dann: „Ich kann den Baum zum Fallen bringen. Komm einfach runter, ich will dir nichts tun. Wirklich.“
Jetzt schwieg Ebony. Den Baum umkippen zu lassen wäre bestimmt möglich. Doch seine Idee brachte sie auf eine ganz andere. Sie hoffte nur, dass sie dabei nicht sterben würde.
Ebony tat so, als würde sie nachgeben und rief: „Okay, ich komme.“
Tatsächlich kletterte sie einige Meter abwärts, aber nur so weit, bis es sie nicht umbrachte, wenn sie sprang. Tief holte sie Luft und rutschte vom Ast ins Leere. Bevor sie auf dem Boden aufprallte, hörte sie, wie Nicolas ihren Namen rief und spürte, wie ein oder zwei Knochen brachen. Die Schmerzen nahm sie kaum wahr, weil sie beinahe sofort in eine andere Welt abtauchte.
Wie viel Zeit war vergangen, seit ihre Seele Thessas Welt verlassen hatte?
Minuten?
Stunden?
Tage?
Als sie von der Metallstadt zurückgekehrt war, war es noch in derselben Nacht gewesen, an mehr konnte sie sich nicht erinnern. Aber vielleicht verlief die Zeit in den zwei neuen Welten ganz anders? Außerdem war sie diesmal viel länger weg gewesen als bei ihrem ersten Weltensprung.
In den anderen Welten hatte sie die Tatsache, dass sie ihre Identität wechseln konnte wie ein Paar Schuhe nicht als erschreckend empfunden, doch als Thessa fiel es ihr schwer, die aufkommenden Tränen der Verzweiflung zu unterdrücken. Sie wollte kein anderer Mensch mehr sein. Sie war immer glücklich damit gewesen, nur Thessa zu sein. Würde das den Rest ihres Lebens so weitergehen?
Ruhelos lief Thessa auf dem kühlen Steinboden des Kellers hin und her. Sie traute sich nicht, hinaufzugehen und zu sehen, dass sie im schlimmsten Fall mehrere Jahre des Lebens da draußen verpasst hatte.
„Thessa? Geht es dir gut?“
Jonas' besorgte Stimme verscheuchte mit einem Mal die beängstigenden Gedanken.
Erleichtert blieb Thessa stehen und antwortete: „Ja, alles gut. Ich hab mich nur gestoßen. Kannst du vielleicht doch beim Tragen helfen?“
„Klar.“ Jonas' Schritte auf der Treppe hallten im Keller wider, als er hinab stieg. „Wo bist du denn?“ Seine Stimme klang jetzt näher. Thessa streckte die Hände aus und bewegte sie langsam vor sich.
„Hier. Sorry, das Kellerlicht ist kaputt.“
Etwas Weiches streifte Thessas Hand und sie griff sofort danach, um Jonas zu sich zu führen.
„Hast du denn keine Angst, dass ich dich hier unten gefangen halten könnte?“, brummte er mit einer tiefen, rauen Stimme.
„Nein, habe ich nicht. Ich kenne mich hier viel besser aus als du“, antwortete sie grinsend, während sie ihre Hände von seinen Armen löste. „Hier sind die Kasten.“
„Du hast es ja eilig“, sagte Jonas bedauernd.
Obwohl sie nach dem berauschendem Kuss im Garten nichts dagegen hätte, noch länger mit ihm allein zu sein, war sie zu aufgewühlt von den jüngsten Ereignissen. Also zuckte Thessa nur mit den Schultern, was Jonas in der Dunkelheit natürlich nicht sehen konnte, und reichte ihm einen Kasten.
„Endlich“, wurden sie freudig im Zelt begrüßt.
Jonas verdrehte die Augen, Thessa grinste und sie stellten die Kasten ab. Sofort wurden sie bestürmt. Jonas nahm sich zwei Flaschen und öffnete sie.
„Endlich“, rief auch Anh von ihrer gemütlichen Ecke und lachte. „Ihr habt was verpasst.“
Thessa schob die Erinnerungen an die letzten paar Stunden von sich und setzte sich zu ihren Freunden aus dem Tanzverein. Jonas reichte ihr eine der beiden Bierflaschen. Sie trank einen Schluck und verzog wegen des bitteren Geschmacks das Gesicht, doch es war gerade genau das Richtige.
„Ach ja? Was denn?“
Paolo antwortete für Anh, mit einem amüsierten Funkeln in den Augen: „Die zwei durften uns demonstrieren, wie fünf Minuten allein bei ihnen aussehen.“ Er wies auf seine Schwester und Mischa.
Thessa kicherte und sah, wie Jonas sich ein Schmunzeln verkniff. Die Vorstellung, dass Mischa hier mit seiner Freundin rumknutschen musste, war schon komisch, denn er vermied es, so etwas vor den Augen anderer zu tun.
„Okay, du bist dran, Paolo“, sagte Lea ungeduldig. Sie schien mittlerweile deutlich die Wirkung des Alkohols zu spüren.
Paolo überlegte kurz, legte dann seine Hand auf die Flasche und drehte. Während sie ihre Pirouetten vollführte, verkündete er: „Die Person, auf die die Flasche zeigt, muss ihr Bier exen.“
Thessa hoffte, dass sie nicht getroffen wurde, weil ihr Bier noch fast voll war. Ohne Erfolg.
„Na los, Thessa“, lallte Lea schadenfroh.
Thessa setzte den Hals zögernd an die Lippen, atmete den bitteren Geruch ein und begann zu trinken. Gerade, als sie zwei Schlücke genommen hatte, wandte sich Elenors Blick von ihr ab.
„Wer ist denn das?“, fragte sie staunend. Die Augen der anderen folgten ihrem Blick.
Auch Thessa wollte zu der Person herüberschauen, setzte das Bier jedoch nicht schnell genug ab und schüttete sich ein paar Tropfen über ihr Kleid.
Na toll.
Sie sah sofort, wen Elenor meinte.
Ein ihr unbekannter, großer Typ hatte das Zelt betreten und sah sich ein wenig planlos um. Er war nur wenige Schritte von der Sitzecke entfernt, in der Thessa und ihre Freunde saßen. Es dauerte nicht lange, bis er die Blicke bemerkte, die auf ihm ruhten.
„Ich wusste gar nicht, dass du so einen scharfen Freund hast“, wisperte Elenor aufgeregt.
Ich auch nicht.
Er drehte sich zu ihnen und es kam Thessa vor, als blicke er ihr direkt in die Augen. Die Temperatur im Zelt senkte sich um mindestens zehn Grad. Seine kalten, grauen Augen schienen sie ebenso zu mustern wie ihre ihn. Er spannte seinen Kiefer an und straffte die breiten Schultern. Eine Narbe zog sich von seiner linken Augenbraue über die Nase bis zum rechten Nasenflügel, aber sie ließ ihn nicht abstoßend, sondern gefährlich wirken. Und auf eine verdrehte Weise attraktiv.
Aber schon nach wenigen Sekunden ließ er die bedrohliche Haltung fallen, die Thessa zu erkennen geglaubt hatte, setzte ein lässiges Lächeln auf und schlenderte zu ihrer Gruppe.
„Du musst Thessa sein“, sagte er mit einem britischen Akzent, während er ihr die Hand reichte. „Alles Gute.“
„Danke.“ Thessa war überrumpelt von der plötzlichen Freundlichkeit des gefährlich wirkenden Mannes. Sie starrte auf die Hand, die er ihr entgegenstreckte. Schwielen zierten die langen, schlanken Finger, als würde er jeden Tag hart mit ihnen arbeiten.
„Wer, äh, wer bist du? Also, mit wem bist du gekommen?“, fragte sie, statt die Hand zu nehmen.
Der Typ machte eine wegwerfende Bewegung und ließ damit seine Hand sinken.
„Ich heiße Orion. Tim hat mich mitgenommen.“
„Ich kenne keinen Tim.“
„Musst du wohl. Sonst wäre ich ja nicht hier.“
Orion blieb entspannt und zuckte nur lässig mit den Schultern. Er wirkte nicht so, als würde er sich beim Lügen ertappt fühlen. Trotzdem blieb Thessa misstrauisch.
Er lügt. Auch bei denen, die sich mir vorgestellt haben, war kein Tim dabei.
Gerade öffnete Thessa den Mund, um etwas zu sagen, aber Elenor kam ihr zuvor.
„Schön, dass du da bist, Orion“, flötete sie und spielte mit einer ihrer roten Haarsträhnen. „Komm doch zu uns und spiel mit.“
Falls er erfreut über die Ablenkung war, zeigte er es nicht. Stattdessen nickte er bloß, deutete auf die Flasche und fragte: „Flaschendrehen?“
„Gut kombiniert, Sherlock“, brummte Jonas missmutig. Er hatte die Lüge vermutlich ebenfalls durchschaut.
„Okay, Thessa, du bist dran“, sagte Anh, die sich trotz Orions Auftauchen unbeirrt an Mischa lehnte.
Thessa drehte die Flasche und sagte: „Die Person muss mit einer anderen das Oberteil tauschen.“
Es traf die betrunkene Lea. Sie zog sich ihr Shirt wortlos über den Kopf und reichte es an Orion, der zwischen ihr und Paolo Platz genommen hatte. Während der Neuankömmling es ihr gleich tat, ruhte sein fester Blick auf Thessa, unnachgiebig, undurchdringlich. Diesmal war sie sicher, dass es keine Einbildung war.
Selbst die anderen schienen den Blickwechsel zu bemerken, der die Luft erhitzte und zum Knistern brachte. Thessa musste in seine Augen sehen. Sie wusste nicht warum, aber aus irgendeinem Grund war es schier unmöglich, den Blick zu lösen.
Orion durchdrang das Schutzschild, das Thessa sich seit ihrer zweiten Rückkehr zurechtgelegt hatte. Er eroberte ihre innersten Gedanken und Geheimnisse, las alles, fraß es auf, bis es sein war. In diesem Moment war Thessa sich sicher, dass er sie durchschaut hatte, dass er von dem größten Geheimnis wusste, das sie jemals bewahrt hatte. Dieses Wissen regte Wut in ihrem Bauch an, er streckte sich, breitete sich aus. Ohne einen Grund nennen zu können, verspürte Thessa plötzlich glühenden Hass. Hinter ihren Augen loderte das Feuer der Verachtung dafür, dass Orion sie gelesen hatte wie ein offenes Buch und drängte ihn langsam, aber sicher aus ihrem Kopf zurück. Sie fühlte sich fiebrig und ihr war schlecht vor Verwirrung und Ärger. Wie konnte das geschehen? Wie hat er...?





























