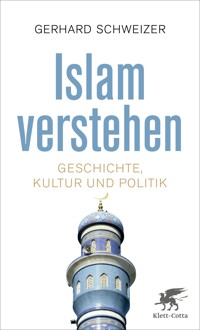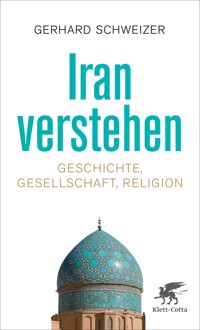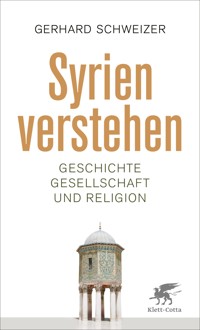
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
»Wer Schweizer gelesen hat, sieht Syrien anders – wirklicher: ein Land, das wenig mit den abendländischen Klischees zu tun hat.« Frankfurter Allgemeine Zeitung Wer Syrien verstehen will, muss jenes Syrien kennenlernen, als es noch nicht zerstört war: seine Geschichte, seine Politik, seine Religion. Dann wird deutlich, wie sehr der gesamte Nahe Osten von der Lage in Syrien abhängt. Die syrische Katastrophe droht zum Unheil für den nervösesten Unruheherd unserer Welt zu werden. Die Weltregion um Syrien befindet sich, wie der Krieg der Hamas gegen Israel zeigt, an einem Abgrund und in einem fast unlösbaren Konflikt, der die ganze Welt in Atem hält. Umso wichtiger ist es, sich ein umfassendes Bild von Syrien, das seit der Antike bis heute eine Schlüsselrolle im Vorderen Orient spielt, anzueignen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gerhard Schweizer
Syrien verstehen
Geschichte, Gesellschaft und Religion
Klett-Cotta
Impressum
»Syrien verstehen« ist die überarbeitete, korrigierte und ergänzte Neuausgabe des Titels von Gerhard Schweizer: »Syrien. Religion und Politik im Nahen Osten«, Stuttgart, Klett-Cotta 1998. Die vorliegende Ausgabe wurde 2024 aktualisiert und erweitert.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2015, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
Karten: Rudolf Hungreder, Leinfelden
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98795-9
E-Book ISBN 978-3-608-12326-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Vorwort: Das Pulverfass im Nahen Osten
Erste Eindrücke: Syrien ein Pulverfass?
Tradition und Umbruch
Jenseits der Feindbilder
»Reden wir nicht über Politik!«
Standpunkt eines orthodoxen Muslim
Das Besondere an Syrien
Minarett und Kreuz: bemerkenswerte Verbindungen
Syrien ... Großsyrien ... Wo liegen die Grenzen?
Dreitausend Jahre Begegnung der Kulturen
Toleranz im Namen Allahs
Arabische Christen mit einer langen Vergangenheit
Mohammed und der christliche Glaube
Das Neue an der islamischen Toleranz
Wo die Offenheit ihre Grenzen findet
Ein Kirchenvater dient dem Kalifen
Was der christliche Mönch Bahira und Mohammed gemeinsam haben
Eine verborgene Achse: Jerusalem – Damaskus
Die Propaganda in der Symbolik des Felsendoms
»Christliches« in der Omayaden-Moschee
Sunniten und Schiiten
Schiitische Pilger in Damaskus
Der weit zurückreichende Konflikt
Die »wahren Imame« und der Märtyrerkult
Siebener-Schiiten und Zwölfer-Schiiten
Die »Ketzerei« der Alawiten
»Die Drusen sind keine Muslime!«
Der Islam und die Frauen
Die große Vielfalt im syrischen Erscheinungsbild
Frauenrechte in Koran, Hadith und Scharia
Reformen und das Bleigewicht der Tradition
Islam und modernes Denken
Der Vorsprung des Westens
Bimaristan Nuri: Wo einst die modernsten Ärzte arbeiteten
Der Vorsprung der Muslime
Glanz und Elend großer Denker
»Ketzer« und der Sieg der Orthodoxie
Ghasali, die »Autorität des Islam«
Ibn al-Arabi, der umstrittene Sufi
Gespräch mit einem Unzufriedenen
Wachsende Front gegen »unislamische« Wissenschaft
Ibn Taimiya, der »erste Fundamentalist«
Von der Moderne ins Mittelalter
Das Trauma der Kreuzzüge
Saladin: ein Mythos und die Folgen
Nuraddin: immer noch ein Idol
Der »Heilige Krieg« wird neu erfunden
Die besondere Rolle der Maroniten
Der »neue Kreuzzug« im Namen der Moderne
Imperialismus und Nationalismus
Das Massaker an Christen in Damaskus
Die Kolonialmächte ziehen neue Grenzen im Nahen Osten
Die Wurzeln des antiwestlichen Nationalismus
»Großsyrien«, der Libanon und Palästina
Toleranzkrisen im 20. Jahrhundert
Gespräche mit Christen über Muslime
Unterschiedliche Auffassungen von Toleranz
Auf der Suche nach dem Judenviertel
Baath und Islam
Michel Aflak: Ein Christ gründet die Baath-Partei
Großarabische Träume und die Wirklichkeit
Zusammenstöße mit der Orthodoxie
Hafis al-Assad und die Baath-Partei
Die Ideologie der Muslim-Brüder
Die Achse Ägypten – Syrien
Reaktion auf die Moderne
Fundamentalismus und Islamismus
Das Feindbild »Säkularismus«
»Islamische Moderne« gegen »westliche Moderne«
Ein kurzer »Heiliger Krieg« in Syrien
Der späte Erfolg der Islamisten
Das Massaker von Hama
Ali Farzat, der politisch brisante Satiriker
Brüchiger Friede
Ist Syrien ein Sonderfall?
Auch Feindbilder wandeln sich
Baath und das Mullah-Regime im Iran
Zwei alte Feinde versöhnen sich
»Gottlose« Regierungen
Ein Muslim zwischen allen Fronten
Sadik al-Azm, der »Ketzer von Damaskus«
Hat der politische Islam Zukunft?
Ein Umbruch mit unabsehbaren Folgen
Baschar al-Assad, der scheinbare Hoffnungsträger
Der Weg in den Bürgerkrieg
Zwei prominente Kritiker im Exil
Kampf entlang der religiös-politischen Grenzlinien
»Heiliger Krieg« gegen die »säkulare Republik Syrien«
Aufstieg der Terror-Organisation »Islamischer Staat«
Triumph und Niedergang des IS-Kalifats
Für oder gegen Assad – die komplizierten Bündnisfronten
Ein Flüchtlingsstrom verändert Europa
Krise der Flüchtlinge – und der Europäer
Das vielfach gespaltene Syrien
Der Pyrrhussieg des Diktators Baschar al-Assad
Die ungelösten Probleme im Jahr 2023
Eine Krise weit über Syrien hinaus
Anhang
Anmerkungen
Erste Eindrücke: Syrien ein Pulverfass?
Das Besondere an Syrien
Toleranz im Namen Allahs
Eine verborgene Achse: Jerusalem – Damaskus
Sunniten und Schiiten
Der Islam und die Frauen
Islam und modernes Denken
»Ketzer« und der Sieg der Orthodoxie
Das Trauma der Kreuzzüge
Imperialismus und Nationalismus
Toleranzkrisen im 20. Jahrhundert
Baath und Islam
Die Ideologie der Muslim-Brüder
Ein kurzer »Heiliger Krieg« in Syrien
Auch Feindbilder wandeln sich
Ein Umbruch mit unabsehbaren Folgen
Zeittafel
Literaturhinweise
Register
Für meine Frau Brigitte und meinen Freund Walter M. Weiss
Vorwort: Das Pulverfass im Nahen Osten
Diese Bilder gingen um die Welt: Tausende Menschen, Männer, Frauen, Kinder, bewegen sich in kilometerlangen Schlangen entlang von Autobahnen, über Feldwege in hitzeflimmernder Ebene, lagern zu Hunderten auf überfüllten Bahnsteigen, drängen in ohnehin schon überfüllte Züge ... Es sind Bilder, die uns im September 2015 in einer Intensität wie nie zuvor erreichen. Es sind Szenen, die sich unmittelbar an der Grenze zu Österreich abspielen. An manchen Tagen überqueren bis zu 20 000 Menschen die Grenze, pro Woche sind es zuweilen zwischen 100 000 und 150 000. Keine Polizei, kein Zaun kann sie aufhalten auf ihrem Weg in die EU, vor allem nach Deutschland. Es sind Flüchtlinge aus von Bürgerkriegen erschütterten Ländern der islamischen Welt wie auch Schwarzafrikas. Aber der Großteil von ihnen kommt im Herbst 2015 aus Syrien.
Wieder rückt Syrien machtvoll in die Schlagzeilen der Weltpresse – und diesmal auf sehr bedrängende Weise: Syrien ist nicht mehr nur distanziert aus der Ferne zu betrachten, Syrien kommt im wahrsten Sinn des Wortes zu uns, mit vielen Tausenden, gar Hunderttausenden Menschen innerhalb weniger Wochen. Ganz neu stellt sich so die Frage: Was für ein Staat ist Syrien?
Diese Bilder gingen ebenfalls um die Welt: Die traditionsreiche Handelsmetropole Aleppo im Norden Syriens ist eine durch Bomben und Straßenkämpfe zerstörte Stadt. Gerade der weit ausgedehnte Basar, einer der schönsten des islamischen Orients, ein »Weltkulturerbe«, besteht nur noch aus geschwärzten Ruinen. Und eine Reihe anderer syrischer Städte bietet genauso einen Anblick, der an die Trümmerlandschaften Deutschlands unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert; kilometerweit nur noch durch die Luftwaffe des Assad-Regimes(1) zerbombte Häuser.
Und schließlich gingen auch diese Bilder um die Welt: Rauchsäulen über der antiken Tempelstadt Palmyra, einem viel besuchten Touristenziel und »Weltkulturerbe« wie die historisch gewachsene Altstadt von Aleppo. Radikale »Gotteskrieger« des sogenannten »Islamischen Staates« sprengten vorislamische Heiligtümer als verabscheuungswürdige Zeugnisse eines »heidnischen Götzendienstes«.
Wie hat es in Syrien zu einem derartigen Bürgerkrieg kommen können, der nicht nur den Nationalstaat selbst, sondern sogar Nachbarländer in den Strudel dieses Konflikts reißt?
Ich hatte Syrien Mitte der 1990er-Jahre zwei Mal bereist. Fasziniert von der kulturellen Vielfalt dieses Landes und der Aufgeschlossenheit seiner Bewohner, aber irritiert durch die damals schon prekäre politische Krisensituation, verfasste ich 1998 Syrien. Religion und Politik im Nahen Osten – das Buch, dessen Überarbeitung Syrien verstehen. Geschichte, Gesellschaft und Religion ist. Dem einleitenden Kapitel gab ich die Überschrift Erste Eindrücke: Syrien ein Pulverfass? Diese Überschrift mutet aus heutiger Sicht prophetisch an. Allerdings glaubte ich damals, dass die untergründigen Spannungen im Verlauf der folgenden Jahre gemeistert würden – in dieser Meinung einig mit vielen anderen westlichen Beobachtern. Ich versah daher die Überschrift mit einem Fragezeichen.
Die Unruhen des sogenannten »Arabischen Frühlings« seit dem Januar 2011 veränderten abrupt und nachhaltig die Situation. Das Fragezeichen in meiner Überschrift hat sich erübrigt, das Pulverfass ist explodiert – und dies ausgerechnet in einem Staat, der lange Zeit als wesentlich stabiler galt als etwa der Libanon, der Irak, das Westjordanland.
Syrien verdient, abgesehen von der aktuellen katastrophalen Situation, ohnehin weltweite Aufmerksamkeit. Denn Syrien ist nicht nur eine Schlüsselmacht im Nahen Osten, wo tiefgehende Veränderungen stets Folgen für die ganze Region zeitigen. Syrien ist wesentlich mehr. Zwar ist der Nationalstaat mit seinen heutigen politischen Grenzen erst im 20. Jahrhundert entstanden, aber Syrien als Kulturraum ist über 3000 Jahre alt: eine Drehscheibe östlicher und westlicher Kulturen mit überragenden Zeugnissen aus antiker, frühchristlicher und islamischer Zeit. Einst war der syrische Raum eine geistige Hochburg des frühen Christentums, dann ein Kernland des Islam, für beide Weltreligionen ein Zentrum entscheidender geistiger Weichenstellungen. Syrien war der hauptsächliche Schauplatz der Kreuzzüge, deren verhängnisvolle Nachwirkungen in den Emotionen von Muslimen wie Christen bis heute zu spüren sind und immer wieder politisch instrumentalisiert werden. Syrien war einer der maßgebenden Brennpunkte, in denen sich die Religionsspaltung in Sunniten und Schiiten entwickelte. Und Syrien ist bis heute eine Region mit einer besonders großen religiösen Vielfalt – zum einen mit der Herausforderung, Toleranz zu leben (was über viele Jahrhunderte gelungen ist), zum anderen mit der Gefahr eskalierender Konflikte (was gerade die Gegenwart signalisiert).
Syrien ist darüber hinaus der Ursprungsort des arabischen Nationalismus und damit eines der ersten islamischen Länder, in denen der Konflikt zwischen säkularen Nationalisten und muslimischen Fundamentalisten eine explosive Dynamik entfaltete. Diese Auseinandersetzung kulminierte schließlich unter der Herrschaft des Assad-Regimes(2) mit den inzwischen unabsehbaren Folgen; unter Hafis al-Assad(3), der von 1970 bis 2000 regierte, und seither seinem Sohn Baschar(1) al-Assad.
Im vorliegenden Buch ziehe ich eine Verbindungslinie von weit zurückliegenden Umbrüchen bis hin zu den tiefgehenden Verwerfungen in unserer Gegenwart, um zu zeigen, dass die Krise von heute Wurzeln in früheren Jahrzehnten, ja früheren Jahrhunderten hat. Und mehr noch: dass der Kulturraum Syrien schon in der Vergangenheit schwerwiegende Umbrüche meistern musste – Umbrüche, die einerseits Zerstörung zur Folge hatten und andererseits Aufbrüche zu neuen, zukunftsweisenden Lebensformen bedeuteten.
Aufmerksame Leser haben mich auf ›Unstimmigkeiten‹ hingewiesen. Daher möchte ich betonen, dass das vorliegende Buch 1998 niedergeschrieben und 2015, 2018 sowie 2023 erneut überarbeitet und ergänzt wurde, um die sich überstürzenden Ereignisse aufzugreifen. Die Einleitung »Erste Eindrücke: Syrien ein Pulverfass?« und das Schlusskapitel »Ein Umbruch mit unabsehbaren Folgen« habe ich für die Ausgabe von 2015 vollständig neu geschrieben, das Schlusskapitel 2018 sowie für diese Ausgabe von 2023 nochmals erweitert. Einleitung und Schluss rahmen die anderen Kapitel gleichsam ein und aktualisieren das ganze Buch.
Alle Kapitel versuchen eine Kulturgeschichte Syriens zu entfalten, ohne die politische Geschichte des Landes aus dem Blick zu verlieren. Durch die Zerstörungen seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im März 2011, durch die zahllosen Toten und das Heer der Flüchtlinge ist Syrien nicht mehr das Land, das die Syrer oder ich noch bis vor wenigen Jahren erlebt haben. Unstimmigkeiten in meinem Buch ließen sich daher nicht gänzlich vermeiden: Syrien macht Geschichte, und Syrien erleidet Geschichte. Vermutlich werden sich die Ereignisse noch mehrfach überschlagen. Diesem Umstand versuche ich im Schlusskapitel gerecht zu werden und zu berücksichtigen. Aber wir werden alle in naher Zukunft viele Daten und Umstände, die Syrien betreffen, anders deuten müssen. Dies werde ich nach und nach tun. Selbstverständlich werden Ungenauigkeiten, Unstimmigkeiten oder Fehler so rasch wie möglich korrigiert.
Gerhard Schweizer im September 2023
Erste Eindrücke: Syrien ein Pulverfass?
Tradition und Umbruch
Es war ein bemerkenswertes Hotel. Alle Zimmer mündeten mit ihren Türen in einen Vorraum, in dem eine Vielzahl Teppiche ausgelegt war – Gebetsteppiche. An die weißgetünchte Stirnwand hatte eine etwas ungelenke Hand die Kaaba sowie die Hauptmoschee von Mekka gepinselt, dazu einige arabische Schriftzeichen. Zusätzlich war dort auf Englisch zu lesen: »Mecca on this direction«. Der internationale Hinweis auf die Gebetsrichtung galt für nichtarabische Muslime, besonders für Türken, Geschäftsreisende, von denen etliche nahe meinem Zimmer wohnten. Manche der Betenden waren jung und westlich gekleidet, ältere Syrer dagegen trugen meist den Keffiye, das rotweiß gewürfelte Kopftuch mit schwarzem Kamelhaarring, einige noch den weiten Umhang.
Ein bemerkenswertes Hotel auch in den Kontrasten. Seitlich über den Betenden hingen zwei große Kunstdrucke in lackierten Holzrahmen, wie man sie bei uns in Kaufhäusern erstehen kann. Die Bilder zeigten schneebedeckte Berge, Blumenwiesen, weidende Kühe, dazu sehr österreichisch wirkende Almhütten. Ohne Zweifel können solche Bilder im sommerlich heißen Syrien exotische Sehnsüchte wecken. Es waren Kunstdrucke, wie ich sie mit nahezu gleichen Motiven später auch immer wieder in Teestuben entdecken sollte. Im Nebenraum dröhnte zeitweise ein Fernsehapparat. Als ich mich das erste Mal dort in einem der plastiküberzogenen Sessel niederließ, flimmerte über die Mattscheibe ein Fußballspiel: Tunesien gegen Zaire.
Eine Woche wohnte ich in diesem Hotel, einem traditionellen Funduk, der von außen so unscheinbar wirkte wie die anderen verwinkelten Häuser entlang der Marktstraße. Direkt unter meinem Balkon wälzte sich ein bunter Menschenstrom, der erst während der späten Abendstunden verebbte, rumpelten gemüsebeladene handgezogene Karren, bahnten sich schrill hupende Autos einen mühsamen Weg. Den Ausblick hatte ich auf Kuppelbauten, ein ornamentverziertes Minarett, in der Ferne Betonwohnblocks, massig die historisch gewachsene Altstadt überragend. Ich befand mich in der nordsyrischen Handelsmetropole Aleppo. Hier, nahe der türkischen Grenze, trifft der aus Europa kommende Reisende erstmals auf eine Großstadt mit auffälligem syrisch-arabischem Flair. Aber bereits hier sollte ich anschaulich erleben, wie schroff in Syrien die politischen und religiösen Gegensätze aufeinanderprallen.
Ich saß mit anderen Gästen des Funduk bei den Abendnachrichten. Unruhen der Palästinenser im israelisch besetzten Westjordanland ... Besuch des amerikanischen Außenministers in Damaskus bei Syriens Staatspräsident Hafis al-Assad(4) ... Kongress der regierenden Baath-Partei ... Dieses dritte Thema beherrschte den Bildschirm. In nervtötender Ausführlichkeit glitt die Kamera über die Versammelten im Saal hinweg, die sich Reihe für Reihe von ihren Plätzen erhoben, rhythmisch in die Hände klatschten und in Jubelrufe ausbrachen. Sie hatten sich einem Podium führender Parteimitglieder zugewandt, über dem erdrückend groß das Monumentalporträt des Staatspräsidenten Assad(5) auf die Versammelten herabsah: ein schmales, kantiges Gesicht mit harten, strengen Augen. Die Kamera verweilte geduldig auf Beifall klatschenden Kongressteilnehmern, deren hochgehaltene Transparente Porträts eines gönnerhaft lächelnden Staatspräsidenten zeigten, mit flammend roten Herzen umrahmt.
Der Inszenierungsstil erschien wie aus einer anderen Zivilisation importiert. Europäer fühlen sich an ähnliche Propaganda in den ehemaligen Ostblockstaaten erinnert, so die Choreographie der Beifallskundgebungen, der Personenkult, die Details der Kameraführung. Ein Zufall? Im Gegenteil, Syriens Baath-Sozialisten haben sich ganz bewusst an Vorbildern des Ostblockfernsehens orientiert.
Ich beobachtete die Zuschauer. Sie begannen, kaum nachdem die ersten Szenen des Baath-Parteitags den Bildschirm füllten, miteinander zu plaudern. Ihre Gebärdensprache verriet deutlich das mangelnde Interesse. Einer rief fingerschnipsend den Kellner und bestellte nach ausführlichem Palaver schließlich Tee, andere drehten dem Fernsehapparat den Rücken zu. Bei zwei älteren Männern, traditionell mit Keffiye und weitem Umhang bekleidet, konnte ich deutlich Gesten der Verdrossenheit erkennen, sie erhoben sich aus den Plastiksesseln und schlurften zu ihren Zimmern.
Hizb al-Baath al-Arabi al-Ishtiraki, »Sozialistische Partei der arabischen Wiedergeburt« ... Wie fremd muss jedem orthodoxen Muslim der Inszenierungsstil, der Parteiname erscheinen?
Die Frage wird vollends brisant, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Baath-Partei zwar von einem Syrer, nicht aber von einem Muslim begründet wurde. Der 1910 in Damaskus geborene Michel Aflak(1) war Christ, er entstammte einer Minderheit, die um die zwölf Prozent der syrischen Bevölkerung ausmacht und eine beachtliche Wirtschaftsmacht bildet. Aber mehr noch: Aflak(2) war linksorientierter Nationalist, der in Paris studierte und sich dort ausgiebig mit nationalistischen und sozialistischen Ideologien des Westens auseinandergesetzt hatte. So nimmt es nicht wunder, dass in seiner Ideologie auch kommunistische Elemente zu finden sind. Bereits im Ansatz widersprach er dem Selbstverständnis orthodoxer Sunniten wie Schiiten. Baath, »Wiedergeburt«, bezieht sich auf die »Araber«, nicht auf die Muslime. Aflak(3) sah in der »Nation« das entscheidende Bindeglied, das Muslime und Christen gleichberechtigt verbindet, nicht im Islam. Ein dem traditionellen Denken ebenso fremd erscheinender Begriff ist »Ishtirakiya«, »Gemeinsamkeit des Besitzes«, im übertragenen Sinn »Sozialismus«; das Wort hat sich erst während des 19. Jahrhunderts – in der Auseinandersetzung mit westlichen Ideen – bei Türken und Arabern herausgebildet.[1]
1943 war die Partei entstanden, 1963 hatten sich die Baath-Sozialisten in Syrien an die Macht geputscht und sich im Verlauf parteiinterner Flügelkämpfe noch radikalisiert. 1970 schließlich war Hafis al-Assad(6) durch einen Putsch gegen die eigene Parteiführung Staatspräsident geworden. Damit hatte sich die politische Situation in Syrien noch einmal zugespitzt, denn Assad(7) gehört zur schiitisch-arabischen Sekte der Alawiten. (Sie ist religiös eng verwandt mit den schiitisch-türkischen Aleviten.) Diese Glaubensgemeinschaft wird von orthodoxen Sunniten wie Schiiten als »ketzerisch« angesehen, ja von nicht wenigen Muslimen als »halbislamisch« oder gar als »ungläubig« abgelehnt. Ungefähr elf Prozent der Syrer sind Alawiten, rund zwei bis drei Prozent Schiiten orthodoxer Richtungen, rund drei Prozent Drusen, aber rund 70 Prozent Sunniten. Welch eine politische Konstellation: Ein Christ begründet die Partei, eine kleine schiitische Minderheit regiert seit zweieinhalb Jahrzehnten!
Wie hat es zu einem derartigen Umbruch kommen können in einem Land, in dem ein Großteil der Muslime noch traditionalistisch lebt und denkt?
Die Frage gewinnt eine weitere Dimension, wenn wir uns klarmachen, dass die Baath-Partei auch im benachbarten Irak Fuß fassen konnte. Dort putschten sich die Baathisten 1968 an die Macht und können seither ihre Position ebenfalls gegen alle Widerstände orthodoxer Muslime halten. Mehr noch: Die Ideologie des syrischen Christen Aflak(4) hat als Vorbild auch für andere moderne Nationalbewegungen der arabischen Welt gedient.
In Syrien sind die Spannungen explosiver geworden, seit die Baath-Partei unter dem Alawiten-Führer Assad(8) regiert. Gerade auch in Aleppo. In dieser Stadt, einer Hochburg sunnitischer Orthodoxie, hatten sich während der siebziger Jahre eine Reihe von Demonstrationen gegen die Herrschaft der »ungläubigen« Alawiten und Baath-Sozialisten formiert, bis hin zum offenen Aufruhr. 1979 schossen radikal-islamische Gegner in einer Artillerieschule von Aleppo über zweihundert Kadetten, vorwiegend Alawiten, nieder. Die Regierung antwortete ebenso brutal, ließ Tausende mutmaßliche Feinde des Regimes einsperren und foltern, etliche Hundert sofort hinrichten. 1980 erschoss die Polizei bei einer Protestkundgebung in Aleppo über dreihundert Demonstranten auf offener Straße. Zu Beginn der achtziger Jahre war ganz Syrien von Unruhen erfüllt, die in einen Bürgerkrieg auszuufern drohten – ähnlich, wie er seit 1992 in Algerien zwischen »sozialistischen« Machthabern und islamischen Fundamentalisten tobt.
»Ikhwan al-Muslimun«, Syriens Muslim-Bruderschaft, rief 1982 gar zum landesweiten Aufstand auf, mit der Parole, eine »Islamische Republik« zu errichten. Mehr als 30 000 Aufständische verloren allein in der mittelsyrischen Stadt Hama innerhalb weniger Tage ihr Leben, als sie bis zur letzten Patrone gegen den Belagerungsring der Regierungstruppen Widerstand leisteten. Das Blutbad von Hama, das zu den schlimmsten Massakern in der neueren Geschichte des Nahen Ostens zählt, hat weder in arabischen noch westlichen Zeitungen große Schlagzeilen gemacht. Denn 1982 war die Aufmerksamkeit der Medien auf die sich zuspitzende Krise im Libanon konzentriert, wo Israel in den Bürgerkrieg zwischen Sunniten, Schiiten und Christen eingriff und den Südteil des Landes vorübergehend besetzte. Dabei sind in Syrien zu Beginn der achtziger Jahre bei bürgerkriegsähnlichen Unruhen mehr Muslime durch Muslime getötet worden, als Syrer insgesamt in sämtlichen Kriegen gegen Israel gefallen sind.
Syrien ist – wie ohnehin die ganze islamische Welt – von einer religiösen und geistigen Einheit weit entfernt. Aber in Syrien summieren sich auf engstem Raum ideologische und religiöse Gegensätze wie sonst kaum im Nahen Osten. Hier stehen nicht nur »säkulare« Nationalisten gegen Fundamentalisten (die seit 1982 allerdings in den Untergrund gedrängt sind), hier lebt auch eine weitgehend orthodoxe Mehrheit der Sunniten neben einer schiitischen Minderheit. Hinzu kommen »ketzerische« Sekten wie die der Alawiten und Drusen, die beide von orthodoxen Sunniten und Schiiten abgelehnt werden. Eine solch konfliktgeladene Vielfalt macht Syrien zum exemplarischen Schauplatz, wenn sich die Frage aufdrängt: Wie kommen Muslime unterschiedlicher Glaubensrichtungen miteinander aus? Wie gehen sie mit Christen, wie mit anderen Minderheiten um? Und wie verschieden reagieren die einzelnen Gruppen auf die Herausforderungen der Moderne?
Syriens religiöse und kulturelle Vielfalt – gerade mit ihren konfliktreichen Gegensätzen – waren für mich Anlass, 1994 und 1995 das Land zu bereisen. Es wurden Entdeckungsreisen weit über die tagespolitische Aktualität hinaus. Denn Syrien ist ohnedies seit vielen Jahrhunderten ein exemplarischer Schauplatz kultureller Wechselbeziehungen gewesen. Nicht zuletzt zeugen davon die zahlreichen Baudenkmäler aus antiker, frühchristlicher und islamischer Zeit unmittelbar nebeneinander. Das multikulturelle Syrien hat sogar zu Beginn der islamischen Geschichte eine Schlüsselrolle eingenommen, die wir kennen müssen, wenn wir die Voraussetzungen für den Aufstieg des Islam zur Hochkultur verstehen wollen. Und im 20. Jahrhundert ist Syrien letztendlich zu einem wichtigen Land in der Auseinandersetzung mit dem Westen geworden, zu einer Keimzelle des arabisch-antiwestlichen Nationalismus wie des islamischen Fundamentalismus.
Diese Entwicklungsprozesse sind zentrale Weichenstellungen auch aus unserer westlichen Sicht und sie eröffnen uns neue Perspektiven, um die aktuellen Probleme des Nahen Ostens in größeren Zusammenhängen zu erfassen. Trotzdem ist Syrien für uns ein nahezu unbekanntes Land geblieben. Was verbinden wir mit Syrien? Zwar begreifen wir Syrien heute als eine Schlüsselmacht im Nahostkonflikt, aber unsere Medien berichten meist nur selektiv über stockende Friedensverhandlungen mit Israel. Spätestens seit den Kriegen mit Israel hat Syrien bei uns ein düsteres Image bekommen: ein Staat, lange im Bündnis mit dem kommunistischen Ostblock, im Bündnis auch mit dem radikal-islamischen Mullah-Regime des Iran; eine Schutzmacht für eine Reihe antiwestlicher Terrorgruppen; eine Diktatur, strikt darauf bedacht, das Land vor der Neugier von Journalisten und Einzelreisenden abzuschirmen ... All das hat dazu beigetragen, Syrien trotz seiner Bedeutung ins Abseits zu rücken.
Umso neugieriger, aber auch umso angespannter reiste ich 1994 in Syrien ein. Es war zu jenem Zeitpunkt, als die Baath-Regierung nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zögernd Dialogbereitschaft mit westlichen Staaten signalisiert hatte – und in diesem Zusammenhang zögernd die Grenzen auch wieder dem Tourismus öffnete. Wie würden die Syrer auf Fremde aus dem bisher offiziell verfemten »Westen« reagieren?
Zunächst war ich auf Syriens unmittelbare Gegenwart konzentriert, die zahlreichen kleinen Begegnungen im Alltag.
Jenseits der Feindbilder
Im Souk von Damaskus beobachte ich einen alten Mann, wie er prüfend eine Orange in der Hand wiegt und schließlich mit dem Händler feilscht. Leicht scheint ihm der Kauf nicht zu fallen, anscheinend verlangt der Händler zu viel. Endlich lässt er aber doch zwei der Früchte in seinen Einkaufskorb fallen. Mich fasziniert sein biblisch schönes Gesicht mit der scharf gebogenen Nase, den klugen Augen und dem silbergrauen Bart, umrahmt vom traditionellen Keffiye-Kopftuch. Unsere Blicke begegnen sich. Er lächelt, ich lächle. Da geschieht das Überraschende: Er greift in seinen Einkaufskorb und schenkt mir eine der beiden mühsam erstandenen Orangen. Mir, dem Nichtmuslim, den er nie zuvor gesehen hat und mit dem er auch kaum etwas reden kann! Im ersten Moment zögere ich, die Orange anzunehmen. Sein rotweiß-gewürfeltes Kopftuch und der Umhang sind mehrfach geflickt; ein eher armer Mann? Wir unterhalten uns mehr in Zeichensprache als mit Worten. »Ana almani«, ich sei Deutscher, kann ich arabisch auf seinen fragenden Blick gerade noch antworten. Er scheint zufrieden, nickt mir noch einmal lächelnd zu und verschwindet in der Menschenmenge.
Solche Begegnungen hatte ich viele in Syrien. Es sind unvergessliche Eindrücke gerade in ihrer Beiläufigkeit. So auch ein Soldat. Er kommt aus einer Bäckerei heraus, sieht mich, bricht den gerade gekauften Kuchen entzwei und gibt mir die Hälfte. So auch eine Bauernfamilie. Sie lädt mich, den Vorbeigehenden, am Feldrand während einer Arbeitspause ein, mit ihnen das ohnehin karg bemessene Mittagessen, Linsen und Brotfladen, einzunehmen. So auch ein junger Bursche. Er weist mir im Busbahnhof, wo die Aufschriften nur in Arabisch gehalten sind, den Weg zum richtigen Schalter, ja besorgt mir noch die Fahrkarten, um mir die Verständigungsprobleme mit dem Schalterbeamten zu ersparen, und verabschiedet sich, höflich lächelnd ein Trinkgeld zurückweisend. Es sind oft Menschen, die keine Fremdsprachen beherrschen, bei denen allein der Augenkontakt, die spontan empfundene Sympathie zählt.
Dann die meist englisch geführten Gespräche in Teestuben, Restaurants, die unvoreingenommene Neugier auf Auskünfte über Europa, den Westen, bei Gebildeten das Interesse an Diskussionen über arabische Kultur, den Islam ...
Solche Begegnungen über alle trennenden Unterschiede hinweg ergeben sich oft zufällig, zwanglos, nebenbei. Es scheint zu genügen, als Nichtmuslim den Eindruck zu erwecken, dass man die heimische Kultur, Lebensform und Religion respektiert.
Die Syrer seien von ihrer Tradition her schon immer offen zu den Fremden gewesen, erklärt mir wortreich ein Basarhändler, schließlich habe der Handel mit dem Ausland stets eine große Rolle gespielt. Ob Kaufleute es sich leisten könnten, sich gegen Fremde abzuschirmen? Er lacht über die selbstgestellte Frage. Die Syrer würden einen Unterschied zwischen der Politik und den einzelnen Menschen machen, mit denen sie es im Alltag zu tun hätten.
Wie sollte ich eine solche Antwort einschätzen?
Es sind Eindrücke, deren Gegensätze zunächst einmal nur widersprüchlich erscheinen.
»Reden wir nicht über Politik!«
Syrien scheint sich Mitte der neunziger Jahre von den religiösen und politischen Erschütterungen erholt zu haben, so signalisiert zumindest der erste Eindruck beim Streifzug durch die Städte. An den Einfahrtsstraßen von Damaskus, Aleppo, Homs, Hama und Lattakia wiederholt sich die gleiche Szenerie: Neubausiedlungen ziehen am Autofenster vorbei, serienweise gereihte Betonwohnblocks, viele Häuser noch mit Baugerüsten umgeben. Ein Bauboom hat das ganze Land erfasst, dessen Anfänge in die achtziger Jahre zurückreichen und dessen Ende nicht abzusehen ist. Grellbunte Propagandaplakate lassen keinen Zweifel daran, wem dieser Bauboom allein zu verdanken sein soll: der Baath-Partei. Auch hier dominieren in der Bilderflut Assad-Porträts. Manche Plakate präsentieren einen Staatspräsidenten, dessen segnend geöffneten Händen wie aus einem Füllhorn Geschenke an das Volk entströmen: Betonhochhäuser, Kraftwerke, Staudämme, Hochspannungsmasten. Fortschritt und Partei haben identisch zu sein, genauer noch: Fortschritt und der Präsident.
Der moderne Umbruch, der Syrien erfasst hat, ist älter als die Macht der Baath-Partei, aber er beschleunigt sich zusehends unter der Regierung der Baathisten. Es ist ein ebenso unvermeidlicher wie auch problematischer Umbruch. Seit den sechziger Jahren stieg die Lebenserwartung der Syrer dank besserer Ernährung und medizinischer Versorgung von durchschnittlich 53 auf 68 Jahre. Entsprechend ist jedoch die Einwohnerzahl nach oben geschnellt, ohne dass eine Geburtenregelung bisher die Entwicklung hätte steuern können: Innerhalb dreier Jahrzehnte wuchs die Bevölkerung von 4,5 auf nahezu 18 Millionen. Dies ließ die Landflucht lawinenartig anwachsen. Nahezu die Hälfte aller Syrer lebt bereits in Städten,[2] dies in einem Staat, der bis in die sechziger Jahre überwiegend auf die Landwirtschaft ausgerichtet war. Die Städte wachsen sprunghaft wie auch in vielen anderen Ländern der sogenannten Dritten Welt. Allein Damaskus vergrößerte sich von 1965 bis 1995 von 500 000 auf nahezu vier Millionen Einwohner. Mit welchen Folgen?
Als ich Mitte der neunziger Jahre nach Syrien kam, lag die letzte größere Wirtschaftskrise mehr als ein Jahrzehnt zurück. Syrien erlebte schon das vierte Jahr eines beachtlichen Wachstumsbooms. Nirgends entdeckte ich ausgedehnte Hüttensiedlungen aus Brettern, Wellblech und Plastikplanen, nirgends Slums mit jenem schreienden Elend, wie ich sie zur Genüge in Ägypten, Algerien, Marokko, dem Iran, ja selbst in der Türkei kennengelernt hatte – nirgends gärende Unruhezonen sozial Entwurzelter, die, herausgerissen aus ihren gewohnten Traditionen, besonders anfällig sind für die Parolen islamischer Fundamentalisten. Hat es Syriens Baath-Partei demnach verstanden, das Massenelend auf Dauer zu besiegen? Und ist es der Regierung tatsächlich gelungen, die »fundamentalistische Gefahr« zu bannen? Auf den ersten Blick sieht es so aus. Für den Nahen Osten wäre es die herausragende Ausnahme.
Je länger ich aber in Syrien unterwegs war, desto mehr sollte ich spüren, wie brüchig der soziale Fortschritt, wie ungesichert der religiöse Frieden auch hier war.
Syrer bestätigen allerdings meinen Eindruck prompt und geschmeichelt, es gebe in ihrem Land auffallend wenig Slums und kaum Bettler. Auf meine Frage, ob sie das für eine Leistung ihrer jetzigen Regierung hielten, stimmen manche vage zu. Andere aber erklären bei weiteren Nachfragen, sie könnten von ihrem geringen Einkommen nicht leben, sie müssten noch in allerlei Nebenjobs arbeiten, um die Familie einigermaßen ernähren zu können. Wie ihnen ergehe es vielen.
Die meisten lenken rasch zu einem anderen Thema über, sobald ich die Baath-Partei oder Assad(9) erwähne. Manche raunen mir zu, ich solle keine Namen nennen, weder den der Partei noch den des Staatspräsidenten, das sei nicht gut. – Wieso das? – Wir würden beobachtet, es gebe recht neugierige Leute; die wenigsten verstünden zwar Englisch, aber bei bestimmten Namen würden sie hören, dass wir über Politik redeten, überhaupt sollten wir über etwas anderes sprechen. Sie fragen mich nach »Germany« und lassen sich nicht mehr so rasch von diesem Thema abbringen. Sie geben jedoch bereitwillig Auskunft über Syrien, soweit ich etwas über Sehenswürdigkeiten, die Kultur und den Islam wissen will.
Ich habe mich bald an die Sprachregelung gewöhnt: Statt Baath-Partei sage ich »die jetzt regierende Partei«, statt Assad(10) »der amtierende Staatspräsident«. Doch auch dann bleiben viele Syrer nervös, so als ob die englisch formulierten Begriffe trotzdem noch von dem einen oder anderen Passanten erfasst werden könnten. Zu viele neugierige Leute ... Ein solcher Hinweis mit vieldeutigem Blick beendet jedes Gespräch über Politik.
In Tartus, einer überschaubaren Kleinstadt, bekomme ich erstmals anschaulich vorgeführt, wovor die Bürger Angst haben. Ich sitze bei Sonnenuntergang in einem der Cafés direkt am Meer, wo das gleichmäßige Wellenrauschen die Worte schon auf kürzere Entfernung undeutlich werden lässt. An meinen Tisch haben sich zwei Lehrer gesetzt. Mit ihnen habe ich bereits einige Minuten über die sozialen Verhältnisse in Syrien geredet, wobei die Lehrer erstaunlich offen davon berichten, dass die Stromversorgung in den Städten wegen Netzüberlastung immer wieder zusammenbreche. Sie fragen mich nach meinem Beruf. Ich habe mir in solchem Fall längst angewöhnt, etwas vage mit »Historiker« oder »Archäologe« zu antworten, um alle Bedenken zu zerstreuen. Aber hier in scheinbar abhörsicherer Umgebung bin ich neugierig, wie die sympathisch-kritischen Gesprächspartner auf meine Antwort reagieren werden. Ich sage, ich schreibe kulturhistorische und auch politische Bücher. Sie starren mich an, schweigen. Dann lacht der eine etwas verkrampft. »Political books?« Er scheint verblüfft, dass ich das so offen sage, verblüfft auch, dass ich anscheinend ungehindert in Syrien reisen kann. In dem Moment erschrecke ich selber über meine Unvorsichtigkeit.
Plötzlich lachen beide. Der eine weist mit einer nur vage erkennbaren Kopfbewegung einen Tisch nach hinten und sagt gedämpft, mit ironischem Augenzwinkern: Ich solle, was ich eben gesagt habe, doch bitte mit etwas größerer Lautstärke wiederholen, damit der da hinten das verstehe. Der sei ein Spitzel. – Ob der Englisch verstehe, frage ich ebenfalls gedämpft. – Nein, das nicht, aber dem sei schon verdächtig, dass wir miteinander redeten. Wir sollten besser das Thema wechseln. Es wimmle hier nur so ... Er verdreht die Augen, beide lachen. Ich sehe kurz zu dem Beobachter an dem hinteren Tisch, einem Mann mit Anorak und Schirmmütze. Die Lehrer trauen sich immerhin, diesem Beobachter durch zweideutiges Gelächter zu demonstrieren, dass sie in der überschaubaren Kleinstadt hier ohnehin seine Funktion kennen. Wir reden nun ganz allgemein über Sehenswürdigkeiten in Tartus. Den Lehrern scheint es darauf anzukommen, ihrem Beobachter außerdem zu demonstrieren, dass sie bei der Unverfänglichkeit der Themen kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen.
Ja, es gebe zur Genüge Geheimpolizei, bestätigt mir noch am selben Abend ein syrisch-orthodoxer Christ. Wir haben uns in einem Restaurant beim Abendessen kennengelernt und gehen auf dem Heimweg ein Stück gemeinsam durch die nächtlichen Straßen. Die Geheimpolizei sei allgegenwärtig, erklärt er, manche Spitzel kenne er schon, Tartus sei schließlich eine kleine Stadt, manche Spitzel aber ... Seine Stimme bleibt gedämpft, als ob er sich sogar auf der menschenleeren Straßenkreuzung beobachtet und belauscht fühlen müsste. Gar nicht weit von hier, nur drei Häuserblocks weiter, habe ein Mann in Zivil einen Flüchtigen erschossen. Der Flüchtige, ein Muslim, habe auf offener Straße aus Eifersucht seine Frau niedergestochen, aber er sei nur zwei- bis dreihundert Meter weit gekommen, dann habe sich ihm der Geheimpolizist in den Weg gestellt. Jeder müsse jederzeit damit rechnen, dass so einer sehr schnell zur Stelle sei. – Das seien ja sehr unsichere Verhältnisse, kommentiere ich. – Unsicher? Wieso unsicher? Nein, im Gegenteil, antwortet der syrische Christ zu meiner Überraschung, gerade weil es so viel Polizei gebe, sei Syrien ein sicheres Land. Die Regierung habe alles unter Kontrolle, die Regierung schütze die Bürger. In Syrien herrsche Ordnung, Syrien sei ein äußerst stabiles Land ...
Ausgerechnet ein Christ verteidigt das Spitzelsystem der Baath-Sozialisten! Vielleicht weil Michel Aflak(5), der Begründer dieser Partei, Christ war? Vielleicht, weil Aflak(6) besonders dafür eingetreten war, dass Muslime und Christen gleichberechtigt als »Araber« in einer »arabischen Nation« leben sollen? Im Verlauf meiner Reisen 1994 und 1995 sollte ich entdecken, dass relativ viele Christen sich demonstrativ zum Baath-Regime bekennen, denn der »jetzt amtierende Staatspräsident« verteidige mehr als seine Vorgänger die Rechte der Christen gegen die Forderungen radikaler Muslime.
Noch eindeutiger loben lediglich die Alawiten das Baath-Regime, sie, die ein paar Jahrzehnte früher sich noch vor Anfeindungen orthodoxer Sunniten und Schiiten fürchten mussten.
Die meisten Syrer aber weichen jedem Gespräch über Politik sichtlich unangenehm überrascht aus. Gerade die gebildeten Muslime. Zugänglich erweisen sie sich nur, sobald ich mit ihnen über die Verhältnisse in Europa rede. Oder sobald ich Interesse zeige, mit ihnen ganz allgemein über Religion, über Islam, über Christentum zu diskutieren. In solchen Gesprächen lerne ich eine Reihe orthodoxer Muslime kennen. Und gerade Gespräche mit ihnen sollten über die tagespolitische Aktualität der Republik Syrien hinausführen.
Standpunkt eines orthodoxen Muslim
In Damaskus sitze ich bei einem Glas Tee nahe der Omayaden-Moschee, wo ein Dutzend Tische mit ziselierten Messingplatten ins Freie gestellt sind. Den Blick genieße ich in einer belebten Gasse auf Häuser mit Holzbalkonen im türkischen Stil sowie ein Minarett.
Neben mir hat sich ein älterer weißhaariger Mann niedergelassen, penibel in Anzug, Weste und Krawatte gekleidet; er könnte vom Habitus her ein Ministerialbeamter aus einer mitteleuropäischen Metropole sein. Mit ihm, der zu meiner Überraschung relativ gut Deutsch beherrscht (und nur zwischendurch englische Formulierungen einfließen lässt), komme ich in ein längeres Gespräch. Der Wortwechsel verdient es, ausführlich wiedergegeben zu werden, denn der Syrer äußert Gedanken, die als modellhaft zumindest für eine gebildete Oberschicht orthodox gläubiger Muslime gelten können. Anfangs sprechen wir nicht über Religion, doch selbst schon die Einleitung ist aufschlussreich.
Aus welchem Land ich komme, wie mir Damaskus, wie mir Syrien gefalle, stellt er die ersten Fragen noch auf Englisch. Ich antworte, Syrien sei historisch wie kulturell ein besonders interessantes Land, vor allem imponiere mir Damaskus als Zentrum islamischer Kultur. Er nickt beifällig, lächelt. Ich sage: Viele der alten Bauten seien noch recht gut erhalten, das sei nicht selbstverständlich. Er lächelt nachsichtig. Nun ist ihm mein Lob anscheinend etwas zu zweideutig ausgefallen. Ob ich es hier nicht sehr schmutzig finde, fragt er mit leichtem Misstrauen in der Stimme. Manches sei renovierungsbedürftig, antworte ich.
Er schweigt für Momente, sieht an mir vorbei. Ungewollt habe ich ihm anscheinend gerade mit meiner Höflichkeit bestätigt, dass die islamische Welt von heute den westlichen Entwicklungsstandards doch erheblich unterlegen sei.
Er lässt kurz den Blick an den gegenüberliegenden Hausfassaden entlanggleiten, wo doch, so kann ich aus seinem Gesicht ablesen, für jedermann genug Nachteiliges zu entdecken sei: Risse in den Mauern, bröckelnder Verputz; ein durch Wellblech nur mühsam verdecktes Loch in einem Ziegeldach; ein Abfallhaufen nahe einem Haustor, der dort wohl schon seit Wochen verrottet. Mir scheint, als schämte er sich auch für die traditionell gekleideten Araber mit Keffiye oder Turban an den Nachbartischen, Männer aus einfachen Volksschichten, die vermutlich in übervölkerten, vernachlässigten Altstadtquartieren wohnen. Dass er selber westlich gekleidet ist, gilt ihm wohl weniger als Nachahmung fremder Lebensart, eher empfindet er sich mit diesem Habitus im Gegensatz zu den einfachen Leuten als »zivilisiert«. Er selber wohnt sicherlich nicht in der Altstadt. Weshalb er trotzdem hier in der Teestube sitzt? Er scheint meinen Seitenblick zu erraten, denn ungefragt erklärt er, er liebe hier besonders den Blick auf die Moschee.
Er wisse, dass in Deutschland die Straßen viel sauberer, die Häuser viel moderner seien. Er selber sei öfter in Deutschland gewesen, auch in Frankreich und England. Er sei Geschäftsmann, habe aber schon vor Jahren den Betrieb seinen beiden Söhnen übergeben, auch reise er jetzt kaum noch. Dagegen lese er viel. Deutschland habe ihn sehr beeindruckt. Die Bevölkerung dort sei im Durchschnitt gut gebildet, die medizinische Versorgung sei ausgezeichnet, der wissenschaftliche Standard sehr gut. Syrien habe da noch viel aufzuholen, ja alle arabischen Staaten. – In Syrien gebe es weniger Slums als in jedem anderen arabischen Land, auch hätte ich fast nie Bettler gesehen, sage ich. Er nickt, aber in seinem Gesicht zeichnet sich zum zweiten Mal jenes nachsichtige Lächeln ab zum Zeichen, dass er meine Antwort wieder um eine Spur zu höflich findet.
Der Ruf der Muezzine von der nahe gelegenen Omayaden-Moschee unterbricht unser Gespräch. Mein Gesprächspartner lauscht zurückgelehnt. Ich beobachte, dass einige Männer von ihren Tischen aufstehen und in Richtung Moschee gehen, die meisten aber sitzen bleiben. Die Passanten in der lebhaften Gasse bewegen sich ohne besondere Reaktion weiter, auch unterbricht keiner der Handwerker in seinem Gewölbe die Arbeit. Dass Muslime zur Gebetszeit massenhaft in die Moschee strömen oder reihenweise auf der Straße in Richtung Mekka niederknien, habe ich bisher nur in Kairo gesehen; in den meisten anderen islamischen Großstädten sind solche Szenen nicht mehr vorstellbar. Auch mein Gesprächspartner bleibt sitzen.
Noch während der Lautsprecherruf von Minarett zu Minarett wandert, dreht sich der Syrer wieder mir zu und bringt das Gespräch auf Religion. Wie ich über den Islam denke, will er wissen. – Es gebe sehr viel Gemeinsamkeiten mit dem Christentum, antworte ich. Er nickt, sichtlich erfreut. Anscheinend ist er auf eine solche Antwort nicht gefasst. Deutet ein Europäer eine Verwandtschaft zwischen beiden Weltreligionen an, löst dies bei Muslimen meistens Überraschung aus. Viele scheinen eher zu erwarten, dass das Trennende betont werde.
Wir sprechen über Mohammed(1). Mein Gesprächspartner betont die »endgültige« Wahrheit der islamischen Offenbarung. Ohne Übergang fragt er mich, wie viele Jahre nach dem Tod Jesu(1) die Evangelien geschrieben worden seien. Diese Frage habe ich von gebildeten Muslimen schon mehrmals gehört, deshalb ahne ich, auf welche Weise sich dieses Gespräch entwickeln wird. Ich antworte, wie ich das schon öfters getan habe: Das Evangelium des Markus(1) sei als Erstes etwa 40 Jahre nach dem Tod Jesu(2) verfasst worden, und während der folgenden zwei bis drei Jahrzehnte seien die Evangelien des Matthäus(1), Lukas(1) und Johannes(1) entstanden.
Der Syrer hört mit hochgezogenen Augenbrauen zu. Vier Autoren hätten also Gottes Offenbarung niedergeschrieben, wiederholt er. Vier verschiedene Menschen, 40 bis 70 Jahre nach dem Tod Jesu(3). Die Zahlen betont er. Ob einer der Autoren Jesus(4) persönlich gekannt habe, fragt er nun schon mit lauerndem Gesichtsausdruck. – Nein, wohl kaum. – Und wie viele Jahre später sei das Neue Testament in seine endgültige Fassung gebracht worden, fragt er suggestiv und demonstriert damit, dass er erstaunlich gut über die Quellenproblematik biblischer Überlieferung informiert ist.
Meine Antwort lässt ihn zufrieden lächeln. Ich sage: Die endgültige Fassung hätten Theologen und Bischöfe ungefähr dreihundert Jahre nach dem Tod Jesu(5) festgelegt. – Aber, so ergänzt der Syrer nun mit plötzlicher Heftigkeit, es habe noch viel länger gedauert, bis die Bischöfe in Konzilien die endgültige Fassung ein für alle Mal festlegten, nicht wahr. – Ja. – Wie lange dagegen, fragt er mit blitzenden Augen, habe es gedauert, bis der Koran in seiner Endfassung vorgelegen habe?
Der Syrer lässt mir keine Zeit für eine weitere Antwort, er erklärt nun mit einem Sturzbach von Worten: Der Koran habe schon zu Lebzeiten Mohammeds(2) in seiner endgültigen Form vorgelegen. Das sei nicht wie bei den Christen, wo drei Jahrhunderte bis zur Endfassung der Heiligen Schrift hätten vergehen müssen. Drei Jahrhunderte! Und vier Autoren, die über das Leben des Propheten Jesus(6), über seine Predigten, über seine Visionen geschrieben hätten. Wie viele Ungenauigkeiten, wie viele Verfälschungen und Entstellungen hätten sich doch da eingeschlichen. Beim Koran sei das anders. Gott allein sei der Autor des Koran, Gott habe die Botschaft Wort für Wort seinem Propheten eingegeben, und Mohammed(3) habe sie Wort für Wort, unabänderlich, so verkündet. Das Neue Testament liege den Christen ja nicht einmal in der ursprünglichen Sprache, dem Aramäischen, vor, wie es Jesus(7) gesprochen habe, sondern nur auf Griechisch und Latein. Der Koran dagegen sei schriftlich in jener Sprache festgehalten, in der Gott seine Botschaft dem Propheten verkündet habe: auf Arabisch. Keine Übersetzung verstelle den Zugang zum Urtext. All diese Tatsachen würden den Koran unangreifbar machen und den Beweis liefern, dass der Koran die einzige unverfälschte Offenbarung Gottes sei.
Ich widerspreche ihm: Es habe immerhin zwei Jahrzehnte nach Mohammeds(4) Tod gebraucht, bis der Koran in endgültiger Fassung vorgelegen habe. Mohammed(5) selber habe ja nichts schriftlich hinterlassen. Gläubige hätten das Gehörte mitgeschrieben und erst später geordnet. Für eine quellenkritische Wissenschaft gebe es da genug Anhaltspunkte, Unregelmäßigkeiten und subjektive Abweichungen der schriftlichen Fixierung nachzuweisen.
Er widerspricht mir: Zwar habe er großen Respekt vor den Leistungen der Wissenschaft, aber wenn im Westen die Wissenschaftler auch noch anfingen, die Religion auf ihre Wahrhaftigkeit zu untersuchen, dann überschätzten sie ihre Möglichkeiten. Er könne mir genau sagen, weshalb im Westen heute die Religion – und mit ihr die moralische Ordnung – so sehr an Kraft verloren habe: durch den Zweifel. Zu wundern brauche das gar nicht. Ein Christ müsse ja, sofern er kritisch genug sei, zwangsläufig die unumstößliche Wahrheit seiner Heiligen Schrift bezweifeln. Dadurch, dass die Bibel nur Menschenwerk sei und Gottes Botschaft nicht unverfälscht wiedergeben könne, habe sie stets Angriffsflächen für Zweifler geboten. Die geistig-religiöse Krise sei im Westen geradezu vorprogrammiert. Naturgemäß drohe im Westen viel stärker als bei den Muslimen die Gefahr des Unglaubens bis hin zum Atheismus.
In Syrien gebe es anscheinend solche Tendenzen nicht, unterbreche ich in fragendem Ton. – Syrien sei ein islamisches Land, entgegnet er knapp. – In Syrien gebe es aber doch eine westlich beeinflusste Bildungsschicht, beharre ich. – Ja, die gebe es, natürlich gebe es die. Er selber habe, und er könne das nur betonen, großen Respekt vor der westlichen Zivilisation, er bewundere die Leistungen der westlichen Techniker und Mediziner. Aber die Muslime müssten kritisch unterscheiden zwischen dem, was im Westen gut und was schlecht sei. Er habe nichts gegen ein Auto aus Amerika, aus Deutschland, aber gegen dekadente Philosophie aus dem Westen. Manche Muslime würden leider dazu neigen, viel zu viel westliches Denken zu übernehmen, und gerade damit würden sie die geistige Krise des Westens in die islamischen Länder transportieren.
Aber verwestlichte Muslime gebe es in Syrien doch auch, sage ich. Oder etwa nicht, frage ich in sein Schweigen hinein. Er mustert mich prüfend von der Seite. Ja, antwortet er knapp. – Auch in der politischen Führungsschicht? Ich frage betont beiläufig. Er zieht erschrocken die Augenbrauen hoch, sieht mich missbilligend an. »Lassen wir die Politik«, raunt er und blickt verstohlen zu den Nachbartischen. Was für ein vorsichtiger Blick. Dabei spricht der Syrer doch deutsch und muss kaum befürchten, von Zuhörern verstanden zu werden.
Die Zukunft der Menschheit entscheide sich an der religiösen Frage, sagt er wieder in voriger Lautstärke. Ein Volk, das sich von der Religion abwende, habe keine Zukunft. Er wisse, wovon er spreche. In seiner Jugend sei er kaum einmal in die Moschee gegangen, er habe Alkohol getrunken, den Ramadan nicht eingehalten, wie etliche seiner Freunde in Damaskus auch. Heute gehe er regelmäßig in die Moschee, trinke keinen Tropfen Alkohol mehr, halte sich strikt an die Fastengebote des Ramadan. Wie viele seiner Freunde auch. Ihm sei klar geworden, dass er nur unkritisch fremde Lebensweise nachgeahmt habe. Es möge mir vielleicht seltsam erscheinen, aber diese Einsicht sei ihm im Westen gekommen. Je mehr er in westlichen Ländern gereist sei, umso mehr habe er gespürt, dass dort etwas fehle. Die letzte Sicherheit fehle den Menschen dort. Die eigentliche Schwäche der Muslime bestehe darin, dass sie sich vom materiellen Standard des Westens blenden ließen. Wo bleibe der letzte Bezugspunkt, der letzte Halt? Viele Menschen im Westen seien ohne Orientierung, ohne tiefere Orientierung.
Der Syrer redet sich in Erregung. Aber je länger er redet, desto selbstbewusster mustert er mich. Jetzt ist nichts mehr zu merken von jener Unsicherheit, mit der er anfangs gefragt hat, wie mir Syrien gefalle; nichts mehr von jener Verlegenheit, mit der er sich für den Schmutz und die Rückständigkeit der Damaszener Altstadt nahezu entschuldigt hat; nichts mehr von jenem untergründigen Minderwertigkeitsgefühl, mit dem er etwas zu übertrieben, wie mir vorkommt, den höheren Standard des Westens gelobt hat. Jetzt scheint er mit jedem Wort das dahinter verborgene Argument zu unterstreichen, das ich immer wieder in unterschiedlichsten Ländern zu hören bekam: Wir Muslime mögen gegenwärtig zwar dem Westen materiell und technologisch unterlegen sein, aber das ist nur eine vorübergehende Krise. Ihr im Westen habt dagegen mit einer sehr viel tiefer gehenden, nämlich religiösen Krise zu kämpfen, und deshalb werdet ihr bald auch wieder den ökonomischen und technologischen Vorsprung eingebüßt haben.
Es ist ein strikt orthodoxer Standpunkt, der in solchen Argumenten gebildeter Muslime zum Ausdruck kommt. Ein solch orthodoxer Glaube darf nicht schon mit fundamentalistischer Überzeugung gleichgesetzt werden. Islamische Fundamentalisten grenzen sich entschieden radikaler vom »Westen« ab.
Andererseits finden sich unter den Muslimen auch Gebildete, die wesentlich freizügiger das Problem der absoluten Wahrheit ihrer Religion diskutieren. Über Liberale ihres Typs werde ich an anderer Stelle ausführlich berichten.
Das Besondere an Syrien
Minarett und Kreuz: bemerkenswerte Verbindungen
Eine Überraschung erwartet mich im Khan al-Hazir, dem Haus des Wesirs.
Ich bin in die traditionsreiche nordsyrische Handelsstadt Aleppo gekommen, um wie alle westlichen Besucher einen der größten Souks des Orients kennenzulernen. Stundenlang bin ich durch die überdachten Ladenstraßen geschlendert, vorbei an farbenfreudigen Auslagen von Teppichhändlern, Schneidern, Kupferschmieden, Juwelieren, Gewürzhändlern. Die Gassen sind überdacht mit Kreuzgrat- und Kuppelgewölben in faszinierendem Wechsel, dazwischen immer neue Ausblicke aus Karawansereihöfen zum Himmel, in dessen Blau ein Minarett, eine Kuppel, eine ornamentverzierte Wand ragt.
Weniger interessant erscheint mir anfangs das Haus des Wesirs. Der Torbogen gibt den Blick frei in den Innenhof mit Bretterverschlägen, einer niedergebrochenen Balustrade, einem Brunnengehäuse, mit Wellblech halb zugedeckt, ringsum Gerümpel. Ich wäre wohl noch ein drittes Mal gleichgültig an der schwarzweiß gestreiften Fassade vorbeigegangen, hätte mich nicht ein junger Syrer hereingewinkt. Der Händler, der fließend Englisch spricht, besitzt unter Arkaden ein Warenlager, eines der wenigen, die im sonst völlig vernachlässigten Innenhof bereits restauriert sind. Er fängt mit mir zu plaudern an, ohne die Absicht, mir etwas verkaufen zu wollen. Ihn scheint eher die Neugierde auf Ausländer zu bewegen, wo doch Touristen im Frühjahr 1994 erst spärlich nach Syrien kommen. Er erklärt mir, noch sei hier alles verwahrlost, jahrelang habe der Innenhof nur als Ablage für Baumaterial gedient, aber jetzt plane die Stadtverwaltung, den Khan nach alten Plänen wieder sorgfältig zu restaurieren und ein Touristenhotel daraus zu machen. Die Glanzzeit des Khan al-Hazir sei vor zwei- bis dreihundert Jahren gewesen: Damals habe das Handelshaus als einer der wichtigsten Umschlagplätze des Großhandels und des Bankenkreditgewerbes gegolten, hier hätten sich Kaufleute aus aller Welt getroffen, hier seien wichtige Abschlüsse getätigt worden, hier sei auch Politik gemacht worden ... Ich höre ihm interessiert zu. Aber wirklich überrascht bin ich, als der Händler auf die Portalfassade deutet. Dort entdecke ich über den benachbarten Fenstern, von Arabesken umrahmt, zwei kunstvoll eingemeißelte Symbole: über dem rechten Spitzbogen ein Minarett, über dem linken – ein Kreuz.
»Was bedeutet das?«
Hinter dem Fenster mit dem Minarett, erklärt der Händler, habe sich der Gebetsraum der Muslime befunden, hinter dem Fenster mit dem Kreuz hätten sich die Christen zur Andacht versammelt. Die eingemeißelten Symbole seien auch darüber hinaus bedeutsam gewesen, denn sie hätten die Machtverhältnisse der Stadt gespiegelt. Im 17. und 18. Jahrhundert sei Aleppo von muslimischen und christlichen Wesiren gemeinsam verwaltet worden, die Stadtoberen hätten die Ämter auf Angehörige beider Religionen verteilt.
»Und das ging ohne Probleme?«
In der Politik gebe es immer Probleme, antwortet der Händler lächelnd, aber grundsätzlich habe das System funktioniert. An der Spitze der Regierung habe allerdings immer ein Muslim gestanden. Ob ich schon al-Djdeide, das Christenviertel, besucht hätte? Es sei ein großes Viertel mit zahlreichen Kirchen. In Aleppo gebe es auch heute noch viele Christen, ungefähr zehn Prozent der Einwohner. Vor 30, 40 Jahren hätten die Christen noch ein Viertel der Bevölkerung ausgemacht und vor hundert Jahren seien es noch mehr gewesen. Geändert habe sich das, weil während der letzten zwei Generationen sehr viele Muslime aus Dörfern in die Stadt eingewandert seien. Er sei 1965 geboren, damals habe Aleppo gerade 500 000 Einwohner gezählt, heute seien es über zwei Millionen. Die Muslime hätten auch eine viel höhere Geburtenrate als die Christen.
Ob er mit Christen befreundet sei, frage ich. – Das nicht, antwortet er zögernd, das sei nicht üblich, auch von deren Seite nicht. Aber er habe gute Geschäftskontakte zu christlichen Kaufleuten, sehr korrekten, sehr angenehmen Partnern. Er könne sich über die Christen nicht beklagen.
Minarett und Kreuz in trauter Eintracht unmittelbar nebeneinander ... Und das in Aleppo! Das in jener Metropole, von der aus die Muslime während des 13. Jahrhunderts den Abwehrkampf gegen die Kreuzritter begonnen hatten. In Aleppo, das über viele Jahrzehnte für den christlichen Angreifer gefährlicher gewesen sein soll als jede andere islamische Stadt. Ein unerschütterliches Bollwerk gegen die »Ungläubigen«.
Und doch auch eine Stadt Abrahams(1). Aleppo, angeblich einer der ältesten ständig besiedelten Orte der Menschheit, ist legendär mit jenem Propheten verbunden, der den Juden wie Christen und Muslimen gleichermaßen als Ahnvater ihrer Religion heilig ist. Abraham(2) – der »Vater vieler Völker«, so die mythenträchtige Bedeutung seines Namens[1] – soll mit seinem Nomadenstamm unterwegs durch den Nahen Osten auch eine Zeit lang an jenem Berg gewohnt haben, auf dem sich heute die Zitadelle befindet. Dort habe Abraham(3) seine Schafe und Ziegen gemolken und die Milch an die Armen verteilt. »Ibrahim halab! Abraham(4) hat gemolken!«, mit diesem Ruf habe er über Monate die Armen vor seinem Zelt versammelt. Halab (oder Haleb) lautet bis heute der offizielle arabische Name der Stadt, der auf besagte Ereignisse zurückgehen soll. So zumindest will es eine populäre Legende, die uns durch einen muslimischen Geschichtsschreiber aus dem 13. Jahrhundert überliefert ist – aus der Zeit der Kreuzzüge. Erst venezianische Kaufleute haben während des 16. Jahrhunderts »Halab« zu »Aleppo« verballhornt und diesen Namen in Europa eingebürgert; sie waren damals die wichtigsten westlichen Geschäftspartner.
Unter der Fremdherrschaft der Osmanen ist die Stadt nicht nur zur Handelsdrehscheibe zwischen Orient und Abendland, sondern auch zum weltoffenen Begegnungsort für Muslime und Christen geworden. Türken, die das überdachte Gassenlabyrinth des Basars zu seiner heutigen Größe anwachsen ließen, haben den Khan al-Hazir mit Minarett- und Kreuzzeichen errichtet. Baujahr 1682. Gerade diese Jahreszahl kann uns wiederum überraschen, ja kann uns in eine falsche Richtung weisen: War es nicht 1683, nur ein Jahr später, dass die Türken Wien belagerten? Zum zweiten Mal waren damals die Türken tief nach Mitteleuropa vorgestoßen, und die Schreckensvision war bei Christen umgegangen, auf den Kirchtürmen würde statt des Kreuzes bald der Halbmond prangen, die Kirchen würden in Moscheen umgewandelt werden.
Minarett und Kreuz ... Syrien besitzt eine ganze Reihe derart frappierender Zeugnisse islamisch-christlicher Koexistenz. Eine Reise in Syrien kann unser Vorurteil vom unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Islam und Christentum korrigieren, denn sie wird zur Entdeckungsreise mit immer neuen Einblicken in das vielfältige Beziehungsgeflecht zwischen islamischer und christlich-abendländischer Welt.
Ich bewege mich im Besucherstrom durch Syriens bedeutendste islamische Kultstätte, die Omayaden-Moschee von Damaskus. Die bunte Menschenmenge strömt in der monumentalen dreischiffigen Gebetshalle zu einem Kuppelbau und dort beten die Muslime mit Blick auf einen Sarkophag, der in ein grünes, mit Koranversen besticktes Tuch gehüllt ist. Welcher Heilige wird hier mit aller Hingabe islamischer Volksfrömmigkeit verehrt? Die Antwort muss Europäer, muss Christen verwundern: Der Schrein beherbergt, so will es die islamische Überlieferung, das Haupt des Propheten und Märtyrers Yahya Ibn Zakariya; heilig ist dieser Prophet aber auch den Christen, allerdings unter dem Namen Johannes(1) der Täufer, Sohn des Zacharias(1).
Frauen und Männer drücken ihr Gesicht inbrünstig an das silberne Schreingitter. Manche befestigen dort Stoffstreifen oder Wollschnüre zum Zeichen ihrer Verbundenheit mit dem Heiligen und in der Hoffnung, dass er ihre Bitten an Gott weiterleite. Es sind Pilger aus allen Teilen des Vorderen Orients, aus allen sozialen Schichten. Neben westlich gekleideten Muslimen, wie sie in jeder nahöstlichen Großstadt zu Hause sind, versammeln sich hier auch zahlreiche Männer in traditioneller Tracht, einem weiten Umhang und dem Keffiye, dem rotweiß gewürfelten Kopftuch mit Kamelhaarring. Dazwischen Frauen im dunklen Umhang der Städterin oder im farbenfrohen Beduinengewand.
Ausgerechnet das Haupt jenes Propheten, der Jesus(8) taufte, soll in einer Moschee begraben sein? Noch ungewöhnlicher muss dies erscheinen, da ja die Omayaden-Moschee von Damaskus den sunnitischen Muslimen als die viertheiligste Kultstätte des Islam gilt. Im Rang über ihr stehen nur noch die Kaaba von Mekka, die Propheten-Moschee in Medina, der Tempelberg mit Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Sunniten, ja selbst Schiiten kommen von weit her, um vor dem Grabmal des Johannes(2) zu beten. Die islamische Tradition will es überdies, dass auch Zacharias(2), der Vater des Johannes(3), seine letzte Ruhestätte in einer Moschee gefunden hat: in der Hauptmoschee von Aleppo, die ebenfalls den Namen der Omayaden-Dynastie trägt.
Nicht minder muss der Name jenes Minaretts überraschen, das an der Südostseite der Moschee aufragt: Madinet Isa, Jesus-Minarett(9). Mit diesem Turm verknüpft sich eine besondere Legende: Am Tag des Jüngsten Gerichts soll Jesus(10) auf dem Dach erscheinen und von dort oben das Ende der Welt verkünden. Die Legende hat ihre Wurzeln zwar in christlicher Tradition, aber erst die syrisch-islamische Volksfrömmigkeit hat die Prophezeiung exakt an dieser Stelle lokalisiert. Dieser Glaube, der heute noch bei vielen Muslimen lebendig ist, hat zusätzlich zur Anziehungskraft der Omayaden-Moschee beigetragen.
Muslime besitzen im Einzugsbereich dieser Moschee aber noch eine weitere verehrungswürdige Stätte. An der Nordwestecke ragt nahe der Außenmauer im Schatten eines baumbestandenen Gartens ein Mausoleum mit rotgetünchter Kuppel auf. Dort ist der 1193 in Damaskus verstorbene Sultan Saladin(1) zur letzten Ruhe gebettet. Lessing(1) hat ihm in seinem Schauspiel »Nathan der Weise« ein Denkmal als religiös besonders tolerantem Herrscher gesetzt. Die Muslime dagegen verehren Saladin(2), weil es ihm gelungen ist, die heilige Stadt Jerusalem von der Herrschaft der Christen zu befreien und damit den Kreuzrittern ihre schlimmste Niederlage zuzufügen.
Damaskus ist wie keine andere Stadt des Orients zum Symbol geworden für den Abwehrkampf der Muslime gegen die Feinde aus dem christlichen Abendland, sie ist noch eindeutiger als Aleppo mit dem Mythos einer islamischen Frontstadt behaftet. Aber gerade Damaskus besitzt eine Moschee mit einem Jesus-Minarett(11) und mit einer Reliquie Johannes(4)’ des Täufers.
Syrien ist auch reich an frühchristlichen Kirchen wie kaum eine andere Region des Mittelmeerraums. Eine dieser Kirchen ist für die Muslime viele Jahrhunderte lang ein Wallfahrtsziel gewesen und hat dadurch eine außergewöhnliche Symbolkraft gewonnen. Diese Kirche aus dem 4. Jahrhundert steht rund 140 Kilometer südlich von Damaskus inmitten des antiken Ruinenfeldes von Bosra, der ehemaligen Hauptstadt der römischen Provinz Arabia. Heute ist von dieser Kirche selbst nur eine Ruine geblieben. Als ich sie besuchte, war der Zugang ins Innere mit einem Eisengitter verschlossen, die unmittelbare Umgebung atmete die Atmosphäre eines verschlafenen Dorfes. Frauen hatten Wäscheleinen zwischen römischen Säulen gespannt, eine Schafherde weidete vor ärmlichen Behausungen. Aber arabische Chronisten des 8. Jahrhunderts berichten, dass in dieser Kirche einst der christliche Mönch Bahira(1) dem Knaben Mohammed(6) begegnet sei und ihn visionär als den zukünftigen Propheten des Islam erkannt habe. Mohammed(7) sei in seiner Jugend mehrmals mit Handelskarawanen durch Syrien unterwegs gewesen. So legendär und ungesichert solche Chroniken auch sein mögen, zeigen sie doch, welche Bedeutung die Araber gerade in der islamischen Frühzeit Syrien beimaßen. Nur Syrien hat der spätere Prophet bereist, nicht Ägypten, nicht den Irak. Weshalb aber machen die Muslime einen syrischen Mönch zu einem wichtigen Zeugen in Mohammeds(8) Lebensgeschichte?
Solche Fragen begleiteten mich auf meinen Reisen in den Jahren 1994 und 1995. Je länger ich unterwegs war, desto mehr drängte sich mir der Gedanke auf, dass solche historischen Konstruktionen ein Hinweis sind auf tiefere Beziehungen zwischen Islam und syrischem Christentum. Kein anderes Land des Nahen Ostens, ja des ganzen Orients, liefert derart augenfällige Beispiele, an denen sich exemplarisch zeigen lässt, wie intensiv Islam und Christentum schon von Anfang an aufeinander bezogen sind.
Syrien war ein Kernland des frühen Christentums. In syrischen Städten, nicht etwa in jüdischen, hatten die Evangelisten das Neue Testament verfasst. In hellenistisch-judenchristlichen Kreisen von Damaskus, nicht etwa in der jüdischen Urgemeinde von Jerusalem, hatte sich der Apostel Paulus(1) um das Jahr 34 unserer Zeitrechnung zum neuen Glauben bekehrt. Seine wegweisende Theologie entwickelte Paulus(2) in Antiochia, damals die Hauptstadt der römischen Provinz Syria. Antiochia, rund 70 Kilometer westlich von Aleppo und heute unter dem Namen Antakya nur noch eine unscheinbare Provinzstadt ohne nennenswerte historische Überreste, war vor zweitausend Jahren eine der wichtigsten Metropolen an der legendären Seidenstraße in den Fernen Osten. Zu jener Zeit, als Jesus(12) predigend durch Palästina zog, hatte Antiochia eine halbe Million Einwohner und wurde im gesamten Mittelmeerraum an Größe, wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung nur von Rom und Alexandria übertroffen. In der Regel wissen heute allein Historiker um die ebenfalls enorme religionsgeschichtliche Bedeutung gerade dieser Stadt. Hier in der Hauptstadt Syriens – nicht im vergleichsweise provinziellen Jerusalem – hatte sich schon zu Lebzeiten des Apostels Paulus(3) die erste große christliche Gemeinde aus Nichtjuden gebildet, jene sogenannten »Heidenchristen«, die entscheidend die weitere Entwicklung der jungen Religion prägen sollten.
In Antiochia war der hebräische Titel »Messias« (der »Gesalbte«) erstmals in das griechische »Christos« übersetzt worden; Paulus(4) hatte hierzu den Anstoß gegeben, dessen Heimatstadt Tarsus westlich von Antiochia liegt. In Antiochia wurden auch die Anhänger Jesu(13) erstmals nach dem griechisch umgeformten Titel des Religionsgründers »Christen« genannt, so erfahren wir aus der Apostelgeschichte.[2] Dort hatten die Christen erstmals das Kreuz als Erlösungssymbol verehrt, hatten sie erstmals ihre Gebetshäuser mit dem griechischen Namen »Kyriakon«, »Haus des Herrn«, bezeichnet, wovon sich unser Begriff »Kirche« ableitet. Mehr noch: In der damaligen Hauptstadt Syriens hatten sich während des zweiten Jahrhunderts Strukturen und Organisationsformen der Kirche entwickelt, wie sie später für das christliche Abendland bestimmend werden sollten.[3] Bevor die muslimischen Eroberer kamen, war Antiochia unter christlich-byzantinischer Regierung eines der wichtigsten theologischen Zentren und einer der herausragendsten Bischofssitze der Christenheit.
Rund zwölf Prozent der Syrer sind selbst heute noch Christen, ein verblüffend hoher Anteil nach mehr als 1300 Jahren islamischer Herrschaft. Nur im Nachbarstaat Libanon ist der Anteil der Christen höher, rund 40 Prozent. Aber weil der Libanon stets eng mit syrischer Geschichte verflochten war, ist eine solche Konzentration arabischer Christen auch in dieser Region des Vorderen Orients kein Zufall. Nirgendwo sonst in der islamischen Welt haben sich christliche Gemeinden derart zahlreich erhalten können, dabei in einer Vielfalt christlich-orientalischer Konfessionen, die noch heute ein treffendes Bild vom Zustand des frühen Christentums vermitteln.
Aus dem Kernland des frühen Christentums ist ein Kernland des Islam geworden. Syrien ist somit unter veränderten Vorzeichen ein Zentrum historischer Weichenstellung geblieben. Allerdings hatte sich der kulturelle Schwerpunkt rasch nach Süden, von Antiochia nach Damaskus, verlagert. Weil den muslimischen Eroberern die bisherige Hauptstadt Syriens zu nahe an der feindlichen Grenze des Byzantinischen Reiches lag und weil Antiochia zu Beginn des 7. Jahrhunderts im Krieg zwischen den Byzantinern und Persern verwüstet war, hatten die Araber das strategisch günstiger gelegene Damaskus zu ihrer Residenz gewählt. Dieses Damaskus war zwar damals schon mehr als zweitausend Jahre lang eine traditionsreiche Handelsstadt gewesen (Damaskus ist angeblich wie Aleppo eine der ältesten ständig bewohnten Städte der Welt), aber trotz wachsender Bedeutung hatte das Handelszentrum nie aus dem Schatten Antiochias treten können. Erst unter islamischer Herrschaft ist Damaskus zum unangefochtenen politischen wie geistigen Mittelpunkt Syriens aufgestiegen. Neun Jahrzehnte lang war Damaskus sogar die Hauptstadt jenes arabischen Großreiches, das von Südspanien bis an den indischen Subkontinent reichte. Damaskus formte sich unter diesen Voraussetzungen zu einer frühen Zentrale, in der die Muslime fremde Kultureinflüsse schöpferisch verarbeiteten und den Aufstieg des Islam zur kulturellen Weltgeltung einleiteten. Syrien nimmt auch von daher im Gedächtnis der Muslime einen besonderen Stellenwert ein.
Aber weil Syrien außerdem in so starkem Maß für Christen »Heiliges Land« geblieben ist, Wirkungsort ihrer Apostel und Sitz der frühen Kirche, wurde Syrien folgerichtig zum Brennpunkt der Kreuzzüge – eine bis in unsere Gegenwart verhängnisvoll nachwirkende Epoche.
In Syrien habe ich erfahren, dass für Muslime das Zeitalter der Kreuzzüge viel lebendiger und gegenwärtiger erscheint als für uns im Westen. Der Grund liegt im Verhalten westlicher Kolonialmächte. Als Frankreich und Großbritannien nach dem Zusammenbruch des Osmanenreiches 1918 den Nahen Osten in eigene Interessensphären aufgeteilt hatten, war unter Muslimen das Schlagwort von einem »neuen Kreuzzug der Christen« aufgekommen. Es brauche einen »neuen Saladin(3)«, um die »Aggressoren« aus dem »Westen« zum zweiten Mal vom »heiligen islamischen Boden« zu vertreiben. Ein arabischer Nationalismus entstand, in dem sich moderne mit vormodernen, vergangenheitsorientierten Leitbildern mischten.
Syrien ist neben Ägypten zum wegweisenden Ausgangspunkt für diesen spezifisch antiwestlichen Nationalismus geworden. Nicht zufällig sind es jene beiden Nahoststaaten, die am frühesten dem Einfluss westlicher Kolonialmächte ausgesetzt waren und deren Metropolen Damaskus und Kairo um den Anspruch wetteiferten, das Herz der arabischen Welt zu sein. Syrien wurde nach Ägypten außerdem das zweite Land, in dem islamische Fundamentalisten eine Protestbewegung gegen den politischen und kulturellen »Imperialismus« des »Westens« entwickelten.