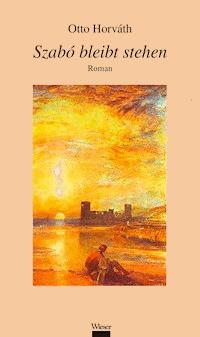
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Szabó versucht den Schmerz über den Tod seiner Ehefrau A. zu überwinden. Er kann die Erinnerung an sie fast nicht ertragen, lebt aber doch in stetiger Angst, diese Erinnerungen an das gemeinsame Leben könnten verblassen. Ist er dann ein Verräter? Das Buch erzählt viel über A. und über die Beziehung zwischen den beiden Liebenden. Und er weiß: Der Preis für eine große Liebe ist der Schmerz. Es tut unendlich weh, dass nichts mehr so ist, wie es war. Aber es ist gut, dass es war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HORVÁTH • SZABÓ BLEIBT STEHEN
OTTÓ HORVÁTH
Szabó bleibt stehen
Aus dem SerbischenvonElvira VeselinoviÊ
Die Herausgabe dieses Buches erfolgtemit freundlicher Unterstützung durchdas Ministerium für Kultur und Mediender Republik Serbien.
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12Tel + 43(0)463 370 36, Fax. + 43(0)463 376 [email protected]
Copyright © dieser Ausgabe 2016 bei Wieser Verlag GmbH,Klagenfurt/CelovecAlle Rechte vorbehalteneISBN 978-3-99047-046-6
Nagyon szerettem ezt a nőt.(Gy. Petri)
in memoriam 1966–2011
Fangen Sie an, Herr Szabó!
Alle zehn Meter bleibe ich stehen. Der Koffer ist groß und schwer, und so entsteht der Eindruck, ich würde ihn eher schleifen als mal in der linken, mal in der rechten Hand tragen. Ich beschließe, eine Abkürzung zum Bahnhof zu nehmen, den ich bereits durch die nackten Äste der hohen Akazien sehe, und so durchquere ich den Busbahnhof, der unmittelbar daneben liegt, muss aber leider meinen Schritt verlangsamen, mühevoll an den Reisenden, die ihn verlassen, vorbeigehen, mich um abfahrbereite Wartende sowie um ihre Taschen herumwinden. Hätte ich doch nur vorher nachgedacht, oder wäre der Koffer bloß nicht so schwer…, aber diese Gedanken denke ich nicht zu Ende, ich gehe, bleibe stehen, nehme die andere Hand. Als ich vor ein paar Tagen meinen Vater bat, mir seinen Koffer für meine Reise zu leihen, sah ich in seinem Gesicht für einen Augenblick sowohl Wut als auch Enttäuschung, dass ich es gewagt hatte, ihn so etwas zu fragen. Ein Familientabu war angekratzt worden. Aus einem unerklärlichen Grund hing mein Vater an diesem Koffer, obwohl er bereits seit fünfzehn Jahren nirgendwohin gereist war. Er nahm ihn regelmäßig vom Schrank, lüftete ihn und wischte den Staub von ihm ab, brach aber zu keinerlei Reisen auf. Soweit ich mich erinnern kann, war er ohnehin kein großer Reisender. Ungarn, Polen, Italien, und von diesem auch nur Triest im fernen Jahr 1966, weiter hat er es nicht geschafft, da ihm Taschendiebe in Triest Geldbeutel und Pass gestohlen hatten, und natürlich, unvermeidlich, die Adriaküste, aber nur diesseits, auf der jugoslawischen Seite. Genauso erinnere ich mich, dass er in meiner Gegenwart niemals irgendwelche hörbaren zukünftigen Reisepläne geschmiedet hat, was natürlich nicht heißt, dass er nicht darüber nachgedacht hätte, denke ich, beziehungsweise kein Verlangen nach irgendeiner Reise verspürt hätte. Kanada war das einzige Land, von dem er mir jemals erzählt hatte, er erwähnte es oft, da ein Großteil unserer Verwandtschaft dorthin ausgewandert war. Vielleicht bewahrte er dieses Reisegepäck also für seine Traumreise auf? Ich weiß es gerade wirklich nicht, kann ihn aber auch nicht fragen. Ich erinnere mich an diesen unförmigen Koffer schon aus meiner Kindheit, da in diesen wie von Zauberhand all unsere Sachen, die wir für einen zweiwöchigen Sommerurlaub brauchten, hineinpassten, und daher erschien er mir gerade wegen seiner Größe als bestmögliche Lösung. Ja, du kannst ihn haben, aber bring ihn mir zurück, lautete seine Antwort. Ich war froh und beschwingt, dass er zugestimmt hatte, denn dieser Koffer war nicht nur groß genug – ich muss das noch einmal betonen – für alles, was ich mitnehmen wollte, dachte ich, vielmehr war er auch ein Teil unserer Familiengeschichte, unserer gemeinsamen Reisen. Dadurch würde mir, so glaubte ich, der Aufenthalt in der Fremde leichter fallen. Ich werde einen Gegenstand haben, der in direkter Verbindung zu meiner Vergangenheit steht, zu dem, was ich bin, was ich zu sein meine. Aber im Moment erinnere ich mich nicht daran, genauso wenig wie an die Familienurlaube im August. Der Koffer ist alt, hat ein hohes Eigengewicht und ich muss alle zehn Meter stehenbleiben, um ihn in die andere Hand zu nehmen. Endlich stehe ich vor dem Glasportal des Bahnhofs und trete in die Eingangshalle, die mir vorher noch nie so hoch und geräumig vorgekommen war. Zu meiner Rechten, am Ende der Halle, führt eine breite Treppe in die erste Etage zum Bahnhofsrestaurant, aus dem man unscharf Radiomusik hört. Ich kann den Text nicht verstehen, und so erscheint es mir, als jaule die Sängerin zur Musik. Vor mir ist von einst zehn Schaltern aus weißem Marmor nur einer geöffnet, und auch an diesem steht niemand an. Überhaupt ist in der ganzen riesigen Eingangshalle, die, was mir jetzt erst klar wird, einem weißen Mausoleum ähnelt, niemand. Die Schalterbeamtin am einzigen beleuchteten Schalter telefoniert und raucht. Ich habe den Eindruck, sie schaue in meine Richtung. Fast unmerkbar fühle ich nach, ob meine Fahrkarte und mein Reisepass noch in der Jackentasche sind oder auf der kurzen Strecke von zu Hause durch den Busbahnhof bis zum Bahnhof auf merkwürdige Weise verschwunden sind, und nachdem ich mich vergewissert habe, dass sie an Ort und Stelle sind, nehme ich den Koffer und eile durch die Halle nach links in den unbeleuchteten Gang, der zu den Gleisen führt. Auch hier treffe ich niemanden und versuche mit Anstrengung, die Stufen zu bewältigen, da ich mehr Bücher als Kleidung mit mir herumtrage. Auf dem Gleis steht der Zug schon bereit, und ich nähere mich dem erstbesten Waggon, steige ein und schleppe den Koffer hinter mir her. Dann drehe ich mich zum Gleis um, als stehe dort jemand, von dem ich mich verabschieden wollte und bleibe eine Weile so in der Tür stehen, bevor der Zug anfährt, sehe aber nur ein leeres, graues und verlassenes Gleis, als würde niemand mehr irgendjemanden zum Zug bringen oder als sei ich der einzige Reisende. Der einzige verbliebene Reisende. Mein Blick bleibt auf der runden schwarzweißen Uhr haften, die an dem grauen Vordach zwischen den beiden Gleisen hängt, jenem Gleis, auf dem der Zug steht, von dem aus ich die Uhr betrachte und dem anderen, auf dem weder ein Zug steht noch Leute, die auf ihn warten würden. Das Uhrglas ist kaputt, und der kleine Zeiger fehlt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie weiterhin geht und ob ich dem Zustand der Uhr irgendeine Bedeutung beimessen sollte. Lieber wäre mir, ich würde etwas sehen, das ich als gutes Omen deuten könnte, das mich glauben machen würde, ich breche unter einem guten Stern zu dieser Reise auf. Plötzlich fährt der Zug mit dem vertrauten Ruck an, aber ohne den bekannten Pfiff des Bahnhofsschaffners, und meine Gedanken über die Bedeutung von Reisen und guten Sternen werden jäh abgerissen wie ein Spinnfaden. Ich bleibe noch ein paar Minuten in der Tür stehen, da ich mit dem Blick die Hochhäuser in der Ferne erfassen will, darunter mein weißes, und den Park, über dem der Zug beschleunigt, mir meine Stadt einprägen und die Lunge mit ihrer Luft füllen will (der Frische der Donau, wovon ich fest überzeugt bin, und nicht der Mischung aus Ruß und verbrannten Maiskolben, von denen auch an jenem Spätnachmittag die Luft erfüllt ist, eigentlich), mich von jedem und niemandem verabschieden will, mich an die Abenddämmerung und das Grau erinnern, das sich auf die Stadt niederließ, und selbst in ihrer Erinnerung bleiben. Und dann, während ich mich mit der rechten Hand am Griff festhalte, knalle ich die Tür mit der linken plötzlich zu und mache mich, den Koffer schleppend, auf zu den leeren und unbeleuchteten Abteilen.
Tizians himmlische und irdische Liebe lässt Ihnen seit der Kindheit keine Ruhe?
Wo ist sein Raum für Trauer in diesen Tagen? Ein Raum, in dem er sich mit ihr ohne Schmerz und Trauer befände, in dem er aber gleichzeitig trauern und um sie weinen könnte? Während seiner Hungarologie-Studien hat er bei Kostolányi (der, wenn ihn jetzt jemand nach seine Meinung fragte, zuckersüß war) gelesen, dass die Toten nur in unseren Herzen eine Adresse haben. Das klingt für ihn jetzt banal und süßlich bis zum Erbrechen, aber so lautete der Satz, wenn er sich richtig erinnert. Und er ist nicht sicher, ob er erleichtert ist, nur weil er weiß, wo ihre Adresse ist. Zerrissenheit. Der geplatzte Gral. Ein Stachelfeld, über das er jeden Tag barfuß schreitet. Er denkt über sie nach, als lebe sie noch, weint aber gleichzeitig um sie, weil sie tot ist. Er ist in derselben Wohnung geblieben, mit denselben gemeinsamen Gewohnheiten, als würde sie morgen zurückkehren, weint aber gleichzeitig um sie, weil sie tot ist. Er fragt mich, wie er sie ansprechen soll, ohne dabei sich selbst anzusprechen. Er sagt mir, nein, er wiederholt sich ständig, immer das Gleiche, er fühle sich verloren und einsam. Er raucht und trinkt jeden Abend, nicht gerade in Maßen, aber ausdauernd und diszipliniert. (Schließlich hat er nicht umsonst als Obergefreiter bei der Jugoslawischen Volksarmee Disziplin gelernt und sich manisch an sie gehalten!). Verloren und vereinsamt. Das sagt er mir nicht, man sieht es ihm eindeutig an, wenn ich ihn mir so anschaue. Er raucht und trinkt, wenn er von der Arbeit aus der Bibliothek zurückkehrt. Nur auf diese Weise kann er den bleiernen Abend ertragen, der auf ihn herabfällt, und nur so stürzt er nicht in die Abgründe der Nacht. Auf der geräumigen Terrasse ist er von Zypressen und Sternen umgeben. Verloren und vereinsamt, so fühlt er sich, obwohl das Lächeln auf seinem Gesicht bei der Verabschiedung täuschen kann. Weder die Zigaretten noch der Wein bekommen ihm dieser Tage. Er hustet ständig. Sein Kopf tut weh, er klagt darüber, den Eindruck zu haben, dieser höre gar nicht mehr auf zu schmerzen, aber weder der Morgen noch der Abend tun ihm gut. Er hat also gar keine Wahl. Verloren und vereinsamt, wie er mir gegenüber betont, tut er jedoch auch nichts, um das zu ändern, denn er kann es nicht, und irgendwie verstehe ich ihn auch, obwohl ich ihn nicht mit der Tatsache zurechtweise, es gebe kein ich kann nicht, im Gegensatz zu ich will nicht. Er findet keine Erklärung für sein Bedürfnis, in den bekannten Zustand der Verzweiflung und des nahezu körperlichen Schmerzes zurückzukehren. In das bekannte Trauma. Durchzudrehen. Je häufiger er sich alltäglich daran erinnert, durchlebt er ihr Leiden wieder von neuem. Ihre körperliche Hölle. Die Hölle, in die ihre Seele hinabgestürzt war. Auf dem Krankenbett. Von dem sie am Ende monatelang nicht aufstehen konnte. Er war ein hilfloser und wahnsinnig gewordener Zuschauer und Betrachter, und nicht jemand, so denkt er, der sie heilen sollte und musste. Oder wenigstens eine Art für sie finden, geheilt zu werden. Er hat es nicht begriffen. Hat er gezweifelt? Es muss Zeichen oder Andeutungen gegeben haben. Oder nicht? Und wann? Und welche? Er hat versagt. Schlicht und einfach gesagt. Er, der Verräter. Er, der Einzige. Er kann all ihre Monate nicht so einfach hinter sich lassen, das spürt er, er denkt nicht. Er kann sie nicht vergessen, auslöschen. Er kann sie nicht ganz allein auf der weiten Flur des Vergessens lassen. Er will es nicht, er kann es nicht, und er versucht auf vielerlei Weise das Grauen zu mindern, das sie gelebt hat, und an das er sich noch sehr gut erinnern kann. Von dem er glaubt, sie habe es gelebt. Sie hat die Hölle durchlebt, physisch und psychisch, sagt er mir sofort darauf und fragt mich, ob ich wisse, wie viele Dreiergruppen von Tagen in diesen elf Monaten stecken? Ungefähr einhundertundzwölf, antwortet er statt meiner selbst. Nie hat sie nach drei Tagen Erlösung erlebt, nie Erleichterung, und sie war elf Monate gekreuzigt. Und dann fragt er mich rhetorisch, ob er ihr Leiden nur verlängert, ob er ihre Hölle, ihren Schmerz nur fortsetzt, auch weiterhin, wenn er darüber nachdenkt, redet? Sie hat das größtmögliche Leiden durchlebt und es als Strafe empfunden. Strafe wofür, fragte er sie einmal und bekam keine Antwort. War nicht all ihr Leiden ein klares Zeichen der Abwesenheit Gottes? Seiner Nicht-Existenz oder Seiner unbegreiflichen und skandalösen Gleichgültigkeit? Der Schmerz, der noch größer und furchtbarer ist, eben weil er der offensichtlichste Beweis Seiner Abwesenheit ist? An den sie glaubte und ihn anrief? Der sie ohne Antwort zurückließ? Sie verließ? Aber ich kann sie nicht einfach so zurücklassen und aufhören, über all das zu reden, denn das würde heißen, dass ich aufhöre, jenen zu beschuldigen, den sie angerufen hat, der aber nicht antwortete, sondern sie allein ließ, sagt er oft laut vor dem Spiegel, gesteht er mir eines Abends auf seiner Terrasse. Er klagt ihr Schicksal an, verflucht sich selbst, zitiert die menschliche Ohnmacht. Wenn er sich zwingen würde, jene zwei letzten Jahre ihres Lebens zu vergessen, die der Horror waren, wenn er sich nicht mehr daran erinnern würde, würde das bedeuten, dass er nicht versucht, das zu verstehen, was man weder aus der noch aus irgendeiner anderen Perspektive verstehen kann, was man nicht vergessen kann, was durch nichts entschuldigt werden kann. Die Metaphysik kann vielleicht einen Trost bieten, aber einen falschen, fügt er direkt hinzu, und zwar nur für diejenigen, die nicht leiden, weder physisch noch psychisch. Diejenigen, die kein direktes Objekt und auch kein Subjekt metaphysischer Fragen sind. Die Metaphysik versagt vor der Physik des Schmerzes und des Leidens. Jedoch sagt er und stellt mir, als habe er mich eben nicht gefragt, wieder dieselbe Frage, in welchem Maße er selbst ihr physisches Leiden, ihr psychisches Leiden nährt und verlängert, indem er darüber redet, sich daran erinnert? Indem er ihnen Raum gibt, seinen ganzen zeitlichen und mentalen Raum? Damit aufzuhören würde doch bedeuten, auch mit der Erinnerung an seine A. aufzuhören? Und erreicht man gezielte Amnesie? Sich an dies erinnern, an das andere nicht? Ist das denn kein Trugbild, was er von ihr erhalten will? Ein manipuliertes Fragment, vergrößert bis zum Maßstab des Gesamtbildes? Wo das Leben kein Ende hat, sondern ohne Erklärung endet, mit einem unklaren und märchenhaften Ende? Wäre es möglich für ihn, nur darum zu wissen, um dieses Nicht-Ende, und nicht um alles andere? Könnte er dann damit leben, wohl wissend, dass das nur ein Teil ihres Lebens ist? Könnte er dann leichter damit leben, dass sie nicht mehr da ist? Genauer gesagt: Könnte er leichter leben? Denn darum geht es ja, um das Leben trotz alledem, dessen er sich nicht sicher ist. All dies schießt ihm durch den Kopf, während er sich im großen Spiegel ihres gemeinsamen Badezimmers betrachtet. Er sollte sich mal rasieren, sieht aber nur seine dunklen Augenringe, den schwarzen, bereits mit Schnee durchwirkten Stoppelbart, seinen mageren Torso, sowie das saubere Hemd, die Hose und die Unterwäsche hinter sich auf dem Schrank. Die sie so an ihm mochte. Er steht im Strudel und wartet darauf, an die Oberfläche des Tages zurückzukehren. Von Zeit zu Zeit wird er mit der Genauigkeit eines Metronoms von der Vergangenheit aufgesaugt, die ihn auf spitze, salzige Klippen wirft. Die Wellen bedecken ihn, stark und unvorhersehbar. Später steht er da, mit Wunden übersät. Verloren und vereinsamt. In einer Wüste, die keine Wüste ist. Einer Welt, die keine Welt ist. Sie ist ganz ausgefranst, weit und breit ist niemand. Nur er, in der finsteren Leere. Dem Abgrund der Einsamkeit. Auf einmal wird ihm klar, dass er sich zu dem Treffen in der Stadt verspäten wird, mit einer Frau, die in derselben Bibliothek arbeitet. Aber er beeilt sich nicht, es gibt keinen Grund mehr für Eile. Passione, fuoco, ardere, fiamme, bruciare, waren zu unbekannten Wörtern für ihn geworden. Die Zeit, die er mit dieser verbringt, wird aus dem Raum der Trauer und des Schmerzes nach jener herausgerissen, die nicht mehr da ist. Das ist ihm klar, er macht sich nichts vor. Er versteht es, vor Trauer und Schmerz zu fliehen. Vor Verzweiflung und Schmerz zu fliehen. Und in diese Beziehung. Was ihn bei all diesen Fluchtversuchen wundert, ist, dass er den Sex mit anderen Frauen nicht als Betrug an ihr erlebt. Aber er ist auch nicht froh oder glücklich, mit keiner von ihnen. Später ist er nur noch verzweifelter. Er vergisst nicht, er kann und will nicht vergessen. Er spielt ein Spiel mit sich selbst, in dem er der einzige Verlierer ist, da er hofft, da er gerne unter seiner Hand ihren Hinterkopf spüren würde, mit seinem Bauch ihren Bauch spüren, mit dem Fuß ihre Füße spüren, ihre Hüften erkennen, mit seiner Zunge die Rauheit und Form ihrer Zunge erkennen, in ihre Augen schauen würde. Und er hat keine Gewissensbisse deswegen, wegen der anderen Frauen. Dragan, sein Kindheitsfreund, antwortet ihm bei einer spätabendlichen Taxifahrt in die Stadt, er treffe sich wahrscheinlich mit all diesen anderen Frauen, da er den Tod gesehen habe und sich nun in das Leben flüchte, das die anderen Frauen darstellten, und glaube, er werde es in ihnen und mit ihnen finden. Yin und Yang wechseln sich ab, wie Thanatos und Eros im Leben. Er ist sich nicht sicher, ob Dragan recht hat. Er hat nicht den Tod gesehen, sondern das langsame, schmerzhafte Sterben der Frau, die er liebte. Er denkt, glaubt, weiß, dass er sie liebte. Dragan gibt er keine Antwort, er schweigt. Das wollte er nicht von ihm hören, er weiß aber auch nicht, was er genau von ihm oder von irgendjemand anderem hören wollte. Dass sie morgen zurückkehrt? Dass dies ein schlimmer Traum ist, aus dem er, sozusagen jetzt, aufwacht, und alles würde sein wie zuvor? Dass es so sein musste? Dass wir nicht imstande sind, die Pläne des Herrn zu ergründen? Er schaut durch das Taxifenster und erkennt die Straßen von Novi Sad nicht mehr. Er sieht nichts, er hört nur: Kannst du mir eine Spritze geben? Ich habe Schmerzen. Und er packt sich am Kopf, ohne Kraft, aufzuschreien, ohne Kraft, zu brüllen neinneinneinnein. Einige Tage später erzählt er mir in Florenz, es sei eine große Enttäuschung für ihn, dass er sich selbst nun definitiv eingestehen muss, weder Orpheus noch jemand ähnliches zu sein, sondern nur ein poeta minor der in den Abgrund der Erinnerung und der Trauer gestürzt ist. Und er sagt mir niedergeschlagen und bedrückt, es sei absurd, dass er so unbegabt über sie schreibe, über seine Liebe zu ihr. Er versuche es, bemühe sich, sitze tagelang vor jedem geschriebenen Satz, sehe darin aber nur seinen Misserfolg. Kein einziger Satz entspricht der Wahrheit, dem, was tatsächlich in ihm und durch ihn fließt. Er stellt sich vor, das es Sätze mit der gleichen Intensität, Harmonie und ähnlicher Nostalgie, Melancholie und Freude sein müssten, aber mit seiner Nostalgie nach ihr, seiner Freude, die er mit ihr gelebt hat. Wie zum Beispiel die Metamorphosis von Glass oder irgendwelche Verse von Robert Hass. Aber in seinen Sätzen, so scheint ihm, liegt weder die reine Intensität der Liebe noch gibt es darin überzeugende Beschreibungen und Erinnerungen an die für immer verlorene Harmonie, und auch keine überzeugend dargestellte Sehnsucht nach der Freude, die vergangen ist und nie zurückkehren kann. Diese Sätze erlebt er, indem er sie laut liest um sie auf diese Weise zu erleben und zu bewerten, jedes Mal lediglich als eine unendliche Aneinanderreihung von Banalitäten und süßem Kitsch eines zweitklassigen Dichters, dem es schwerfällt zuzugeben dass diese Sätze, über denen er tagelang sitzt, die er wochenlang ausgedacht und in kleinere oder größere Versgruppen zusammengefügt hat, die das Erhabenste überhaupt an Oden über die Frau, die er geliebt hat – beziehungsweise liebt – sein sollten, ein völliges und unzweideutiges Fiasko der Literatur an sich sind. Wut ist nicht erhebend, genauso wenig, wie Leid erhebend ist – dieser Gedanke kommt ihm eines Tages – aber die Liebe ist es. Allein, er schreibt immer noch aus Wut über ihr Leiden und ihr zu kurzes Leben. Allerdings ist diese Wut vermischt mit Schmerz um sie, und das ist offensichtlich, aber die Wut überwiegt doch, schließlich ist sie die treibende Kraft für alles. Er sagt mir, er kämpfe noch immer gegen das Geschehene, er kämpfe noch immer darum, dass das Geschehene nicht geschieht. Und sofort danach denke er intensiv nach und frage sich unaufhörlich, und so wolle er auch mich bei dieser Gelegenheit fragen – si deus, unde malum? Und er wisse die Antwort nicht, und ich wisse die Antwort wahrscheinlich auch nicht, so wie sie die viel Gelehrteren schon seit ewigen Zeiten nicht wussten und auch nicht im Wesentlichen begründen konnten, denn keine metaphysische oder ideologische Antwort ist wirklich befriedigend. Die Antwort auf die Frage, die ihm nicht nur wichtig war, sondern am wichtigsten und unentbehrlichsten. Vielleicht könnte er erst dann begreifen. Sich damit abfinden. Auch sich selbst verzeihen, dass sie gelitten hat. Und er sagt mir, er sollte wahrscheinlich eine andere Form finden für das, was er erzählen will, notieren will. Eine andere Form als Gedichte, davon ist er fest überzeugt. Eine andere Form, um sie anzusprechen. Gedichte kann man nicht mehr schreiben. Obwohl er sich das sehnlich wünschen würde, sieht er momentan nur eine definitive Unmöglichkeit, sie zu schreiben. Wenn die Muse stirbt, hört die Sprache der Poesie auf zu existieren





























