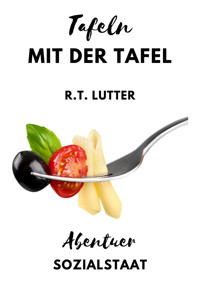
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kein Geld, keine Arbeit und eine hungrige Mitbewohnerin, die nur das Beste will? Gemüse muss her, Kräuter und Schokolade. Bei der Tafel gibt es alles, fast umsonst. Darf's noch ein bisschen Demütigung sein? Gern, aber hinten anstellen. Dankbarkeit ist Trumpf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Dienstag, 8. Januar
Freitag, 11. Januar
Samstag, 12. Januar
Dienstag, 22. Januar
Mittwoch, 23. Januar
Freitag, 25. Januar
Dienstag, 29. Januar
Freitag, 1. Februar
Samstag, 2. Februar
Dienstag, 5. Februar
Mittwoch, 6. Februar
Freitag, 8. Februar
Freitag, 15. Februar
Dienstag, 19. Februar
Mittwoch, 20. Februar
Freitag, 22. Februar
Dienstag, 26. Februar
Freitag, 1. März
Freitag, 8. März
Dienstag, 12. März
Montag, 18. März
Dienstag, 19. März
Montag, 25. März
Dienstag, 26. März
Mittwoch, 27. März
Dienstag, 9. April
Freitag, 12. April
Dienstag, 16. April
Freitag, 3. Mai
Dienstag, 7. Mai
Freitag, 10. Mai
Dienstag, 14. Mai
Dienstag, 21. Mai
Freitag, 31. Mai
Dienstag, den 4. Juni
Donnerstag, 27. Juni
Dienstag, 2. Juli
Mittwoch, 3. Juli
Samstag, 6. Juli
Impressum
Vorwort
Keine Arbeit, kein Geld und eine unzufriedene Freundin?
„Geh doch zur Tafel!“, sagte ein Kumpel, von dem ich weiß, dass er es selbst nie täte. Braucht er auch nicht, er hat Hühner und Schafe.
Abtauchen in die Tiefe der Gesellschaft? Würde nicht alles noch schlimmer werden?
Ich wappnete mich mit Humor als Schild, schärfte die Lanze des Witzes, setzte mir den Helm der Gelassenheit auf, bestieg mein klapperiges Fahrrad und ritt dem Feind entschlossen entgegen.
Ein halbes Jahr habe ich meine Erfahrungen getreu notiert, wie jeder Abenteurer, der in unbekanntes Gebiet vordringt. Es war so ...
Dienstag, 8. Januar
Heute gab es allerlei Leckeres, aus dem ich ein nicht unschmackhaftes dreigängiges Abendessen bereitet habe. Als Entrée servierte ich glutenfreies Dreikornbrot aus Reis, Hirse und noch einem sehr seltenen Korn, mit Ricotta und frischen Minzblättern. Dazu gab es zwei Scheiben hauchdünne Entenbrust. Das Hauptgericht war geschmorte Champignons zu Fusilli mit Blumenkohl. Zum Nachtisch gab es Quark mit Bananen und Apfelsinen. Meine Freundin war es zufrieden, wiewohl man sagen muss, dass sie großzügig ist und mit direkter Kritik an meinem Kochen sparsam umgeht. Unser Leben ist durch die Tafel verbessert, ja unser Zusammenleben im Grunde gerettet worden.
Wir hatten eine schöne Wohnung bezogen im Zentrum von dem Städtchen Bad Münstereifel in unmittelbarer Nähe der romanischen Stiftskirche, deren Glocken uns jeden Morgen daran gemahnten, dass ein neuer Tag begonnen hatte, den es zu gewinnen galt. Müde wünschten wir uns Guten Morgen und begannen ihn so gut es ging. Meine Freundin ging zunächst zum Kaffee in der Küche, von dort zur Arbeit. Ich widmete mich dem Morgengebet, wobei ich bemerkte, dass mir der Kopf schwer war und inwendig dröhnte. Eine Grippe kündigte sich an. Vielleicht hatte ich gestern doch zu lange im Schnee gestanden, den Stockenten zugeschaut und den weißen Kirchturm betrachtet, während ich darauf wartete, dass Kalle einen guten Griff tat und mit seiner kräftigen Stimme von der Treppe hinunter „25!“ rief.
Dann konnte ich nämlich die Treppe hinauf steigen, mein grünes Kärtchen mit der geforderten Nummer einhändigen und wurde eingelassen in die Tafelrunde, wo graubärtige Recken und stämmige Frauen jeden Ankömmling nach Würde und Verdienst oder auch nach Laune und Gutdünken gaben, was er brauchte oder auch nicht. Joghurt zum Beispiel brauchte ich nicht. Es war heute das dritte Mal, dass ich hier war und ich hatte schon gelernt, dass bei dieser Tafel in Iversheim, ganz wie an jener des Artus, Höflichkeit und Sitte die vorherrschenden Tugenden waren. Auch Tapferkeit. Natürlich, denn wenn man das alles essen soll, was andere schon Tage vorher nicht mehr kaufen wollten…
Dennoch, eine unverschämte Bemerkung wie: „Ne, so was esse ich nicht.“ konnte übel aufgenommen werden. Auch die unbezwungene Gier, die einen verleiten mochte zu früh an dieser ersten Station nach etwas bestimmten zu fragen, geriet möglicherweise zum Nachteil. Sitte am Hof ist es, gebührend zu warten bis der Mitarbeiter, Helfer, ritterliche Knecht oder schlicht Ehrenamtliche einem etwas anbot, das man im Regelfall dankbar und höflich annahm und nur ausnahmsweise freundlich zurückweisen konnte.
Aber ich bin vom Thema abgekommen, eigentlich wollte ich von der Grippe berichten, an der Kalle Schuld war, gewissermaßen. Kalle, ein lieber tätowierter Glatzkopf mit einem Ring im Ohr, kräftig, Respekt gebietend, hatte sich diese ausgezeichnete Position oben auf der Treppe verschafft. Eine unscheinbare und doch die alles beherrschende. Denn ob man rasch davon ziehen konnte, mit Tüten bepackt, mit Rucksack oder Karton beladen, oder ob man mehr als eine Stunde lang wartete und zusah wie andere das Beste davon trugen, an wem hing es, wenn nicht an Kalle, der dem Glück seine schwere, abgearbeitete Hand lieh? Immerhin behandelte er mich nicht allzu stiefmütterlich. Beim letzten Mal hatte er es einem kleinen Mädchen überlassen, der Tochter einer unerschrockenen Harz VI Empfängerin. Ich war der letzte, der nach 1 ½ Stunden zur Ausgabe schritt. Besser Kalle. Nun lag ich also im Bett und hatte die Grippe. Das war nicht weiter schlimm, denn arbeiten musste ich ja nicht. Nur lästig war es. Da kam mir eine Idee: Hatte ich nicht am Tag zuvor auch einige frische Minzblätter erbeutet, zusammen mit anderen leckeren Küchenkräutern wie Majoran – die Hälfte war noch brauchbar – Thymian, Oregano, Salbei, wie frisch gepflückt, und Petersilie?
Fein säuberlich hatte ich die noch verwendbaren Stängel der Minze in ein Wasserglas gestellt. Der Tee daraus sowie einer der sechs leckeren Äpfel, die ich ergattert hatte, belebten mich. Apropos sechs. Wenn Kalle eine Nummer ausrief und es war die sechs, dann unterließ er es nie dazu zu bemerken. „Also ich meine sechs, nicht Sex. Ha, ha.“ Ein lustiger Bursche, der Kalle. Und die umstehenden Frauen um ihn herum lachten auch immer. Gab es dafür Kaviar? Ich weiß es nicht. Es wurde hin und wieder gemunkelt, dass es bei der Verteilung nicht immer mit rechten Dingen zuginge.
Ich hielt mich etwas abseits, befreundete mich mit der Grippe und hing meinen Gedanken nach. So vieles geht einem durch den Kopf, wenn man müßig herumsteht und wartet. Unsinnige Gedanken wie zum Beispiel, ob es richtig sei, dass in Deutschland die Hälfte aller produzierten Lebensmittel gegessen werden. Immerhin, kann man sagen. Die andere Hälfte wird weggeworfen. Ist das fein? Und dabei geben wir uns soviel Mühe bei der Tafel! Also die Hälfte der Lebensmittel wird weggeworfen. Da kann man sich vorstellen, dass die Händler und Lebensmittelverkäufer weit mehr als das Doppelte, ja das Dreifache im Schnitt, wie ich einmal gehört habe, für beispielsweise einen Apfel nehmen müssen, als sie im Einkauf bezahlen. Kein Wunder also, dass Äpfel so teuer sind, außer man bekommt sie geschenkt. Das wiederum heißt, dass die Produzenten sehr wenig dafür bekommen, was wiederum heißt, dass sie sehr billig produzieren müssen, woraus folgt, dass die Qualität nicht besonders gut sein kann. Wer einkauft, kauft also teuer schlechte Ware. Ich war zufrieden. Ich hatte ein schwieriges Problem in meinen Augen gelöst. Über den tieferen Sinn mögen andere nachdenken. Ich bin nur Hartz-IV-Empfänger.
„23!“ Wieder nichts. Im Grunde, dachte ich weiter, wäre es ja nicht weiter schlimm. Uns Deutschen ist Essen nun mal nur quantitativ wichtig und dass es gut ausgeleuchtet im Supermarkt steht. Peinlich ist nur, wenn peinlich das richtige Wort ist, dass anderswo – also nicht gerade in Iversheim, da gibt es ja auch die Tafel – dass anderswo andere Menschen aus anderen Ländern keine Tafel haben und Hunger leiden.
Während dieser Gedanken war ich näher an das Wasser herangetreten und die Stockenten kamen erwartungsfroh auf mich zu geschwommen. ‚Ne, ihr kleinen Schmarotzer, dachte ich, ihr kriegt kein Brot. Ihr kackt bloß das Gewässer voll und dann kippt es um und ihr mit ihm. Sucht euch mal schön selber euer Futter!’
Man stelle sich vor, so ungerechte Gedanken hatte ich. Aber wie auch nicht in einer Welt voll von Ungerechtigkeit. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, am Ufer. Am anderen Ufer, da ist die Armut. Mein Blick fiel auf einen der Kartons mit braunen Bananen und mir kam ein schöner und praktischer Gedanke: Wenn es doch im Sinne der Globalisierung opportun ist, grüne Bananen von Afrika nach Deutschland zu verschiffen; wenn es doch für alle am besten ist sie im Regal nachreifen zu lassen und sie, sobald sie wirklich reif sind, nämlich braun gesprenkelt wie mir einmal ein Afrikaner unter dem Siegel der Verschwiegenheit verriet, sie dann auszusortieren, weil sie dem deutschen Konsumenten nicht mehr zuzumuten seien, könnte dann nicht eine Hilfsorganisation, die gereiften Bananen wieder nach Afrika zurückbringen und dort verteilen?
Beim besten Willen, wir in Iversheim, wir können nicht alles essen, was andere wegwerfen und die Afrikaner wissen die braunen Bananen zumindest zu schätzen und zur Not kochen sie sie. Wir sitzen doch irgendwie alle in einem Boot und das Obst und Gemüse aus den ärmeren Ländern wegzuwerfen, das ist nicht schön. Da müssen die Asiaten und Südamerikaner auch mal mit ran. Wir in Europa können nicht alles alleine schaffen! Trotz König Arthur, trotz der Tafel.
Freitag, 11. Januar
Mir ist schlecht. Ich schaffe es nicht. Unser Kühlschrank quillt über und ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Ein Teil der guten Kräuter habe ich gewaschen und klein gehackt, wie es meine Freundin gesagt hatte; dann trocknen lassen, in Gefrierbeutel gepackt, beschriftet und in das kleine Gefrierfach gestopft. Sie hat einen sadistischen Zug. Ich wünschte, ich hätte Arbeit! Die Grippe steckt immer noch in mir. Ich glaube, es ist die Ernährung. Ich schaffe es nicht. Ich werde heute nicht zur Ausgabe gehen. Ich schwächel. Ich bin ein Arbeitsverweigerer, ich weiß. Es ist meine Pflicht alles zu essen, was für armselige Existenzen zur Tafel gekarrt wird.
Die Brötchen sind hart. Ich hätte sie nicht auf die Heizung legen sollen. Diese Fertiggerichte von Rewe bringen mich noch um. Ich kann keinen Salat mehr sehen. Ich wünschte, ich hätte Kaninchen. Kaninchenzucht, das wär’s! Wenn ich all den Salat verfüttern würde, dabei könnte man steinreich werden, irgendwie. Aber dann wäre ich unschlagbar reich und könnte nicht mehr zur Tafel. Und wo kriegen die Kaninchen dann ihren Salat her? Oder Möhren? Meine Freundin sagt: „Wenn Sie das Gemüse waschen und schälen, hält es sich länger im Kühlschrank.“ Ist das sinnvoll? Ich muss bald wieder zur Tafel. Adel verpflichtet.
Trotz aller Schwierigkeiten: Ich bin der Tafel dankbar. Ohne sie wäre das Zusammenleben mit meiner Freundin unmöglich. Sie beteuert, sie habe nicht die geringste Lust mich durchzufüttern, dabei koche ich für sie und wasche ab. Sie behauptet auch, ich esse mehr als sie. Das ist absurd, aber wer will mit Frauen diskutieren? Durch die Tafel leben wir im Überfluss. Ich schaffe Nahrung herbei, genug für Wochen und eine fünfköpfige Familie. Sie könnte zufrieden sein. Aber heute? Wie machen die anderen das? Mein Magen ist all die abgelaufenen Lebensmittel noch nicht gewöhnt.
Doch irgendjemand muss sie essen, sonst kracht das System zusammen. Ich meine, eine Gesellschaft, die soviel wegwirft, während andere hungern, muss doch zugrunde gehen, wegen moralischer Inkompetenz oder so. Nur die Tafeln halten uns noch am Leben. Wir müssen essen, damit der Supermarktmanager weiter guten Gewissens für glänzende, stets frische Ware sorgen kann; wir müssen essen, damit die ehrenamtlichen Rentner ein gutes Werk tun können. Wir löffeln den Joghurt aus, damit es weiter geht, damit der Kapitalismus keck behaupten kann: Wir schaffen Wohlstand! Mir ist schlecht. Aber das ist meine Schuld. Ich bin es nicht wert an der Tafel zu sein. Ich werde arbeiten gehen.
Samstag, 12. Januar
Ich hatte mir vorgenommen nur an den Tafeltagen zu schreiben, dienstags und freitags, an den Tagen, an denen sich die Edlen und Hungrigen versammeln. Das schien mir würdiger. Aber nachdem ich gestern keine Gelegenheit zu neuen Einsichten hatte, muss ich eben alte verbraten. Heute geht es mir besser. Ich habe ein Ei gekocht von der Tafel. Natürlich hatte ich es angepiekst, dass die Luft entweichen kann. Trotzdem zeugte das Vibrieren des Deckels nach zwei Minuten von einem Missgeschick. Der untere Teil des Eies war – wahrscheinlich durch außerordentliche Gasentwicklung – schier weggesprengt und so quoll das Eigelb in das kochende Wasser. Nicht ohne Kühnheit meine ich, habe ich es dennoch gegessen und es tat mir gut. Ich fühlte mich wieder stärker. Am Nachmittag buk ich Pfannkuchen. Zwei Eier niederländischer Herkunft lauerten noch im Kühlschrank. Ich schlug sie auf. Zwei orangefarbene Dotter rollten umgeben von klarem Eiweiß in die Schüssel. Das war vielversprechend. Ich schlug sie mit Zucker auf, der von meiner Freundin stammte und keinerlei Risiko barg. Ich schlug sie lange und dachte dabei an Goethe. Es musste Luft ran. „Luft, Clavigo, Luft!“ - die Grundlage jedes gelungenen Pfannenkuchens.
Menschen, die Backpulver an den Teig mischen, beim besten Willen, ich kann das nicht schätzen. Buttermilch ist eine gewandte Alternative. Sie macht den Pfannkuchen locker und luftig. Leider hatte ich keine, also schlug ich und schlug ich bis meine Freundin sagte: „Sie haben jetzt genug geschlagen.“ Und da sie Konditormeisterin ist, befolgte ich ihren Rat. Als sie kurz darauf die Küche verließ, konnte ich die letzte der reifen Bananen in den Teig schneiden.
Es war einmal eine Banane gewesen von erstklassiger Qualität, Chiquita ihres Zeichens. Der alte Werbespruch, der eine Generation von Bananenessern beherrscht hatte, erfüllte sich endlich an dieser Frucht: denn - ‚nie Chiquita nur Banane‘. Ich wollte gar nicht wissen, was sich alles in den tiefbraunen, matschigen Stellen noch verbarg. Und doch – er geriet köstlich der Pfannkuchen. Es ist wohl wie bei der Weinernte, bei der zahlreiche Reben mit eingesammelt werden, die schon verfault und schimmelig sind, aber durch die Gärung gleichsam geläutert werden. Selbst der Schimmel wird zu köstlichem Wein. So auch bei matschigen Bananen im Pfannkuchen. Ich bestrich ihn mit leckerem Honig, streute wohl auch noch eine Prise Zimt darüber und meine Freundin lobte ihn. Eigentlich wollte ich Rückschau halten, in mich gehen, mir klar darüber werden, was bisher alles bei der Tafel geschehen war, bevor ich wieder nach vorne Blicke. Ich habe Zeit, bis Dienstag. Dienstag ist Tafeltag.
Wie war mein erster Eindruck? Was waren meine Gefühle und Gedanken bei der ersten Begegnung?
...
Ich hatte einen kleinen Umweg gemacht mit dem Fahrrad, scheu hatte ich mich den Auserwählten genähert. Würde ich würdig sein? Wie würde man mir begegnen? Mein erster Tag.
Nun, niemand kümmerte sich um mich. Ich stieg schließlich die Treppe hinauf, um mich anzumelden. Man muss nachweisen, dass man Hartz IV-Ritter ist: Eine Doppelnull, Lizenz zum Vernichten. Man wird in eine Liste eingetragen, die hoffentlich sehr, sehr geheim gehalten wird; man bezahlt einen Euro, Familien zwei. Ich weiß nicht wozu. Vielleicht Schutzgebühr. Dass nicht irgendjemand auf die Idee kommt irgendetwas von dem, was weggeworfen werden sollte, einfach nur mitzunehmen und – wegzuwerfen! Daher der Euro, nehme ich an.
Ich ging wieder raus und wartete. Dann trat eines der führenden Burgfräulein aus der Tür, nahm Haltung an oben auf der Treppe und hielt eine flammende Rede: „Es ist wieder mal das Gerücht aufgekommen, wir (wir Edlen von der Brotverteilung) würden Geld nehmen für unsere Arbeit!“ (Dramatische Pause) „Dem ist nicht so.“ (Pause)
Wusste sie nicht weiter oder wollte sie dem Volk Gelegenheit geben zu Beifallsbekundungen, Zurufen, spontanen Gefühlsausbrüchen? Tatsächlich, eine meldete sich schließlich und fragte zaghaft: „Wer sagt denn so was?“ „Ich weiß es nicht“, klang es von oben herab, „aber das Gerücht ist nun mal da. Wir hielten wir es für besser ihm entgegenzutreten.“
(Bedeutungsvolle Pause)
Ich überlegte, ob es nicht besser wäre, wieder zu gehen. Dieser Auftritt hatte mich tief beeindruckt. Es kam, was kommen musste und eine Frauenstimme sagte: „Wir können doch froh sein, dass ihr das für uns tut!“ „Tja“, sagte die Stimme von oben, „ich sage nur, was ich gehört habe.“
Alles war wieder in schönster Ordnung und würdevoll schritt sie zurück in den Thronsaal. Aber das war nicht die einzige Misstimmung an diesem Tag. Es gibt nämlich zwei Ausgaben. Eine draußen, eine drinnen. Für die drinnen muss jeder Angehörige der Tafelrunde eine Nummer ziehen und warten bis ihm oder ihr das Losglück den Zutritt gewährt. Für das, was draußen steht, ist der Zugang frei, und Punkt halb eins bedient sich dort jeder wie er mag.
Wollte man bissig sein, könnte man sagen: Draußen stehe das Kaninchenfutter, drinnen das Schweinefutter. Draußen vorwiegend Salate und Kräutertöpfe, diverse Kohlsorten, manchmal auch Obst, wenn es überreichlich da ist; drinnen alles aus der Kühltheke, Brot und Brötchen, Gemüse, Obst, hin und wieder auch Tiefgefrorenes wie Pizza oder sogar Fleisch.
Bei der letzten Ausgabe jedoch war draußen wohl ein unsittliches Benehmen ausgebrochen. Clementinen hatten auf dem Boden gelegen, sogar Salatköpfe. Die Gier hatte obsiegt und man hatte den Anstand verletzt. Wie beim Buffet der Reichen und Unerzogenen hatte man sich darauf gestürzt und der Futterneid hatte die Früchte des Feldes zurück auf den Boden befördert. Ein Fauxpas, nein mehr als ein Fauxpas, ein Affront. Ein Affront der geahndet wurde, nämlich bei der nächsten Ausgabe, als die Nahrungssuchenden aufgefordert wurden, den Zugang dergestalt zu regulieren, dass immer nur einer zu dem Grünzeug schritt, während alle anderen in einer Schlange geduldig warteten.
Ich fand das groß. Wo sonst fand man auf so engem Raum das Wesen politischer Systeme und Ideologien so harmonisch miteinander vereint? Hier unten erlebte ich den Kommunismus pur in Form dieser Zuteilung und der strengen Aufseherin.
Während ich in der Reihe wartete, suchte ich Kontakt zu einem älteren Polen, der an diesem Tag sicherlich an die Zeiten dachte, als er noch jung gewesen war und täglich Schlange stehen dürfte. Im edlen Wettkampf stritten wir darum, wem die Ehre zuteil würde, den anderen vorzulassen. Der Pole ging als Sieger hervor, er war der Ältere, und so musste ich vor ihm durchs welke Feld der milden Gaben schreiten, wobei es mir eine Pflicht war, ohne zu zögern, rasch und zielstrebig, genau das zu nehmen, wovon ich hoffte, es vielleicht irgendwann einmal essen zu können.





























