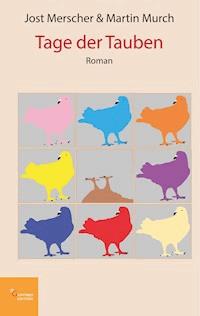
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Nacht taucht er auf: ein rätselhafter weißer Kubus. Wie vom Himmel gefallen, besetzt er eines Morgens einen Platz mitten in der Provinzhauptstadt Hannover - und verändert alle und alles. Jost Merscher und Martin Murch erzählen in ihrem Roman vom Irrwitz, der hinter dem Vorhang der Alltagswirklichkeit seine Streiche spielt, vom Zauber der Kunst und von der geheimnisvollen, bislang ver-borgenen Parallelgesellschaft
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Teil: Montag/Exposition
Teil: Dienstag/Komplikation
Teil: Mittwoch/Peripetie
Teil: Donnerstag/Retardation
Teil: Freitag/Katharsis
Schluss, Dank und Aufklärung
Über die Autoren
1. Teil
Montag / Exposition
1.
»Danklose Stadt«, murmelte Adam von Platen, nachdem er Punkt drei den Motor seines MAN Büssing 16.320 am Rand des Weißekreuzplatzes ausgeschaltet hatte.
›Danklose Stadt‹ – wahr wie vor hundert Jahren. Von Platen wusste, dass er das Richtige tat. Theodor Lessing, scharfsichtiger Analytiker des Haarmannprozesses, hieß seine Aktion gut. Adam konnte die Anerkennung des vorausschauenden Hindenburg-Porträtisten geradezu physisch spüren.
Als er nach rechts blickte, entsinnlichte sich Lessings noumenale Präsenz allerdings schlagartig. Neben der handfesten Realität der drei Ukrainer auf der Beifahrerbank – tief in die Stirn gezogene Wollmützen, untersetzt, Maurerpranken – hatte die geistige Idealität des Philosophen keine Chance, sich in der Welt der Erscheinung zu halten. Allerdings beherrschten die drei Osteuropäer trotz ihrer überlegenen Phänomenalität die deutsche Sprache nicht so souverän wie Lessing. Eigentlich konnten sie überhaupt kein Deutsch. Und wollten außerdem so schnell wie möglich wieder in ihr welthistorisch abgehängtes, russifiziertes, gerade noch im Nordosten der Ukraine gelegenes Heimatnest zurück.
Ideale Helfer.
›Danklose Stadt‹ – gemeint war natürlich die zum ersten und letzten Mal im sechzehnten Jahrhundert reformierte ehemalige Residenzstadt Hannover, die Generationen von Reiseführerverfassern in Sinnkrisen gestürzt und neue Berufe mit betonter Neigung zu Esoterik und Ästhetik hatte ergreifen lassen, Gastronom, Galerist, Quantenphysiker. Immerhin zeigte sich die Frühsommernacht wohlgesinnt. Der von seiner erhabenen aristotelischen Unveränderlichkeit überzeugte Himmel war Sternbild für Sternbild deutlich zu sehen, ein aus glücklicheren, mediterran-katholischen Landstrichen herbeigezogener Luftstrom floss zephirsanft durch die stillen, provinzstädtischen Straßenschluchten, und wer eine feine Nase hatte, konnte späten, wollüstigen Fliederduft riechen. Die meisten Fenster der den Platz säumenden vierstöckigen Häuser waren gekippt und schimmerten dunkel, glasreinigergeputzt. Keine Passanten, nicht einmal späte Zecher, frühe Selbstmörder oder aus der Zeit gefallene Liebespaare.
Hannoversche Nichtzeit zwischen Sonntag und Montag.
Der ideale Zeitpunkt.
Adam – kein reicher Baron, aber im besten Mannesalter – atmete tief durch, nachdem Benjamin Brittens ›War Requiem‹ verklungen war, das ihn während der Herfahrt aus der Lüneburger Heide begleitet hatte, wo er eine kleine, ländlich ruhige Möbeltischlerei betrieb, stieg bedächtig aus dem LKW und öffnete lautlos die beiden sorgfältig in ihren Scharnieren geölten Türschläge zum Laderaum. Wenn jetzt für eine Stunde niemand störte, würde er kurz nach Sonnenaufgang am groben, runden Holztisch seiner bäuerlichen Küche sitzen, eine aus Paris importierte Maïs-Gitanes rauchen und einen selbst gebrannten, in der alten Drückerkanne aufgegossenen schwarzen Kaffee trinken, während hier seine Arbeit zu arbeiten beginnen würde.
Erstaunlicherweise war selbst dann, als der nun entstehende Bau weit über die bedeutungslos gewordenen Grenzen Deutschlands hinaus warholsche Berühmtheit erlangt hatte, kein Augenzeuge seiner Aufrichtung noch überhaupt jemand zu ermitteln, der etwas über seine Planung oder Anfertigung hätte mitteilen können. Spätere Zeitungskommentatoren waren sich lediglich darin einig, dass der Aufbau perfekt vorbereitet gewesen sein musste.
Diese von den meisten Kunstkritikern für wenig relevant gehaltene Feststellung wurde von der hannoverschen Bürgerschaft in großen, polemischen Social Media- und Leserbriefschlachten allerdings unterschiedlich bewertet, je nachdem, ob man das Ergebnis als kriminelle Tat, dadaesken Ulk, subversives Attentat oder schöpferischen Akt verstand. Nahezu alle, die sich mit dem Fall beschäftigten, stimmten darin überein, dass der Bau nur von mehreren habe hochgezogen werden können.
Lediglich Hartmut Greiner, leicht adipöser Mittfünfziger mit hängenden Schultern, chronischer Bronchitis und der seltsamen Neigung, das eigene Leben ernst zu nehmen – als Parkettverleger mit ausgeprägtem Gespür für außergewöhnliche, aber politisch korrekte Hölzer zu einem für hannoversche Verhältnisse respektablen Wohlstand gekommen –, war selbst, als sonst niemand mehr an der Vielpersonenthese zweifelte, nicht von der Überzeugung abzubringen, dass nur ein einzelner den Kubus habe aufbauen können, weil kein Helfer so lange dichtgehalten hätte. Greiner arbeitete gelegentlich für städtische Behörden und wusste, was von menschlicher Verschwiegenheit zu halten war.
Der Aufbau war tatsächlich perfekt vorbereitet. Adam von Platen und seine Gehilfen hatten alles zur Hand. Die millimetergenau zugeschnittenen Leichtbauteile lagen wohlgeordnet auf der Ladefläche, die Akkuschrauber waren aufgeladen, jeder Handgriff saß. Sie überschritten die geplante Aufbauzeit nicht um eine Sekunde.
Um vier stand der Bau, ein handwerklich makelloser Kubus, lotrecht aufgerichtet mitten auf dem modisch kurz geschorenen Rasen des innerstädtischen Platzes, dessen einziger Schmuck ein betongraues Stück Berliner Mauer mit der dunkelgrauen Aufschrift ›MAHNMAL FÜR DIE OPFER VON MAUER UND STACHELDRAHT‹ war, an welches das städtische Denkmalschutzamt aus einer Laune delikater Ironie heraus ein weißes Blechschild mit der schwarzen Aufschrift ›PLAKATE ANKLEBEN VERBOTEN!‹ hatte dübeln lassen.
Spätere geodätische Messungen zu Land und aus der Luft ergaben eine Kantenlänge von exakt 4,791 Meter, 5,5 Zentimeter Wand-, Decken- und Fußbodendicke und, als erstaunlichstes Datum, die genaue Übereinstimmung der geometrischen Schwerpunkte der Gebäudegrundfläche und des katastrierten Terrains des Weißekreuzplatzes. Alle Wände waren innen wie außen vollkommen glatt und, seltsamerweise, in Reinweiß glänzend lackiert, RAL 9010. In die Decke waren zwei quadratische Oberlichter eingeschnitten (Seitenlängen 1,974 Meter), durch die man den gleichmäßig dahinziehenden Sternenhimmel sehen konnte.
Auf das Dach um die beiden Oberlichter herum hatte Adam Regenwasserrückhaltebleche (2,1 Zentimeter breit, 5,5 Zentimeter hoch) aus Aluminium und auf diese quadratische Abdeckungen aus bruchsicherem Spezialglas (Seitenlänge 2,207 Meter) auf je acht 23,3 Zentimeter hohen, 2,1 Zentimeter breiten quadratischen Aluminiumstangen aufgeschweißt. In der nordöstlichen Wand, deren Normalenvektor im Winkel von 46°54' zum Polarstern stand, befand sich eine 2,584 Meter hohe und 98,7 Zentimeter breite Aluminiumtür mit federgespanntem Bügel, die auch für Kinder leicht zu öffnen war und selbstständig zuschwang, außen an der Tür ein 13 x 34 Zentimeter großes weißes Emailleschild mit der Aufschrift ›KUNST‹.
Der Innenraum war leer.
Am groben, runden Holztisch seiner geräumigen Küche trank Adam zufrieden seinen starken, schwarzen Kaffee, rauchte eine Maïs-Gitanes und hörte sich Frank Sinatras ›In the Wee Small Hours of the Morning‹ an. Es war geschafft. Ein Bau, dessen wahren Urheber nie jemand kennen würde, war errichtet. Ein außergewöhnlicher, ein singulärer Bau.
Nicht unbedingt ein Raum für Kunst.
Mehr ein Kunst-Raum.
Was auch immer an, in und um ihn herum geschehen würde, es würde Kunst sein. Es wäre nicht mehr möglich, hier an diesem Ort nicht an Kunst zu denken – so wenig, wie seit Descartes bei der Betrachtung eines Kreuzes nicht an Mathematik zu denken.
Verweilen: Kunst.
Betrachten: Kunst.
Denken: Kunst.
Tanzen: Kunst.
Es sollte einige Stunden dauern, bis der Kubus zum ersten Mal von einem Fremden betreten wurde.
2.
Wie schon in den Nächten zuvor hatte Paul Schützengrabner – frühverrentet (Burnout), nahezu schuldenfrei (nur der 4K-Ultra-HD-LED-Fernseher und die Wohnung waren noch nicht abbezahlt), Grantler – wenig und schlecht geschlafen. Es war bereits hell, als er aufwachte. Halb fünf. Das übliche hässliche Frühvogelgeschrei. Heiß, schon jetzt 25 Grad. Er wickelte sich aus dem Betttuch, schlurfte zum Fenster, zog sich das blaue Arminia-T-Shirt aus und schrubbelte sich stöhnend den juckenden Rücken mit dem steif-kratzigen rosa Handtuch, das er gestern nach der Dusche an den Fenstergriff gehängt hatte. Immerhin ein wenig Lust.
Seit seine Frau ihn verlassen hatte, wachte er jeden Morgen klatschnass auf, winters wie sommers. Er war immer stolz auf seine Freigebigkeit gewesen, aber dieses Miststück hatte ihm im Abgehen gezeigt, was wahre Generosität ist. Wie selbstverständlich hatte sie ihm die geräumige, nahezu hypothekenfreie Dachgeschosswohnung voller Tinnef und Nippes überlassen, obwohl sie Anspruch auf die Hälfte gehabt hätte. Natürlich hätte sie das nicht getan, wenn ihr Neuer, ein uralter, verblödeter Witwer aus dem Kleefelder Philosophenviertel, dem sie das bisschen verbliebene Resthirn in alle Winde verblasen hatte, nicht steinreich gewesen wäre. Es war nichts als eine letzte Demütigung. So eine Schlampe! Richtig freuen an der Wohnung konnte Paul sich nicht.
Vom Fenster aus überblickte er den gesamten Weißekreuzplatz. Noch absolut nichts los, nicht mal der Zeitungsausträger war unterwegs. Nur die Scheißtauben pickten schon wie blöd zwischen den angeketteten Tischen und Stühlen der Straßencafés herum. Alles sah wie immer aus. Was hätte sich in der Nacht auch verändern sollen?
Da war aber doch was. Paul nahm die Hand aus seinen schweißnassen Boxershorts. Hatte das korrupte Bauamt jetzt doch das neue Klohäuschen aufgestellt? Klammheimlich, wie zu erwarten? Dabei hatten sie versprochen, erst die Anwohner zu fragen, ob das alte abgerissen und ein neues gebaut werden sollte. War denn das alte für die Protestcamper, die den Platz zu einem Saustall gemacht hatten, nicht gut genug? Was brauchten die ein modernes mit allen Schikanen? Natürlich, dafür hatten die Schwuchteln von der Stadt Geld. 90.000 Euro! Aber für die Kegelbahn, die er und seine Freunde sich wünschten, war keins da. Verlogenes Pack! In Schützengrabner stieg Wut auf. Wo war die Befragung? Dachten wohl, keiner würde sich beschweren. Nicht mit ihm!
Er ging an seinen Schreibtisch und schrieb eine orthographisch nahezu korrekte Mail an die HAZ. Sachlich bleiben! Jedenfalls so sachlich, wie der verletzte Gerechtigkeitssinn es zuließ. Man sollte ihm nicht unterstellen können, unzurechnungsfähig zu sein. Sein Schreiben wollte er veröffentlicht sehen. Den Bürgern die Wahrheit, die Stadt vom Tyrannen befreien!
Nach Versendung der Mail schaltete er das Radio ein, NDR 1, Sender der Niedersachsen. Eben hatte die Morgenandacht begonnen. Das Thema heute: Gerechtigkeit.
Natürlich wurde die Mail nicht veröffentlicht. Allerdings schickte die Zeitung einen Praktikanten zum Weißekreuzplatz. Er sollte herauszufinden, ob die Sache mit dem neuen Klohäuschen überhaupt stimmte.
Ulf Schafohr war froh, endlich anderes machen zu dürfen, als den elenden Veranstaltungskalender zu aktualisieren. Sisyphosarbeit, allerdings für einen Sisyphos, den man sich als unglücklichen Menschen vorstellen musste. Vier Wochen lang hatte er das gemacht. Der Montagmorgen war besonders krass. Noch völlig zu vom Wochenende, sah sich Schafohr wochenanfangs immer mit dreimal mehr Veranstaltungsmeldungen auf seinem Mailaccount konfrontiert als an anderen Tagen. Sonntags hatten die ehrenamtlichen Vorsitzenden der niedersächsischen Vereine offenbar besonders viel Zeit, ihre steifledernen Presseinfos zu formulieren und zu verschicken. Der Kultur- und Heimatverein Visselhövede annoncierte einen samstäglichen Sommerferien-Briefmarken-Tauschtag für Studenten, Schüler, Azubis, Praktikanten und Arbeitslose, der Hegering Markhausen-Gehlenberg kündigte den traditionellen Winter-Jägerball mit einem spätmittelalterlich sechsgängigen a.a.O.-Dieter-Froelich-Wildbret-Menu an, die Kunstfreunde Hannover sagten den für nächsten Donnerstag vorgesehenen Vortrag zur Frage des Problems der Datierung des Rothenburger Heiligblut-Retabels Tilman Riemenschneiders wegen einer versehentlichen Doppelbelegung des Vortragssaals des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover ab, die Ricklinger Allianz zur Rettung bedrohter Wörter lud zu einem Gabelfrühstück mit Sättigungsbeilage für Suppenkasper ein (besonders knorke: für bannig wenig Pinke). Gott sei Dank war er diesen Scheißjob los. Für die nächsten vier Wochen erledigte den Ilse, eine Praktikantin, die schon länger dabei war und jetzt auch mal ran musste. Als Praktikant bei der HAZ hieß es, durch alle Jobs zu rotieren, für die die Kulturfertigkeiten Lesen und Schreiben vollauf genügten. Pol Pot hätte seine Freude dran gehabt.
Als Ulf am Weißekreuzplatz ankam, schien nichts auf Ungewöhnliches zu deuten. Die Protestcampbewohner saßen zusammen mit einer Handvoll Unterstützer vor ihren Mannschaftszelten an mehreren Bierzeltgarnituren und frühstückten. Ringsum dümpelte der übliche 9-Uhr-30-Verkehr. Das neue Klohäuschen interessierte offenbar niemanden. Es war Ulfs erster Rechercheauftrag. Erst mal Notizen machen: Weißer Kasten, hat Ähnlichkt. mit Spielwürfel, nur ohne Punkte, ungef. fünf Meter breit. Schneeweiß. Keine Fenster, Tür mit Schild ›KUNST‹.
Also doch kein Klohäuschen? Ulf schlich mehrmals um den seltsamen Bau herum und machte Fotos. Gut, dass er den Apparat, eine nagelneue Canon EOS M3, mitgenommen hatte. Schließlich wollte er ernstgenommen werden.
Rein in den Kubus traute er sich aber nicht. Ihm war zwar sofort klar, dass er als zukünftiger Journalist die Pflicht hatte, hinter die Fassaden zu sehen. Doch das mach' mal, wenn du als Sechsjähriger den manieristisch verdrehten Kadaver deines geliebten Beagles Willy in einer Lache Erbrochenem hinter der Tür des Gartengeräteschuppens gefunden hast, in dem sich der arme Hund an den mit Rattengift versetzten Ködern gütlich getan hatte, die Vater für sich und einige Nachbarn zur Bekämpfung der die Rasenflächen zerstörenden Maulwürfe fachmännisch zubereitet, aber wenig verantwortlich im unverschlossenen Verschlag offen aufbewahrt hatte.
Ulf schluckte trocken. Bei der HAZ, hoffte er, würde seine vorsichtige Vorgehensweise vielleicht nicht auffallen. So richtig investigativ schien da niemand zu sein. Erst mal hören, was Haller, sein neuer Chef, zu seinem Bericht sagen würde. Immerhin war er schnell. Schnelligkeit, hatte ihm Haller mit auf den Weg gegeben, sei für einen Reporter das Allerwichtigste. Wichtiger noch als Wahrheit. Abgesehen davon, dass sowieso keiner wisse, was Wahrheit sei.
Haller hatte ein Faible für halb erinnerte Zitate.
3.
Harry Haller hätte mit seinem bürgerlichen Namen Berthold Svinekoben wenig Chancen gehabt, die umkämpften Karrierestufen der lokalen Berichterstattung bis zur ruhmbekränzten Spitze hochzusteigen. Zum einen galt im grünkohlschlagenden Niedersachsen bis in die polnische Erntehelfergegenwart hinein die Ordnung schaffende Traditionsregel ›Name gleich Herkunft gleich Zukunft‹, zum anderen wäre das dann zwangsläufig abgeleitete journalistische Kürzel BS identisch gewesen mit dem Kfz-Kennzeichen von Braunschweig, der mit Hannover tief verfeindeten zweitgrößten Siedlungsverdichtung des à la Jugoslawien gegründeten Bundeslandes. Das seit Annahme seines Nom de Plum verwendete, hanseatisch anmutende HH hingegen sprach eine ganz andere Sprache. Eine diskreten Geldes, diskreten Handels, diskreter Weitläufigkeit, kurz: erotischer Freiheit. (›Da lag doch gleich der Ozean, England, Amerika!‹)
Das alles ist dir aber ziemlich egal, wenn du mit 1,2 Promille Restalkohol und Fahne wie Nationalfeiertag im überfüllten Fahrstuhl stehst und versuchst, flach zu atmen. Ermelinde Stückerschmied, die blöde Kuh, konnte es nach Betreten des Lifts im ersten Stock nicht lassen laut zu fragen, ob eine Betriebsfeier stattgefunden hatte. Alles grinste. Aber so war es halt.
»In ›Lokalredaktion‹«, hatte ihm sein alter Lehrmeister Ansgar Rating, Zeitungsfuchs und Kenner jeder Spirituose von der Etsch bis an den Belt, gebetsmühlenartig eingeschärft, »steckt vor allem ›Lokal‹, merk dir das.«
Dabei waren es nicht mal die kneip-teutonischen Braukünste von hell bis dunkel gewesen, sondern die restó-burgundischen Verfeinerungen mit An-, Ab- und Jahrgang, die ihm zu seiner ästhetisch polarisierenden Duftnote verholfen hatten. Warum sollte er sich verstecken? Immerhin hatte seine kurze Blitzexkursion in die sagenumwobene welsche Önologie auch absolut unglaublichen journalistischen Ertrag eingebracht. Er wusste nun, mit welch hinterfotzigen Mitteln der Verein der Förderer des Maschseefests das rot-grüne Rathaus unter Druck setzen wollte, um die Laufzeit der alljährlichen, so erfreulich lukrativen Uferfeierlichkeiten ins Uferlose zu verlängern. Dafür hatte es sich weiß Gott gelohnt, einen über den Durst zu trinken. Das der Stückerschmied zu erklären, wäre verlorene Liebesmüh gewesen. Was verstand eine knallige Theatertussi schon von Intrigen.
Die meisten Fahrstuhlmitfahrer atmeten erleichtert auf, als sie endlich aus dem verpesteten Aufzug treten und sich in die Ressorts verteilen durften. Hallers Büro gloste in zärtlich zurückhaltendem Licht, die weißen Lamellenrollos vor den bodentiefen Fenstern waren blickdicht geschlossen. Jeden, der das Büro zum ersten Mal betrat, überwältigte ein gleichsam philosophisches Staunen. Hinter einem butlerfinish-gebürsteten kirschhölzernen Schreibtisch auf Sphingenbeinen mit matt englischgrün schimmernder Schirmlampe und silbernem Apple-Laptop stand ein senfgelber Designer-Rollenstuhl, vor dem Tisch zwei vergoldete venezianischrote Boudoirsessel, um einen niedrigen, gletschereisblauopaken Blockglastisch mit geschliffener amöbenförmiger Oberfläche und zarter, orangeblütiger Plastikorchidee in azurinlackroter Vase eine dreiteilige schlammgrüne Nappaledersitzgruppe, dahinter ein filigranes, glanzschwarzlackiertes Regal, gefüllt mit anthrazitfarbenen Leitz-Ordnern.
Die Einrichtung war keineswegs nach Hallers nativem Geschmack. Ein Büro ist ein Büro ist ein Büro ist ein Büro. Anfang des Jahres hatte ihm der Chef vom Dienst Dr. Herwarth Bittenfeld jovial schulterklopfend eröffnet, dass endlich seine schrottigen, abgeranzten Möbel gegen neue ausgetauscht werden würden – ›Gratulation, du musst beim Vorstand einen dicken Stein im Brett haben, du bekommst sogar ein größeres Büro‹ –, hatte aber vergessen zu erwähnen, dass es sich bei dem neuen Mobiliar um die kürzlich angelandete Büroeinrichtung des eben erst wegen HAZ-inkompatibler stilistischer Eigenwilligkeiten geschassten, nur ein halbes Jahr hier tätig gewesenen, italienisch hypereleganten Marketingchefs handelte. Sein Nachfolger hatte, wie alle anderen im Haus auch, die Möbel nicht haben wollen.
Die aus Anlass der sensationellen Neumöblierung frisch geweißten Wände waren vollkommen leer. Haller schienen die althannöverschen Kupfer, die sein altes Büro geziert hatten, nicht mehr passend. Nur die Eingangstür schmückte ein Bild, ein mit einer rostigen Reißzwecke befestigtes, vergilbtes Foto des Prinzen von Hannover mit dem krakeligen Gruß ›FÜR DIRTY HARRY VON DIRTY ERNIE, 10. JANUAR 1998‹ und der doppelt unterstrichenen Aufforderung ›UNBEDINGT WIEDERHOLEN!‹ Alle Versuche seiner neugierig-eifersüchtigen Kollegen herauszufinden, worauf diese Anspielung zielte, die geradezu empörend schmutzige Phantasien frei setzte, waren an Hallers unschuldiger Erwiderung ›Ihr seid doch von der Presse. Kriegt's raus!‹ gescheitert.
Es klopfte leise an der Tür. Das konnte nur ein Fremder oder jemand sein, der noch nicht lange dabei war. Alte HAZ-Hasen klopften nicht. Sie traten einfach ein.
»Ja?« Hoffentlich ein junges, knackiges HAZ-Häschen und kein Externer.
Ulf Schafohr, der Praktikant ... Schafohr ... Doch wer war Haller, sich über feinsinnige Namen lustig zu machen? Fünf Minuten später hatte Haller das Smartphone am heißen Ohr.
»Geh ran, geh ran, geh ran, geh ran.«
Er wusste, er musste schnell sein. Der Bengel hatte ihm was an den Haken geliefert, das die Damen von der Kultur ihm garantiert gerne wegschnappen würden. (Als er auf der letzten Weihnachtsfeier mit dem halb geklauten Spruch ›Meine sehr verehrten Damen von der Kultur, mit und ohne Bart‹ die Feuilletonredaktion begrüßt hatte, hatte ihm der Theaterkritiker Åsperg Tistau, der mit seinem Spitzbart dem Terrorliebhaber und Stalinvorläufer Lenin zum Verwechseln ähnlich sah, wutentbrannt eine gescheuert. Wunderbar! Die Lokalen hatten sich vor Lachen gekringelt.)
»Geh ran, geh ran.«
»Gott.«
Endlich.
»Hallo Rudi, Harry hier.«
Haller sah seinen Gesprächspartner genau vor sich: Dr. Rudolph Gott, Leiter des Kulturbüros Hannover, immer tiptop gekleidet (Leiter), immer zerzauste Haare (Kultur) und immer wild gemusterte Krawatte (Hannover), an deren akkurat gebundenem Knoten (Büro) er zu ziehen pflegte, wenn er telefonierte. ›Wenn Sie wollen, dass er sich stranguliert, telefonieren Sie lange mit ihm‹, hatte ihm Gotts Assistentin Tanja Sommer einmal am Rand eines vom Arbeitsstab des Oberbürgermeisters organisierten Symposiums zum Stadtentwicklungskonzept 2090 fröhlich verraten.
»Harry ... wer?«
»Na, Harry, Mensch. Harry Haller, HAZ, Lokales. Schon vergessen? Letzter Opernball? Unsere Travestienummer?«
»Ah ja, jetzt hab ich's. Nicht vergessen. Aber auch nicht stolz drauf.«
»Na komm, wir machen alle mal was, was wir am nächsten Tag nicht mehr so genau wissen wollen. Ich hab eine Frage.«
»Wenn ich helfen kann ...«
»Schon was gehört von dem Ding da auf dem Weißekreuzplatz?«
»Ding? Weißekreuzplatz? Harry, drücken Sie sich bitte präziser aus, Sie sind nicht bei der FAZ.«
Gott duzte niemanden außerhalb der Familie und die war klein. Eigentlich bestand sie nur aus ihm, wenn man die zwei jungen malischen Männer nicht dazu zählte, deren Patenschaft er schon übernommen hatte, als sie kaum auf der Welt waren.
Der eine, Streetworker, war in eine prekäre Sippe hinein geboren worden, die Familie des anderen war gänzlich unbekannt. Umso erstaunlicher seine Karriere: Als charismatischer, polyglotter, wiewohl manchmal etwas windiger Unternehmensberater hatte er eine große, weltweit agierende Marketingagentur aufgebaut.
Vornamen ja, Duzen nein.
»Sehr witzig. Ein weißer Klotz mit Tür, innen wahrscheinlich leer, aber unser kleiner Prakti hatte Schiss reinzugehen. Draußen dran auf einem Schild ›KUNST‹. Großbuchstaben, Gänsefüßchen. Ich dachte, ich frag erst mal dich.«
»Noch nichts gehört, Harry, tut mir leid. Aber ich kann nachher in unserer Montagsrunde mal nachfragen.«
Klang seine Stimme etwa gepresst? Atemlos? Log er? Eigentlich nicht seine Art. Um Himmels willen, der Krawattenknoten!
»Tu das, und nichts für ungut. Und wenn du was hörst, bin ich erste Adresse, okay?«
Gott röchelte, Haller legte rasch auf. Es half nichts. Er musste selbst zum Weißekreuzplatz. Vorher schnell eine zweite Aspirin und eine Mail an Ilse. Der lispelnde Leiter der Zinnfiguren in Burgdorf hatte sich telefonisch bei ihm beschwert, dass es seine Arbeitsgruppentermine noch nie in die Printausgabe geschafft hätten.
»Mit Sinnfiguren kann man das ja machen.« Aber diesmal müsse es sein. »Und unbedingt die richtige Uhrseit angeben. Vorgesogen!«
Haller erinnerte sich an die Zinnsoldatensammlung seines monarchistischen Großvaters und wie sie zusammen Langensalza und Königgrätz nachgespielt hatten. In Burgdorf ging es beim nächsten Termin um Waterloo. Da durfte man nicht zu spät kommen.
4.
Zuerst aber zu Bittenfeld. Haller musste ihn unbedingt noch vor der Redaktionskonferenz erwischen. Gott sei Dank hatte sich Bittenfeld verspätet.
»Herwarth, hast Du eine Minute? Ich hab was absolut Unglaubliches.«
Bittenfeld blieb berufsgeübt stoisch. Er kannte Haller seit der gemeinsam vertrödelten Schulzeit am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium, ›Was Besseres als den Tod findest du überall‹. Haller hatte schon damals alles, was er gerade herausgefunden hatte, für absolut unglaublich gehalten. Der ideale Lokalredakteur. Schnell begeistert, fast nicht beleidigbar, selten zynisch. Manchmal war er allerdings kaum zum Aushalten.
»Berthold, schieß los. Wir sind eh schon zu spät.« Wenn kein Dritter zuhörte, benutzte Bittenfeld Harrys Jungennamen.
»Ich komme nicht mit. Muss zum Weißekreuzplatz. Unfassbar, pass auf. Ein als Kunst getarntes Klohäuschen. Wahrscheinlich stiekum aufgestellt von der Stadt. Ganz große Nummer. Hab schon mit Gott gesprochen, Kulturbüro, du weißt schon, aber er mimt den Ahnungslosen. Ich düse sofort hin, nur eine Bitte: Kannst du mir die Kultur vom Hals halten, bis ich die Story habe?«
Bittenfeld war's recht. Die Damen von der Kultur konnte er sowieso nicht leiden. Bildeten sich immer ein, was Besseres zu sein. Damals, als er sich bei ihnen vorstellte, weil er bei ihnen volontieren wollte – Kultur schien ihm das geistigste aller Ressorts, jetzt wusste er es besser –, hatten sie ihn nach drei hinterhältigen Insiderfragen zu irgendwelchen ihm völlig unbekannten zeitgenössischen Künstlern, von denen sie behaupteten, dass man sie kennen müsse, die aber schon zwei Jahre später wieder im Abgrund des Vergessens verschwunden waren, spöttisch abserviert. Er eigne sich doch wohl eher fürs Sportressort. Immerhin war er jetzt Chef. Auch ihrer. Er versprach seinem lieben Berthold, zu tun, was er könne.
Als Haller atemlos am neuen Häuschen auf dem Weißekreuzplatz ankam, war ein etwas verwahrlost aussehender Mann – weiß-rote, mit stilisierten Rentieren bedruckte Boxershorts, gelbes Feinripp-Muscleshirt, weiß-blaue Ringelsocken, schwarze Flipflops – dabei, die Tür aufzudrücken.
»Was machen Sie da? Wer sind Sie?«
Paul Schützengrabners permanent schlechtes Gewissen krampfte. Erst mal gegenhauen.
»Und selber?«
Die übliche hannoversche Begrüßung. Schnörkellos.
»Haller, HAZ. Wir haben eine Mail erhalten, dass hier ein Klohäuschen aufgebaut worden ist.«
»Genau. Von mir. Schützengrabner. Paul Schützengrabner. Ich wohne hier.«
Haller konnte sich den Elfer nicht entgehen lassen.
»Sie haben das Häuschen gebaut?«
Schützengrabner ging in Abwehrstellung.
»Seh' ich so aus? Ich hab die Mail geschrieben.«
»Und das hier ist das Häuschen?«
»Ja.«
»Ein Klohäuschen?«
»Ja.«
»Woher wissen Sie das?«
»Was soll's sonst sein? Das neue Büro vom OB? Es fehlen nur die Kloschüsseln.«
Haller betrachtete die Tür, die wieder geschlossen war. ›KUNST‹. Genau, wie Ulf gesagt hatte.
»Und das Schild da?«
»Was weiß ich. Das haben die drauf geschrieben, um uns zu täuschen.«
»Wer die?«
»Na, die Politiker.«
»Und wer uns?«
»Na, die Anwohner hier.«
»Und die Politiker wollen Sie täuschen?«
»Die wollen uns mundtot machen.«
»Mundtot?«
»Wir sollen die Fresse halten.«
»Und warum?«
»Eigentlich interessieren wir die gar nicht. Die da«, und dabei zeigte Schützengrabner auf das Protestcamp, »sind denen wichtiger.«
›Daher also‹, dachte Haller. ›Am besten nicht drauf einlassen.‹
»Also ein Klo, nur ohne Schüsseln?«
»Ja.«
»Auf dem ›KUNST‹ drauf steht.«
Schützengrabner hatte seit seiner Scheidung ein sicheres Gespür dafür, was sein Gegenüber von ihm hielt. Dieser Journalist jedenfalls nicht viel.
»Ist vielleicht dasselbe«, grinste er.
Schützengrabner weiter zu befragen brachte nichts. Haller sah sich um. Direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ein Kiosk. Hannovers Kioske waren eine Institution. Tag und Nacht geöffnet. (Kioske öffnen sich rasch und Illustrierte schrillen.) Vielleicht wusste der Besitzer was.
So einen Kiosk hatte Haller allerdings noch nicht gesehen. Von weitem sah er aus wie jeder andere: Zeitungen, Zeitschriften, Getränke, Süßigkeiten. Aber was für Zeitungen, Zeitschriften, Getränke, Süßigkeiten: ›Philosophical Transactions of the Royal Society‹, ›Neuer Literarischer Handweiser zunächst für das katholische Deutschland‹, ›Journal des dix-neuvièmistes‹, erlesenste Schokoladen und Pralinés belgischer Manufakturen, ausgesuchte Jahrgangsrieslinge von Rhein und Mosel, große Franzosen. Haller las mit offenem Mund Chateau Pétrus 1990. Das für Lust und gute Laune zuständige Hirnareal leuchtete auf. War gestern Abend nicht eine attraktive Petra dabei gewesen, selber Jahrgang?
Drinnen war niemand. Auf dem Schild neben der Durchreiche stand:
INHABER MARTIN MURCH, TEL: 0172-5137569
Haller drückte den Klingelknopf auf dem Thekenbrett. Erst hörte er einen leisen Glockenton und kurz darauf das Klappen einer Tür. Ein freundlich aussehender, sehr schlanker, sehr kleiner Mittvierziger mit dichtem, langem, zu einem Zopf gebundenem rötlichem Haar und Bijou-Oberlippenbärtchen trat an die Theke. Schwarzes Samtjackett, grün-weiß gestreifte Fliege, schwarzes Seidenhemd. Irgendwie eine noble Erscheinung. Nur der Brilli im linken Ohrläppchen irritierte.
Offenbar stieg er auf einen Schemel.
»Was darf ich für Sie tun, mein Herr?«
Haller brauchte einen Moment, bis er verstand. Der Mann sächselte und beherrschte die in Hannover eher selten vorkommende Fertigkeit, Sprechen und Lächeln gleichzeitig zu präsentieren.
»Sagen Sie – ich komme von der HAZ –, wissen Sie was über das neue Klohäuschen da drüben, oder Kunsthäuschen, oder was immer das sein soll?«
Haller drehte eine Pirouette, um auf den ihn interessierenden Bau zu zeigen. Zum Zeigen kam er allerdings nicht.
5.
Bereits kurz vor neun stellte Max Griesig, aufleuchtender Komet am explodierenden Himmel des hannoverschen Hairstylinghandwerks, seinen metallic-malachitgrünen Porsche 911 Carrera GTS in der Parkgarage der Galerie Luise ab und betrat den sorgfältig desinfizierten Aufzug zum Shopping Center de luxe, in dem seit sieben Jahren sein florierender Frisiersalon ›Hair Griesign‹ untergebracht war.
Die Galerie, benannt nach der viel zu früh verstorbenen Gemahlin König Friedrich Wilhelms III. von Preußen – nicht einmal so alt wie Jesus war sie geworden, aber wer mochte es ihr verdenken? –, beherbergte neben international Geld scheffelnden Modeboutiquen mit teuersten Allerweltslabels auch eine kleine Anzahl Inhabergeschäfte, die, von Kamikaze-Kaufleuten geführt, alle zwei bis drei Jahre die Eigentümer in die Privatinsolvenz führten, um von neuen, ebenso suizidalen Besitzern weiterbetrieben zu werden. Zwei von flachster Lounge-Musik durchsäuselte Einkaufspassagen – Anmutung amerikanisch-japanisch-kuwaitische Mall, nur kleiner – kreuzten sich zu einer runden, glasüberdachten, halligen Plaza mit überteuertem Bistro und passend unbequemen Stühlen. Jeden Samstagnachmittag arbeiteten hier vier studentische Prekariatsstreicher der Hochschule für Musik, Theater und Medien ihre aktuellen Fähigkeiten an Mozart und Haydn ab.
Griesig pfiff wie jeden Morgen heroisches Liedgut, heute die Marseillaise. Gleich würde sich der Geist Luises zeigen, wie immer verführerisch geschminkt – ihr Doppelkinn fiel kaum auf – und makellos gekleidet in zeitlos musealer Eleganz (griechisches, tief dekolletiertes, direkt unter dem Busen gebundenes, locker fallendes Kleid, gepuffte Ärmel, perlenbestickte Schuhe Größe 41). Seit es Preußen nicht mehr gab, hielt es Luise nicht mehr in ihrer Charlottenburger Gruft. Sie wollte etwas erleben, jedenfalls solange noch jemand ihren Namen kannte. Repräsentationspflichten hatte sie ja keine mehr. Ihr Mann, selbst schon halb vergessen, verstand das und ließ sie um die Häuser ziehen.
In Hannover fühlte sie sich zuhause. Besonders gefiel ihr der Aufzug in der nach ihr benannten Galerie. Jeden Tag neue, unbekannte Gesichter, die wieder weg waren, bevor sie anstrengend werden konnten. (Außerdem war der Aufzug viel komfortabler als der in Tinas Kiosk-Litfaßsäule, mit dem sie auf die Oberwelt gefahren war (There is no alternative). Und herkulëisch gebaute junge Kaiser, die eine längere Begegnung gelohnt hätten, kamen nicht.)
»Guten Morgen, Hoheit«, nickte Max ihr zu.
Luise war weniger höflich.
»Sie verhalten sich mal wieder impertinent, Sie Ungeheuer.«
»Sie meinen das Liedlein? Seien Sie froh, dass ich's nicht singe.«
Beleidigtes Schweigen wie beinahe jeden Morgen. An 363 Tagen im Jahr – in Schaltjahren an 364 – war Luise schlechtest gelaunt, nur am 10. März, ihrem Geburtstag, und, merkwürdigerweise, am 19. Juli, ihrem Sterbetag, erschien sie einnehmend und gnädig. Dann konnte sie sogar ein bisschen kokett sein und schäkern. An ihrem 200sten Todestag hatte sie das Revolutions-Chanson sogar mitgesummt und Griesig ein Küsschen auf die Wange sowie eine Kornblume in die Hand gedrückt.
Griesig beließ es heute bei seiner kurzen Antwort. Er musste sich konzentrieren. Ursula Malorty, die allmächtige Kulturchefin der HAZ, würde in wenigen Minuten seine erste Kundin sein, verabredungsgemäß wie immer vor der ausgewiesenen Öffnungszeit des Salons, weil sie um nahezu jeden Preis vermeiden wollte, bei Privatem beobachtet zu werden. Und Privateres als Frisiertwerden gab es für sie nicht. Ursula Malorty lebte nach dem klugen Motto einer schönen Freundin, die sich ihrem liebenswürdigen Ehemann niemals anders als gesund, ausgeschlafen und blendend zurechtgemacht präsentierte. (Auch Fotos à la Iwein, direkt nach dem Aufwachen, gab es von ihr nicht.) Ursulas nicht ganz so liebenswürdiger Lebensgefährte war die Öffentlichkeit. Das hieß privatissime frisieren, ohne andere Kunden, und vor den gaffenden Augen der mediokren Meute verborgen durch eine spanische Wand.
Doch hatte Griesigs Konzentrationsbedürfnis nichts mit dieser verzeihlichen Idiosynkrasie Malortys zu tun. Sie war auch keine komplizierte Klientin in haarästhetischer Hinsicht. Im Gegenteil, ihre wallende Mähne naturglänzender blonder Haare war stets nur dezent zu stutzen und ein wenig in lässige Unordnung zu bringen. Das hätte auch jeder seiner Assistenten gekonnt.
Aber Griesig hatte vor drei Jahren, um die Kundin, die auch als unsichtbare einflussreich genug war, zur regelmäßigen Wiederholung ihres ersten, damals noch öffentlichen Salonbesuchs zu ermuntern, spontan behauptet, ein Liebhaber des modernen Tanzes zu sein, nachdem sie ihm verraten hatte, ihr Herz seit Pina Bausch komplett an diese Sparte verloren zu haben.
»Die einzige Kunst, in der noch wirklich Neues geschaffen wird. Musik, Sprechtheater, bildende Kunst, Literatur, die besonders, sind allesamt gestrig und erschöpft, nur le ballet ist durch seine triebkörperliche, fleischliche Authentizität noch zu genuinen Schöpfungen fähig.«
Seitdem verbrachte Griesig fast jede Nacht vor einem Malorty-Termin auf einschlägigen Internet-Foren und war wider jegliches Interesse drauf und dran, zum veritablen Kenner der Szene zu werden. Aber heute hatte ihn die ursprüngliche Unlust am unverständlichen Rumgebiege und -gehüpfe wieder voll im Griff. Wie würde er diesmal bloß um das leidige Thema herumkommen, das ihn etwa so enthusiasmierte wie der verhasste Erdkundeunterricht in der Schule? (›Max, wie heißen die rechten Nebenflüsse der Donau? Und bitte in der richtigen Reihenfolge!‹)
»Die Kultur«, seufzte die Malorty inbrünstig und ließ sich in den Frisiersessel fallen, »gleitet der absoluten Bedeutungslosigkeit entgegen. Die Frage der Stunde lautet: Wird man weiter in Starre verharren und sich von der Geistlosigkeit endgültig in Zechen und Gruben anketten lassen, um sich fortan nur noch an zitternden Schatten zu entzücken, oder besinnt man sich und steigt wieder aufwärts zur Sonne, zur Freiheit?«
Griesig kannte die Stimmung. Wenn die Malorty dunkel redete, war auch ihr Seelenbefinden unterirdisch. Gleich würde sie wieder erzählen, dass sie lieber hungernde, aber glückliche Tänzerin geworden wäre statt Redakteurin beim Feuilleton und hinzufügen, dass das Schreiben übrigens auch nicht besonders gut bezahlt würde.
»Ein Cappuccino-Vanille, wie immer mit besonders viel Schaum?«, säuselte Griesig und griff ihr von hinten ins volle Haar. Demnächst würde er sie darauf vorbereiten müssen, dass auch sie bald ein wenig chemisch tönende Nachhilfe benötigen würde.
»Ein kleines Kekslein dazu? Kokos mit einer Spur Zimt.«
»Du bist süß, Max.«
Sie nahm einen der blassrosa Kekse.
»Ist ja ein Herz.«
Sie seufzte.
»Auch süß.«
Die große Malorty, wie ihr Kollege, der Opernkritiker Gesternhagen, sie ehrfürchtig nannte – er hatte sich vor Jahren unsterblich in sie verliebt, als sie während einer fürs Nachtprogramm bei NDR-Kultur aufgezeichneten, leider nie gesendeten Podiumsdiskussion zum Thema ›Das zeitgenössische Musikdrama und sein Publikum‹ seine Kritiken mit den ästhetischen Briefen Schillers verglich –, die Malorty sank verzagt ihrem emotionalen Nullpunkt entgegen. Mit ihrem nächsten Kommentar würde sie auf die Ballettschiene einschwenken. Jetzt hieß es gegensteuern. Hatte ihm der Murch nicht was von einem nächtlings aufgebauten Kunsthaus auf dem Weißekreuzplatz erzählt?
Vielleicht wusste sie noch nichts davon.
»Blasen Sie nicht unnötig Trübsal, teuerste Ursel.«
Griesig wusste, dass das gezirkelt Höfische die Malorty aufmunterte, und hatte mit vorausschauendem Bedacht Louis Couperins Cembalosuite in frühlingshaftem F-Dur in der gepflegten Einspielung des phantastischen Christophe Rousset als Hintergrundmusik aufgelegt. Wie passend, dass gerade die Courante lief.
»Heute Nacht trug sich Unerhörtes zu, liebste Ulla, das Ihr wohlwollendes Interesse kaum verfehlen wird. Weshalb Sie selbstverständlich die Erste sein sollen, der die Kunde zu Gehör kommt. Ihr Haar ist wirklich wundervoll.«
»Schieß los, Max.«
Ihre Stimme klang schon wieder einige Grade lebendiger. Journalistenwitterung.
Max arbeitete am Mähnenberg, während er formvollendet berichtete. Sie wisse ja, nach welchem Ritus er seinen geheiligten Feierabend einläute, ein Gläschen Louis Roederer Vintage Rosé und eine Romeo y Julieta Mille Fleurs, die er sich jeden Morgen frisch kaufe, bei der einzigen Person in der Stadt, die diese Meisterwerke der kubanischen Tabakverarbeitung respektvoll zu lagern verstehe, Monsieur Martin Murch vom Weißekreuzplatz.
»Der kleine Murch.«
Malorty kicherte.
»Ist er nicht süß, wenn er mitten im Gespräch ins Lateinische wechselt, nur um davon abzulenken, dass er einem die ganze Zeit in den Ausschnitt starrt?«
Griesig hatte diese schöne Erfahrung leider nicht gemacht. Er konnte kein Wort Latein und trug während der Arbeit auch keine Bluse mit Ausschnitt, weshalb er Malortys Einschub unkommentiert ließ und seinen galanten Bericht ohne sternesche Ausschweifungen fortsetzte. Ja, Martin Murch, genau der, bei dem kaufe er jeden Morgen seine Feierabend-Havanna aus dem Klimakasten, und heute Morgen habe Martin ihn gebeten – ja, er sei schon lange per Du mit ihm, Martin sei wirklich süß –, Martin habe ihn also heute Morgen gebeten, sich mal umzudrehen, auf einen großen weißen Bau gezeigt und ihm zugeraunt, dieser wunderbar ebenmäßige, weiße Kubus sei vollkommen, gewissermaßen jungfräulich neu, erst letzte Nacht aufgestellt, und kein Mensch wisse, woher er käme, vielleicht sei das aber auch nicht wichtig, interessant sei allerdings, was auf dem Türschild stehe.
Griesig hielt die Schere über Malortys Kopf und betrachtete versonnen sein Schnittwerk. Auch unter dem Frisierumhang waren Malortys Rundungen eminent.
»Dieses Romeo-und-Julia-Zeug macht dich offenbar zu einem Experten für Cliffhanger, Max. Was steht denn jetzt drauf?«
»KUNST«
Einen Moment schien es, als ob die Malorty nicht reagieren würde. Doch nach drei Sekunden sprang sie ruckartig auf, mit dem rechten Ohr um Haaresbreite an der gerade wieder geöffneten Schere vorbei – Ursula van Gogh, schoss es Griesig durch den Kopf –, und riss sich entschlossen den gelb-rot-blauen Mondrian-Umhang von der Schulter.
»Nichts für ungut, Max, aber da muss ich hin. Sofort. Wir können dann beim nächsten Mal mit dem Schnippeln weitermachen.«
Wusste sie, dass sie ihn kränkte? Sie schnappte sich ihren safrangelben Shopper und rannte los.
»Schreib's an. Ich zahl später.«
Sie zahlte natürlich nie.
6.
Genau in dem Moment, in dem Haller sich umdrehte, um auf den im Sonnenlicht gleißenden Kubus zu zeigen, und der schöne, ihm irgendwoher bekannte Satz ›Kunst oder Klo, das ist hier die Frage‹ sein noch nicht wieder ethanolfreies Bewusstsein beschäftigte, hielt ein cremefarbenes Großraumtaxi vor dem Kiosk und versperrte die Sicht.
Die Malorty.
Jetzt hieß es das Revier abstecken. Nach einer kurzen Wendung zu Murch – ›'tschuldigung, komme gleich wieder‹ – rannte Haller hinter der aus dem Taxi gestiegenen Malorty her, die eilig Richtung Kubus strebte.
»Mensch, Ulla, was treibt dich denn hierher?«
Die Malorty blieb abrupt stehen und drehte sich langsam zu ihm um.
»Und dich, mein einsames Wölfchen?«
Sie war belesen. Haller mochte belesene Frauen nicht. Belesene Männer auch nicht.
»Bestimmt was anderes als dich. Ich bin wegen des Klohäuschens hier. Klohäuschen interessieren dich ja wahrscheinlich nicht.«
»Da hast du recht. Klohäuschen sind mehr was für dich. Aber es ist keins. Guck aufs Schild.«
»Stimmt schon, ist komisch. Ist trotzdem meine Story. Hab ich mit Bittenfeld abgesprochen. Ich mach' das.«
»Tatsächlich? Ich wusste gar nicht, dass dich Kunst interessiert.«
»Ob das Kunst ist, weiß niemand. So ein Schild kann jeder hinhängen. Das heißt gar nichts.«





























