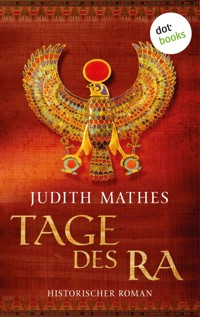
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leidenschaft, Machthunger und Intrigen: Der Ägypten-Roman "Tage des Ra" von Judith Mathes jetzt als eBook bei dotbooks. Ägypten um 1200 v. Chr.: Bai, ein aufstrebender Beamter am Hofe des Pharao, hütet ein gefährliches Geheimnis. Aus seiner Affäre mit einer Tochter des Herrschers sind zwei illegitime Söhne hervorgegangen. Sollte irgendjemand von der Existenz der Jungen erfahren, würde das ihren sofortigen Tod bedeuten. Bai tut alles, um seine Söhne zu schützen, doch dabei gerät er immer tiefer in das gefährliche Ränkespiel am Hof. Als der Pharao stirbt, entbrennt ein grausamer Kampf um seine Nachfolge: Während dramatische Ereignisse in der Totenstadt von Waset auf einen furchterregenden Höhepunkt zutreiben, droht das gesamte Land ins Chaos zu stürzen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Tage des Ra" von Judith Mathes – das Historische-Roman-Highlight bietet packende Unterhaltung auf über 1000 Seiten! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1499
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ägypten um 1200 v. Chr.: Bai, ein aufstrebender Beamter am Hofe des Pharao, hütet ein gefährliches Geheimnis. Aus seiner Affäre mit einer Tochter des Herrschers sind zwei illegitime Söhne hervorgegangen. Sollte irgendjemand von der Existenz der Jungen erfahren, würde das ihren sofortigen Tod bedeuten.
Bai tut alles, um seine Söhne zu schützen, doch dabei gerät er immer tiefer in das gefährliche Ränkespiel am Hof. Als der Pharao stirbt, entbrennt ein grausamer Kampf um seine Nachfolge: Während dramatische Ereignisse in der Totenstadt von Waset auf einen furchterregenden Höhepunkt zutreiben, droht das gesamte Land ins Chaos zu stürzen …
Über die Autorin:
Judith Mathes, geboren 1952 in München, wandte sich schon während ihres Studiums der Germanistik, Romanistik und Bibliothekswissenschaften der alten römischen und ägyptischen Geschichte zu. Für die Recherchen zu ihren Romanen – aber auch aufgrund der persönlichen Leidenschaft für dieses Thema – verbrachte sie selbst einige Zeit in Ägypten und erlernte sogar die altägyptische Sprache.
Bei dotbooks erscheint auch ihr Roman »Tage des Seth«.
Die Autorin und ihre Werke im Internet:
www.judithmathes.dewww.tage-des-ra.dewww.tage-des-seth.de
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe Dezember 2016
Copyright © der Originalausgabe 2005 area Verlag gmbh, Erftstadt
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-866-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tage des Ra« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Judith Mathes
Tage des Ra
Historischer Roman
dotbooks.
Diese Geschichte widme ich meinen Eltern:
Meinem verstorbenen Vater Hermann Mathes, der mir vor langer Zeit das Tor zu alten Welten geöffnet hat
und
meiner Mutter Henni Mathes, die mich stets ermuntert hat, durch Tore auch hindurchzugehen.
Einleitung
JAHR 61, PHARAO RAMSES
(1218 v. CHR.)
Plötzlich hörten die Schreie auf. Die unerwartete Stille traf Bai wie ein Keulenschlag.
Er blieb stehen und lauschte angestrengt in die Dunkelheit.
Einen Augenblick lang vernahm er überhaupt nichts mehr, so ausschließlich hatte er sein Gehör auf die furchtbaren Laute gerichtet. Seit Stunden hatten sie jedes Lebewesen in weitem Umkreis in Schrecken versetzt. Es war ein dunkles Heulen, das geradewegs von den schwärzesten Orten der Nacht zu kommen schien. In Abständen steigerte es sich zu einem Kreischen und verebbte schließlich in einem langgezogenen Stöhnen.
Der Mann löste sich aus dem tiefschwarzen Schatten des Hauses, dessen flaches Dach sich hinter Feigenbäumen und Tamarisken gegen den sternenübersäten Nachthimmel abzeichnete. Das Licht des aufgehenden Mondes schimmerte matt in den Säulengängen, die das Hauptgebäude umgaben. Langsam wanderte er über bläulich glänzende Grasflächen und schattenhafte Bäume weiter nach Westen, wo sich der Garten sanft zum Fluß hin neigte. Hundert Ellen entfernt duckte sich eine kleine Hütte unter das Laubwerk einer alten, ausladenden Sykomore. Schon vor Tagen hatte der Diener Ipuki mit einigen Arbeitern des Gutes Tjeni Nefer den luftigen Bau aus Akazienholz und Schilfmatten errichtet. Vor dem Eingang brannten zwei Fackeln und warfen ihre flackernden Lichtgarben über Gras und Büsche. Auch innerhalb der Laube verbreiteten Lämpchen verschwommenes Licht. Durch die fingerbreiten Spalten in den Wänden konnte Bai erkennen, daß sich Frauen darin bewegten.
Wieder zerriß ein Schrei die Nacht. Unbehagen verursachte einen Krampf in Bais Eingeweiden, und sein Atem ging schneller. Auf seine innere Stimme konnte er sich verlassen, sie hatte ihn noch nie getrogen. Sollte er, mußte er nun etwas unternehmen? Was konnte er tun? Hinübergehen zur Laube vielleicht? Nein, was sich dort abspielte, war Frauensache! Aber es mußte doch …, warum halfen sie denn nicht? Jene, die das Los der Frauen erleichtern, wie Bes oder Taweret, die Nilpferdköpfige? Warum straften sie ihn? ›Nein‹, verbesserte er sich, ›auch Henutmira ist gestraft, eigentlich vor allem sie.‹
Doch sein Mitleid mit der Gebärenden reichte nicht weit, er spürte sogar einen Hauch von Befriedigung, daß Henutmira so litt. Seit vier Mondumläufen verweigerte sie sich ihm, und er fühlte sich von ihr verlassen. Er zweifelte nicht daran, daß sie sich in der Hand eines Gottes befand, denn ihr Herz war in den Zustand der Raserei getreten. Bai wußte wie jeder Gebildete im Lande Kemet, daß ein Mensch sich stets so verhält, wie sein Herz es ihm vorgibt. Das Herz ist der Sitz des Verstandes. Von dort schwand Henutmiras Geist von Tag zu Tag mehr, und im selben Maße wuchs Bais Verzweiflung.
›Ihr Herz ist abgelenkt und vergeßlich wie bei einer, die an anderes denkt‹, grübelte er. ›Aber warum? Hat ihr der Hauch eines Zauberpriesters geschadet? Oder ist es ein böser Geist, der sie schlug? Ich habe getan, was ich konnte. Bereit war ich, mein Leben hinzugeben! Nicht einmal den Verlust meiner Stellung fürchtete ich, als ich hintrat vor den, der das ganze Land in seiner Hand hält.‹
Flüchtig erinnerte er sich an die Unterredung mit dem Thronfolger Merenptah. Dessen jüngere Tochter war Henutmira, und Bai hatte eingestehen müssen, daß er es gewagt hatte, seine Augen zu ihr zu erheben. Mehr noch, Henutmira war in Hoffnung, und er, ein hurritischer Höfling, trug Schuld daran. Er entsann sich der Erleichterung, die ihn damals fast überwältigt hatte. Merenptah hatte ihm seine Gunst nicht entzogen! Bereinigen sollte Bai die Lage, und das möglichst unauffällig. Der gute Ruf Henutmiras durfte nicht beschädigt werden.
In einem großen Bogen wanderte er um das Hauptgebäude herum und gelangte in die Nähe der Stallungen. Pferde scharrten und schnaubten, und die halblauten Stimmen der Stallburschen drangen an sein Ohr. Ob sie Henutmiras Schreie gehört hatten? Von hier aus war die kleine Hütte nicht zu sehen, sie lag auf der gegenüberliegenden Seite des Gutes, verdeckt vom Haupthaus. Einige Männer lachten laut auf, und einen Augenblick lang vermochte Bai sich nichts Erstrebenswerteres vorzustellen, als bei diesen Pferdeknechten zu sitzen, Bier zu trinken, eine Runde zu würfeln und danach eine gesunde, einfache Frau ins Bett zu nehmen, um seine Lust an ihr zu stillen. Zorn durchzuckte ihn bei dieser Vorstellung, denn er empfand es als Verrat Henutmiras, daß sie kaum noch ansprechbar war. Wie konnte sie die Liebe vergessen, die sie immer wieder beschworen hatten? Die zahllosen Nachmittagsstunden in Henutmiras Gemächern, das feine Leinen und der Duft der Lotosblüten auf dem nahen Teich … nein, danach durfte er sich nicht mehr sehnen. Je eher er das alles vergessen konnte, desto besser!
Die Ahnung eines drohenden Verhängnisses verdrängte bald alle gefühlvollen Erinnerungen. Warum brachte ihm niemand Nachricht? Das Schweigen beunruhigte ihn noch mehr als die Schreie vorhin. Rufe der Freude und Glückwünsche hätten ein gesundes Kind begrüßen müssen. Fieberhaft durchforschte er sein Gedächtnis, ob alle Opfer vorschriftsmäßig durchgeführt worden waren, aber er konnte keine Fehler finden. Er selbst hatte zwischen Ranken und Blumengebinden die Schutzzeichen aufgehängt, um die stets lauernden Feinde des Sonnengottes Ra abzuwehren, während der eigens herbeigeholte Priester Schutzzauber gegen die bösartigen Bedroher von Mutter und Kind murmelte und das Zaubermesser auf Henutmiras Leib legte. Auch Bai hatte gewissenhaft Gebete geflüstert, denn er war überzeugt, daß die Götter ihn in jedwedem Anliegen unterstützten, sofern er nur seinen Sinn ganz fest darauf richtete.
Inzwischen war der Mond aufgegangen, und der Garten lag in seinem silbrig funkelnden Licht. Ein leichter Westwind trug den Duft von Blumen und Wasser vom Fluß herüber, vermengt mit einem Hauch von Fäulnis, der die kleine Bootsanlegestelle am Ende des Gartens immer umwehte. Wieder blieb Bais Blick an der Geburtslaube hängen. Warmes, einladendes Licht drang aus dem Innern. Gerade als er sich entschloß, doch hinüberzugehen, mochte es nun Sitte sein oder nicht, vernahm er leise Schritte. Sein Diener Ipuki näherte sich im flackernden Schein der Fackel, die er in der Hand hielt.
»Herr, würdest du mit mir kommen? Es ist vorüber, glaube ich.«
Die Worte kamen zögernd, kaum hörbar, und Bai hätte schwören mögen, daß Ipukis Stimme schwankte.
»Wie ist es gegangen? So rede doch!« drängte er, während er mit langen Schritten neben dem Diener auf die Hütte zuging. »Was ist mit dem Kind?« Eigentlich brauchte er keine Antwort, denn ein Blick in das ernste Gesicht des Mannes bestätigte ihm, daß dort drinnen etwas Furchtbares auf ihn wartete.
»Die Kinder leben.«
Die Kinder? Bai glaubte, sich verhört zu haben. Und Henutmira? Lebte sie denn nicht mehr? Er beschleunigte seinen Schritt und eilte auf das Häuschen zu. Vor dem Eingang blieben die beiden Männer stehen. Zwei ältere Frauen huschten aus der Tür, einen geflochtenen Korb schleppend, der mit Tüchern bedeckt war. Dann erschien Mehit in der Türöffnung, Ipukis treue Gefährtin. Da sie mit dem Rücken zum erhellten Raum stand, blieb ihr Gesicht im Schatten, und Bai konnte nichts darin erkennen.
»Es ist schwer gewesen, Herr, der edlen Henutmira geht es nicht gut, ihr Bewußtsein ist entflohen.«
»Ist sie … ?«
»Nein, nein, ihr Ba weilt noch bei ihr, aber ich weiß nicht, ob sie wieder gesund werden kann. Sie hat viel Blut verloren.«
Bai schob Mehit zur Seite und betrat den Raum. Ein süßlicher Geruch nach Blut schlug ihm entgegen. Schmierige Flecken bedeckten den Schilfboden. Ein junges Mädchen, kaum älter als zehn Jahre, goß aus einem irdenen Krug Wasser auf den Schleim und legte frisches Stroh darauf. Eine andere Frau schichtete Ziegel in einen Sack. Sie war damit beschäftigt, den eigentlichen Geburtsplatz abzubauen.
»Die Herrin war zu schwach, um hier zu knien.« Mehit war hinter Bai getreten. »Wir mußten sie auf das Bett legen.«
Dort lag Henutmira auch jetzt. Bai verspürte allerdings keinerlei Bedürfnis, zu ihr hinüberzugehen. Er erblickte zwei Bündel in einem flachen Weidenkorb am Fußende des Lagers.
Mehits Augen waren seinem Blick gefolgt. »Ja, Herr, es sind zwei Kinder«, flüsterte sie, »deshalb war es ja auch so schwer, eins lag falsch herum und das wollte nicht kommen. Es ging ja nicht, denn dieses Kind hat …« Auf eine gebieterische Geste Bais verstummte sie.
»Entferne die Tücher!« befahl er und hoffte inständig, daß nicht wahr sein möge, was er insgeheim schon ahnte. Mit flinken Bewegungen nestelte Mehit an den Stoffen, und schließlich lagen die zwei Säuglinge nackt auf dem aufgefalteten Leinen. Die Frau erhob sich und blieb mit hängenden Schultern und gesenkten Augen neben dem Korb stehen.
Bai warf einen Blick hinein und erstarrte. »Aber das ist doch …« seine Stimme klang heiser, » … ein Krüppel!« Er ließ sich auf die Knie nieder und betrachtete widerstrebend, was ihm seit vielen Zehntagen Kopfzerbrechen verursacht und ihn beinahe seine Stellung am Hof gekostet hatte. Beide Kinder waren männlich. Dennoch bestand kaum Ähnlichkeit zwischen ihnen. Er starrte auf den kläglich mißgestalteten Körper eines der beiden Knaben. Das Kind lag auf der Seite, ein Knie an den Bauch hochgezogen, während das andere, etwas kürzere Bein dünn und schwächlich dalag. Bai konnte seinen Blick nicht von dem ausgeprägten Buckel lösen, der sich über der linken Schulter des Kindes wölbte. Daß der Kopf verformt und die ganze linke Seite verkürzt war, erkannte er erst bei näherem Hinsehen.
»Was ist damit?« fragte er knapp und deutete auf eine schrundige Stelle über dem Ohr.
»Das kommt von der Zange, mit der wir ihn aus dem Leibe –«
»Schon gut, ich verstehe!« unterbrach Bai. So genau wollte er es nicht wissen. Trotzdem konnte er nicht verhindern, daß eine widerwärtige Vorstellung von Zangen in ihm aufstieg, die in Henutmira hineinfuhren und den Kopf des Kindes zusammenpreßten. Dennoch schien das Kind sehr lebendig zu sein, es fuchtelte mit seinen Ärmchen und versuchte, sich die kleinen, zu Fäusten geballten Hände abwechselnd in den Mund zu stopfen.
Bai wandte sich dem anderen Säugling zu. Dieser lag auf dem Rücken, er hatte die Arme und Beine von sich gestreckt und die Augen geschlossen. Äußerlich schien ihm nichts zu fehlen, beunruhigend aber war die völlige Bewegungslosigkeit. Im ersten Augenblick dachte Bai, das Kind sei tot, bis er das kaum merkliche Heben und Senken des kleinen Brustkorbs sah.
›Warum, o Reschpu, der du die Gebete hörst‹, dachte er trostlos, ›warum läßt du es so enden?‹ Es war ihm nicht bewußt, daß er sich an die Gottheit gewandt hatte, die ihm aus seinem hurritischen Elternhaus vertraut war.
Was sollte er jetzt tun? Warum ließen ihn die Götter im Stich? Hatte er sich nicht nach Kräften bemüht zu erfüllen, was er für ihren Wunsch hielt? Mit größter Umsicht hatte er für die Zukunft des Kindes, eines Kindes, vorgesorgt. Und nun? Dies waren seine ersten Kinder, zumindest wußte er von keinen anderen. Davon war das eine fast tot – und das andere? Er mußte das Notwendige veranlassen, und zwar möglichst rasch.
»Mehit, hole deinen Mann!« Sein Befehl klang barscher, als er beabsichtigt hatte. »Halt, sage mir noch: Wer außer euch und den Frauen weiß hiervon?«
»Niemand, Herr, wir haben alles so vorbereitet, wie du es befohlen hast. Der Priester bricht morgen nach Nechen auf und wird dort bleiben. Für diese beiden«, Mehit wies mit einer Bewegung des Kopfes auf die ältere Frau und das Mädchen, die noch immer schweigend den Raum säuberten, »die Wehmutter und ihre Tochter, bürge ich dir. Die zwei Alten draußen sind taubstumm. Niemand wird etwas erfahren, wenn du es nicht willst.« Sie huschte zur Tür hinaus, und die beiden Dienerinnen trotteten ihr nach.
Nun, da er allein war, ging Bai zu Henutmiras Bett und betrachtete die reglos daliegende Gestalt. Ihre durch die Ohnmacht entspannten Züge schienen ihm makellos und von großer Klarheit. Nur die schweißnassen Löckchen, die an der Stirn klebten, erinnerten an die Anstrengung der letzten Stunden. Er beugte sich über sie.
»Meine Schwester!« Da sie ihn nicht hören konnte, wollte er sie ein letztes Mal anreden wie ein Liebender. »Ich habe dir niemals Unheil zufügen wollen! Kehrtest du nur zurück, damit ich zu dir sprechen könnte wie einst …«
Aber was geschähe dann? Er wußte, daß er ihr nur um so tieferen Schmerz zufügen müßte. Denn gewiß würde sie ihre Kinder nie kennenlernen. Und kein anderer als er würde die Verantwortung dafür tragen. Für alle Fälle flüsterte er einen Zauberspruch, um die Peiniger Henutmiras zu bannen, wenngleich er nicht wußte, ob er dazu überhaupt berechtigt war. Womöglich verschlimmerte er die Lage mit dieser Anmaßung. »Gelöst werden möge die Last, weichen möge die Schwäche, die ein Wurm in diesen reinen Leih gelegt hat, den ein Gott oder ein Feind erzeugt hat.«
Draußen näherten sich Schritte.
Er ging zur Tür, trat hinaus und blickte in die sorgenvollen Gesichter Mehits und Ipukis. Alle drei spürten die Spannung, die zwischen ihnen herrschte. Bai verschränkte die Arme vor der Brust und ließ sich Zeit, bis er das Wort ergriff.
»Die Götter haben es nicht gut mit uns gemeint«, sagte er endlich. »Sie sandten Leid, wo wir uns Freude ersehnten. Die Niederkunft der edlen Henutmira war schwer. Chnum, dem Schöpfer, hat es gefallen, nur das eine Kind mit einem wohlgestalteten Leib zu versehen, doch befindet es sich wohl schon auf dem Weg in die Gefilde des Westens. Das andere ist nur ein Klumpen Lehm von des Höchsten Töpferscheibe.« Es war ausgesprochen. Sofort spürte Bai Erleichterung, jetzt wollte er handeln, um wieder Herr der Lage zu sein. »Mehit, du bist verantwortlich dafür, daß Henutmira die beste Pflege erhält. Ipuki, du gibst mir Nachricht über alles, was geschieht. Ich erwarte jeden Zehntag einen ausführlichen Bericht in die Hauptstadt. Außerdem sorgst du dafür, daß der verkrüppelte Knabe seinen Bruder auf seinem beschwerlichen Weg begleitet.«
»Nein!« schrie Mehit auf. »Das darfst du nicht, Herr, du kannst doch nicht dein Kind ermorden! Das ist ein Verbrechen gegen die Götter und …«
»Schweig!« unterbrach er sie schroff. »Du vergißt dich! Dies ist meine Entscheidung!«
»Aber es ist ein Kind, und es lebt! Was hat es verbrochen, daß du es töten willst?« Mehit trat vor Bai hin und sah ihm eindringlich ins Gesicht. Obwohl ihr Tränen über die Wangen liefen, wirkte sie entschlossen und kämpferisch wie die löwenköpfige Göttin Sachmet selbst.
»Mehit, sei ruhig, du weißt nicht mehr, was du sprichst!« Ipuki ergriff die Schulter seiner Frau und zog sie zurück. »Bezähme dich, sonst erregst du den Zorn unseres Herrn, und wenn er dich dafür straft, wird er recht daran tun.«
»Aber er darf das Kind nicht töten lassen! Vielleicht kann es gesund werden, wenn man es nur richtig pflegt«, schluchzte Mehit. »Bitte, Ipuki … ach bitte!«
Bai sah in den Nachthimmel hinauf. Der Leib der Himmelsgöttin Nut, der sich über das flache Land spannte, erglänzte noch immer in atemberaubender Sternenpracht. Doch er sah die Schönheit nicht. Mehits Verhalten machte ihn so zornig, daß er sie am liebsten geschlagen hätte. Statt dessen funkelte er sie an: »Du wirst tun, was ich dir sage, Frau! Und zwar ohne Widerspruch. Ich warne dich!«
»Bitte, Herr«, fuhr Ipuki dazwischen, »Mehit wird handeln, wie du befiehlst.«
In diesem Augenblick hörten sie etwas, das sie erstarren ließ. Ein zweifaches Kreischen, ein Wimmern, ein dumpfer Schlag und ein gespenstisches Stöhnen, das Bai das Blut in den Adern stocken ließ. Henutmira!
»Die Kinder!« keuchte Mehit und stürzte auf die Geburtslaube zu, dicht gefolgt von den Männern.
An der Tür schob Bai die Dienerin unsanft zur Seite und betrat als erster den Raum. Fassungslos starrte er auf das Bild, das sich ihm bot.
Henutmira lag auf dem Boden. Ihr Gesicht war verzerrt. Mit der einen Hand krallte sie sich in den Rand des Kinderkorbs, die andere streckte den Säugling mit den gesunden Gliedern in die Höhe, ein winziges, zappelndes, schreiendes Wesen. Dieses Kind hatte Bai auf dem Weg in den Westen gewähnt. ›Er wird nicht sterben‹, dachte er wie betäubt. Unfähig, seine Gedanken zu ordnen und das Geschehen zu begreifen, nahm er nur einzelne Bilder wahr: den Korb, das Kind und schließlich das Antlitz Henutmiras. Ihre Lippen verzogen sich, und sie brach in Gelächter aus. Kalt lief es ihm den Rücken hinunter, als er in Henutmiras Gesicht sah. Er vermochte kaum, seinen Blick von der Leere in diesen toten Augen zu lösen.
Sein Denkvermögen kehrte erst zurück, als er einen Schlag gegen die Brust erhielt. Ipuki hatte ihn zur Seite gestoßen und war mit zwei Sätzen bei Henutmira. Er riß ihr das Kind aus der Hand und legte es in den Korb zurück. Mit beiden Händen packte er ihre Arme und zerrte die sich heftig wehrende Frau zum Lager zurück.
Wo war der andere Knabe? Bai entdeckte ihn nicht gleich, wohl aber Mehit. Mit einem Aufschrei stürzte sie an ihm vorbei in eine entfernte Ecke des Raums. Sie stolperte, fast wäre sie ausgeglitten. Schluchzend brach sie in die Knie, hob das winzige Geschöpf auf und drückte es an ihre Brust. Sie stammelte zärtliche Worte und stieß dazwischen Verwünschungen aus gegen alle, die diesem Kind fürderhin etwas anhaben wollten.
Noch immer vermochte Bai sich nicht zu bewegen. Es war, als weigere er sich, an diesem Augenblick seines Lebens teilzunehmen. Vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihn nicht Ipuki mit dem Mut der Verzweiflung laut angeschrien hätte.
»Herr, Herr! Hilf mir doch! Sonst muß ich ihr wirklich wehtun! Herr, sie ist doch die Tochter des Thronfolgers!«
Nun kam Bewegung in Bai, und mit einem Sprung war er an Ipukis Seite. Noch immer wand sich Henutmira und schlug mit erstaunlicher Kraft um sich. Ihr Haar hing zerzaust bis auf die Schultern, das Hemd war zerrissen, ihr Körper besudelt. Speichelfäden rannen ihr aus den Mundwinkeln, und aus ihrer Kehle quollen Töne, die an das Grunzen eines Tieres erinnerten. Bai schlug ihr ins Gesicht, um sie zur Ruhe zu bringen, und der Schauder verdoppelte die Wucht des Schlages. Henutmira sank zusammen, ihre Augen verdrehten sich, bis nur noch das Weiße darin zu sehen war. Geschickt wurde sie von Ipuki aufgefangen, der sie beinahe zärtlich auf das Lager bettete. Als er aufblickte, sah Bai, daß er Tränen in den Augen hatte. »Sie gehört zur Familie des Gottes«, flüsterte Ipuki, »warum sind die Ewigen gegen sie?«
Bai antwortete nicht. Er verstand genausowenig, warum Meren- ptahs Tochter die Gunst der Götter verloren hatte. Er wollte auch nicht darüber nachdenken. Es galt, das Nächstliegende zu tun, und das fiel ihm schwer genug. Eigentlich wollte er nur noch fort. Und schlafen. ›Ich werde morgen Beschlüsse fassen. Nicht heute‹, entschied er bei sich. »Schaffe hier Ordnung und melde dich morgen früh bei mir im Haus!« befahl er dem Diener. Ohne einen Blick auf Mehit, Henutmira oder die Kinder verließ er den Raum.
***
Bai blinzelte in das Licht der Morgensonne, das schräg auf sein Lager fiel, funkelnde, goldene Wärme, dank der frühen Stunde noch sanft und schmeichelnd. Während sein Verstand sich langsam und zögernd dem neuen Tag zuwandte, vernahm er die üblichen Morgengeräusche des großen Hauses. Irgendwo wurden Truhen gezogen, ein Hammer klopfte, und unter Geklapper von Geschirr mischten sich die halblauten Zurufe von Frauen und die hellen Stimmen der Kinder draußen im Vorgarten. Dreißig Bedienstete beschäftigte der edle Nedjem im Haus.
Nedjem, dem Obersten Vermögensverwalter von Pharao Ramses, diesem wahrhaft Großen am Hof von Pi-Ramesse, oblag die Leitung des Weingutes Tjeni Nefer. Er hatte sich als ein liebenswürdiger Freund Bais offenbart, seitdem sich herausgestellt hatte, daß der junge Mann die besondere Gunst Merenptahs genoß. Und Merenptah, der Sohn des Guten Gottes Ramses, hatte einen Befehl erteilt: »Bringe Henutmira zu dem Ort, wo reichlich die Trauben an den Weinstöcken gedeihen und Kelterer den Gottestrank bereiten.«
Henutmira? Mit schmerzhafter Klarheit war sie wieder da, die Erinnerung an die Ereignisse der vergangenen Nacht. Bai schob die dünne Wolldecke zur Seite und erhob sich. So elend hatte er sich schon lange nicht mehr gefühlt. Hinter der Stirn hämmerten Schmerzen, und sein Magen wand sich in einem Krampf. Ein Grund mehr, die notwendigen Entscheidungen sofort zu treffen.
Als er den Empfangsraum betrat, war er gewaschen und hatte die Barthaare entfernt. Er war geschminkt, gesalbt und mit einem blütenweißen, frisch gestärkten Schurz bekleidet. Seinen Hals zierte ein Usech-Kragen aus tropfenförmigen, dunkelgrünen Perlen, um die sich winzige Blüten aus Blattgold rankten. An seiner linken Hand blitzten zwei Smaragdringe. Nachdenklich musterte er die Gesichter der Hausdiener. Was hatten sie von den Ereignissen der vergangenen Nacht bemerkt? Jeder, der ihm begegnete, blickte ihn erwartungsvoll an und schien auf eine Nachricht zu hoffen, die ihn aus der Ungewißheit erlöste. Selbst das junge Mädchen, das ihm die Speisen brachte, suchte in seinem Gesicht nach Anzeichen, die einen Ausbruch von Jubel rechtfertigen würden. Der Aufseher der Dienstboten neben der Tür trat verlegen von einem Bein auf das andere, wohl um den richtigen Augenblick abzupassen, um seinem Herrn die ergebensten Glückwünsche vorzutragen. Hastig beendete Bai sein Frühstück und winkte ihn zu sich.
Der Aufseher Kaka war ein Mann an der Schwelle des Alters, ein treuer Untergebener mit eher beschränkten Geistesgaben. Er hatte sein ganzes Leben auf diesem Weingut zugebracht. Die Anwesenheit einer offenbar sehr hochgestellten Vornehmen aus dem Chenu, dem Palast, gehörte zu den aufregendsten Ereignissen in seinem Leben.
»Ich habe keine freudige Nachricht, Kaka.« Bais Stimme klang belegt, er mußte sich mehrmals räuspern, bis ihm die Worte klar über die Lippen kamen. »Die hohe Frau ist sehr, sehr krank, und große Opfer müssen gebracht werden an Isis, Bes und auch an Ischtar, damit sie geheilt werde, sofern das überhaupt möglich ist.«
Kaka senkte betroffen den Kopf. Wenn man sogar die Göttin aus Babylon anrufen mußte, dann standen die Dinge wirklich schlecht.
»Henutmira wird hier in Tjeni Nefer bleiben«, fuhr Bai fort, »bis die Götter ihr Genesung gewähren. Ich werde zwei oder drei ihrer Dienerinnen aus Pi-Ramesse kommen lassen. Ihr sorgt dafür, daß es ihr an nichts fehlt.« Eine kurze Pause entstand. »Das ist alles.« Auf Kakas fragenden Blick hin setzte er knapp hinzu: »Das Kind liegt im Sterben.«
Der Alte schlich mit hängenden Schultern davon, und Bai betrachtete mit gerunzelter Stirn seine Fingernägel. Auch bei anderem Verlauf der Ereignisse wäre seine Auskunft dieselbe gewesen. Je weniger Menschen von dem Dasein eines Kindes, seines Kindes, erfuhren, desto besser. Ein Knabe mußte nach Men-nefer geschafft werden, und die Menschen von Tjeni Nefer würden ein Begräbnis erleben. Nun würde man wirklich ein totes Kind beisetzen.
***
Ipuki war es gelungen, innerhalb einer Stunde eine Amme zu besorgen. Mehit bedachte ihren Gefährten mit einem Lächeln. ›Wie tüchtig er ist‹, dachte sie. ›Er wird den Herrn überzeugen, daß er das Kind nicht töten darf!‹
Während der Nacht hatte Mehit kein Auge zugetan. Sie hatte die Säuglinge gewaschen und in frisches Linnen gehüllt. Sie hatte sie gestreichelt und liebkost, während ihre Lippen unermüdlich Gebete murmelten. Der Knabe mit den gesunden Gliedern war sehr bald in Schlaf gefallen, der andere lag noch lange mit weit geöffneten Augen und schürzte suchend seine winzigen Lippen. Mehit beobachtete ihn, und ihr Herz schmerzte vor Sehnsucht, ihn zu behüten und zu lieben.
Als die Sonne aufging und Ras erste Strahlen durch das Flechtwerk der Laubenwände fielen, kniete sie noch immer neben dem Kinderkorb, die Stirn auf seinen Rand gesenkt, mit der Hand sacht den kleinen Kopf umfangend. So flehte sie zum Herrn der Ewigen:
»Du gehst auf, o Ra, du gehst auf, steh mir bei, o Ra, mein Herr! Ich gebe dich nicht her, mein Knabe, ich gebe dich nicht her! Siehe, ich schütze dich, mein Kindl«
So viele Nilschwemmen hatte Mehit schon erlebt, und nie war ihr Leib fruchtbar geworden. Jahre des vergeblichen Wartens und Hoffens, der Gebete und Opfer hatten ihr Leben mit einem hauchfeinen Schleier von Traurigkeit bedeckt, ähnlich dem kaum wahrnehmbaren Grau in der Luft, wenn ein Sandsturm sich ankündigt aus den Weiten der westlichen Wüste. Daß dieser Schatten über ihrer Lebensfreude dennoch nie ins Dunkel der Bitterkeit hinüberglitt, hatte seinen Grund darin, daß Mehit Ipuki von Herzen zugetan war und dieser sich ihre Liebe, die stets eine mütterliche Färbung besaß, mit unschuldigem Genuß gefallen ließ. Ipuki, ein Mann von bodenständigem Wesen, bedauerte seine und Mehits Kinderlosigkeit zwar auch, nahm sie sich aber bei weitem nicht so zu Herzen. Er tröstete sich damit, daß er seinem Herrn mit Hingabe diente und für Mehits Haushalt ausgeklügelte Vorrichtungen erfand, die ihr die Arbeit erleichtern sollten. Ansonsten bemühte er sich so oft wie möglich, seiner Frau ein Kind zu zeugen.
»Mehit!«
Die Angesprochene schreckte hoch. Sie hatte niemanden kommen hören. Ipuki berührte sie sanft an der Schulter. Als sie aufstand, erkannte sie hinter ihm Bai, ihren Herrn. Anders als in der vergangenen Nacht wirkte er jetzt kühl, selbstbewußt, fast geschäftsmäßig.
»Die Frau dort draußen ist die Amme, nehme ich an?«
»Ja, Herr, sie ist jung und gesund, und die Gute Göttin hat sie überreich mit Milch gesegnet, welche die Knaben …«
»Schon gut!« unterbrach er sie und versuchte, nicht zu dem Lager hinzusehen, auf dem noch immer Henutmira in tiefem Schlaf lag. »Ich habe meine Pläne geändert, Mehit. Ihr werdet in einigen Tagen nach Men-nefer reisen. Die Amme wird euch begleiten. Danach wird man euch Anweisungen geben.«
Mehit hob die Augen und fragte mit zitternder Stimme: »Herr, wen meinst du?«
»Das bist du, dein Mann und das gesunde Kind«, entgegnete Bai mit Nachdruck.
Vor diesen Worten hatte sich Mehit seit Stunden gefürchtet. Mühevoll hatte sie sich Sätze zurechtgelegt, kluge Gründe gefunden, um den Herrn zu überreden. Vergeblich, wie es schien. Verschwunden waren die wohlgesetzten Worte, entflohen wie Fliegen, nach denen die Hand schnappt. Wild brodelte es in ihren Gedanken. Sie sank vor ihrem Herrn auf die Knie und berührte mit der Stirn seine Sandalen. »Herr, vergib deiner unwürdigen Dienerin ihre dreiste Bitte«, flehte sie. »Der Körper des zweiten Knaben ist zwar verkrüppelt, aber sein Ka ist stark und schön! Ich will für ihn sorgen und ihn lieben, wenn du es erlaubst! O Herr, der du gütig bist und voller Mitgefühl, höre auf das Flehen deiner Dienerin, die wie der Sand ist unter deinen Füßen …«
Bai zog die Brauen zusammen. »Mehit, erinnere dich an meine Worte!«
»Herr, es ist nicht Mehits Schuld!« Auch Ipuki stand nun mit tiefgebeugtem Rücken vor Bai. »Die Ewigen selber haben ihr die Liebe zu diesem Kind ins Herz gelegt, bitte strafe sie nicht für ihre Kühnheit.«
Mehit erhob sich umständlich und strich sich eine widerborstige Haarsträhne aus dem Gesicht. Auf ihrer Stirn standen feine Schweißperlen, und die Haut an der zarten Mulde unterhalb der Kehle hob und senkte sich in schnellem Wechsel. Sie war sehr bleich. »Gütiger Herr, niemals wirst du Sorgen haben durch dieses Kind, ich bürge mit meinem Leben dafür. Du weißt von allen Dingen, so wisse auch von meiner Not. Ich sehne mich nach einem Kind, wie der Verdurstende nach Wasser verlangt.«
Lange blieb es still.
Bai sah Mehit an. Zu seinem nicht geringen Schrecken brannten ihm die Augen, und in seiner Kehle schmerzte ein glühender Knoten. Schroff drehte er den Kopf zur Seite. Hatte er nicht wahrlich genug am Hals auch ohne das Gejammer dieses Weibes?
Eine Erinnerung stieg in ihm auf. Er sah sich als Knaben in einem lichten, von wuchtigen Säulen eingefaßten Saal. Überall liefen Menschen scheinbar ziellos umher. Schwaden von Weihrauch zogen durch die Luft und verbreiteten würzigen Duft. Bai vernahm die schrillen, klagenden Stimmen schwarzgekleideter Frauen, die sich die Haare rauften und bedrohlich schnell auf ihn zukamen wie große, dunkle Vögel. Seine Hand lag in der seines Vaters, der ihn zu einem buntbemalten Sarg führte. Viele Bilder bedeckten das Holz, aber der kleine Knabe sah nur das eines zähnefletschenden Ungeheuers, vor dem hochaufgerichtet eine ehrfurchtgebietende Gestalt mit erhobenem Speer stand. Wie aus weiter Ferne hörte er seinen Vater sagen: »Dein Bruder wird deine Mutter begleiten auf ihrem Weg in den Westen!« »Aber wer wird sie vor dem Ungeheuer beschützen?« hatte Bai gefragt. Auch jetzt spürte er etwas von der Bestürzung, die er damals empfunden hatte, als er sich vorstellte, wie das schreckliche Wesen den kleinen Bruder aus den Armen seiner Mutter riß.
Ohne es zu merken, ballte Bai die Fäuste, bis seine Knöchel sich weiß färbten. »Nimm das Kind, Mehit«, stieß er mit rauher Stimme hervor. »Aber sollte jemand erfahren, daß es nicht deines ist, werde ich dich töten. Hörst du? Ich werde dich töten!« Er ergriff Mehits Kinn, hob ihr Gesicht und zwang sie, ihm in die Augen zu sehen. »Wie du es anstellst, daß dir die Leute glauben, ist deine Sache. Ich rate dir, laß dir etwas einfallen!«
Mehit hob dankbar die Arme, aber Bai beachtete sie schon nicht mehr. Er stand vor Ipuki und erteilte ihm mit beherrschter Stimme Anweisungen. »In der Stunde, in der Ra sich anschickt, seine nächtliche Fahrt anzutreten, nimmst du ein Gespann und fährst nach Men- nefer. Dort begibst du dich umgehend zum Schrein des Qasarti, der im südlichen Teil der Stadt liegt. Dort findest du ein Haus mit blauer Tür, um die Lotosblüten gemalt sind. Der Mann, der in diesem Haus wohnt, heißt Hui. Ihm fehlt ein Auge, daran erkennst du ihn leicht. Sag ihm, du kommst aus Tjeni Nefer, das genügt. Er wird für ein Boot sorgen, mit dem das Kind, Mehit und die Amme geholt werden … und … nun, auch Mehits Kind.«
Nachdenklich sah Ipuki zu Henutmiras Lager hinüber, wo die Kranke sich mit leisem Stöhnen bewegte. »Und was geschieht mit ihr?«
»Du bringst zwei Frauen aus Henutmiras Haushalt her, die sie pflegen werden. Für wie lange, weiß ich nicht. Vielleicht für sehr lange.«
Mehit trat an die Seite ihres Mannes. »Großmütiger, guter Herr«, fragte sie sanft, »wem wirst du das Kind mit den schönen Gliedern geben?«
Bai wurde traurig, ohne zu wissen, warum. Bemühte er sich nicht, alles so gut zu regeln, wie er nur konnte? ›Das braucht sie nicht zu wissen‹, dachte er. Zu seinem eigenen Erstaunen hörte er sich sagen: »Dem Hohenpriester des Ptah von Men-nefer will ich es geben.«
ERSTES BUCH
JAHR 5, PHARAO MERENPTAH
(1209 – 1208 v. CHR.)
Kapitel 1DIE GRABBAUER PHARAOS
Die Sterne verblaßten bereits über dem felsigen Tal, in dessen Grund sich eine kleine Siedlung duckte. Eine fast mannshohe Ziegelmauer umschloß sie in schützender Umarmung. Die dicht aneinandergebauten Häuser wirkten wie eine einzige, wuchtige, tiefschwarze Masse und verschmolzen mit den Schatten, die von den Berghängen herunterkrochen. Die Luft duftete nach der Frische des Morgens, der sich in einem grauen Streifen über der Kuppe des östlichen Hügels ankündigte. Auf dem gegenüberliegenden Abhang war das Dunkel nicht mehr ganz so schwarz, schon ließen sich Grabanlagen, Tempel, kleine Pyramiden aus Lehmziegeln und Schreine aus Kalkstein als helle Flecke erahnen. Dazwischen wanden sich schmale Wege, viel begangen während des Tages, aber menschenleer in der Zeit, da Ra durch die Gefilde des Totenreiches reist. Ab und zu streunten magere Hunde auf den steinigen Pfaden durch die Gemäuer und knurrten Fledermäuse an, die in lautloser Jagd vorbeihuschten. Hier ruhten die Ahnen der Dorfbewohner in ihren Wohnungen für die Ewigkeit. Wohl versorgt waren sie, denn ihre Kinder und Kindeskinder wurden nicht müde, ihnen Opfer zu bringen, in Gebeten mit ihnen zu sprechen und sie um Rat und Hilfe zu bitten in Angelegenheiten, die ihr diesseitiger Sinn nicht bewältigen konnte.
Sechzig Familien lebten in dem kleinen Ort auf engem Raum zusammen, stolze und selbstbewußte Menschen, die eine besondere Rolle im Lauf der Welt spielten. Ihre Bedeutung war ihnen bewußt. Sie besaßen das Wohlwollen der Großen des Landes, sogar die Gunst des Guten Gottes selbst. Jeder Mensch im Lande Kemet hatte von diesem Dorf gehört. Man mußte es nicht einmal beim Namen nennen. Sprach man von »Pa-Tíme«, dem »Ort«, so erschauerte jeder Bewohner Ägyptens, denn dort befand sich Ta Set Ma’at, der Große Platz der Wahrheit. In Pa-Tíme lebten Handwerker, die aus den Bergen die ewigen Ruhestätten der Pharaonen herausmeißelten und so dafür sorgten, daß die Mumie jedes toten Königs von seinem Ka besucht werden konnte, während der Verstorbene selbst unter den Göttern weilte. Sie malten die Bildnisse der Ewigen auf die Wände der Grabkammern und erzeugten damit jene unbegreifliche Zauberkraft, die Göttern und Verstorbenen Leben einhauchte. So vereinigten sich in den Horizonten der Ewigkeit das Diesseits und das Jenseits auf geheimnisvolle Weise.
An diesem Herbstmorgen, in der Jahreszeit, da der Nil über die Ufer tritt und die Erde schwarz werden läßt vor Fruchtbarkeit, schritt ein Mann auf das Dorf zu. Er kam von seiner eigenen Grabstätte, an der er seit Jahrzehnten arbeiten ließ. Dort hatte er, wie fast jede Nacht, eine Stunde still verbracht und sich in den Anblick der Gestirne am nächtlichen Himmel versenkt. Bevor er das Werk des Tages begann, wollte er einige Gedanken aufschreiben. Er beschleunigte seinen Schritt. Die Nacht war ungewöhnlich gewesen; seltsame Träume hatten ihn heimgesucht, deren Deutung ihm soeben gelungen war. Er ging an der niedrigen Mauer aus Kalksteinziegeln entlang, die den äußeren Ring um das weitläufige Gräberfeld des Dorfes zog.
Ein Geräusch ließ ihn innehalten. Ganz still stand der Mann auf dem Pfad, der von den Gräbern ins Dorf hinunterführte, und lauschte in das Zwielicht des heraufdämmernden Morgens. Außer dem Sirren der Zikaden vernahm er ein Rascheln, ein leises Stöhnen und gedämpfte menschliche Stimmen.
»Verlasse mich noch nicht, Geliebter, denn der Tag ist noch weit, und mich verlangt so sehr nach dir!« flüsterte Baket-Ra und schlang die Arme um Niu, der sich aufgerichtet hatte.
Niu nahm ihr Gesicht in beide Hände und sah sie so eindringlich an, daß sie sich fast zu fürchten begann. »Ich kann nicht länger bleiben, du Schöne! Es ist bald hell, und man darf uns nicht entdecken.«
»Aber ich ertrage es nicht, dich ziehen zu lassen, denn Nacht, dein Bruder, wird bald zurückkehren mit den Männern der Kolonne, und dann werde ich … wirst du …« Baket-Ra verstummte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und Niu brach es beinahe das Herz.
»Er ist dein Mann!« murmelte er hoffnungslos. »Das Beste, was ich tun kann, ist, das Haus zu meiden. Erst, wenn er wieder zum Großen Platz der Wahrheit aufbricht, kann ich zu dir kommen, falls ich nicht auch dorthin muß.«
»Gerade das wird geschehen!« klagte Baket-Ra. »Auch du wirst wieder im Grab des Königs zeichnen müssen, und ich werde allein sein. Meine Augen werden danach verlangen, dich zu sehen, und meine Schenkel werden hungern, dich zu umschließen. Bleib noch eine kurze Weile!« Sie zog Niu auf den Sandboden zurück. Sie wollte nicht daran denken, daß der Tag anbrach und die Menschen im Dorf der Grabbauer kaum hundert Ellen weit entfernt erwachten. Sie verschloß ihre Ohren vor dem fernen Geschrei der kleinen Kinder und den ersten Rufen ihrer Mütter, sie hörte weder das Krähen der Hähne noch das Bellen der Hunde. Für sie gab es nur die Begierde in Nius Augen und die Härte seiner Muskeln, die sich unter ihrer Berührung spannten. O Hathor, niemals hatte Nacht es vermocht, solche Gefühle in ihr wachzurufen! Kein einziges Mal hatte sie den Wunsch verspürt, ihm ihren Leib entgegenzudrängen, wie sie es nun bei Niu tat. Nie konnte sie sich ihm so öffnen an Herz und Körper, nie ihn so beschenken, wie sie Niu beschenkte seit jenem Nachmittag, als er vorzeitig vom Großen Platz zurückgekehrt war.
»Komm zu mir, Freude meines Herzens!« flüsterte sie. »Lege deine Hand auf die meine und tu wohl meinem Leib!«
»Es geht nicht, es ist zu spät!« Niu riß sich los. »Niemand darf davon erfahren. Ich muß zurück, denn Neferhotep wird die Männer zusammenrufen!« Er sprang auf, bevor Baket-Ra ihn daran hindern konnte, und legte mit fahrigen Bewegungen seinen Schurz an. »Früh müssen wir uns auf den Weg machen. Noch vor dem Abend sollen die Schäden am Platz der Schönheit behoben sein.« Er hielt inne, als er sah, wie Baket-Ra die Hände vors Gesicht schlug. »Ich werde mir etwas überlegen, meine Schwester. Ich werde uns retten!«
Er atmete schwer, und Baket-Ra begann zu weinen. Im Grunde ihres Herzens wußte sie, daß ihre Lage aussichtslos war. Sie war Nachts Ehefrau, und obwohl Nacht ein ehrenwerter Mann war, meist freundlich sogar, so gab er doch höchst ungern her, was ihm gehörte. Niemals würde er verstehen, daß seine schöne Frau sich in seinen jüngeren Bruder verliebt hatte!
Auch sie erhob sich jetzt und streifte sich das Kleid über. Ihre Hände zitterten, die Träger verfingen sich, und mit schlängelnden Bewegungen ließ sie das Leinen an sich hinuntergleiten.
›Wie schön sie ist‹, dachte Niu. ›Unglaublich schön!‹ Er vermochte nicht, seine Augen von Baket-Ras Vollkommenheit zu lösen, obwohl er wußte, daß ihm keine Zeit mehr blieb. Jeden Augenblick konnte ihr Geheimnis entdeckt werden. Er staunte, wie sehr Gefahr sein Begehren steigerte. Doch wenn er dem jetzt nachgab, war er, waren sie beide verloren! In einer plötzlichen Aufwallung nahm er alle Kraft zusammen.
»Möge die Gute Göttin dich schützen!« stieß er hervor und legte seine Hand an ihre Wange. Dann verschwand er hinter der Mauer, die sie gegen die Siedlung abgeschirmt hatte.
Baket-Ra starrte ihm nach. Sie bemühte sich um Fassung. Wenn sie weiter so heftig weinte, blieben ihre Augen geschwollen, und jede Frau in ihrer Straße würde wissen wollen, was sie bedrückte. Dem Habichtblick von Nachts Mutter Nesmut entging ohnehin nichts. Deren Mißtrauen hatte sie womöglich schon geweckt. Als sie die Tränen endlich niedergekämpft hatte, strich sie die Falten aus ihrem Kleid und spähte hinter die Mauer. Niu konnte sie nicht mehr sehen, aber ihr wurde bewußt, wie sehr die Zeit drängte. Der Sonnengott Ra bescherte der Welt einen neuen Tag. Die Schatten der Dämmerung lösten sich in hellgraue Dunstschwaden auf, die in Kürze den mächtigen goldenen Sonnenstrahlen weichen würden. Gelbe und orangerote Schleier am Himmel kündigten die Glutscheibe bereits an. Bald würde sie über die Hügelkuppe aufsteigen, und dann würden die Geheimnisse der Dunkelheit, die Sehnsüchte und Verheißungen zurücksinken und an jenem Ort des menschlichen Herzens verharren, aus dem das Dämmerlicht niemals schwindet.
Die Siedlung summte schon vor morgendlicher Betriebsamkeit. Baket-Ra roch die Feuer der Herde, auf denen Brote für den Tag bräunten. ›Nesmut wird mich schon suchen!‹ dachte sie und verdrängte alle Gedanken an Niu aus ihrem Herzen. ›Die Mädchen fragen sicher auch schon nach mir.‹
Baket-Ras Zwillingstöchter Hutemwija und Mutemwija waren Geschöpfe von außergewöhnlichem Liebreiz und sahen einander so ähnlich, daß sie verschiedenfarbige Bänder um ihren Oberarm tragen mußten, damit die Dörfler sie auseinanderhalten konnten. Hutemwijas Band war rot, Mutemwija liebte die Farbe Blau. Alle waren sich einig darüber, daß die beiden Sechsjährigen dereinst ihre Mutter an Schönheit noch übertreffen würden. Ihr Vater Nacht hielt das allerdings für blanken Unsinn, man brauchte Baket-Ra nur anzusehen, um zu wissen, daß sie vollkommen war. Für Nacht bedeuteten die Mädchen vor allem Störungen in den Liebesnächten mit seiner Frau, dann nämlich, wenn zu höchst unpassender Gelegenheit eine kleine heulende Gestalt neben dem Lager auftauchte und verkündete, sie habe Schlimmes geträumt und bedürfe dringend der Tröstung. Nicht einmal bei ihren Namen rief sie Nacht, er beschränkte sich darauf, sie Tepet und Sennut zu nennen, die Erste und die Zweite.
Ein plötzliches Geräusch ließ Baket-Ra zusammenzucken. Hinter ihr knirschte Sand, und ein Steinbrocken polterte gegen die Mauer. Sie stieß einen Schrei aus, fuhr herum und blickte in ein strenges Gesicht, dessen mißbilligender Ausdruck ihr nur allzu vertraut war. Vor ihr stand der Schreiber Ken-her-chepeschef.
»Ich wollte nur …«, stammelte Baket-Ra. »Ehrwürdiger Schreiber, wie lange stehst du schon hier?« Mit einer Hand fuhr sie sich durchs Haar, mit der anderen über die Wange. Hilflos, vergeblich der Versuch, ihre Locken zu ordnen und die verschmierte Augenschminke wegzuwischen. Was hatte Ken-her-chepeschef bemerkt? Warum war er hier? Dumpfe Furcht steckte ihr wie ein Klumpen in der Kehle.
»Mein Ohr vernahm Laute, die es nicht zu hören begehrte«, sagte Ken-her-chepeschef mit einer gefährlich leisen Stimme, die Baket-Ra frösteln ließ. »Mein Auge sah, obwohl es nicht sehen wollte. Dich wollte ich bestimmt nicht hier finden! Du bist als Ehefrau in das Haus Nachts eingetreten und hast seine Kinder getragen.« Die Stimme wurde lauter. »Und jetzt muß ich dich in den Armen seines Bruders erblicken!«
Alles hatte der Schreiber gesehen!
»Ich bitte dich, Ken-her-chepeschef, kehre um und vergiß, was du gesehen hast. Ich gehe ins Dorf zurück und …« Konnte sie auf Mitgefühl hoffen? Der alte Schreiber war ihr immer unzugänglich erschienen. Es wurde ihr bewußt, daß sie ihn eigentlich kaum kannte. Er übte sein wichtiges Amt schon seit der Zeit aus, als Baket-Ra noch nicht geboren war. Alle rühmten seine Klugheit, sein Wissen, aber jeder fürchtete auch seine scharfe Zunge und war froh, wenn ihm nichts unterlief, was dem gestrengen Dorfoberen mißfallen konnte.
Der Mann rührte sich nicht. Unverwandt sah er Baket-Ra an. Fast schien er ihre Not zu genießen, denn er ließ sich lange Zeit. »Wie kann ich das vergessen, Frau? Du mußt doch gewußt haben, was du tust! Und was auf dich und deinen Liebhaber wartet! Du kennst jene alte Geschichte von den zwei Brüdern. Nacht wird sein wie der ältere von ihnen, der wütend wurde wie der Leopard und seinen Spieß zur Hand nahm, um seinen Bruder zu töten!«
Baket-Ra kannte das Märchen gut, in dem die Frau des älteren Bruders den jüngeren verführt. Und leider wußte sie auch, was dann mit der Ehebrecherin geschah. Ihr war, als hörte sie von fern die Stimme ihres Vaters: ›Er tötete seine Frau, er warf sie den Hunden hin und saß trauernd da wegen seines jüngeren Bruders.‹ Warum quälte Ken-her-chepeschef sie damit? ›Wie bist du roh und gefühllos!‹ dachte sie. ›Kein Wunder, daß dich keine Frau liebt, kein Wunder, daß du so verbissen aussiehst! Du bist einer, in dessen Herz der Skorpion wohnt!‹ Laut aber beschwor sie ihn: »Nacht muß nichts erfahren, Schreiber, es sei denn, du gehst zu ihm. Aber wenn du das tust«, sie schluckte, »dann wird er barmherzig sein.« Ihre Worte klangen wenig überzeugend, denn im Grunde ihrer Seele ahnte sie, daß Nacht alles andere als großmütig sein würde. Nein, Ken-her-chepeschef hatte recht. Nacht würde sich verhalten wie jener Mann in der Geschichte. Er würde sich rächen.
Ken-her-chepeschef beobachtete sie. Seine Einfühlsamkeit war nicht so gering, wie Baket-Ra in ihrer Angst es ihm unterstellte. Eine Ehebruchsgeschichte hielt er im Grunde für abgeschmackt, jedenfalls nicht wert, sich näher damit zu befassen. Aber er sah wohl den Jammer und verspürte sogar ein wenig Mitleid mit der Frau, die zitternd vor ihm stand, hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Verzagen. Doch es bestand die Gefahr, daß in Kürze zwei der fähigsten Maler und Umrißzeichner am Großen Platz einander die Kehle durchschneiden wollten. Und das konnte ihm nicht gleichgültig sein.
Er hatte wahrlich nicht vor, Nacht reinen Wein einzuschenken. Es konnte aber nicht schaden, wenn er Baket-Ra darüber im unklaren ließ, vielleicht würde sie sich dadurch veranlaßt sehen, dieser unsäglichen Geschichte ein Ende zu bereiten.
»Kehre zurück zu deinen Pflichten, Frau«, sagte er düster, »und vergiß nicht: Auf die Ehebrecherin wartet das Krokodil.«
»Wie tröstlich!« stieß Baket-Ra hervor. Die Entscheidung war gefallen, er würde sie verraten, ihr Schicksal war besiegelt. »Warum bist du ohne Mitgefühl, Unbarmherziger? Nichts weißt du, der du fern bist von den Gefilden Hathors! Du hast nie eine Frau in dein Herz gelassen, du kennst die Liebe nicht!«
»Laß mich aus dem Spiel, Weib! Es geht nicht um mich, sondern um dich!«
»Dein Herz ist kalt, Schreiber, sonst könntest du mich verstehen!«
Ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, lief Baket-Ra an Ken- her-chepeschef vorbei und bog auf den Weg zum Dorf ein. Der Schreiber zuckte die Achseln und folgte ihr gemächlich.
***
Zufrieden schritt Ubechet, die Gattin des Vorarbeiters Neferhotep, durch das Haus, um Blüten auf Betten und Schemeln zu verteilen. Jeder Raum atmete Ordnung, Geschmack und Wohlhabenheit.
Das Haus des Vorarbeiters war eines der größten Anwesen der Siedlung. Es lag in dem Teil von Pa-Tíme, wo die Hauptstraße eine scharfe Biegung nach Westen macht. An dieser Stelle hatte man vor vielen Jahrzehnten mit der Erweiterung des Dorfes begonnen, als die Häuser im alten Teil für die ständig größer werdenden Familien der Handwerker nicht mehr ausreichten.
Ubechet betrat den Schlafraum, den sie seit zweiunddreißig Jahren mit Neferhotep teilte. Mit geübten Bewegungen ordnete sie die strohfarbenen, mit Fransen besetzten Decken auf den Lagern. Trotz der Morgenkühle schwitzte sie, denn mit den Jahren war sie rund und schwerfällig geworden.
Sie hörte die schnellen Schritte bloßer Füße auf den geflochtenen Matten, und einen Augenblick später steckte ein zehnjähriger, ungewöhnlich hellhäutiger Knabe mit braunem Haar und grauen Augen den Kopf durch die Tür.
»Ubechet! Du hast Besuch! Wabet ist gekommen!« Das war Hesisunebef, Neferhoteps Lehrling, der mit im Haus lebte. »Sie weint, und ihre Nase blutet.«
»Ich kümmere mich schon um sie!« Ubechet schob den Kleinen zur Seite und lief nach vorn in den Wohnraum. Dort lehnte eine kleine, füllige Frau an der Wand und verbarg das Gesicht in den Händen. »Wabet! Was ist geschehen?« Als die junge Frau die Hände herunternahm, sog Ubechet hörbar die Luft ein. Wabets Gesicht war blutverschmiert. »Ich hole Wasser, damit du dich säubern kannst.« Ihr Blick fiel auf Hesisunebef, der ihr nachgekommen war und die Frau anstarrte. »Hesi! Für dich ist die Stunde des Aufbruchs gekommen! Neferhotep wartet schon am Dorfausgang! Im Vorraum sind die Beutel mit Brot und Datteln. Vergiß die Wasserschläuche nicht, sonst mußt du später in der Mittagshitze wieder zurück!«
»Ich vergesse schon nichts. Du mußt mich nicht immer erinnern! Ich bin einer, der auf alles achtet!« Hesisunebef tänzelte um Ubechet herum. »Vielleicht werden wir heute fertig am Platz der Schönheit! Ich werde sehr hart arbeiten!«
Ubechet schmunzelte. Ja, er würde strebsam und emsig zu Werke gehen! Sie gab ihm einen Klaps auf den Rücken. »Los, los, du Fleißiger!«
»Mögen die Ewigen deinen Tag vergolden!« rief Hesisunebef und verschwand.
Ubechet ergriff den Wasserkrug und kehrte zu Wabet zurück. »Wieder Paneb?« fragte sie.
Die Besucherin nickte. »Er wollte Apachte zum Platz der Schönheit mitnehmen. Zeit wird es, daß der Bursche richtige Arbeit kennenlernt, sagte er. Aber Apachte war nicht da. Er streunt herum.«
»Euer Sohn macht, was er will!«
»Wie ein störrischer Esel, voll Jähzorn und Eigensinn!«
»Wie Paneb selber.« Ubechet stellte den Krug auf den Tisch und reichte Wabet ein Leinentuch. »Apachte ist seinem Vater sehr ähnlich, finde ich.«
»Aber er ist nicht fleißig wie er. Das macht Paneb rasend, und er prügelt ihn mit der Nilpferdpeitsche.«
Wabet wischte sich das Gesicht und legte den Kopf in den Nacken, um das Nasenbluten zu stillen.
Ubechet musterte sie aufmerksam. »Und dich schlägt er auch, nicht wahr?« fragte sie sanft.
»Nein, nein! Schlagen kann man das nicht nennen, nur ein kleiner Stoß, wenn er sehr wütend ist!« Wabet mied den Blick der Älteren.
»Was redest du! Das Blut, das ich sehe, kommt also von einem kleinen Stoß? Gute Göttin! Du bist in Hoffnung! Du erwartest ein Kind!«
»Hör auf, bitte! Er wird ruhiger werden, wenn das Kind erst da ist.«
»Das ist doch nicht dein Ernst! Warum sollte Paneb bei eurem sechsten Kind friedlicher werden? Bis jetzt ist er jedesmal wilder geworden!«
»Ubechet!« Wabet weinte wieder. »Warum machst du mir nicht Mut? Ich brauche deine Hilfe! Sprich mit deinem Mann! Vielleicht kann Neferhotep noch einen Lehrling brauchen, und es wäre gut für Apachte, mit dem jungen Hesisunebef zusammenzusein. Neferhotep hat doch schon Paneb im Grabmeißeln ausgebildet, als dessen Vater die Lähmung befiel. Paneb kann Apachte nicht ertragen! Kaum ist er mit ihm zusammen, befällt ihn wilde Wut. Sie sind Gejagte, alle beide.«
»Ich frage Neferhotep«, versicherte Ubechet. »Aber ich kann dir nicht viel Hoffnung machen. Mein Mann wird alt, und ich weiß nicht, ob er sich einem Wildling wie Apachte noch gewachsen fühlt. Zwar hat er Paneb zu einem der besten Steinmetze in der Kolonne ausgebildet. Aber diese Aufgabe hat ihn erschöpft. Paneb gebärdete sich oft wie ein Tollwütiger.«
»Aber Neferhotep hat ihn immer gemocht. Er ist fast der einzige im Dorf, der noch etwas von ihm hält.«
»Das stimmt nicht. Jeder bewundert Panebs Fähigkeiten.«
»Als Handwerker, ja! Aber als Mensch?«
»Er liebt das Bier und schwingt die Faust; da kann man es keinem verübeln, wenn er ihn meidet. Und was euren Sohn betrifft: Apachte ist der Paneb unter den Kindern, das weißt du. Aber ich spreche mit meinem Mann.«
»Ich danke dir!« Wabets Erregung hatte nachgelassen, und ihre Nase blutete nicht mehr. »Vielleicht wird doch noch alles gut! Ich gehe jetzt zurück zu den Kleinen. Ta-Scherit achtet zwar gut auf sie, aber sie ist selbst erst sieben Jahre alt.«
»Ta-Scherit! An deiner Tochter hast du doch viel Freude! Und was Apachte angeht: Vergiß nicht, ein Sohn stirbt nicht an den Prügeln seines Vaters. Zuviel Nachsicht wäre schlimmer!« Ubechet geleitete Wabet zur Tür und blickte ihr lange nach. Ihr Wohlgefühl von vorhin war verschwunden. Sie hatte Wabet nicht die Wahrheit gesagt. Niemals würde Neferhotep Apachte ausbilden. Er verabscheute ihn.
Nein, sie würde Wabet nicht helfen können.
***
Vorarbeiter Neferhotep hatte acht Männer für diesen Tag zusammengerufen. Am heutigen Abend, das stand für ihn fest, würde Ta Set Neferu, der Platz der Schönheit, vollständig wiederhergestellt sein. Hier, in dem Tal, wo die Ruhestätten der Großen Königlichen Gemahlinnen, der Königinnen und Prinzen sich in das Innere des Berges dehnten, hatten vor sechs Mondumläufen Wolkenbrüche und Überschwemmungen furchtbare Verwüstungen angerichtet. In viele Gräber war Wasser eingedrungen, hatte die Böden aufgeweicht und die in leuchtenden Farben prangenden Malereien bis zu einer Höhe von einer Elle aufgelöst. In der Sargkammer des vor langer Zeit verstorbenen Königs Men-cheper-Ra Thutmosis stand das Wasser kniehoch, ein Steinschlag hatte den Eingang zertrümmert. Das Wasser mußte viele Tage lang in hölzernen Eimern über steile Leitern ans Tageslicht geschleppt werden.
Seit jenem Tag nun arbeiteten nur die Männer der zweiten Arbeiterkolonne unter Vorarbeiter Inherchau im Grab des gegenwärtigen Königs, des Pharao Ba-en-Ra Merenptah. Neferhoteps Leute bemühten sich, die Schäden des Unwetters zu beheben. Hesisunebef und einige seiner Altersgenossen halfen beim Wegräumen von Steinen und zerhackten den getrockneten Schlamm, bis ihnen der Schweiß in den Augen brannte und die Arme schmerzten.
An diesem Tag wollten die Männer als letztes Grab am Platz der Schönheit das der Königin Nefertari vollenden. Diese Wohnung für die Ewigkeit liebte Neferhotep besonders. Es war das Lebenswerk seines Vaters, und er hielt sie für die vollkommenste in diesem Tal. Monate- und jahrelang hatte Neferhotep hier während seiner Jugend, ehrerbietig und fleißig, neben seinem strengen Vater gearbeitet. Dabei hatte er sich allmählich große handwerkliche Fertigkeiten angeeignet.
»Wo bleibt Niu?« richtete Neferhotep das Wort an To, einen grauhaarigen Mann, der neben ihm stand und ungeduldig an den Riemen seines Lederbeutels zerrte.
»Ich weiß es nicht!« sagte To ärgerlich. »Ich habe ihn heute morgen nicht gesehen. Deshalb dachte ich, er sei schon hier und warte auf uns. Aber mein Sohn ist nicht der einzige, der fehlt!« Dabei sah er den Steinmetz Paneb an.
»Apachte kann etwas erleben, wenn ich heimkomme!« knurrte der.
Auch die anderen Handwerker verloren die Geduld.
»Dann brechen wir ohne Niu auf«, sagte einer von ihnen. »Er wird uns später folgen, nehme ich an. Und Apachte brauchen wir ohnehin nicht.«
»Wir sollten schon zum Schrein des Amenhotep gehen und Segen für die Arbeit erbitten«, schlug ein anderer vor. Beifälliges Brummen begleitete dieses Zeichen zum Aufbruch, denn alle wollten so rasch wie möglich ins Dorf zurück. Pa-en-resi, der mit seiner Familie im Haus neben dem Panebs wohnte, feierte Geburtstag. Ein schöner Abend stand bevor: Er würde mit einem feierlichen Zug zu Pa-en-resis Eltern beginnen, die ihre Ewige Wohnung schon bezogen hatten. Dann aber wollten die Lebenden ein Fest feiern und fröhlich sein!
»Das Beste an einem Geburtstag«, sagte Pa-en-resis Sohn Kai- djeret, ein hübscher junger Mann von achtzehn Jahren, »das Allerbeste ist das Essen.«
»Hauptsache, es gibt Bier«, rief ein anderer. »Heute will ich mich ans Ufer der Trunkenheit schwingen.«
»Aufbrechen, Leute!« befahl Neferhotep und warf einen verdrossenen Seitenblick auf To. »Du magst Niu trefflich belehrt haben, mein Freund, aber du hättest ihn öfter züchtigen sollen.«
»Mag sein, Vormann. Seit einiger Zeit ist Niu wie einer, der an anderes denkt. Meine Rede ist: ›Arbeite mit Eifer, daß die Gottheit, Vormann Neferhotep und ich zufrieden seien!‹ Doch Niu hört nicht, was ich spreche.« To schob seine Perücke zur Seite, um sich am Schädel zu kratzen, packte seinen Beutel und stapfte hinter Neferhotep drein.
Die Handwerker marschierten den Pfad entlang, der in weitem Bogen aus ihrem Heimattal zum Platz der Schönheit hinausführte. Kaidjeret ging hinter To und mühte sich, seinen Schritt im gleichen Takt zu halten. Ihm folgten mehrere Knaben, unter ihnen Vormann Neferhoteps Lehrling Hesisunebef. Sie schleppten den großen Sack mit neuen Meißeln und Farbschalen.
»Er ist da!« schrie Hesisunebef plötzlich. »Seht doch nur, Niu ist doch gekommen!«
Die kleine Gruppe blieb stehen. Aller Augen richteten sich auf den jungen Mann, der verschwitzt und außer Atem den Weg von Pa-Tíme heruntergerannt kam.
»Ich bitte um Vergebung, Großer!« keuchte Niu und blieb mit gebeugtem Nacken vor Neferhotep stehen. »Auch dich, Vater!« sagte er leise in Tos Richtung, ohne die Augen zu heben.
»Nicht lieben die Götter den Säumigen«, trug Neferhotep belehrend vor, »und den, der sein Herz an flatterhafte Vergnügungen hängt!« Er musterte Niu von Kopf bis Fuß.
»Ich suchte nicht das Vergnügen«, log Niu und hoffte, der Vorarbeiter würde nicht weiter in ihn dringen.
Neferhotep beschloß, Nius Unpünktlichkeit keine große Bedeutung beizumessen. Jeder war doch einmal jung! »Du magst Gründe gehabt haben. Doch achte, daß wir nicht noch einmal auf dich warten müssen!«
To wollte betonen, daß er seine Söhne zu Hörenden erzogen habe und Niu gut daran täte, die Worte seines Vaters zu beherzigen, insbesondere das, was er über Ordnung zu sagen hatte. Da kreuzte sich sein Blick mit dem seines Sohnes, und sein Atem setzte einen Augenblick aus. Irgend etwas stimmte nicht. Er fühlte, daß Niu nicht die Wahrheit gesprochen hatte. Beunruhigt verschluckte er seine Belehrungen.
Die Andachtsstätte für den vergöttlichten König Amenhotep, den Beschützer Pa-Tímes, befand sich dort, wo der Fußweg sich um eine flache Bergnase herumwand und in die langgestreckte Schlucht einbog, an dessen Ende der »Ort der Erhebung der göttlichen Seelen« lag: Ta Set Neferu, der Platz der Schönheit.
Neferhotep ließ den Handwerkern nur so viel Zeit zum Beten, wie es vor der Gottheit gerade noch vertretbar war. Kurz darauf erreichten sie den Eingang des Grabes der Königin Nefertari. Eine kurze Wegstrecke weiter schmiegten sich ein paar windschiefe Hütten an die schroff aufragende Felswand. Aus einer von ihnen zerrten zwei fremdländisch aussehende Männer einen Schlitten mit Werkzeug. Mühsam knirschte das schwere Gefährt über das Geröll zum Grabeingang.
»Wie steht’s mit den Dochten?« fragte Neferhotep. »Haben wir genug für die nächsten Stunden?« Er musterte die Kiste, in der dünne, in Fett gedrehte Leinenstreifen sich in Bündeln häuften.
Mit gekrümmten Rücken standen die beiden Männer vor Neferhotep. »Nicht ein einziger ist abhanden gekommen! Möge dein Auge wohlgefällig auf ihrer Vielzahl ruhen!«
»Sehr gut. Was ist mit den Lampen?«
Zwei der Handwerker öffneten eine längliche, mit Stroh ausgelegte Kiste. Zwischen grobleinenen Tüchern stapelten sich flache Öllampen mit hochgezogenen Schnäbeln. Geschickt goß einer der beiden Öl in die Öffnungen. Der andere rieb die Dochte mit Salz ab, damit sie in den engen Räumen nicht zu sehr rußten und die Deckengemälde schwärzten. Dann fädelte er sie in die Lampen. Neferhotep entzündete eine Fackel und verschwand im Grab. Die Männer folgten ihm.
Flackerndes Licht fiel auf die Figuren an den Wänden, und in strahlenden Farben erglänzte die jenseitige Welt mit ihren ehrfurchtgebietenden Göttergestalten und den Opfertischen, die sich unter Bergen ›aller guten und reinen Dinge‹ bogen. Die Schriftzeichen sprachen heilige Worte und erzählten von den Gefilden des Imentet, des Landes der Ewigkeit.
Die Luft roch dumpf und drückte schwül in die Lungen der Männer. Die Maler tauchten ihre Pinsel in die bauchigen Tonschalen mit den gemischten Farben. Sie arbeiteten ruhig und zügig. In ihrer eingespielten Mannschaft gab es nicht viele Worte zu verlieren. Jeder wußte, wo sein Platz war und was er zu tun hatte. Vorarbeiter Neferhotep beschriftete einen flachen Schieferstein. Er schrieb die Anzahl der verbrauchten Dochte, der Salzhüte und der Farbkugeln auf. Für sämtliche Güter mußte vor den Beamten Pharaos Rechenschaft abgelegt werden. Eigentlich war es Aufgabe des Kolonnenschreibers, diese wichtigen Einzelheiten festzuhalten. Doch Schreiber Ken-her-chepeschef überwachte heute die Ausgabe von Getreide und neuem Werkzeug im Dorf. Der zweite Schreiber, Anup-em-hab, würde erst morgen mit der Mannschaft des Vorarbeiters Inherchau vom Großen Platz der Wahrheit zurückkehren.
Nach einigen Stunden der Arbeit winkte Paneb den Lehrling des Vorarbeiters zu sich. »Pack zwei der Kupfermeißel in den Sack, der beim Eingang liegt. Ich brauche sie heute nachmittag auf dem Friedhof.«
»Aber Hesisunebef blickte sich hilfesuchend um, »aber ich darf doch nicht das Werkzeug Pharaos wegnehmen!« Vor allem durfte Paneb dies nicht anordnen, aber das wagte der Knabe nicht auszusprechen. Es war nicht erlaubt, Werkzeuge aus den Königsgräbern für sich zu nutzen.
»Ich werde dir sagen, was du nicht darfst!« In Panebs Stimme schwang bereits der gereizte Unterton mit, den alle Mitglieder der Kolonne fürchteten. »Du darfst mir nicht widersprechen! Das wird dir sehr schlecht bekommen!«
»Aber wenn Neferhotep sieht, daß ich Meißel einstecke, dann wird er mich schlagen!« Hesisunebef trat von einem Bein auf das andere. Hatte der Vorarbeiter schon etwas gehört?
»Laß doch den Knaben!« Einer der älteren Arbeiter ging kopfschüttelnd auf Paneb zu. Mußte der gerade den Kleinen in seine Angelegenheiten verwickeln? »Du bringst ihn in Schwierigkeiten!«
»Das ist meine Sache! Misch dich nicht ein!«
Niu und die anderen Maler verfolgten neugierig die Auseinandersetzung.
»Euch geht das nichts an!« brüllte Paneb. »Glotzt nicht so blöde!«
Sofort beugten sie sich wieder über ihre Malereien und gaben vor, ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Strich ihrer Pinsel zu richten.
»Hesisunebef, du tust sofort, was ich dir sage, oder du bekommst meine Hand zu spüren!«
Das letzte Wort hallte durch die Anlage, und Neferhotep erschien im Mauerbogen, der den Pfeilersaal mit dem linken Querschiff verband.
»Was schreist du so, Paneb? Aus dir wütet der böse Geist des Seth! Hast du vergessen, wo wir sind?«
»Halte dich heraus, Vormann!« fuhr Paneb auf ihn los. »Ich komme auch ohne deine Hilfe zurecht!«
Hesisunebef hielt den Atem an. Niemand durfte so mit dem Vorarbeiter sprechen! Aber weder er noch einer der Handwerker wagte, etwas einzuwenden. Niu versuchte, sich möglichst unauffällig an den Streitenden vorbeizudrücken, und von den anderen war mit einemmal niemand mehr zu sehen.
»Sofort erklärst du«, befahl Neferhotep, »was dich veranlaßt, in derart unwürdiger Weise an einem heiligen Ort herumzuschreien!«
»Da gibt es nichts zu erklären!« behauptete Paneb kühn. »Meine Angelegenheiten unterstehen nicht deinen Anordnungen!«





























