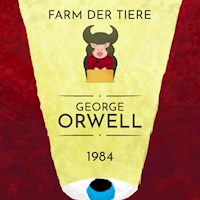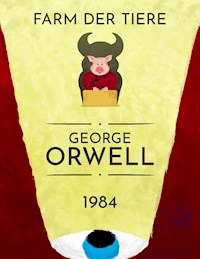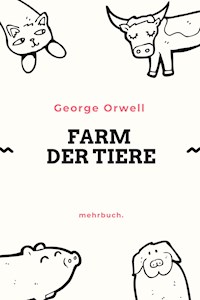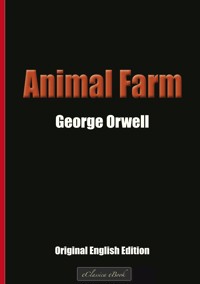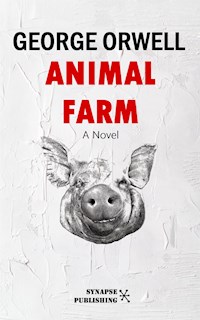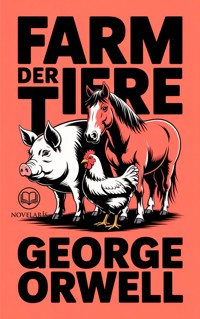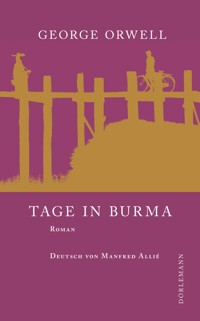
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Debütroman Tage in Burma zeichnet George Orwell ein verheerendes Bild der britischen Kolonialherrschaft. Er beschreibt Korruption und imperiale Bigotterie in einer Gesellschaft, in der "immerhin Eingeborene Eingeborene waren – interessant, kein Zweifel, aber schließlich … ein minderwertiges Volk".Als John Flory, ein weißer Teakholzhändler, sich mit dem Inder Dr. Veraswami anfreundet, widersetzt er sich dieser Doktrin. Der Arzt ist in Gefahr: U Po Kyin, ein korrupter Magistrat, plant seinen Untergang. Das Einzige, was ihn retten kann, ist die Mitgliedschaft im Europäischen Club, und Flory kann ihm dabei helfen. Die Begegnung mit der schönen Elizabeth Lackersteen verändert Florys Leben grundlegend. Sie zeigt ihm einen Ausweg aus der Einsamkeit und der "Lüge" des Koloniallebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
George Orwell
Tage in Burma
Roman
Aus dem Englischen von Manfred Allié
Mit einem Nachwort von Manfred Papst
DÖRLEMANN
Die englische Originalausgabe »Burmese Days« erschien 1934 bei Harper & Brothers, New York. Neuübersetzung Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2021 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Umschlagbild: © Zenobilis/Shutterstock.com Porträt Seite 5: Pictorial Press Ltd/Alamy Stock Photo Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-980-5www.doerlemann.com
Inhalt
George Orwell
In dieser unzugangbar’n Wildnis,
Unter dem Schatten melanchol’scher Wipfel.
William Shakespeare, Wie es euch gefällt
Deutsch von August Wilhelm von Schlegel
I
U Po Kyin, Unterbezirksrichter in Kyauktada, Oberburma, saß auf seiner Veranda. Es war erst halb neun, aber es war April, die Luft drückend, und die langen, stickigen Mittagsstunden kündigten sich schon an. Bisweilen setzte, kühl im Vergleich, ein leichter Windhauch die Orchideen in Bewegung, frisch gegossen in ihren Körben unter der Dachtraufe. Jenseits der Orchideen sah man den staubigen, gekrümmten Stamm einer Palme, und von da wanderte der Blick weiter zum strahlend ultramarinblauen Himmel. Am Zenit, so hoch oben, dass einem schwindelte, wenn man zu ihnen hinaufschaute, kreisten einige Geier ohne die Spur eines Flügelschlags.
Starren Auges, eher wie eine große Porzellanfigur, blickte U Po Kyin hinaus in das gleißende Sonnenlicht. Er war ein Mann von fünfzig Jahren, so fett, dass er schon seit langem nicht mehr ohne Hilfe aus seinem Sessel aufstehen konnte, aber doch ansehnlich, ja sogar schön in seiner Beleibtheit, denn die Burmesen werden nicht schlaff und schwabbelig wie die Weißen, sondern setzen das Fett symmetrisch an, wie eine Frucht, die heranreift. Sein Gesicht war riesengroß, gelb und gänzlich ohne Falten, seine Augen waren goldbraun. Die Füße – pummelige Füße mit hohem Spann, die Zehen alle gleich lang – waren nackt, und ebenso war er barhäuptig, mit kurz geschorenem Haar, und war gewandet in einen der typischen bunten Longyis aus dem Arakan, grün und fuchsienrot kariert, wie die Burmesen ihn im Alltag tragen. Er kaute Betel, aus einem Lackkästchen auf dem Tisch, und dachte über sein bisheriges Leben nach.
Es war ein ausgesprochen erfolgreiches Leben. In seiner frühesten Erinnerung, noch aus den Achtzigern, sah U Po Kyin sich als dickbäuchiges Kind in Mandalay, wie er den Einmarsch der siegreichen britischen Truppen verfolgte. Er spürte noch den Schrecken, den diese Kolonnen mächtiger rindfleischgenährter Männer ihm eingejagt hatten, rotgesichtig und rotberockt, mit den langen Gewehren über der Schulter und dem schweren, rhythmischen Stampfen ihrer Stiefel. Ein paar Minuten lang hatte er zugesehen und dann Reißaus genommen. Mit seinem Kinderverstand hatte er begriffen, dass seine Landsleute gegen eine solche Rasse von Riesen keine Chance hatten. Auf der Seite der Briten zu kämpfen, sich an ihnen festzusaugen wie ein Blutegel, war zum großen Antrieb seines Lebens geworden, schon als Kind.
Mit siebzehn hatte er sich um eine Beamtenstelle beworben, aber er hatte sie nicht bekommen, arm und ohne Freunde wie er war, und drei Jahre lang hatte er in den stinkenden Basaren von Mandalay gearbeitet, als Gehilfe der Reishändler, manchmal hatte er auch gestohlen. Dann, mit zwanzig, war er durch eine geglückte Erpressung in den Besitz von vierhundert Rupien gekommen, und er ging sofort damit nach Rangun und kaufte sich eine Stelle als Schreiber. Es war eine einträgliche Stelle, auch wenn das Salär nicht hoch war. Damals machte ein Ring dieser Amtsschreiber guten Gewinn mit dem Unterschlagen von staatlichen Vorratsgütern, und für so etwas war Po Kyin (denn damals war er einfach nur Po Kyin; der Ehrentitel U kam erst Jahre später) genau der Richtige. Allerdings war er viel zu talentiert, um sein Leben als kleiner Schreiber zuzubringen, der ein paar armselige Anna und Paise beiseiteschaffte. Eines Tages erfuhr er, dass die Regierung, der es an rangniederen Beamten mangelte, einige unter den Schreibern befördern wollte. In der Woche darauf sollte es öffentlich bekanntgemacht werden, aber zu den hervorstechenden Eigenschaften von Po Kyin gehörte, dass er alles immer schon eine Woche früher als andere wusste. Er sah seine Chance und verriet seine sämtlichen Mitgauner, bevor diese die Gefahr erkannten. Die meisten landeten im Gefängnis, und Po Kyin bekam zum Lohn für seine Ehrlichkeit einen Posten als Hilfsgemeindebeamter. Inzwischen, mit sechsundfünfzig, war er Unterbezirksrichter und würde vermutlich noch zum amtierenden Vizekommissar aufsteigen, und Engländer würden ihm gleichgestellt, ja sogar Untergebene sein.
Im Richteramt waren seine Methoden einfach. Selbst für noch so viel Bestechungsgeld verkaufte er nie den Ausgang einer Verhandlung, denn er wusste, dass ein Richter, der falsche Urteile fällt, früher oder später zur Verantwortung gezogen wird. Seine Praxis, und eine weitaus sicherere, bestand darin, Schmiergelder von beiden Seiten anzunehmen und das Urteil ausschließlich nach juristischen Grundsätzen zu fällen. Damit erwarb er sich den nützlichen Ruf des Unparteiischen. Neben seinen Einkünften von den Prozessparteien erhob U Po Kyin auch stets Tribut, eine Art Privatsteuer, in sämtlichen seiner Jurisdiktion unterstellten Dörfern. Wenn ein Dorf versäumte, die Abgabe zu entrichten, ergriff U Po Kyin Strafmaßnahmen – Banditen überfielen das Dorf, Älteste wurden unter falschen Anschuldigungen verhaftet und so weiter –, und es dauerte nie lange, bis gezahlt wurde. Auch von sämtlichen größeren Raubüberfällen des Bezirks strich er seinen Anteil ein. Natürlich wussten das alle, ausgenommen U Po Kyins offizielle Vorgesetzte (kein britischer Beamter wird je glauben, was Schlechtes über seine eigenen Leute erzählt wird), aber die Versuche, ihn anzuklagen, scheiterten mit schöner Regelmäßigkeit; die Zahl seiner Anhänger, deren Loyalität durch ihren Anteil an der Beute gesichert war, war zu groß. Wenn etwas gegen ihn vorgebracht wurde, widerlegte U Po Kyin es einfach mit Hilfe gedungener Zeugen und beschuldigte dann die Gegenseite, und am Ende saß er fester im Sattel denn je. Er war praktisch unverwundbar, denn er kannte die Menschen so gut, dass er nie zum falschen Instrument griff, und Intrigen waren zu sehr sein Metier, als dass er dabei jemals durch Unachtsamkeit oder Unwissen versagt hätte. Es konnte als so gut wie sicher gelten, dass keiner ihm je auf die Schliche kommen würde, dass sein Leben eine lange Reihe von Erfolgen bleiben würde, und am Ende würde er als ehrenwerter Mann sterben, mit einem schönen Batzen Rupien, Lakhs davon.
Selbst jenseits des Grabes würde sein Erfolg fortbestehen. Nach buddhistischer Überzeugung werden diejenigen, die in ihrem Leben Böses getan haben, die nächste Inkarnation in Gestalt einer Ratte, eines Froschs oder sonst eines niederen Tiers verbringen. U Po Kyin war ein guter Buddhist und gedachte gegen solche Gefahr Vorsorge zu treffen. Seine letzten Lebensjahre würde er frommen Werken widmen und so viel Gutes tun, dass es sein vorheriges Leben mehr als aufwog. Wahrscheinlich würden diese guten Werke im Bau von Pagoden bestehen. Vier Pagoden, fünf, sechs, sieben – die Priester würden ihm sagen, wie viele es sein mussten –, mit kunstvollen Steinmetzarbeiten, vergoldeten Schirmen und mit Glöckchen, die im Wind klimperten, jedes Klimpern ein Gebet. Und er würde als Mensch, und zwar als Mann auf die Erde zurückkehren – denn eine Frau hat ungefähr den gleichen Rang wie eine Ratte oder ein Frosch –, oder im schlimmsten Falle als ehrwürdiges Tier, als Elefant zum Beispiel.
All das ging U Po Kyin durch den Kopf, in rascher Folge und meist in Gestalt von Bildern. Bei aller Gerissenheit war sein Verstand primitiv, er trat nur in Aktion, wenn es darum ging, ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen; Nachdenken um des Nachdenkens willen kannte er nicht. Jetzt war er an dem Punkt angekommen, auf den er seine Gedanken gerichtet hatte. Er stützte sich mit seinen beinahe zierlichen Patschhänden auf die Sessellehnen, wandte sich ein klein wenig um und rief recht kurzatmig:
»Ba Taik! He, Ba Taik!«
Ba Taik, U Po Kyins Diener, trat durch den Perlenvorhang auf die Veranda. Er war ein schmächtiger, pockennarbiger Mann, dessen Ausdruck etwas Furchtsames, irgendwie Hungriges hatte. U Po Kyin zahlte ihm keinen Lohn, denn er war ein überführter Dieb, und ein Wort hätte genügt, ihn ins Gefängnis zu bringen. Im Gehen legte Ba Taik die Hände aneinander und verneigte sich, so tief, dass es aussah, als mache er einen Schritt rückwärts.
»Hochheiliger?«, sagte er.
»Wartet jemand, der mich sprechen will, Ba Taik?«
Ba Taik zählte die Besucher an den Fingern ab: »Da ist der Dorfvorsteher von Thitpingyi, Euer Ehren, der Geschenke bringt, und zwei Dörfler, die einen Fall von tätlichem Angriff anzeigen, den Euer Ehren verhandeln sollen, und auch sie bringen Geschenke. Ko Ba Sein, oberster Schreiber beim Vizekommissar, wünscht Euch zu sprechen, und dann wäre da noch Ali Shah, der Konstabler, mit einem Banditen, dessen Namen ich nicht kenne. Ich glaube, sie liegen im Streit wegen goldener Armreifen, die sie gestohlen haben. Und noch ein junges Mädchen aus dem Dorf mit einem Baby.«
»Was will sie?«, fragte U Po Kyin.
»Sie sagt, das Kind ist von Euch, Hochheiliger.«
»Ah. Und wie viel hat der Dorfvorsteher mitgebracht?«
Soweit Ba Taik wisse, seien es nur zehn Rupien und ein Korb Mangos.
»Dann sag dem Vorsteher«, entgegnete U Po Kyin, »dass es zwanzig Rupien sein sollten und dass es Ärger für ihn und sein Dorf gibt, wenn das Geld bis morgen nicht hier ist. Die anderen empfange ich gleich. Sag Ko Ba Sein, er soll zu mir herauskommen.«
Schon im nächsten Moment war Ba Sein da. Er hielt sich aufrecht, ein Mann mit schmalen Schultern, hochgewachsen für einen Burmesen, mit einem merkwürdig glatten Gesicht, das an einen Mokkapudding erinnerte. Für U Po Kyin war er ein nützliches Werkzeug. Bieder und beflissen, tat er seine Büroarbeit gewissenhaft, und Mr Macgregor, der Vizekommissar, vertraute ihm die meisten seiner Dienstgeheimnisse an. U Po Kyin, den seine Gedanken in gute Laune versetzt hatten, begrüßte Ba Sein mit einem Lachen und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, sich beim Betel zu bedienen.
»Nun, Ko Ba Sein, macht unsere Angelegenheit Fortschritte? Ich hoffe, dass sie, wie der gute Mr Macgregor sagen würde« – hier äffte U Po Kyin das Englische nach – »›bedeeeutende Fortschritte‹ macht?«
Der kleine Scherz entlockte Ba Sein kein Lächeln. Steif und aufrecht nahm er Platz auf dem freien Stuhl und antwortete:
»Hervorragende, Herr. Unsere Zeitung ist heute Morgen gekommen. Wenn Ihr so freundlich sein wollt.«
Er zog ein Exemplar des Burmese Patriot aus der Tasche, einer zweisprachigen Zeitung. Es war eine armselige achtseitige Postille, miserabel gedruckt auf Bögen, die nicht besser als Löschpapier waren, und der Inhalt bestand teils aus Material, das aus der Rangoon Gazette gestohlen war, teils aus einfältigen nationalistischen Parolen. Auf der letzten Seite war der Satz verrutscht, so dass das ganze Blatt kohlschwarz war, wie zum Zeichen der Trauer wegen der geringen Auflage der Zeitung. Der Artikel, den U Po Kyin sich vornahm, war allerdings von anderem Kaliber. Er lautete:
In den heutigen glücklichen Zeiten, da uns armen Schwarzen die mächtige westliche Kultur Auftrieb gibt mit der Fülle ihrer Segnungen wie etwa dem Kinematographen, Maschinengewehren, Syphilis usw., welches Thema könnte da erhebender sein als das des Privatlebens unserer europäischen Wohltäter? Deshalb stellen wir uns vor, dass es unsere Leser interessieren wird, von Ereignissen im Inland zu hören, aus dem Bezirk Kyauktada. Und besonders von Mr Macgregor, dem angesehenen Vizekommissar des besagten Bezirks.
Mr Macgregor ist ganz vom Typus des vornehmen englischen Gentlemans alter Schule, von dem wir zu unserer Freude in diesen Tagen eine große Anzahl unter uns haben. Er ist ein »Mann mit Familiensinn«, wie unsere geliebten englischen Vettern so gerne sagen. Ja, eine große Familie hat Mr Macgregor im Sinn. Sein Sinn dafür ist so groß, dass er tatsächlich bereits Vater von drei Kindern im Bezirk Kyauktada ist, wo er seit einem Jahr Dienst tut, und in seinem letzten Bezirk Shwemyo sind es sechs junge Sprösslinge. Es mag schiere Zerstreutheit von Mr Macgregor sein, dass er diese kleinen Kinder ohne jegliche Versorgung zurückgelassen hat und dass manche ihrer Mütter dem Hungertod nahe sind usw. usf.
Es folgte noch eine ganze Spalte in dieser Art, und so erbärmlich es auch war, ging es weit über das Niveau der restlichen Zeitung hinaus. U Po Kyin las sorgfältig den ganzen Artikel, hielt das Blatt mit ausgestrecktem Arm vor sich – er war weitsichtig – und spannte nachdenklich die Lippen, wobei er eine große Anzahl kleiner, perfekt geformter Zähne zeigte, blutrot vom Betelsaft.
»Der Chefredakteur wird sechs Monate Gefängnis dafür bekommen«, sagte er schließlich.
»Das macht ihm nichts aus. Es heißt, die einzige Zeit, zu der seine Gläubiger nicht hinter ihm her sind, ist die, die er im Gefängnis sitzt.«
»Und du sagst, dein kleiner Bürogehilfe Hla Pe hat das ohne alle Hilfe geschrieben? Dann ist er wirklich ein sehr cleverer Junge – ein ausgesprochen vielversprechender Junge! Erzähl mir nie wieder, dass die staatlichen Schulen nur vertane Zeit sind. Hla Pe soll seinen Posten als Schreiber bekommen, unbedingt.«
»Und Ihr meint also, mit diesem Artikel ist es genug?«
U Po Kyin antwortete nicht sofort. Ein Keuchen und Schnaufen war von ihm zu hören; er versuchte, von seinem Stuhl aufzustehen. Ba Taik kannte dieses Geräusch. Er trat hinter dem Perlenvorhang hervor, und er und Ba Sein fassten U Po Kyin jeder auf einer Seite unter den Achseln und hievten ihn auf die Beine. Einen Moment lang stand U Po Kyin schwankend da, balancierte das Gewicht seines Bauches, wie ein Träger auf dem Fischmarkt, der seinen Korb in die richtige Stellung bringt. Dann entließ er Ba Taik mit einer Handbewegung.
»Genug nicht«, beantwortete er Ba Seins Frage, »genug auf keinen Fall. Da ist noch eine Menge zu tun. Aber es ist ein guter Anfang. Hör zu.«
Er ging ans Geländer und spuckte einen scharlachroten Mundvoll Betel aus, dann ging er mit kurzen Schritten auf der Veranda auf und ab, die Hände hinter dem Rücken. Durch die Reibung seiner mächtigen Oberschenkel watschelte er ein wenig. Im Gehen redete er, im primitiven Jargon der Bürokratie – ein Kauderwelsch aus burmesischen Verben und abstrakten englischen Wendungen:
»Betrachten wir die Sache von Anfang an. Wir werden einen koordinierten Angriff auf Dr. Veraswami führen, den Amtsarzt und Gefängnisdirektor. Wir werden ihn verleumden, sein Ansehen untergraben und ihn schließlich vollkommen vernichten. Es wird eine heikle Unternehmung.«
»Ja, Herr.«
»Gefährlich ist es nicht, aber wir müssen behutsam vorgehen. Wir haben es hier nicht mit einem kleinen Angestellten oder Provinzpolizisten zu tun. Wir haben es mit einem hohen Beamten zu tun, und bei einem hohen Beamten, selbst einem Inder, können wir es nicht machen wie bei einem Schreiber. Wie treibt man einen Schreiber in den Ruin? Einfach: eine Anschuldigung, zwei Dutzend Zeugen, Entlassung und Gefängnis. Aber das können wir hier nicht machen. Behutsam, ganz behutsam, so werde ich vorgehen. Kein Skandal, und vor allen Dingen keine amtliche Untersuchung. Es darf keine Anschuldigungen geben, denen man etwas entgegensetzen könnte, und trotzdem muss ich binnen drei Monaten im Kopf jedes Europäers in Kyauktada den Gedanken festsetzen, dass der Doktor ein Schurke ist. Was nehmen wir als Vorwurf? Bestechung kann es nicht sein, ein Arzt bekommt keine nennenswerten Bestechungen. Was dann?«
»Wir könnten einen Gefängnisaufstand organisieren«, schlug Ba Sein vor. »Als Direktor würde der Doktor dafür verantwortlich gemacht.«
»Nein, zu gefährlich. Ich will nicht, dass die Aufseher wild um sich schießen. Außerdem würde es viel kosten. Illoyalität, das ist es – Nationalismus, aufwieglerische Propaganda. Wir müssen die Europäer davon überzeugen, dass der Doktor illoyale, antibritische Einstellungen hegt. Das ist weit schlimmer als Bestechlichkeit; sie erwarten, dass einheimische Beamte Bestechungsgelder nehmen. Aber wenn sie auch nur einen Augenblick lang an seiner Loyalität zweifeln, dann ist es um ihn geschehen.«
»Es wäre nicht leicht, so etwas zu beweisen«, wandte Ba Sein ein. »Der Doktor ist ausgesprochen loyal gegenüber den Europäern. Er gerät in Rage, wenn jemand etwas gegen sie sagt. Das wissen die Europäer, meint Ihr nicht?«
»Unsinn, Unsinn«, antwortete U Po Kyin gelassen. »Die Europäer machen sich gar keine Gedanken um Beweise. Wenn einer ein schwarzes Gesicht hat, dann ist ein Verdacht bewiesen. Ein paar anonyme Briefe wirken da Wunder. Hartnäckigkeit ist dabei alles; Anschuldigungen, Anschuldigungen und noch mal Anschuldigungen – so funktioniert das bei den Europäern. Anonyme Briefe einer nach dem anderen, reihum an jeden Europäer. Und dann, wenn ihr Misstrauen gründlich geweckt ist –« U Po Kyin brachte einen seiner kurzen Arme nach vorn und schnippte mit dem Finger. »Mit diesem Artikel im Patrioten fangen wir an«, fügte er hinzu. »Die Europäer werden schnauben vor Wut, wenn sie den sehen. Tja, und als Nächstes reden wir ihnen ein, dass der Doktor ihn geschrieben hat.«
»Das wird nicht leicht, solange er Freunde unter den Europäern hat. Alle gehen zu ihm, wenn sie krank sind. Diesen Winter hat er Mr Macgregor von seinen Blähungen kuriert. Sie halten ihn für einen sehr guten Arzt, glaube ich.«
»Wie wenig du vom Verstand der Europäer begreifst, Ko Ba Sein! Die Europäer gehen nur zu Veraswami, weil es in Kyauktada keinen anderen Arzt gibt. Kein Europäer traut einem Mann mit schwarzem Gesicht etwas zu. Nein, bei den anonymen Briefen kommt es nur darauf an, dass man genug davon schickt. Ich werde sehr schnell dafür sorgen, dass er keine Freunde mehr hat.«
»Da wäre Mr Flory, der Holzhändler«, gab Ba Sein zu bedenken. (Bei ihm klang es wie »Mr Porley«.) »Der ist ein guter Freund des Doktors. Wenn er in Kyauktada ist, sehe ich ihn jeden Vormittag zu dessen Haus gehen. Zweimal hat er den Doktor sogar zum Essen eingeladen.«
»Stimmt, da hast du recht. Wenn Flory ein Freund des Doktors wäre, könnte uns das Schwierigkeiten machen. Einem Inder kann man nichts tun, wenn er einen Europäer zum Freund hat. Es verleiht ihm – wie heißt das Wort, das sie so gern benutzen? – Prestige. Aber Flory wird seinen Freund sehr schnell im Stich lassen, wenn der Ärger anfängt. Solche Leute kennen keinerlei Loyalität gegenüber den Einheimischen. Außerdem weiß ich zufällig, dass Flory ein Feigling ist. Mit dem werde ich fertig. Dein Teil, Ko Ba Sein, ist es, die Schritte von Mr Macgregor zu überwachen. Hat er dem Kommissar in letzter Zeit geschrieben? Vertraulich, meine ich.«
»Er hat ihm vor zwei Tagen geschrieben, aber als wir den Brief über Dampf öffneten, fanden wir nichts von Belang.«
»Na, wir werden schon dafür sorgen, dass er etwas hat, worüber er schreiben kann. Und wenn er erst einmal misstrauisch gegenüber dem Doktor geworden ist, wird es Zeit für die andere Sache, von der ich dir erzählt habe. Dann werden wir – wie sagt Mr Macgregor? Ah ja, ›zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen‹. Einen ganzen Fliegenschwarm – ha, ha!«
Wenn U Po Kyin lachte, war es ein abstoßender blubbernder Ton aus den Tiefen seines Bauches, wie der Anlauf zu einem Husten; aber es war doch ein fröhliches Lachen, ein Kinderlachen sogar. Er sagte nichts weiter über die »andere Sache«, es war etwas zu Persönliches, das man nicht einmal auf der Veranda zur Sprache bringen konnte. Ba Sein begriff, dass die Audienz zu Ende war, stand auf und verneigte sich, zackig wie ein Zollstock.
»Gibt es sonst noch etwas, das Euer Ehren von mir wünschen?«
»Sorge dafür, dass Mr Macgregor sein Exemplar des Patrioten bekommt. Und am besten empfiehlst du Hla Pe einen schweren Durchfall, so schwer, dass er nicht ins Büro kommen kann. Ich brauche ihn für die anonymen Briefe. Das wäre alles für den Augenblick.«
»Dann darf ich mich zurückziehen, Herr?«
»Möge Gott mit dir sein«, sagte U Po Kyin recht geistesabwesend, dann rief er sofort wieder nach Ba Taik. Er ließ keinen Augenblick des Tages ungenutzt verstreichen. Es dauerte nicht lange, die anderen Besucher abzufertigen, und das Mädchen aus dem Dorf schickte er mit leeren Händen fort, nachdem er ihr ins Gesicht geblickt und erklärt hatte, er kenne sie nicht. Jetzt war es Zeit für das Frühstück. Um diese Zeit des Vormittags packte ihn regelmäßig der Heißhunger wie ein quälender Schmerz im Bauch. Ungeduldig rief er:
»Ba Taik! He, Ba Taik! Kin Kin! Mein Frühstück! Macht schnell, ich verhungere.«
Im Wohnzimmer hinter dem Vorhang war bereits der Tisch gedeckt, mit einer großen Schüssel Reis und einem Dutzend Schälchen mit verschiedenen Currys, getrockneten Garnelen und aufgeschnittenen grünen Mangos. U Po Kyin watschelte zum Tisch, ließ sich mit einem Seufzer auf seinen Stuhl plumpsen und machte sich sofort über das Essen her. Ma Kin, seine Frau, stellte sich hinter ihn und bediente ihn. Sie war eine schmale Frau von fünfundvierzig mit einem freundlichen hellbraunen Affengesicht. U Po Kyin beachtete sie überhaupt nicht, solange er aß. Mit dem Schälchen dicht unter der Nase schaufelte er mit geschäftigen Fettfingern das Essen in sich hinein und schnaufte heftig dazu. All seine Mahlzeiten waren geschäftig, genüsslich und groß; eigentlich waren es eher Orgien als Mahlzeiten, Gelage aus Curry und Reis. Als er fertig war, lehnte er sich zurück, rülpste mehrere Male und ließ sich dann von Ma Kin eine grüne burmesische Zigarre bringen. Er rauchte nie englischen Tabak, denn der schmeckte für seine Begriffe nach nichts.
Bald darauf kleidete U Po Kyin sich mit Ba Taiks Hilfe für die Arbeit an und bewunderte sich dann eine ganze Weile in dem langen Wohnzimmerspiegel. Die Wände dieses Zimmers waren aus Holz, zwei Säulen, die noch als Teakbaumstämme zu erkennen waren, trugen den Firstbalken, und es war ein dunkler, ungepflegter Raum wie alle Räume in Burma, auch wenn U Po Kyin ihn in »Ingaleik fashion« eingerichtet hatte, mit furnierter Kommode und Stühlen, einigen Lithographien des englischen Königshauses und einem Feuerlöscher. Den Boden bedeckten Bambusmatten, fleckig von Limonellen- und Betelsaft.
Ma Kin saß auf einer Matte in der Ecke und nähte an einer Ingyi. U Po Kyin drehte sich ein wenig vor dem Spiegel, ein Versuch, einen Blick auf seine Rückseite zu erhaschen. Er trug einen Gaungbaung aus hellrosa Seide, eine Ingyi aus gestärktem Musselin und einen seidenen Paso, Mandalay-Seide in prachtvollem Lachsrot, gelb durchwirkt. Unter Mühen drehte er den Kopf und betrachtete geschmeichelt den Paso, straff und glänzend über sein gewaltiges Hinterteil gespannt. Er war stolz auf seine Leibesfülle, denn für ihn war all das angesammelte Fett und Fleisch ein Zeichen seiner Stärke. Er, der einmal unscheinbar und hungrig gewesen war, war heute satt, reich und gefürchtet. Er hatte sich vollgefressen an den Leichen seiner Feinde – ein Bild, das in seinen Augen beinahe schon Poesie war.
»Mein neuer Paso war billig mit seinen zweiundzwanzig Rupien, was, Kin Kin?«, sagte er.
Ma Kin hielt den Kopf über ihr Nähzeug gebeugt. Sie war eine einfache, altmodische Frau, die von den Gewohnheiten der Europäer noch weniger angenommen hatte als U Po Kyin. Wenn sie auf einem Stuhl sitzen musste, war es ihr unbequem. Jeden Morgen ging sie zum Basar, mit einem Korb auf dem Kopf wie eine Dörflerin, und am Abend sah man sie auf den Knien im Garten, im Gebet der weißen Spitze der Pagode zugekehrt, die wie eine Krone auf der höchsten Erhebung der Stadt stand. Sie war U Po Kyins Vertraute bei all seinen Intrigen, seit zwanzig Jahren und noch länger.
»Ko Po Kyin«, sagte sie, »du hast viel Böses in deinem Leben getan.«
U Po Kyin tat es mit einer Handbewegung ab. »Was macht das schon? Meine Pagoden werden alles aufwiegen. Es bleibt noch viel Zeit.«
Ma Kin beugte sich wieder über ihre Näharbeit, auf die trotzige Art, die sie immer bekam, wenn sie etwas, das U Po Kyin tat, missbilligte.
»Aber Ko Po Kyin, wozu brauchst du all die Ränke und Intrigen? Ich habe gehört, was du mit Ko Ba Sein auf der Veranda besprochen hast. Du führst etwas gegen Dr. Veraswami im Schilde. Warum willst du dem indischen Doktor etwas tun? Er ist ein guter Mensch.«
»Was verstehst du schon von diesen Amtsdingen, Frau? Der Doktor steht mir im Wege. Zunächst einmal nimmt er keine Bestechungen an, und das macht es schwierig für uns andere. Und außerdem – na, es gibt da noch etwas anderes, aber du hättest nie Verstand genug, das zu begreifen.«
»Ko Po Kyin, du bist reich und mächtig geworden, aber was hat es dir genützt? Wir waren glücklicher, als wir noch arm waren. Ach, ich weiß noch, wie es war, als du nur ein Gemeindebeamter warst, und wir hatten zum ersten Mal unser eigenes Haus. Wie stolz wir auf unsere Korbmöbel waren, und auf deinen Füllfederhalter mit dem goldenen Clip! Und als der junge englische Polizeibeamte uns besuchen kam und im besten Sessel saß und eine Flasche Bier trank, was war das eine Ehre für uns! Geld allein macht nicht glücklich. Was willst du denn mit noch mehr Geld?«
»Unsinn, Frau, Unsinn! Kümmere dich um deine Küche und um dein Nähzeug und überlass die Amtsgeschäfte denen, die etwas davon verstehen.«
»Also ich weiß nicht. Ich bin deine Frau und bin dir immer ergeben gewesen. Aber es ist nie zu früh, Verdienste zu erwerben. Versuche, mehr Verdienste zu erwerben, Ko Po Kyin! Könntest du nicht zum Beispiel ein paar lebende Fische kaufen und sie im Fluss freilassen? Auf die Art erwirbt man große Verdienste. Und als heute Morgen die Priester hier waren, um ihren Reis zu holen, haben sie mir erzählt, dass es jetzt zwei neue Priester im Kloster gibt, und die haben Hunger. Willst du ihnen nicht etwas abgeben, Ko Po Kyin? Ich selbst habe ihnen nichts gegeben, dann kannst du noch die Verdienste erwerben, wenn du es tust.«
U Po Kyin wandte sich vom Spiegel ab. Die Worte rührten ihn ein wenig. Wenn es sich ohne große Mühen tun ließ, ließ er nie eine Gelegenheit aus, Verdienste zu erwerben. In seinen Augen war dieser Vorrat an Verdiensten eine Art Bankkonto, und die Summe wuchs immer weiter an. Mit jedem Fisch, den er im Fluss freiließ, jedem Geschenk, das er einem Priester gab, kam er dem Nirwana um einen Schritt näher. Es war ein beruhigender Gedanke. Er gab Anweisung, den Korb Mangos, den der Dorfälteste gebracht hatte, dem Kloster zu schicken.
Bald darauf verließ er das Haus und machte sich auf den Weg die Straße hinunter, und Ba Taik folgte ihm mit einem Stoß Akten. Er ging langsam, sehr aufrecht, um seinen Bauch zu balancieren, und hielt sich einen Sonnenschirm aus gelber Seide über den Kopf. Der lachsfarbene Paso schimmerte in der Sonne wie eine Praline in Satin. Er war auf dem Weg zum Gericht, zu den Verhandlungen des Tages.
II
Ungefähr zu der Zeit, zu der U Po Kyin seine vormittäglichen Geschäfte aufnahm, verließ »Mr Porley«, der Holzhändler und Freund von Dr. Veraswami, sein Haus und ging zum Club.
Flory war ein Mann von etwa fünfunddreißig Jahren, mittelgroß, von guter Statur. Er hatte pechschwarzes, borstiges Haar mit tiefem Ansatz, trug einen kurz geschnittenen schwarzen Schnurrbart, und seine Haut, von Natur aus fahl, war dunkel von der Sonne. Weder fett noch kahlköpfig geworden, wirkte er noch jung für sein Alter, aber sein Gesicht sah, obwohl sonnenverbrannt, sehr abgezehrt aus, die Wangen eingefallen, mit dunklen Ringen unter den Augen. Es war nicht zu übersehen, dass er sich an diesem Morgen nicht rasiert hatte. Er hatte wie die meisten ein weißes Hemd an, kurze Hosen aus Drillich mit Kniestrümpfen dazu, aber statt Tropenhelm trug er einen zerbeulten breitkrempigen Filzhut, ein wenig schräg auf dem Kopf. In der Hand, mit einem Riemen fixiert, hielt er einen Bambusstock, und ein schwarzer Cockerspaniel namens Flo trottete hinter ihm her.
All das blieb jedoch von untergeordneter Bedeutung. Das Erste, was einem an Flory auffiel, war ein hässliches Muttermal, das sich in einem gezackten Halbmond die linke Wange hinunterzog, vom Auge bis zum Mundwinkel. Von links gesehen hatte sein Gesicht etwas Geschundenes, Gramgezeichnetes, als habe er sich geprügelt – denn die Farbe des Mals war dunkelblau. Er wusste, wie hässlich es aussah. Und immer wenn er in der Öffentlichkeit war, gingen seine Bewegungen ein wenig seitwärts, denn er war stets bemüht, sich so zu halten, dass die anderen seinen Makel nicht sahen.
Florys Haus stand am Oberende des Maidan, fast schon am Rande des Dschungels. Der Maidan, ein großer, leerer Platz, verlief vom Tor aus steil bergabwärts, ausgedorrt und khakifarben, von einem halben Dutzend strahlend weißer Bungalows umrahmt. Alles flirrte, flimmerte in der heißen Luft. Es gab einen englischen Friedhof auf halbem Wege hügelabwärts, mit einer weißen Mauer abgeschirmt und einer winzigen, blechgedeckten Kirche daneben. Jenseits der Kirche kam der Europäische Club, und wenn man den Club erblickte – einen unförmigen einstöckigen Holzbau –, dann erblickte man den wahren Mittelpunkt der Stadt. In jeder Stadt in Indien ist der Europäische Club das spirituelle Bollwerk, der wahre Sitz britischer Macht, das Nirwana, nach dem sich die einheimischen Beamten und Millionäre vergebens verzehren. Hier sogar aussichtsloser als anderswo, denn der Club von Kyauktada hielt sich besonders viel darauf zugute, dass er, beinahe als einziger in Burma, noch nie einen Orientalen aufgenommen hatte. Jenseits des Clubs floss lehmgelb und gewaltig der Irrawaddy, glitzerte diamanten, da wo die Sonne sich darin spiegelte; und wiederum jenseits dessen erstreckten sich riesige Reisfelder, reichten bis an den Horizont, wo eine dunkle Bergkette sie begrenzte.
Die Stadt der Einheimischen, das Gerichtsgebäude und das Gefängnis, lagen zur Rechten, größtenteils verborgen in einem grünen Hain aus Pepulbäumen. Zwischen den Bäumen ragte die Pagode auf wie eine vergoldete Speerspitze. Kyauktada war eine recht typische Stadt für Oberburma, wo sich von den Tagen Marco Polos bis zum Zweiten Anglo-Burmesischen Krieg kaum etwas verändert hatte, und vielleicht hätte es noch ein weiteres Jahrhundert im Mittelalter geschlummert, hätte es sich nicht als günstiger Ort für eine Bahnstation erwiesen. 1910 machte die Regierung es zur Bezirkshauptstadt und damit zu einem Ort des Fortschritts – erkennbar an einem großen Gerichtshaus mit seiner Armee aus fetten, doch trotzdem gefräßigen Advokaten, einem Krankenhaus, einer Schule und einem jener gewaltigen, für die Ewigkeit gebauten Gefängnisse, die die Engländer überall errichtet haben, von Gibraltar bis Hongkong. An Einwohnern hatte die Stadt ungefähr viertausend, darunter einige hundert Inder, ein paar Dutzend Chinesen und sieben Europäer. Außerdem gab es zwei Eurasier, Mr Francis und Mr Samuel, der eine der Sohn eines amerikanischen Baptistenmissionars, der andere der eines römisch-katholischen. In der Stadt fanden sich keinerlei Sehenswürdigkeiten, abgesehen von einem indischen Fakir, der schon seit zwanzig Jahren auf einem Baum nicht weit vom Basar lebte und jeden Morgen sein Essen in einem Korb hinaufzog.
Flory gähnte, als er nun aus dem Tor trat. Er hatte sich am Vorabend ziemlich betrunken, und das gleißende Licht tat ihm in den Augen weh. »Was für ein verfluchtes Scheißloch!«, dachte er beim Blick hügelabwärts. Und da außer dem Hund niemand in der Nähe war, sang er laut »Scheißloch, Scheißloch, Scheißloch, Scheißloch ist das hier« zur Melodie von »Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr«, schritt dazu die glühheiße Straße hinunter und schlug mit dem Stock nach dem verdorrten Gras. Es war kurz vor neun, und die Sonne brannte von Minute zu Minute unbarmherziger. Die Hitze hämmerte einem auf den Schädel, ein gleichmäßiges, rhythmisches Pochen wie Schläge mit einem riesigen Polsterkissen. Am Clubtor hielt Flory inne und überlegte, ob er die Straße noch ein Stück weitergehen und Dr. Veraswami besuchen sollte. Dann fiel ihm wieder ein, dass heute »England-Posttag« war und vermutlich die Zeitungen gekommen waren. Er ging durchs Tor, vorbei am Tennisplatz, abgeschirmt mit einem Spalier, an dem eine Kletterpflanze mit sternförmigen lila Blüten wuchs.
In den Rabatten beiderseits des Wegs wucherten die englischen Blumen – Phlox und Rittersporn, Stockrosen und Petunien – kräftig und üppig und noch nicht von der Sonne versengt. Die Petunien waren riesig, Bäume beinahe. Es gab keinen Rasen, dafür aber einen Garten mit einheimischen Bäumen und Büschen – Flammenbäume wie gewaltige Sonnenschirme aus blutroten Blüten, Frangipani mit ihren cremefarbenen Blüten direkt an den Ästen, leuchtend violette Bougainvilleen, scharlachroter Hibiskus und rosafarbene chinesische Rosen, giftgrüner Kroton, Tamarinden mit ihren Federwedeln. Eine Pracht so reich und bunt, dass es bei der Helligkeit in den Augen schmerzte. Ein fast nackter Mali zog mit der Gießkanne in der Hand durch diesen Blütendschungel wie ein überdimensionaler Kolibri.
Auf den Stufen des Clubhauses stand ein rotblonder Engländer mit struppigem Schnurrbart, hellgrauen, zu weit auseinanderliegenden Augen und unverhältnismäßig dünnen Waden, die Hände in die Taschen seiner kurzen Hosen gesteckt. Dies war Mr Westfield, der örtliche Polizeichef. Mit ausgesprochen gelangweilter Miene wiegte er sich auf den Fersen und hatte die Oberlippe so hoch geschürzt, dass sein Schnurrbart ihn an der Nase kitzelte. Er begrüßte Flory mit einer leichten Seitwärtsbewegung des Kopfes. Er sprach forsch und abgehackt, ließ jedes Wort aus, das man überhaupt auslassen konnte. Praktisch alles, was er sagte, war als Witz gemeint, aber er sprach es in einem finsteren, melancholischen Ton.
»Hallo Flory, mein Junge. Ziemlich schrecklicher Morgen, was?«
»Um diese Jahreszeit nicht anders zu erwarten, nehme ich an«, entgegnete Flory. Er drehte den Kopf ein wenig zur Seite, damit sein Muttermal von Westfield abgewandt war.
»Stimmt, ’flucht noch mal. Dauert noch Monate. Letztes Jahr kein Tropfen Regen bis Juni. Sehen Sie sich den ’fluchten Himmel an, kein Wölkchen. Wie so ein ’scheuerter Kochtopf aus blauer Emaille. Gott! Was wäre das schön, jetzt auf der Piccadilly, was?«
»Sind die englischen Zeitungen gekommen?«
»Ja. Gute alte Punch, Pink’un und Vie Parisienne. Kriegt man Heimweh, wenn man die sieht, was? Kommen Sie, wir gehen rein und trinken was, bevor das ganze Eis weg ist. Der alte Lackersteen schwimmt regelrecht in dem Zeug. Schon halb blau.«
Sie gingen hinein, wozu Westfield mit seiner Grabesstimme »Auf, auf, Macduff« raunte. Drinnen waren die Wände aus Teakholz, es roch nach Petroleum, und insgesamt gab es nur vier Räume, von denen einer die triste »Bibliothek« aus fünfhundert stockfleckigen Romanen enthielt, ein zweiter einen alten, schäbigen Billardtisch – der allerdings nur selten benutzt wurde, denn einen Großteil des Jahres umsummten Scharen von Käfern die Lampen und landeten dann auf dem Tuch. Es gab auch ein Kartenspielzimmer und einen »Salon« mit Blick auf den Fluss, über eine große Veranda hinweg; aber um diese Tageszeit waren sämtliche Veranden mit grünen Bambusjalousien verschlossen. Der Salon war ein nicht gerade anheimelnder Raum mit Kokosmatten auf dem Fußboden, möbliert mit Korbsesseln und Tischen, auf denen überall Illustrierte lagen. Als Schmuck gab es eine Reihe Bilder mit Bonzo dem Hund sowie verstaubte Sambar-Geweihe. Ein Pankha schwang träge auf und ab und wedelte Staub in die schwüle Luft.
Es waren drei Männer im Zimmer. Unter dem Pankha saß über den Tisch gebeugt ein rotgesichtiger, kräftiger, ein wenig aufgeschwemmter Mann von vierzig Jahren; er hielt sich den Kopf und stöhnte vor Schmerz. Dies war Mr Lackersteen, der hiesige Agent einer Holzfirma. Er hatte sich am Vorabend schwer betrunken, und jetzt litt er unter den Folgen. Ellis, hiesiger Agent einer weiteren Firma, stand am schwarzen Brett und las etwas dort Angeschlagenes mit grimmig konzentrierter Miene. Er war ein winziger Bursche mit drahtigen Haaren, blassem Teint, scharfen Zügen, ein Mann, der immer in Bewegung war. Maxwell, der diensttuende Forstaufseher des Bezirks, hatte sich auf einem der Chaiselongues ausgestreckt und las Field, das Magazin für Landleben und Jagd; man sah nur seine kräftigen Beine und die dicken, behaarten Unterarme.
»Jetzt seh sich einer diesen alten Wüstling an«, sagte Westfield, packte Mr Lackersteen halb freundschaftlich bei den Schultern und schüttelte ihn. »Vorbild für die Jugend, was? Reines Glück, dass er es ist und nicht wir. Kriegt man eine Vorstellung, wie man mit vierzig aussehen wird.«
Mr Lackersteen stöhnte etwas, das wie »Brandy« klang.
»Armer alter Mann«, lästerte Westfield weiter; »opfert sich auf für den Alkohol. Sieht man richtig, wie ihm das Zeug zu den Poren rauskommt. ’innert mich an den alten Colonel, der immer ohne Moskitonetz schlief. Jemand fragte seinen Diener warum, und der Diener antwortete: ›Am Abend Herr zu betrunken, um Moskitos zu merken; am Morgen Moskitos zu betrunken, um Herrn zu merken.‹ Seht ihn euch an – gestern Abend blau, jetzt will er mehr. Dabei soll doch seine kleine Nichte bald ankommen. Heute Abend, richtig, Lackersteen?«
»Ach, lassen Sie den alten Säufer in Ruhe«, entgegnete Ellis, ohne sich umzudrehen. Er sprach mit gehässiger Cockneystimme. Wieder stöhnte Mr Lackersteen; »– die Nichte! Um Himmels willen, hol mir einer einen Brandy.«
»Kann die Kleine gleich was lernen, was? Onkelchen unter dem Tisch, sieben Tage die Woche. – He, Butler! Bringen Brandy für Lackersteen Master!«
Der Butler, ein stämmiger dunkler Dravide mit feuchten, gelben Hundeaugen, brachte den Brandy auf einem Messingtablett. Flory und Westfield bestellten Gin. Mr Lackersteen nahm ein paar Löffelvoll Brandy, lehnte sich in seinem Sessel zurück und stöhnte nun gefasster. Er hatte ein breites, offenes Gesicht, geziert von einem Chaplinbärtchen. Im Grunde war er ein sehr einfältiger Mensch, mit keinen anderen Ambitionen im Leben als »seinen Spaß zu haben«. Seine Frau lenkte ihn nach der einzig möglichen Methode, nämlich indem sie ihn nie länger als ein oder zwei Stunden am Stück aus den Augen ließ. Nur ein einziges Mal, im zweiten Jahr ihrer Ehe, hatte sie ihn für vierzehn Tage allein gelassen, und als sie unangekündigt einen Tag früher als vorgesehen heimkehrte, hatte sie Mr Lackersteen betrunken vorgefunden, auf beiden Seiten gestützt von je einem nackten Burmesenmädchen, und ein drittes hatte ihm direkt aus der Flasche den Whisky in die Kehle gegossen. Seitdem beobachtete sie ihn, wie er zu sagen pflegte, »wie die Katze ihr verfluchtes Mauseloch«. Allerdings hatte er auch so immer noch häufig genug »seinen Spaß«, auch wenn es jedes Mal ziemlich schnell damit vorbei war.
»Gott, was habe ich einen Brummschädel heute Morgen«, stöhnte er. »Rufen Sie noch mal diesen Butler, Westfield. Ich brauche noch einen Brandy, bevor meine Alte hier ist. Sie sagt, wenn unsere Nichte da ist, gibt’s nur noch vier Gläser pro Tag. Der Teufel soll die beiden holen!«, fügte er noch finster hinzu.
»Jetzt lasst mal einen Augenblick die Alberei sein, alle zusammen«, knurrte Ellis, »und hört euch das an.« Er hatte eine merkwürdig ruppige Art zu reden, und nur selten sagte er etwas, ohne dass er damit jemanden kränkte oder beschimpfte. Mit Absicht übertrieb er seinen Cockneyakzent, weil seine Worte dadurch umso sarkastischer klangen. »Habt ihr den Aushang hier vom ollen Macgregor gesehen? Ein hübsches Kuckucksei für uns alle. Maxwell, aufwachen! Hören Sie zu.«
Maxwell ließ seine Zeitschrift sinken. Er war ein blonder junger Mann mit frischen Gesicht, höchstens fünf- oder sechsundzwanzig – sehr jung für den Posten, den er bekleidete. Mit seinen schweren Gliedmaßen und den borstigen weißen Wimpern erinnerte er an einen jungen Karrengaul. Ellis zupfte den Aushang mit einer präzisen, gehässigen kleinen Bewegung vom Brett und las laut vor. Neben seinem Amt als Vizekommissar war Mr Macgregor auch Schriftführer des Clubs, und in dieser Eigenschaft machte er seine Mitteilung.
»Hört euch das an. ›Da es mittlerweile bei den meisten Europäischen Clubs üblich geworden ist, höhere Amtsträger auch in denjenigen Fällen aufzunehmen, in denen es sich um Nichteuropäer handelt, und unserem Club bisher kein einheimisches Mitglied angehört, ist angeregt worden in Erwägung zu ziehen, diesem Beispiel auch in Kyauktada zu folgen. Die Frage wird bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Diskussion gestellt. Es lässt sich dazu einerseits darauf hinweisen‹ – ach, ich muss ja nicht den ganzen Sermon vorlesen. Nicht einmal einen kleinen Aushang kriegt er ohne geistigen Dünnpfiff hin. Kurz gesagt geht es um Folgendes. Er will, dass wir unsere sämtlichen Regeln brechen und einen lieben kleinen Niggerjungen in diesen Club aufnehmen. Den lieben Dr. Veraswami zum Beispiel. Dr. Swamischleimi sage ich. Das wäre doch ein Spaß, was? Kleine dickbäuchige Nigger pusten einem am Bridgetisch Knoblauchdünste ins Gesicht. Himmel, allein schon die Vorstellung! Wir müssen uns jetzt sofort zusammensetzen und dieser Geschichte ein Ende machen. Was sagen Sie dazu, Westfield? Flory?«
Westfield hob schicksalsergeben die schmalen Schultern. Er hatte am Tisch Platz genommen und sich einen übelriechenden schwarzen Burmastumpen angesteckt.
»Muss man sich mit abfinden, denke ich«, sagte er. »Scheiß Eingeborenen werden ja jetzt überall in die Clubs aufgenommen. Sogar im Pegu-Club, höre ich. Lauf der Zeit in diesem Land. Wir sind so ziemlich der letzte Club in ganz Burma, der noch durchhält.«
»Das sind wir; und das werden wir verflucht noch mal auch bleiben. Eher lasse ich mich im Kampf abknallen, als dass ich hier einen Nigger reinlasse.« Ellis hatte einen Bleistiftstummel aus der Tasche gezogen. Mit jenem seltsamen Schauspiel der Gehässigkeit, das manche Menschen auch noch in die kleinste Bewegung legen können, heftete er das Blatt wieder ans Brett und schrieb ein winziges, akkurates »Blödmann« neben Mr Macgregors Unterschrift – »da, das halte ich von seinem Vorschlag. Das kriegt er auch zu hören, wenn er herkommt. Wie denken Sie denn darüber, Flory?«
Flory hatte die ganze Zeit über kein Wort gesagt. Obwohl von Natur aus wahrlich kein Schweiger, fiel ihm zu den Unterhaltungen im Club selten etwas ein. Er hatte sich an den Tisch gesetzt und las G. K. Chestertons Artikel in der London News, und dazu kraulte er mit der linken Hand Flos Kopf. Ellis hingegen war jemand, der immer die anderen drängte, seinen Meinungen beizupflichten. Er wiederholte die Frage, Flory sah auf, und ihre Blicke trafen sich. Die Haut rund um Ellis’ Nase wurde schlagartig so bleich, dass sie beinahe grau aussah. Bei ihm war das ein Zeichen von Ärger. Ohne jede Vorwarnung brach er in einen wüsten Strom von Beschimpfungen aus, der bestürzend gewesen wäre, wären die anderen nicht daran gewöhnt gewesen; etwas in dieser Art bekamen sie jeden Vormittag zu hören.
»Meine Güte, ich hätte wirklich gedacht, dass Sie in so einem Fall, wo es darum geht, diese stinkigen schwarzen Schweine von dem einzigen Ort fernzuhalten, an dem wir uns mal amüsieren können, anständig genug sind und mir zur Seite stehen. Selbst wenn dieser dickbäuchige schmierige kleine Niggerstinker von Arzt Ihr bester Freund ist. Mir ist das egal, wenn Sie sich mit Abschaum vom Basar rumtreiben. Wenn’s Ihnen Spaß macht, zu Veraswami nach Hause zu gehen und mit ihm und seinen sämtlichen Niggerkumpeln Whisky zu schlürfen, ist das Ihre Sache. Tun Sie, was Sie wollen, außerhalb des Clubs. Aber es ist verflucht noch mal eine andere Sache, wenn Sie jetzt diese Nigger hier hereinschleppen wollen. Sie hätten Veraswami doch gern als Clubmitglied, hm? Damit er uns bei unseren Unterhaltungen dazwischenplappert, jeden hier mit seinen Schweißfingern bepatscht, uns seinen ekligen Knoblauchgestank ins Gesicht bläst. Gott, mit was für einem Fußtritt ich den nach draußen befördern würde, wenn ich seine schwarze Schnauze jemals hier in der Tür sähe. Dieser schmierige dickbäuchige kleine –!« und immer so weiter.
Mehrere Minuten lang ging das so. Es war bemerkenswert beeindruckend, denn alles war vollkommen ernst gemeint. Ellis hasste die Orientalen tatsächlich – hasste sie mit der bitteren, empörten Verachtung, die man etwas Bösem oder Unreinem entgegenbringt. Als Agent einer Holzfirma musste er notgedrungen in ständigem Kontakt mit den Burmesen leben, doch trotzdem hatte er sich an den Anblick eines dunklen Gesichts nie gewöhnt. Für ihn war jedes freundliche Gefühl gegenüber einem Orientalen eine entsetzliche Verirrung. Er war ein intelligenter Mann und leistete seiner Firma gute Dienste, aber er gehörte zu der Sorte Engländer – von denen es leider sehr viele gibt –, denen man niemals erlauben dürfte, auch nur einen Fuß auf ostindischen Boden zu setzen.
Flory saß da, tätschelte Flos Kopf in seinem Schoß, und brachte es nicht fertig, Ellis in die Augen zu sehen. Selbst unter den besten Umständen machte sein Muttermal es ihm schwer, andere geradewegs anzublicken. Und als er sich anschickte zu sprechen, merkte er, dass seine Stimme bebte – denn sie hatte eine Art, gerade dann zu beben, wenn sie fest sein sollte; manchmal zuckten auch seine Gesichtsmuskeln unkontrolliert.
»Nun mal langsam«, sagte er schließlich, mürrisch und reichlich matt. »Nun mal langsam. Kein Grund, sich aufzuregen. Ich habe nie vorgeschlagen, Einheimische hier aufzunehmen.«
»Ach, haben Sie nicht? Wir wissen aber alle verdammt gut, dass Sie das gerne möchten. Weswegen gehen Sie denn sonst jeden Morgen diesen schmierigen kleinen Babu besuchen? Setzen sich mit ihm an den Tisch, als wäre er ein Weißer, trinken aus Gläsern, aus denen seine fetten schwarzen Lippen geschlabbert haben – ich könnte kotzen, wenn ich mir das vorstelle.«
»Setzen Sie sich, alter Junge«, drängte Westfield ihn. »Lassen Sie’s gut sein. Trinken Sie ein Glas drauf. Ist doch nicht wert, dass wir uns deswegen streiten. Zu heiß.«
»Gott«, knurrte Ellis, ein klein wenig gefasster, »Gott, ich verstehe euch Burschen nicht. Verstehe es einfach nicht. Der alte Dummkopf Macgregor will einen Nigger in unseren Club holen, ohne den kleinsten Anlass, und ihr lasst euch das alle gefallen, nicht ein einziger Muckser. Ja lieber Himmel, wozu sind wir denn in diesem Land? Wenn wir hier nicht die Macht behalten wollen, warum zum Teufel gehen wir dann nicht einfach nach Hause? Hier sitzen wir, angeblich dazu da, über einen Haufen verfluchter schwarzer Schweine zu herrschen, die seit den Anfängen der Weltgeschichte Sklaven gewesen sind, und statt dass wir auf die einzige Art mit ihnen umgehen, die sie verstehen, gehen wir hin und behandeln sie, als wären sie uns gleichwertig. Und ihr blöden Hunde nehmt das einfach so hin. Flory zum Beispiel hat als besten Freund einen schwarzen Babu, der sich Doktor schimpft, weil er mal zwei Jahre auf einer sogenannten Universität in Indien gewesen ist. Und Sie, Westfield, stolz wie Oskar auf Ihre bestechliche Bande von feigen, x-beinigen Polizisten. Und dann hätten wir Maxwell, der den halbschwarzen Nutten nachläuft. Doch, das tun Sie, Maxwell; ich habe von den Geschichten in Mandalay gehört, wo Sie mit einer Mischlingsschlampe namens Molly Pereira poussiert haben. Wahrscheinlich hätten Sie sie ja sogar noch geheiratet, wenn Sie nicht hierher versetzt worden wären. Ihr alle mögt diese stinkigen schwarzen Schweine tatsächlich. Himmel, ich weiß nicht, was mit uns los ist. Uns allen. Ich weiß es wirklich nicht.«
»Kommen Sie, trinken Sie noch was«, sagte Westfield. »He, Butler! Fläschchen Bier, bevor das Eis alle ist, hm? Butler, Bier!«
Der Butler brachte Flaschen mit Münchner Bier. Ellis setzte sich zu den anderen und legte die kleinen Hände um das kühle Glas. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er war mürrisch, aber nicht mehr in Rage. Immer wieder wurde er boshaft und ausfällig, aber seine Wutausbrüche dauerten nie lange, und niemals entschuldigte er sich dafür. Streitereien gehörten zum täglichen Clubleben. Mr Lackersteen hatte sich ein wenig erholt und studierte nun die Illustrationen der Vie Parisienne. Inzwischen war es nach neun, und in dem Raum, erfüllt vom beißenden Qualm von Westfields Stumpen, war es drückend heiß. Allen klebte das Hemd am Rücken, vom ersten Schweiß des Tages. Der Chokra, der unsichtbar draußen das Pankhaseil zog, döste allmählich im gleißenden Sonnenlicht ein.
»Butler!«, brüllte Ellis, und als der Butler erschien: »Geh und mach dem verdammten Chokra Beine!«
»Ja, Herr.«
»Und Butler!«
»Ja, Herr?«
»Wie viel Eis haben wir noch?«
»Ungefähr zwanzig Pfund, Herr. Reicht nur noch für heute, fürchte ich. Es wird immer schwieriger, das Eis kühlzuhalten.«
»Rede nicht in solchen Tönen mit mir, verflucht noch mal – ›Fürchte ich. Wird immer schwieriger!‹ Hast du ein Wörterbuch verschluckt? ›Bitte, Herr, können nicht halten Eis kühl‹ – so hast du zu reden. Wir werden den Burschen vor die Tür setzen müssen, er kann zu gut Englisch. Grauenhaft, wenn die Dienstboten Englisch mit einem reden. Hast du das gehört, Butler?«
»Ja, Herr«, antwortete der Butler und zog sich zurück.
»Gott! Kein Eis bis zum Montag«, brummte Westfield. »Gehen Sie wieder in den Dschungel, Flory?«
»Ja. Sollte eigentlich schon da sein. Ich bin nur wegen der englischen Post hergekommen.«
»Ich glaube, ich gehe selbst auch auf Tour. Paar Spesen machen. Im Büro ist es nicht auszuhalten um diese Jahreszeit. Man sitzt da, unter dem ’fluchten Pankha, zeichnet Rechnungen ab, eine nach der anderen. ’pierkram. Gott, was wünschte ich, wir wären wieder im Krieg!«
»Ich ziehe übermorgen los«, sagte Ellis. »Soll am Sonntag nicht der verdammte Padre kommen? Da werde ich sehen, dass ich vorher wegkomme. Scheiß Kniebeugen.«
»Nächsten Sonntag«, sagte Westfield. »Hab versprochen, dass ich da bin. Macgregor auch. Nicht nett zu dem armen Padre, finde ich. Kommt nur alle sechs Wochen her. Kann man doch auch mal in die Kirche gehen, wenn er da ist.«
»Teufel noch mal! Ich würde auch meine Psalmen runterleiern, um dem Padre einen Gefallen zu tun, aber ich halt’s nicht aus, wie die verdammten Eingeborenen sich in unsere Kirche drängen. Dienstboten aus Madras, Schullehrer von den Karen, das ganze Pack. Und dann die beiden Gelbbäuche Francis und Samuel – die wollen ja auch Christen sein. Das letzte Mal, als der Padre hier war, besaßen sie die Frechheit, sich auf die vorderen Bänke zu den weißen Männern zu setzen. Jemand müsste da mal ein Wort mit dem Padre reden. Was waren wir für Dummköpfe, als wir die Missionare ins Land gelassen haben! Kehrer aus dem Basar erzählen, dass sie so gut sind wie wir. ›Bitte, Sir, Christ sein genau wie Herr.‹ Unverschämt.«
»Was sagt ihr zu den Beinen«, ließ sich Mr Lackersteen vernehmen und reichte die Vie Parisienne weiter. »Sie können doch Französisch, Flory; die Bildunterschrift, was steht da? Meine Güte, was erinnert mich das an die Zeit in Paris, mein erster Urlaub, bevor ich geheiratet habe. Meine Güte, wie gern möchte ich da noch mal hin!«
»Kennt ihr den mit ›Es war eine Dame in Woking‹?«, fragte Maxwell. Er war ein recht schweigsamer junger Mann, hatte aber wie jeder junge Mann eine Schwäche für angenehm anzügliche Limericks. Er brachte die Biographie der Dame aus Woking zu Ende, und alle lachten. Westfield konterte mit der Dame aus Ealing, die einen Rock trug, der nur bis ans Knie ging, und Flory ergänzte den Pfarrer aus Horsham, der ging aber nun wirklich forsch ran. Weiteres Gelächter. Selbst Ellis wurde versöhnlicher und steuerte mehrere Verse bei; die Reime, die von Ellis kamen, waren immer ausgesprochen witzig, aber auch schmutziger als alle anderen. Die Laune stieg, und alle waren nun friedfertiger, trotz der Hitze. Sie hatten das Bier ausgetrunken und wollten eben weitere Drinks bestellen, da war von der Treppe vor der Tür Schuheknarzen zu hören. Eine Stimme, die die Bodenbretter vibrieren ließ, dröhnte munter:
»Ja, scherzhaft, unbedingt. Ich habe es in einem meiner kleinen Beiträge für das Blackwood’s untergebracht, müssen Sie wissen. Und aus der Zeit, als ich in Prome stationiert war, fällt mir noch eine weitere – ähm – unterhaltsame Anekdote ein, in welcher –«
Das war Mr Macgregor, unverkennbar. »Teufel! Meine Frau ist da«, rief Mr Lackersteen und schob sein leeres Glas so weit von sich weg, wie er nur konnte. Gemeinsam traten Mr Macgregor und Mrs Lackersteen in den Salon.
Mr Macgregor war ein großer, schwer gebauter Mann schon gut über die vierzig, mit einem freundlichen Mopsgesicht und Goldrandbrille. Die massigen Schultern und seine Angewohnheit, immer den Kopf vorzurecken, erinnerte eigentümlich an eine Schildkröte – tatsächlich hatte er bei den Burmesen auch den Spitznamen »die Schildkröte«. Er trug einen frischen Seidenanzug, unter dessen Achseln sich allerdings schon Schweißflecken zeigten. Er begrüßte die anderen mit einem lustigen Pseudo-Salut, und dann stellte er sich breitbeinig vor das schwarze Brett, strahlend, ganz wie ein Schulmeister, der hinter seinem Rücken das Stöckchen zwirbelt. Der gutmütige Ausdruck war vollkommen echt, aber trotzdem wirkte seine Leutseligkeit so gewollt, er stellte so bemüht zur Schau, dass er nicht im Dienst war und keiner ihn seinem Rang gemäß behandeln sollte, dass in seiner Gegenwart niemand je ganz entspannt war. Sein Plauderton war offenbar dem eines drolligen Schulmeisters oder Pfarrers nachgebildet, den er in jungen Jahren gekannt hatte. Jeder längere Ausdruck, jedes Zitat, jedes Sprichwort hatte in seinen Gedanken offenbar etwas Scherzhaftes, und unweigerlich kündigte er es mit einem linkischen Laut an, einem »äh« oder »mhm«, damit jeder wusste, dass jetzt ein Scherz kam. Mrs Lackersteen war eine Frau von ungefähr fünfunddreißig, gutaussehend auf eine konturlose, langgestreckte Art wie eine Modezeichnung. Ihre Stimme klang vorwurfsvoll und unzufrieden. Bei ihrem Eintreten hatten sich alle erhoben, und Mrs Lackersteen ließ sich erschöpft in den besten Sessel unter dem Pankha sinken und fächelte sich mit schlanker Hand, die an die Extremitäten eines Molchs erinnerte, Luft zu.
»Meine Güte, ist das eine Hitze. Ist das eine Hitze! Mr Macgregor hat mich mit dem Wagen abgeholt. So freundlich von ihm. Tom, dieser grässliche Rikschadiener behauptet schon wieder, er sei krank. Ich finde, du solltest ihm wirklich eine ordentliche Tracht Prügel verabreichen, damit er zur Vernunft kommt. Einfach entsetzlich, wenn man bei so einer Sonne tagtäglich zu Fuß draußen unterwegs sein muss.«
Mrs Lackersteen war der Viertelmeile Fußweg zwischen ihrem Haus und dem Club nicht gewachsen und hatte eine Rikscha aus Rangun importiert. Von Ochsenkarren und Mr Macgregors Automobil abgesehen war es das einzige Fahrzeug in Kyauktada, denn im ganzen Bezirk gab es keine zehn Meilen Straße. Im Dschungel ertrug Mrs Lackersteen sämtliche Schrecken, lieber als dass sie ihren Mann allein gehen ließ, die stickigen Zelte, die Moskitos, die Mahlzeiten aus Konserven; aber wenn sie dann wieder im Hauptquartier war, zahlte sie es ihm mit Klagen über Kleinigkeiten heim.
»Ich finde wirklich, die Faulheit der Dienerschaft wird allmählich zum Skandal«, seufzte sie. »Meinen Sie nicht auch, Mr Macgregor? Heutzutage haben wir anscheinend keinerlei Autorität über die Eingeborenen mehr, mit all diesen schrecklichen Reformen und der Aufsässigkeit, die sie aus den Zeitungen lernen. In manchem sind sie schon beinahe genauso schlimm wie die niederen Schichten zu Hause.«
»Oh, so schlimm nun doch wieder nicht, will ich hoffen. Aber kein Zweifel, die demokratische Gesinnung macht sich breit, sogar hier.«
»Und noch vor kurzem, sogar noch direkt vor dem Krieg, waren sie so nett und respektvoll! Sagten brav ihr Salaam, wenn sie einem auf der Straße begegneten – bezaubernd geradezu. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als wir unserem Butler nur zwölf Rupien im Monat zahlten, und der Mann war uns so treu ergeben wie ein Hund. Jetzt fordern sie vierzig und fünfzig Rupien, und wenn man will, dass die Diener auch nur dableiben, muss man ihnen den Lohn mit mehreren Monaten Verzug zahlen.«
»Es gibt immer weniger Dienstboten vom alten Schlag«, pflichtete Mr Macgregor ihr bei. »In meinen jungen Jahren, wenn da ein Butler frech wurde, schickte man ihn mit einem Zettel ins Gefängnis, darauf stand: ›Bitte verabreichen Sie dem Überbringer fünfzehn Peitschenhiebe.‹ Tja, eheu fugaces! Flüchtig vergehen die Jahre. Die Tage sind vorbei, und zwar für immer, fürchte ich.«
»Tja, da haben Sie wohl recht«, stimmte Westfield auf seine grimmige Art zu. »In dem Land hier wird man nie wieder anständig leben können. Mit dem Empire geht es zu Ende, wenn Sie mich fragen. Götterdämmerung und so weiter. Zeit, dass wir hier verschwinden.«
Worauf sämtliche Anwesenden beifällig murmelten, sogar Flory, der als Bolschewist verschrien war, sogar der junge Maxwell, erst drei Jahre im Land. Kein Engländer in Indien wird jemals bestreiten, dass Indien vor die Hunde geht, keiner hat es je bestritten – denn genau wie der Punch ist auch Indien schon lange nicht mehr das, was es einmal war.
Währenddessen hatte Ellis hinter Mr Macgregors Rücken den anstoßerregenden Anschlag vom schwarzen Brett genommen, hielt ihn ihm vor die Nase und sagte in seinem gereizten Ton:
»Hier, Macgregor, wir haben diesen Anschlag gelesen, und wir finden alle, dass diese Idee, einen Eingeborenen in den Club aufzunehmen, vollkommener –« Ellis hatte »vollkommener Dünnschiss« sagen wollen, aber gerade noch rechtzeitig fiel ihm wieder ein, dass Mrs Lackersteen anwesend war, und er nahm sich zusammen – »vollkommen fehl am Platze ist. Schließlich ist dieser Club ein Ort, an den wir zu unserem Vergnügen kommen, und wir wollen nicht, dass Eingeborene hier ihre Nase reinstecken. Wir möchten uns gern darauf verlassen können, dass es noch einen Ort gibt, an dem wir nichts mit ihnen zu tun haben. Die anderen sind absolut derselben Meinung.«
Er blickte in die Runde. »Allerdings!«, bestätigte Mr Lackersteen bärbeißig. Er wusste, dass seine Frau merken würde, dass er getrunken hatte, und wollte mit vernünftiger Einstellung schön Wetter machen.
Mr Macgregor nahm das Blatt mit einem Lächeln entgegen. Er sah das Wort »Blödmann« neben seinem Namen, und insgeheim fand er Ellis’ Benehmen arg respektlos, aber er tat die Sache mit einem Scherz ab. Er gab sich genauso viel Mühe, im Club ein guter Kumpel zu sein, wie er in den Dienststunden darauf achtete, seine Würde zu wahren. »Wenn ich recht verstehe«, sagte er, »ist unser Freund Ellis hier nicht ganz so erpicht darauf, seinen – ähm – arischen Bruder im Club willkommen zu heißen?«
»Nein, bin ich nicht«, antwortete Ellis säuerlich. »Und meinen mongolischen Bruder auch nicht. Ich mag, kurz und knapp gesagt, keine Nigger.«
Mr Macgregor erstarrte bei dem Wort »Nigger«, das in Britisch-Indien unerwünscht war. Er selbst hegte keinerlei Vorurteile gegen die Orientalen; genau genommen mochte er sie sogar ausgesprochen gern. Solange man ihnen keine Freiheiten erlaubte, fand er, waren sie die charmantesten Menschen überhaupt. Es quälte ihn immer, wenn jemand sie so gedankenlos beschimpfte.
»Ist es wirklich so ganz anständig«, erwiderte er steif, »wenn Sie diese Leute Nigger nennen – eine Bezeichnung, die sie sich verständlicherweise verbitten –, wo sie doch offensichtlich nichts in dieser Art sind? Die Burmesen sind Mongolen, die Inder sind Arier oder Draviden, und das sind allesamt ganz andere –«
»Ach, dummes Zeug!«, erwiderte Ellis, der sich von Mr Macgregors Rang nicht im Mindesten einschüchtern ließ. »Nennen Sie sie Nigger oder Arier oder wie Sie wollen. Was ich sagen will: Wir wollen keine schwarze Haut in diesem Club. Wenn Sie es zur Abstimmung stellen, werden Sie sehen, dass wir einstimmig dagegen sind – es sei denn«, fügte er noch hinzu, »Flory will seinen guten Freund Veraswami aufnehmen.«
»Allerdings!«, wiederholte Mr Lackersteen. »Ich stimme gegen die ganze Bande, da können Sie sich drauf verlassen.«
Mr Macgregor schürzte gutmütig die Lippen. Er war in einer kniffligen Lage, denn die Idee, einen Einheimischen in den Club aufzunehmen, stammte nicht von ihm, sondern der Kommissar hatte es ihm nahegelegt. Allerdings war es nicht seine Art, einen anderen vorzuschieben, und so sagte er in versöhnlicherem Ton:
»Sollen wir die Diskussion bis zur nächsten Mitgliederversammlung verschieben? In der Zwischenzeit können wir es uns in aller Ruhe überlegen. Und jetzt«, fügte er hinzu und machte einen Schritt zum Tisch, »darf ich Sie zu einer – ähm – kleinen Erfrischung einladen?«
Der Butler wurde gerufen, die »kleine Erfrischung« bestellt. Inzwischen war es heißer denn je, und alle hatten Durst. Mr Lackersteen war schon im Begriff, einen Drink zu ordern, da sah er den Blick seiner Frau, zog die Schultern ein und sagte mürrisch: »Für mich nichts.« Er saß mit den Händen auf den Knien da, mit recht mitleiderregender Miene, und verfolgte, wie Mrs Lackersteen ein Glas Limonade mit Gin trank. Mr Macgregor, obwohl er die Runde bezahlte, nahm nur Limonade. Als einziger unter den Europäern in Kyauktada hielt er sich an die Regel, vor Sonnenuntergang keinen Alkohol zu trinken.
»Alles schön und gut«, brummte Ellis und stützte sich mit den Unterarmen auf den Tisch. Er fuchtelte mit seinem Glas; der Disput mit Mr Macgregor hatte ihn wieder unruhig werden lassen. »Alles schön und gut, aber ich stehe zu dem, was ich sage. Keine Eingeborenen hier im Club! Damit haben wir das Empire ruiniert – damit, dass wir immer wieder bei solchen Kleinigkeiten nachgegeben haben. Dass man in diesem Land Aufwiegler an allen Ecken findet, liegt doch nur daran, dass wir diesen Kerlen gegenüber zu weich gewesen sind. Die einzige mögliche Haltung ist, sie wie den Dreck zu behandeln, der sie sind. Wir leben in kritischen Zeiten, und wir brauchen jedes bisschen Prestige, das wir bekommen können. Wir müssen zusammenhalten und sagen: ›Wir sind die Herren, und ihr, ihr armseligen Hunde‹« – Ellis drückte sein Däumchen fest auf den Tisch, als zerquetsche er eine Made – »›ihr armseligen Hunde bleibt, wo ihr hingehört!‹«
»Aussichtslos, alter Junge«, widersprach Westfield. »Völlig aussichtslos. Was kann man noch machen? Überall sind einem die Hände mit Vorschriften gebunden. ’dammten Eingeborenen kennen sich mit den Gesetzen besser aus als wir. Sagen einem Frechheiten ins Gesicht, und dann zerren sie einen vor den Kadi, sobald man zuschlägt. Nichts zu machen, es sei denn, man spricht ein Machtwort. Und wie soll man das machen, wenn sie sich nie zum Kampf stellen?«
»Unser Burra Sahib in Mandalay«, sinnierte Mrs Lackersteen, »hat immer gesagt, dass wir Indien am Ende einfach verlassen werden. Junge Männer werden nicht mehr herkommen und ein Leben lang hier arbeiten, wenn sie dafür nichts als Undank und Beleidigungen ernten. Wir gehen einfach. Wenn die Eingeborenen kommen und uns anflehen zu bleiben, werden wir sagen: ›Nein, ihr habt eure Chance gehabt, ihr wolltet sie ja nicht ergreifen. Nun gut, dann lassen wir euch jetzt allein, und ihr könnt euch selbst regieren.‹ Dann werden sie sehen, was sie davon haben!«