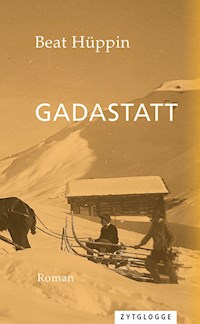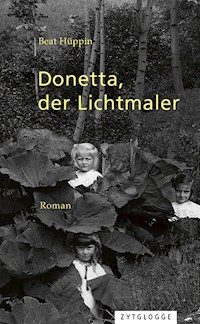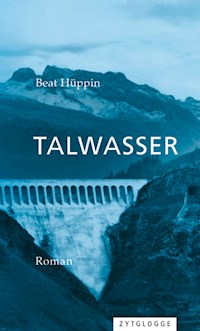
26,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf wird geflutet •Das abgelegene Schwyzer Innerthal um 1920, Bauplatz der grössten Gewichtsstaumauer der Welt •Bauern aus dem Tal müssen ihre Heimwesen aufgeben •Historischer Roman, fiktive Geschichte der Grossfamilie Dobler Innerthal im Jahre 1917: Vater Dobler bringt eines Abends die Nachricht nach Hause, dass es mit der Mauer nun doch ernst werden soll. Die Staumauer, über die zwanzig Jahre lang diskutiert wurde und an deren Bau niemand mehr ernsthaft geglaubt hat, wird tatsächlich gebaut. Im beschaulichen, etwas abgelegenen Voralpental entsteht die damals grösste Gewichtsstaumauer der Welt. Die Kraftwerksgesellschaft baut eine 66 Meter hohe Wand in die Schräh, um danach das ganze Tal zu fluten. Für die Bauern im Talboden des Innerthals bedeutet das, dass sie ihre Heimwesen aufgeben müssen. Beat Hüppin erzählt auf der Grundlage von geschichtlichen Quellen und Zeugnissen die fiktive Geschichte der Bauernfamilie Dobler, deren Mitglieder ganz unterschiedlich auf die drohende Umsiedlung reagieren. Hüppin verfolgt deren Geschicke bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus. So ergibt sich ein vielschichtiges Bild einer Gesellschaft und einer Familie im Wandel, eine Geschichte über Heimat und Fremde und letztlich über Leben und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
BEAT HÜPPIN
TALWASSER
Beat Hüppin
TALWASSER
Roman
Mit freundlicher Unterstützung von:
Zytglogge Verlag AG
© 2016 Zytglogge Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Angela Fessler
Cover: Postkarte «Wäggithal Staumauer», Fotograf unbekannt
Gesetzt aus: Frutiger LT Std, Garamond Premier Pro, Palatino LT Std
E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch
E-ISBN ePUB: 978-3-7296-2076-6
E-ISBN mobi: 978-3-7296-2077-3
www.zytglogge.ch
ERSTER TEIL
1.
Im Tal wütete das Wetter so gotteserbärmlich, dass man keinen Hund hätte nach draussen schicken mögen. Der Regen fiel prasselnd auf die Wiesen, Wege und Dächer, die Dachrinnen vermochten längst nicht mehr alles Wasser zu schlucken, und überall um den Doblerhof bildeten sich grosse Wasserlachen. Der Wind pfiff durch alle Ritzen, so dass man unwillkürlich fröstelte, obwohl es wenige Stunden zuvor noch ein schweisstreibender Sommertag gewesen war. Von den Felswänden, die das Tal umringten, widerhallte der Donner, und jedes Mal erzitterte das ganze Haus, so dass es im morschen Gebälk knarzte.
Die Mamä ging nervös auf und ab. Wo bloss der Dädi mit den Buben steckte? Ganz vorne beim Stockerli hatte er im Holz zu tun gehabt. Dölf und Kari waren als Gehilfen mitgegangen. Das war ein weiter Weg, natürlich, aber hätten sie nicht trotzdem schon längst zurückgekehrt sein müssen? Ob die vom Gewitterregen angeschwollene Aa wieder einmal die gedeckte Brücke weggerissen hatte, so dass sie auf der anderen Seite festsassen, oder ob sie sich beim Einsetzen des Regens schlicht irgendwo am Weg untergestellt hatten?
Da, es blitzte gerade wieder so fürchterlich, ganz in der Nähe, und ein besonders laut krachender Donner folgte dem Blitz auf dem Fuss. Sofort bekreuzigte sich die Mamä mehrmals in rascher Folge und begann zu beten. Tinäli und der Seppli taten es ihr gleich. Nur Agneysli sass auf der Ofenbank, mit einer kleinen Katze im Arm, der sie seelenruhig gut zuredete. Die anderen wussten genau, dass Agnes für den Herrgott nicht gerade viel übrig hatte, und auch der Pfarrer und der Lehrer waren der Meinung, dass das Mädchen in diesem Fall wohl ein Heidenkind sein müsse.
Tinäli schalt die jüngere Schwester: «Wenn es bei uns wirklich einmal in den Gaden oder ins Haus einschlägt, dann bist allein du schuld mit deinem Unglauben. Erinnerst du dich nicht mehr, letztes Jahr beim alten Mächler Ignaz, als der Blitz direkt in den Gaden eingeschlagen hat? Im ganzen Innerthal hat man damals die Feuersäule gesehen. Der Inderbitzin hat am nächsten Tag in der Schule gesagt, der Mächler Ignaz sei eben einer von denen, die zu wenig beten.»
«Ach, der Gufäschnuuz», machte Agneysli mit einer verächtlichen Handbewegung, «der sagt viel, wenn der Tag lang ist.»
Agneysli war soeben zwölf Jahre alt geworden und das jüngste Mädchen bei Doblers. Zwei Jahre nach ihr war noch der Seppli geboren worden, der ihr besonderer Liebling war und auf den sie, als die nächstältere Schwester, besonders grossen Einfluss hatte – der strenge Dädi meinte, nicht gerade den besten, denn die beiden jüngsten Geschwister trieben allerhand Unfug miteinander, und im weiten Umkreis waren sie für ihre Streiche bekannt.
Das Gewitter zog unterdessen weiter, man hörte den Donner nur noch aus der Ferne grollen. Bloss der Regen fiel nahezu unvermindert stark. Und immer noch fehlte der Dädi.
Seppli meldete Bedenken an: «Was, wenn der Stockerligeist ihn mit den Brüdern geholt hat?»
«Ha, der Schuhmacher», fuhr Agneysli auf, «wenn der mich holen wollte, dem würde ich schon die Meinung sagen, und zwar deutlich. Seppli, vor dem musst du keine Angst haben. Der hat noch niemanden geholt.»
Tinäli kam dem Seppli zu Hilfe: «Spotte doch nicht schon wieder, Agneysli. Was war denn mit dem Bauernknecht, der im Ried in Nuolen erst vor kurzem wieder ein Muättiseyl gesehen hat? Schauerlich soll es aus seinem feurigen Gerippe geschrien haben. Ganz vergelstert sei der Knecht an jenem Abend nach Hause gekommen, sagen sie.»
Agneysli verzog das Gesicht zu einer spöttischen Grimasse: «Und wenn schon. So hat sich der Knecht am Feuer wenigstens schön wärmen können. Wenn es nur nicht etwa daran lag, dass er einen Schnaps zu viel gehabt hat.»
«Von wegen Schnaps! Du hörst doch auch, wie die Gespenster bei uns im Dach wild durcheinanderfahren und toben. Das bilden wir uns doch nicht alle nur ein!»
«Dummes Zeug! Ich will dir sagen, was das ist. Deine Gespenster sind völlig harmlose Mäuse und Siebenschläfer. Vielleicht ist noch ein Käuzchen dabei, das da oben sein Nest gebaut hat. Ich glaube, ich habe das Käuzchen sogar schon rufen gehört. Durch das halboffene Guggeyräfensterchen fliegt es wahrscheinlich ein und aus.»
«Das glaube ich nicht», sagte Tinäli ernsthaft. «Da oben sind ganz sicher Gespenster.»
«Kannst ja nachschauen gehen, keine Angst, es geschieht dir schon nichts. Aber dazu hast du ja den Mut nicht, du bist und bleibst ein ewiger Schisshas.»
«Jesses Marie», sagte die Mamä kopfschüttelnd, «was bist du nur für ein Kind, Agnes.»
Das Wohnhaus des Doblerhofs unterschied sich in nichts vom Gros der Bauernhäuser im hinteren Wägital, es war nicht grösser und nicht kleiner und nicht besser oder schlechter ausgestattet als die meisten anderen. An fliessendes Wasser oder gar an elektrisches Licht war nicht zu denken. In den Räumen standen einige wenige, schmucklose Möbel, und im Herrgottswinkel in der Stube hing das Kruzifix. Seit die beiden ältesten Töchter nicht mehr zuhause wohnten, war die Wohnsituation im Haus etwas komfortabler geworden, man hockte nicht mehr ganz so eng aufeinander. Tinäli genoss seither das Privileg, allein in der Nebenstube schlafen zu dürfen. Im ersten Stock, über der Stube, gab es zwei Kammern, von denen die erste von den Eltern und die zweite von den beiden älteren Buben bewohnt wurde. In der Kammer direkt unter dem Dachstock waren schliesslich Agnes und Seppli untergebracht. Die beiden jüngsten Geschwister teilten sich nicht nur die Kammer, sondern auch den satt gefüllten Laubsack, der auf einem roh gezimmerten hölzernen Bettgestell lag. So konnten Agnes und Seppli einander wenigstens etwas Wärme spenden, denn wie alle anderen Kammern war auch die Dachkammer nicht beheizt und besonders im Winter nur mit einem aufgewärmten Chriesimaa zu ertragen. Im Nachttopf bildete sich dann zum Vergnügen der Kinder regelmässig ein gelbglänzender Eisblock. So schlimm war es diese Nacht zum Glück nicht, obschon es für eine Sommernacht reichlich kühl war.
Tinäli in ihrer Nebenstube und auch der dicht an Agnes geschmiegte Seppli sprachen ihre Gebete und schlummerten bald darauf ruhig ein.
Agneysli aber dachte immer noch an den Dädi und die älteren Brüder. Was es wohl gegeben hatte? So wälzte sie sich lange auf dem Laubsack hin und her, bis eine riesenhafte, respekteinflössende Gestalt auftauchte. Agneysli hatte den Stockerligeist aus dem Schuhmacherloch zwar nie mit eigenen Augen gesehen, doch es konnte kein Zweifel daran bestehen, dass er das war. Aber warum hatte er bloss das Gesicht des Dädi? Der Dädi und der Schuhmacher konnten doch nicht ein und dieselbe Person sein! Agneysli streckte dem Schuhmacher-Dädi frech die Zunge heraus, als er Anstalten machte, das Mädchen zu ergreifen. Flink lief sie fort, durch den Regen ins weite Ried hinein. In einiger Entfernung vernahm sie plötzlich ein grausiges Heulen. Voller Neugier lief sie auf das Geräusch zu, bis sie erkannte, was es war. Ein Muättiseyl! In seinem Gerippe loderte, ganz wie es Tinäli zuvor berichtet hatte, eine gelbrote Flamme. Fasziniert blieb Agneysli stehen und betrachtete schweigend das Phänomen. Wieso verlöschte die Flamme im strömenden Regen nicht? Plötzlich aber begann das Muättiseyl, das Mädchen mit schnarrender Stimme zu tadeln, genau so, wie es der Lehrer Inderbitzin in der Dorfschule jeweils tat: «Agneys, du wirst doch kein Heidenkind sein wollen, du musst beten! Beten, hörst du! Bättä!» Zu ihrem Entsetzen stellte sie fest, dass der Knochenschädel des Muättiseyl nun auch die Gesichtszüge von Inderbitzin mitsamt seinem Gufäschnuuz annahm. Währenddessen regnete es unablässig weiter wie aus Kübeln, so dass das Wasser der Aa bereits in grossen Schwallen über die Ufer trat und das Wiesland überschwemmte, bis der Schuhmacher ein zweites Mal erschien, diesmal mit einem undefinierbaren Geistergesicht. Sein finsteres Lachen echote durch das ganze Tal. Das Wasser stieg und stieg, höher als der First des Doblerhofs, höher als das Schulhaus und das Pfarrhaus, höher als das Bad Wägital, nur die Spitze des Kirchturms lugte aus den Fluten hervor. Und die Talbewohner? Gab es für sie irgendeinen Ausweg oder mussten sie elendiglich ertrinken wie das Vieh? Agneysli wachte erschrocken auf.
Sollte das Mädchen irgendjemandem von diesem unmöglichen Traum erzählen? Dem Dädi, der Mamä, ihren Geschwistern? Lieber nicht, die würden sicher denken, Agneysli sei eben doch abergläubisch, vom Schuhmacher und einem Muättiseyl zu träumen. Und wenn doch etwas an diesem Beten dran war? Und an der Flut? Draussen regnete es noch immer, das Wasser konnte morgen oder schon heute Nacht so hoch stehen wie in ihrem Traum. Aber andererseits beruhigte sie das Geräusch des gleichmässig fallenden Regens, genau wie der leise Atem des kleinen Bruders neben ihr, so dass sie bald wieder einschlief.
2.
Die ganze Zeit über wartete die Mamä in der Stube auf ihren Mann und die beiden grösseren Buben. Im schummrigen Licht der Petrollampe flickte sie ein Hirtenhemd, in das Seppli einen Dreiangel gerissen hatte, und vor ihr auf dem Tisch lagen Wollstrümpfe und ein Paar Hosen, die ebenfalls ausgebessert werden mussten.
Endlich hörte sie draussen die vertrauten Schritte ihres Mannes und der Buben. Sie hörte, wie sie durch die Pfützen vor dem Haus stapften. Nun zogen sie vor der Haustüre die durchnässten Schuhe aus. Ohne ein Wort empfing die Mamä die drei Vermissten mit fragendem Blick.
«Ja, Mamä», erklärte der Muuslöchler, wie man den Dädi und die ganze Familie Dobler im Tal nannte, «als das heftige Gewitter losbrach, wollten wir kurz in den ‹Aubrig›, da es draussen so ungemütlich war. Wir hätten ja noch einen weiten Heimweg gehabt, und alles durch den Regen. Und da …»
«Da habt ihr über eurem Kafi Schnaps die Zeit vergessen? Und ich habe mir derart Sorgen gemacht, aber daran denkt ihr ja nie.»
Dölf, der siebzehnjährige Sohn, fuhr fort: «Nein, der Kafi Schnaps war diesmal nicht schuld, der war ausnahmsweise nur die Nebensache, das kannst glauben. Weisst, in der Wirtschaft war eine ganze Gruppe von Männern beieinander, der Mächler Wisel, der Schnyder Mathey, der OuberliBäni und noch mehrere, und da wurde erzählt, dass heute nach dem Mittag verschiedene Leute vom Bezirk im Tal aufgetaucht seien, wichtige Herren. Unser Gemeindepräsident sei auch dazugestossen und Männer aus dem Genossenrat und dazu mehrere Unbekannte. Wir haben die sonderbare Gesellschaft übrigens auch von fern gesehen, als wir im Holz oben waren, und haben uns gewundert, was das wohl wird.»
«So? Und was war es?»
«Es gingen natürlich zuerst Gerüchte herum, wie immer. Der Mathey meinte zum Beispiel, die Zürcher würden möglicherweise das Bad weiter vergrössern wollen. Oder ein anderer spekulierte, dass sie vielleicht vorhätten, das gute Fläschlochwasser in Flaschen abzufüllen und für teures Geld zu verkaufen, ganz so, wie sie es schon an manchen Orten in den Bergen machen. Es gab ja sogar schon solche, die Leitungen bis nach Zürich legen wollten, um die Brunnen in der Stadt mit unserem Wasser zu speisen, die Spinncheiben. Die hätten es sicher gemacht, wenn es nur nicht so verfluämärät teuer gewesen wäre.»
«Nicht nur wegen des Geldes», korrigierte Dädi den Dölf, «sondern weil sie einsehen mussten, dass gegen uns Wägitaler nicht anzukommen ist, wenn wir etwas nun einmal nicht wollen.»
«Jaja», lachte Dölf, «die Zürcher sagten, die Wägitaler seien Mordsbeschtänä, sture Stierengrinde, Dickschädel.»
«Wie ihr meint», seufzte die Mamä schulterzuckend. «Aber wie war es damals mit dem Konsortium? Wie ist es den Wägitaler Stierengrinden dort ergangen?»
Mit einem Schlag verfinsterte sich die Miene des Muuslöchlers, und er erklärte bitter: «Eben, das ist es, was da im Aubrig herausgekommen ist. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Die längste Zeit haben sie zugewartet, die Elektrizitätsherren, dabei aber gleichzeitig immer ein bisschen nachgebohrt, so dass die ersten Wunden gar nie richtig verheilen konnten. Immer musste der Schmerz ein wenig schwelen, nie so stark, dass er unerträglich geworden wäre, aber doch immer stark genug, um uns zu ärgern. Projekte kamen und gingen wieder, wir glaubten bald schon, alles würde abgeblasen werden, aber nein, jetzt machen sie den Sack doch zu. Jetzt gilt es ernst, kannst es glauben. Die Behörden hören natürlich auf alles, was die Elektrizitätsherren in ihrer Gier behaupten. Sie kuschen und genehmigen einfach alles, alles im Namen des Fortschritts und des Gewinns. So sieht es aus.»
«Ist das etwa am Ende auch nur ein Gerücht?», fragte die Mamä.
«Nein, das stimmt hundertprozentig. Als wir so beieinander sassen und die Männer all diese Vermutungen äusserten, stiess noch mein Vetter Meyri zu unserer Runde und erzählte uns, was heute passiert ist. Er ist einer, der es wissen muss, als Mitglied des Genossenrats. Er war ja persönlich bei diesem Besuch der Herren vom Bezirk dabei.»
Die Mamä seufzte. Nun also doch! Man hatte es schon so lange gewusst, auch wenn viele Talleute es nicht wahrhaben wollten. Es wäre einem Wunder gleichgekommen, wenn man die Sache mit einem Mal doch ganz aufgegeben hätte, nach so komplizierten Abklärungen und Verhandlungen über all die Jahre. Nur zwei Fragen beschäftigten die Mamä noch. So fragte sie knapp: «Wann soll denn jetzt gebaut werden?»
«Nächstes Jahr soll es vor die Bezirksgemeinde kommen, heisst es. Falls diese das Projekt bewilligt, soll daraufhin gleich eine Aktiengesellschaft gegründet werden, und damit wäre dann auch die Finanzierung geregelt», antwortete Dölf.
«Und wir?», war die zweite Frage, die die Mamä stellte.
«Das kann heute natürlich noch niemand genau sagen. Ein paar Jährchen bleiben uns sicher noch, bis wir unser Muusloch aufgeben müssen. So schnell geht das nicht. Ich meine, da werden sicher einige Rekurse und Einsprachen kommen. So einfach wird man es den Herren wohl nicht machen. Die Natur- und Heimatschützer werden auch etwas zu sagen haben. Zwanzig Jahre haben die Elektrizitätsherren schon an dem Ganzen herumgeknorzt. Wie leicht kann es jetzt nochmals so lange dauern! Oder das Projekt wird am Ende vor lauter Rekursen gleich ganz zurückgezogen – das wäre natürlich das Beste für uns. Oder das Geld geht vorher aus. Hat man alles schon erlebt. Irgendwann müssen wir wahrscheinlich schon von hier fort, vielleicht aber auch nicht. Wer weiss das schon?»
3.
Am nächsten Tag waren das Gewitter und der Regen fast vergessen, und die Sonne schien wieder von einem stahlblauen Himmel. Das Einzige, was noch an das Unwetter erinnerte, war die Aa, die als wuchtige, braune Masse daherfloss und ihr Bett bis an den obersten Rand ausfüllte. Gewöhnlich war sie hier oben ein munter dahinplätschernder, klarer Forellenbach.
Dölf besserte am Weg vorne den Zaun aus, als sich Kurgäste aus dem Bad näherten. Es waren zwei noble Damen, eine ältere und eine deutlich jüngere, die strahlend weisse Kleider und feine Sommerhütchen trugen und dazu ebenfalls weisse hochhackige Schuhe.
«Kann man bei euch ein Glas Most bekommen?», sprach die ältere Dame Dölf an.
«Most haben wir keinen, ich kann euch höchstens etwas frische Milch aus unserem Felsenkeller bringen. Die ist gerade so erfrischend wie Most.»
Die Damen waren einverstanden, und Dölf machte sich auf den Weg zum Keller.
«Die Bauernhäuser sind hier oben schon sehr ärmlich», meinte die Dame zur anderen, während sie den Doblerhof musterten, «keine Verzierungen, keine Malereien, keine schönen Bauerngärten mit Blumenschmuck.»
«Das Land hier oben im kargen Bergtal gibt wohl nicht mehr her», sagte die jüngere Dame. «Kornfelder wie in der Ebene unten habe ich kein einziges gesehen und auch keine Obstbäume. Einen Haufen Kinder werden sie natürlich haben und bis zum Umfallen arbeiten. Und hast du bemerkt, alle Kinder haben schmutzige und geflickte Kleider und gehen barfuss. Selbst der Bauernbursche da trug keine Schuhe, obwohl er sicher sechs- oder siebzehn ist.»
«Gerade auf dem Land leiden die Familien eben am meisten darunter, dass die Väter an der Grenze sind. Die Mütter kommen doch nicht nach mit allem. Unter normalen Umständen sähe es gewiss etwas anders aus.»
«Ah, da kommt der Bursche mit einem Krug. Gibst ihm dann aber schon etwas dafür, Martha.»
«Natürlich, wo denkst du auch hin!»
Dölf füllte zwei Becher mit der schneeweissen, schäumenden Milch und reichte sie den Damen: «Trinkt mir aber nicht zu schnell, das ist ganz ungesund. Es haben sich schon andere mitten im Sommer schwer erkältet, weil sie zu hastig von der eiskalten Milch aus dem Felsenkeller getrunken haben.»
«Das sind schöne Berge, die ihr da habt», sagte die ältere Dame zu Dölf, während sie vorsichtig an der Milch nippte. «Wie heissen die alle?»
«Da drüben zum Beispiel, dieser zuckerhutförmige Berggipfel, das ist der Zindelspitz. Dort, diese Pyramiden, die nennt man Bockmattli. Auf der anderen Seite dort, das zerklüftete Massiv, das ist der Fluebrig.»
«Wenn man diese Berge einmal besteigen könnte!», schwärmte die jüngere Dame.
«Möglich wäre es auf alle Fälle», antwortete Dölf. «Da müsste man freilich andere Kleider und anderes Schuhwerk tragen, als ihr jetzt tragt. Hier auf den staubigen Wegen im Tal mag es mit diesen Schühlein gerade noch angehen. Wie auch immer, wenn ihr an landschaftlichen Dingen interessiert seid, könntet ihr beim Taleingang den hübschen Wasserfall in der Schräh besichtigen. Mein Bruder, der Kari, könnte euch an einem anderen Tag mit dem Fuhrwerk hinfahren, wenn ihr wollt.»
«Ja, das wäre vielleicht etwas, warum nicht», meinte die Dame.
Die Becher der beiden Damen waren leer, und Dölf schenkte ihnen nochmals ein.
Schon fuhr die ältere Dame mit ihrer Fragerei fort: «Habt ihr hier oben denn gar nirgends so eine Art Dorfkern? Ich sehe überall nur einzelne verstreute Häuser.»
«Das seht ihr richtig. Bei der Kirche steht das Pfarrhaus, gleich daneben das Schulhaus, aber das ist auch schon alles. Sonst leben im Tal fast nur Bauern, und Bauernhäuser stehen nun einmal weit auseinander, umgeben von Wies- und Streuland für die Landwirtschaft.»
«Automobile verkehren wohl auch keine hier herauf?», wunderte sich die jüngere Dame.
Geduldig antwortete Dölf: «Ein Automobil sehen wir hier oben bloss alle Schaltjahre einmal, wenn überhaupt. Bei uns gibt es nur Pferdefuhrwerke, das heisst, bei denjenigen, die überhaupt ein Pferd besitzen.»
«Aber wie lebt ihr hier im Winter? Da seid ihr doch sicher komplett von der Umwelt abgeschnitten.»
«Natürlich», erklärte Dölf. «Wir kennen nichts anderes. Bis die Bauern jeweils dazu kommen, mit ihren Pferdegespannen die Wege zu pfaden, müssen die Kinder oft durch den tiefen Neuschnee zum Schulhaus waten. Auch bei der Strasse ins Vorderthal hinunter ist es jedes Mal eine Riesenbüez, bis sie wieder gepfadet ist. Viele Männer und sämtliche verfügbaren Pferde müssen dafür aufgeboten werden. Manchmal kommt man tagelang nicht mehr aus dem Tal hinaus.»
«Was steht denn bei euch so auf der Menükarte? Ich meine, habt ihr irgendwelche Spezialitäten hier oben, die man einmal probieren könnte?», fragte die jüngere Dame weiter.
Dölf lachte: «Spezialitäten? Zum Essen? Nicht, dass ich wüsste. Bei uns zuhause gibt es fast immer nur Vogelheu, Ribäli oder geröstete Gumel. Auf der Alp werden Käse und Butter hergestellt. Wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Für Extras langt’s nicht, und wenn das Wetter einmal Kapriolen macht, gibt es eben ein Hungerjahr. Wenn wir im Sommer nicht zusätzlich ins Wildheu gingen, kämen wir schon gar nicht durch.»
«Alle Achtung, unter welchen Bedingungen ihr euch hier oben durchschlagt. Vielen Dank für die wunderbare Milch. Hier hast du einen Franken.»
Die feinen Damen stöckelten mit wiegenden Hüften davon, einen leichten Schleier von Parfümduft hinter sich her schleppend.
Bereits wenige Tage später rückten die Städterinnen aus Winterthur – so viel hatte Dölf ihnen beiläufig entlockt – wieder an. Kari, der von Dölf vorgewarnt worden war, sagte zu, sie mit dem Fuhrwerk, vor das er den braven Fridolin gespannt hatte, durch das Tal zu fahren. Bis zum Wasserfall in der Schräh und zurück sollte die Reise gehen.
Schon während der Fahrt wollten die Damen von Kari die verschiedensten Dinge über das Tal wissen. In der Schräh angekommen, erzählte er ihnen schliesslich, wie man das Tal bereits vor der Jahrhundertwende als möglichen Standort für die Gewinnung von Elektrizität entdeckt hatte: «Genau hier in der Enge zwischen dem Fuss des Grossen Aubrig und dem Gugelberg wollten die Herren vom Konsortium ursprünglich eine Staumauer errichten. Nur konnten sie keinen soliden Grund finden. Dann wollten sie weiter hinten beim Ausgang des Schlierenbachs einen Erddamm aufschütten. Damit wäre nur der hintere Teil des Tals geflutet worden. Die Bewohner im vorderen Teil wären noch einmal glücklich davongekommen. Aber auch dieser Plan scheiterte.»
«Warum das?»
«Die Finanzierung war zu wacklig. Die Konzessionen wechselten mehrere Male den Besitzer, und niemand nutzte sie. Jetzt sind das Elektrizitätswerk des Kantons Zürich und die Stadtzürcher Elektrizitätswerke mit vereinten Kräften am Ruder.»
«Der Stadt Zürich gehört doch auch das Bad Wägital, in dem wir gerade zu Gast sind?», fragte die ältere Dame nach.
«Ganz genau. Und die Zürcher haben sogar zusätzliches Geld in das Kurhaus gesteckt, um einen rentablen Betrieb sicherzustellen, bis der See kommt.»
«Und nun soll dieses hübsche Tal einfach so von einem Stausee geflutet werden? Das ist doch entsetzlich! Was hat denn die Bevölkerung dazu gesagt? Und die Gemeinde?»
«Die Gemeinde und die Genossame hatten nichts dazu zu sagen», erklärte Kari. «Der Kanton und der Bezirk haben alles entschieden, und wir, die Bevölkerung, haben es erst später aus der Presse erfahren. Direkt hat man uns nie über den Fortschritt der Verhandlungen informiert.»
«Aber da müsstet ihr doch Widerstand leisten! Ihr Talbewohner müsstet euch zusammenschliessen und unter einer gemeinsamen Flagge auftreten. Es gibt Beispiele, wo man auf diese Weise etwas erreicht hat.»
«Vielleicht müssten wir das», nickte Kari. «Bis jetzt konnten wir uns aber nie dazu aufraffen, eine solche Bewegung ins Leben zu rufen. Die meisten Leute warten lieber ab. Manche haben als Einzelkämpfer versucht, Widerstand zu leisten, aber inzwischen auch schon wieder aufgegeben, weil sie ohnehin nie angehört worden sind. Was kann man schon ausrichten gegen die Übermacht von Bezirk und Kanton und gegen all die Elektrizitätsbefürworter und Technikgläubigen im ganzen Land? Wir werden von allen im Stich gelassen, so sagt unser Dädi immer. Und ganz unrecht hat er ja nicht.»
«Das wäre jammerschade um dieses Bergtal. Wir könnten dann ja auch gar nicht mehr in dieses schöne Kurhaus kommen. Ist das etwa nichts wert? Und was soll dann mit der Bevölkerung geschehen, die fort muss?»
«Das weiss bis jetzt nur der Herrgott, wenn überhaupt. Ich bezweifle, dass er noch eingreifen wird, um das Ganze zu verhindern. Aber lassen wir das. Seht ihr, wir sind angekommen. Da ist der Wasserfall, den ich euch zeigen sollte.»
Es gab höhere und imposantere Wasserfälle als den in der Schräh, doch das Wasser des Schrähbachs stürzte in mehreren Kaskaden über bizarr geschichtete und gestufte Felsen hinab und bot so einen malerischen Anblick. Die beiden Damen bewunderten den Wasserfall. Auf der ganzen Rückfahrt waren sie aber auffällig schweigsam und stellten gar keine Fragen mehr. Auch Kari spürte, dass seine Ausführungen eine bedrückte Stimmung geschaffen hatten. Er fuhr die Winterthurerinnen bis vor den Eingang des Kurhauses. Als ihm die ältere Dame beim Abschied einen Fünfliber in die Hand drückte, blickte sie ihn mit einem Ausdruck an, der ihm wie Mitleid vorkam, aber Kari dachte bei sich, nur mit Mitleid sei den Innerthalern auch nicht geholfen.
4.
Die Mamä reagierte auf die Nachricht, dass es mit der Staumauer und den Kraftwerksanlagen nun doch ernst galt, nicht wie der Muuslöchler mit harschen Worten und schlecht beherrschtem Zorn, sie reagierte auch nicht wie Kari und Dölf mit sachlichen, weitgehend nüchternen Analysen, sondern mit einer Art stiller Trauer. Als geborene Diethelm war sie, wie der Dädi, im Tal aufgewachsen, hatte ihr ganzes Leben hier verbracht und hing daran. In den ganzen Jahren, seit sie verheiratet war, war sie nie mehr als ein, zwei Tage am Stück vom Muusloch fortgewesen. Und nun würde sie gezwungen sein, das alles für immer aufzugeben. Man riss doch einem Menschen auch nicht das Herz bei lebendigem Leib heraus, um ihn nachher so weiterleben zu lassen!
Wer würde es verantworten und so herzlos sein können, sie und all die anderen Bewohner einfach so aus dem Tal wegzuverfrachten? Und dies alles für etwas nicht Greifbares, etwas nicht Lebensnotwendiges wie diese Elektrizität? Sie dachte besonders an ihren Ältesten, Xaver, der den Hof einmal hätte übernehmen sollen. Sie und der Dädi waren schon alt, und man konnte sagen, dass sie ihre Zeit hier im Tal gehabt hatten, aber Xavers Zukunft lag noch vor ihm, sie begann eigentlich erst. Er würde sich also an einem ganz anderen Ort eine neue Existenz aufbauen müssen. Und nun stand er bereits seit Jahr und Tag an der Grenze im Jura und bekam nicht einmal mit, was in seiner Heimat vor sich ging. So ging es auch vielen anderen Männern aus dem Tal, die immer noch im Dienst waren. Die Mamä musste ihm mitteilen, was dem Tal bevorstand, und so setzte sie sich an den Tisch und begann zu schreiben:
Feldpost
Innerthal, den XI. August 1917
Lieber Xaver!
Hoffentlich geht es Dir und Deinen Kameraden soweit gut. Habt ihr es im Moment streng? Wir alle vermissen Dich sehr, aber der Dädi besonders, da er doch gerade jetzt so viel Arbeit im Wildheu hat.
Auch die beiden grossen Mädchen sehen wir nur selten. Es wäre so schön, wenn wieder einmal die ganze Familie zusammenkäme. Wenigstens hat der Dädi bis auf weiteres nach Hause kommen dürfen, das ist für uns schon eine grosse Erleichterung.
Leider müssen wir Dir auch eine ernste Nachricht schicken. Es ist bekannt geworden, dass nächstes Jahr ein neues Projekt für den Stausee vor die Bezirksgemeinde kommen soll. Am liebsten möchte man dann sogleich mit den Bauarbeiten beginnen, wie es heisst. Ich dachte, dass man es Dir zumindest schreiben sollte, obwohl Du es vielleicht auch schon von Rosa gehört hast.
Niemand weiss heute genau, was mit seinem Heimwesen passieren soll. Der Dädi ist deswegen sehr besorgt. Es wäre doch besser, man könnte auf einen Schlag vom Hof wegziehen, anstatt in diesem merkwürdigen Zustand hier zu leben. Das Leben im Tal scheint einfach so weiterzugehen,und doch wird es irgendwann einmal plötzlich damit zu Ende sein. Das ist es, was mir die Luft zum Atmen nimmt.
Ich hoffe, dass Dich diese Nachricht nicht zu schwer belastet. Wichtig genug ist die Sache für Dich allemal, und Du tust wohl gut daran, wenn Du Dich schon frühzeitig auf die Lage einstellst.
Behüt Dich Gott! Sei herzlich gegrüsst von Deiner Mamä, nebst der ganzen Familie.
Als Xaver den Brief ausgehändigt bekam und ihn in einer stillen Minute las, fröstelte ihn. Seit seiner frühesten Kindheit, noch vor der Jahrhundertwende, wurde immer wieder über den künftigen Stausee gesprochen. Es fiel ihm schon immer schwer, sich im Talboden mit all den Heimwesen den See vorzustellen, und dass seine Familie einst gezwungen sein würde, tatsächlich ihr Muusloch zu räumen, wollte ihm noch viel weniger in den Kopf gehen. Jetzt aber, da die Idee des Sees Realität werden sollte, erschien ihm das Projekt mit all seinen Konsequenzen sogar unwahrscheinlicher denn je. Die Situation machte ihn traurig, denn wie die Mamä hing auch er am Tal und am Muusloch. Gleichzeitig glaubte er daran, dass es für die ganze Familie eine gute Lösung für die Zukunft geben würde. Er konnte sich für den Notfall auch ein Leben anderswo vorstellen.
War nicht seine Situation hier draussen an der Grenze im Grunde sehr ähnlich? Es herrschte dauernde Alarmbereitschaft, man wusste, dass es irgendwann plötzlich ernst gelten konnte. Niemand aus Xavers Kompanie hatte je einen Feind aus der Nähe gesehen, und doch gab es diese Feinde, und irgendwann konnten sie plötzlich da sein. Es war klar, dass sie kein reines Hirngespinst waren, denn die Artillerie von drüben hörte man, und zwar deutlich genug.
Hätte er in einer so entscheidenden Zeit nur zuhause sein und direkt Einfluss nehmen können auf das, was dort vor sich ging! Hätte er bloss den Dädi entlasten können, gerade jetzt im Sommer! Eine starke Erinnerung an die Gerüche auf der Alp überwältigte ihn, an den herben und würzigen Geruch der Bergkräuter und der zur Reifung eingekellerten Käselaibe. Wie gern hätte er gerade jetzt im Wildheu gearbeitet oder auf der Zindlen gekäst! Stattdessen lag er in einem alten, schlecht gemauerten Schuppen im Jura, in dem man Stroh ausgebreitet hatte. In dieser improvisierten Truppenunterkunft schliefen sie. Statt der Bergkräuter hatte er den säuerlichen Schweissgeruch und das Müffeln von feuchten Socken seiner Kameraden in der Nase, das war eben nicht zu vermeiden, wo viele Soldaten auf einem Haufen untergebracht waren. Auf der Alp roch andererseits auch längst nicht alles gut. Verwöhnt durfte man da wie dort nicht sein. Aber dennoch, wie gern wäre er dort gewesen!
Xaver erinnerte sich lebhaft an eine Situation mit seinem Dädi und dem Schnyder Franz, Rosas Dädi. Xaver war damals noch ein Schulbub gewesen und mit dem Dädi mitgegangen, um eine stierige Kuh von Schnyders Muni decken zu lassen, an sich nichts Ungewöhnliches. Bei dieser Gelegenheit kam es jedoch zu einer heftigen Diskussion zwischen den beiden Männern, denn Franz gehörte zu den wenigen, die sich von Anfang an bemüht hatten, auf die Vorteile des Fortschritts hinzuweisen, der entstand, wenn man dafür den Talboden mit dem guten Wies- und Streuland opferte.
«Die Armut ist bei uns hier hinten gross, das weiss jeder», hatte er damals gesagt. «An den jährlichen Abgaben und Steuern für die Nutzung der Wasserkraft kann die Gemeinde wenigstens etwas verdienen. Viele Wägitaler werden bei den Bauarbeiten und im späteren Kraftwerksbetrieb Arbeit finden. Und es wäre doch denkbar, dass ein See Touristen von weit her anziehen könnte. Man könnte Hotels und Pensionen für den Fremdenverkehr aufbauen, statt der Landwirtschaft.»
«Was wollen wir hier mit Fremdenverkehr?», schimpfte der Muuslöchler. «Es ist doch das Mindeste, dass wir das Tal für unsere Nachkommen so erhalten, wie es ist und war. Seit Generationen haben unsere Vorfahren hier gelebt und sind hier gestorben. Dieses Land war immer schon ihre Existenzgrundlage und soll es auch für unsere Nachkommen bleiben.»
«Aber der Fortschritt», entgegnete der Schnyder Franz, «schau doch, in was für Verhältnissen wir alle hier leben! Das Land ernährt uns alle nur mit Mühe und Not. Schon früher konnten längst nicht alle Jungen im Tal bleiben, selbst wenn sie gewollt hätten. Warum mussten sie denn alle auswandern und müssen es noch immer, in die anderen Marchgemeinden hinunter oder in andere Gegenden der Schweiz und gar ins Ausland? Wir brauchen neue Möglichkeiten, um unseren Wohlstand zu steigern.»
«Wenn ich das nur schon höre, Fortschritt, Wohlstand, Verhältnisse! Das ist doch alles ein fertiger Chabis!», griff der Dädi den Franz an. «Wir leben hier auf natürliche Art und Weise, verbunden mit der Natur. Unsere Vorfahren konnten mit dem auskommen, was sie hatten, und wir können und sollten das auch. Wir brauchen keinen Fortschritt, solange wir zufrieden sind mit dem, was wir sind. Ich denke an meine Kinder, ich will nicht, dass sie wegen dieser Profitgier das Tal verlassen müssen. Du bist auch Familienvater, Franz!»
Darauf setzte Franz seufzend zu einer längeren Belehrung an: «Du musst endlich einsehen, Sepp, dass der Fortschritt hier im Tal schon lange begonnen hat. Du kannst diesen Prozess nicht aufhalten, er geht immer weiter. Denk an die erste befestigte Fahrstrasse, die endlich das ganze Wägital erschlossen hat. Es ist noch nicht so lange her, seit sie eingeweiht wurde. Unsere Eltern können sich noch gut daran erinnern und vor allem daran, wie beschwerlich davor der Weg bis zu uns ins Innerthal war. Die Wägitaler Gemeinden hätten die Finanzierung damals nie alleine stemmen können. Dann kam das Kurhaus, das unserem Tal Gäste aus dem ganzen Land, sogar aus dem Ausland, beschert hat. Und damit ist der Fortschritt noch nicht zu Ende. Dein Ältester ist doch anno vierundneunzig geboren worden, zwei Jahre nach meinem Beyter. Gerade in diesem Jahr haben wir auch die Eidgenössische Pferdepost bekommen, die täglich einen Kurs ins Innerthal führt. Das weisst du ja alles so gut wie ich. Aber siehst du, das war eben noch immer nicht das Ende der Fahnenstange, sondern dann hat man die Stromgewinnung als neue Möglichkeit entdeckt, und an diesem Punkt stehen wir nun. Es wurde schon so viel Geld in die Entwicklung unseres Tals investiert, da ist es doch klar, dass man auch etwas herausbekommen will. Und das kann man nun eben mit der Stromproduktion, die im Interesse der ganzen Nation liegt.»
«Es reicht, Franz!», knurrte der Muuslöchler mit einer zornigen Handbewegung, die aussah, als ob er ein lästiges Insekt hätte verscheuchen wollen. Dann nahm er Xaver bei der Hand und sagte: «Komm, Bub, wir gehen. Der Franz kann selber schauen, wem sein Donnersstier aufhocken soll. Mir jedenfalls nicht, das Sprunggeld würde mich reuen.»
Und tatsächlich marschierten sie mit ihrer Kuh unverrichteter Dinge nach Hause.
So hatten sich damals die unterschiedlichen Haltungen der beiden Familienväter präsentiert, und daran änderte sich auch später nichts Wesentliches. Xaver selbst stand irgendwo zwischen den beiden Fronten. Die Meinungsverschiedenheit zwischen dem Muuslöchler und Rosas Dädi war aber glücklicherweise für niemanden von Belang gewesen, als Xaver begann, bei Rosa z’Liecht zu gehen. Es war auf beiden Seiten klar gewesen, dass diese Situation nicht zur Ursache einer Fehde zwischen den beiden Familien werden durfte. Die beiden Väter waren ansonsten nämlich zu keiner Zeit miteinander zerstritten. Sie hatten denselben Jahrgang und waren schon in der Schulzeit Freunde gewesen. Beide wussten, wo der andere stand, beide beharrten auf ihrer Meinung, was ja ihr gutes Recht war. So erübrigte es sich für sie, weitere Diskussionen über das Thema zu führen.
Als drei von Xavers Kameraden von der Wache zurück in den muffigen Schuppen kamen, drang ein Schwall kühler, frischer Luft mit ihnen in den Raum und holte Xaver wieder in die Gegenwart zurück. Er seufzte und fragte sich, wie er die kommenden Wochen und Monate hier im Dienst überstehen sollte. Es war absehbar, dass ihm die Situation zuhause zu denken geben würde, beim Wacheschieben oder abends im Stroh. Einmal würde er sich wohl oder übel klar werden müssen, was er von diesen Entwicklungen halten sollte und was sie konkret für seine Zukunftspläne mit Rosa bedeuteten. Wie lange wohl dieser Dienst noch dauern würde?
5.
Zuhause, besonders abends beim Einschlafen, beschäftigte auch Agneysli die Sache mit der Flutung des Tals, weil sie beständig an ihren Traum aus der Regennacht denken musste. Es war also nicht nur ein Traum, sondern dem Tal stand ein solches Schicksal tatsächlich bevor. Das wusste Agneysli, denn Dölf hatte ihr am Tag danach haarklein erzählt, was in der Wirtschaft besprochen worden war. Nun kamen aber die Fragen erst recht: Was würde mit der Kirche passieren? Würde die Spitze des Turms am Ende keck aus dem Wasser hervorgucken, so wie sie es geträumt hatte? Wo würde sie dann zur Schule gehen? Im Grunde wäre es ihr ja ganz recht gewesen, sie hätte überhaupt nicht mehr zum Gufäschnuuz gehen müssen, der sie sowieso nur die ganze Zeit an den Ohren nahm. Und was würde mit all den Fröschen und Forellen in der Aa geschehen, die Agnes mit Seppli zusammen fürs Leben gern jagte? Würden sie diese, statt aus der Aa, aus diesem See herausfischen müssen? Würden die Fische später auf dem Seegrund im Doblerhof umherschwimmen, womöglich sogar genau hier in Agneyslis Kammer?
Diese Überlegungen behielt das Mädchen für sich, nicht einmal dem Seppli erzählte sie davon. In der Schule schwieg sie darüber erst recht, dort machten auch ohne Agneyslis Mitwirkung die wildesten Gerüchte die Runde.
So meinte Mächlers Seppel eines Morgens nach der Schulmesse: «Der Dädi sagt, es solle eine Zahnradbahn auf den Aubrig hinauf geben, wie die auf die Rigi oder den Pilatus, und oben auf dem Gipfel ein grosses Restaurant und ein Hotel für die Touristen.»
«Du glaubst aber auch jeden Schmarren, den man dir angibt. So ein ausgekochter Blödsinn!», riefen die anderen Kinder reihum.
Zügers Leynäli rückte mit einer anderen Sensation heraus: «In der Zeitung stand doch letzte Woche etwas von einer Eisenbahnlinie von Siebnen ins Innerthal!»
«Ja, warum nicht?», erwiderte einer der vorlauten Buben. «Wahrscheinlich mit Fortsetzung durch einen Tunnel bis ins Muotathal.»
«Und von dort nach Schwyz, mit Anschluss an die Gotthardbahn und nach Italien», schmunzelte der Lehrer Inderbitzin, der das Gespräch mit angehört hatte.
Zum Sigristen, der neben ihm stand, meinte er kopfschüttelnd: «Es ist mir unbegreiflich, woher die Kinder all dieses Zeug aufschnappen. Morgens muss ich den Unsinn den Viert- bis Siebtklässlern ausreden, nachmittags den Erst- bis Drittklässlern. Es nimmt kein Ende.»
«Kein Wunder», erwiderte der Sigrist, «bei uns Erwachsenen ist es auch nicht viel besser. Das Tal ist eben eine grosse Gerüchteküche, und niemand weiss sicher, was nun kommt und was nicht. Es wird ablaufen, wie es seit Beginn dieses Theaters um die Wasserkraft immer abgelaufen ist: Irgendwann werden wir einfach vor vollendete Tatsachen gestellt.»