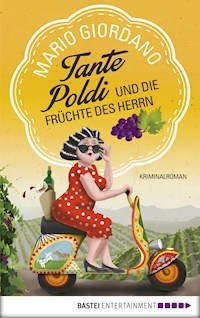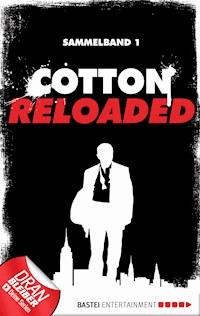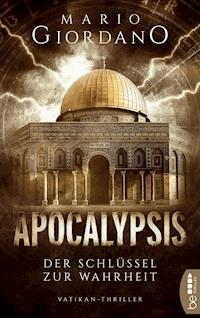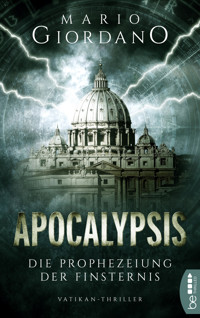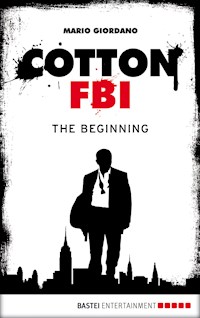9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sizilienkrimi
- Sprache: Deutsch
Lecktsmiamarsch, Poldis Geburtstag steht vor der Tür! Blöderweise sieht es nicht so aus, als ob sie den überleben würde. Denn als in Rom eine junge Ordensschwester vom Dach des Apostolischen Palastes stürzt, gerät die Poldi unter Verdacht. Einziger Hinweis auf den Täter: die Schwarze Madonna. Und diesmal hat es die Poldi mit sehr gefährlichen Leuten zu tun. Als sich dann noch in Torre Archirafi auf einmal alle von ihr abwenden, reicht es der Poldi. Krachledern, mit Perücke und tüchtig Dings findet sie heraus, warum ihre Freundin, die Signora Cocuzza, immer so traurig ist, und gerät mit dem Commissario ihres Herzens voll ins Visier der Mörder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Titel
Impressum
Motto
Kleines Vorspiel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Kleines Intermezzo
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Danksagung
Über das Buch
Lecktsmiamarsch, Poldis Geburtstag steht vor der Tür! Blöderweise sieht es nicht so aus, als ob sie den überleben würde. Denn als in Rom eine junge Ordensschwester vom Dach des Apostolischen Palastes stürzt, gerät die Poldi unter Verdacht. Einziger Hinweis auf den Täter: die Schwarze Madonna. Und diesmal hat es die Poldi mit sehr gefährlichen Leuten zu tun. Als sich dann noch in Torre Archirafi auf einmal alle von ihr abwenden, reicht es der Poldi. Krachledern, mit Perücke und tüchtig Dings findet sie heraus, warum ihre Freundin, die Signora Cocuzza, immer so traurig ist, und gerät mit dem Commissario ihres Herzens voll ins Visier der Mörder.
Über den Autor
Mario Giordano, geboren 1963 in München, schreibt Romane, Jugendbücher und Drehbücher (u. a. »Tatort«, »Schimanski«, »Polizeiruf 110«, »Das Experiment«). Bei Bastei Lübbe ist er mit der Apocalypsis-Trilogie und vor allem mit seiner Krimireihe um die charismatische Tante Poldi sehr erfolgreich. Giordano lebt in Berlin.
Weitere Titel des Autors:
Tante Poldi und die sizilianischen Löwen
Tante Poldi und die Früchte des Herrn
Tante Poldi und der schöne Antonio
Apocalypsis
Apocalypsis II
Apocalypsis III
Wir waren Papst. Das Apocalypsis-Interview
Cotton Reloaded – 01
Titel auch als Hörbuch erhältlich
MARIO GIORDANO
Tante
PoldiUND DIE
SCHWARZE
MADONNA
Kriminalroman
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Daniela Jarzynka
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München unter Verwendung eines Motivs von © Martina Frank, München
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-7203-8
Sie finden uns im Internet unter: www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
»Alter schützt vor Liebe nicht,
aber Liebe vor dem Altern.«
Coco Chanel
»Im Zweifel lass zwei Kerle mit Pistolen
durch die Tür hereinkommen.«
Raymond Chandler
»Dezenz ist Schwäche.«
Tante Poldi
Kleines Vorspiel
(un poco infernale ma non troppo)
Die Frau auf der uralten Massageliege bäumte sich wie unter Stromstößen auf und grunzte, knurrte und fauchte wie ein Tier. Schaum stand ihr vorm Mund, sie verdrehte die Augen, knirschte mit den Zähnen, schnappte um sich und stieß zwischendurch gotteslästerliche Flüche aus. Jedes Mal, wenn der Priester wieder Weihwasser auf sie spritzte, hatten die drei Diakone ihre liebe Mühe, die Frau an Beinen und Schultern auf die Liege zurückzupressen, ohne dabei gebissen zu werden.
Sie war so um die vierzig, trug einen billigen gemusterten Sportanzug ohne Schuhe und wirkte überhaupt sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation.
Die wackelige Handykamera zoomte diskret zurück und schwenkte einmal durch den kleinen Behandlungsraum. Man konnte eine Spüle erkennen, drei alte Holzstühle um einen Küchentisch mit geblümtem Wachstuch und zwei Espressotassen sowie einen kleinen Altar mit einer Madonnenfigur. An den pastellgrün gestrichenen Wänden hing ein Kruzifix, daneben einige Bilder von Padre Pio, ein Mannschaftsposter von Juventus Turin aus dem Jahr 1986 und ein gerahmtes Foto des Papstes. Zwei Fenster gaben den Blick auf eine Art Garten oder Park frei und fluteten den Raum mit sonnigem Tageslicht. Aber mit der monströsen Liege und dem alten Steinboden wirkte der Raum dann halt doch nur etwa so heimelig wie das Vernehmungszimmer eines Junta-Knasts.
Außer dem Fauchen der Frau und der sonoren Stimme des Exorzisten war nichts zu hören.
Das Handy schwenkte weiter und stoppte einen Moment bei einer jungen Ordensschwester, die kokett in die Kamera lächelte.
Dann folgte eine dramatische Nahaufnahme des Priesters, eines fülligen, jovialen Typs um die sechzig mit weißem Haar, gesundem italienischem Teint und einigen Lachfältchen um die Augen. Ohne Soutane hätte man ihn für den Wirt eines Slow-Food-Restaurants halten können.
Er malte der Frau das Kreuzzeichen auf die Stirn. »Lasse ab, Rosaria, vom Satanismus! Lasse ab von Hexerei, von Dämonen, Alkohol und Wollust!«
Erneut bespritzte er die Frau mit Weihwasser, und umgehend fauchte Rosaria ihn an wie eine in die Enge getriebene Katze. Den Exorzisten schien das nicht im Mindesten zu jucken.
»Wie heißt du, Dämon?«
Keine Antwort, nur Fauchen, Grunzen und Knurren.
»Ich frage dich, Dämon! Sag mir deinen Namen!«
Das wiederholte er ein paar Mal. Weihwasser spritzen, Kreuz auf die Stirn, nach dem Namen fragen. Rosaria gurgelte, röchelte und zuckte wie der Sänger einer Metalband. Die Diakone mussten sich auf sie werfen, um sie zu bändigen.
»Sag mir deinen Namen!«
»Nigra sum sed formosa!«, schrie Rosara auf Latein. Und noch mal: »Nigra sum sed formosa!«
Sie verdrehte die Augen, wurde dann plötzlich ganz starr und öffnete den Mund.
»Sterrrben!«, presste sie nun mit unnatürlich tiefer Stimme auf Italienisch heraus. »Sie muss sterrrben! Qualvoll verrrrecken!!!«
Der Exorzist schien Derartiges gewohnt zu sein, ungerührt wiederholte er seine Frage.
»Wer bist du, Dämon! Sag mir deinen Namen!«
Und diesmal antwortete Rosaria. In astreinem Bairisch.
»Leckmiamarsch, du oida G’schwollschädel!«, fuhr sie den Exorzisten an. »I bin die Poldi, du Kuttenbrunzer! Und noch mal zum Mitschreiben, du bleder Spruchbeidl: Isolde Oberreiter aus Torre Archirafi, hast mi?!«
1. Kapitel
Erzählt von Graffiti, Start-ups, Chakren, Piraten, Lernen im Alter, Uniformen, Neid und Tod. Der sizilianische Sommer lässt die Muckis spielen, die Poldi ist auf einer spirituellen Reise, und der Neffe hat wieder mal keinen Plan. Die Poldi dafür eine neue Haushaltshilfe mit einer Räuberpistole. Als Montana ernst macht, bekommt die Poldi erst kalte Füße und dann nächtlichen Besuch.
»KRAZZZ AB!«, stand da in fehlerhaftem Deutsch an die Hauswand der Via Baronessa 29 gesprüht, gleich neben Poldis protzigem Messingschild. Die schwarze Farbe leuchtete in der Mittagssonne und hob sich sehr dramatisch vom Sonnengelb der Fassade ab, muss man schon sagen. Schwarz-Gelb ist ja eh die Signalkombination der Natur für giftiges Gewürm, Killerwespen und no entry areas aller Art. Weithin sichtbar, unmissverständliche Warnung, Schluss mit lustig, weiß auch das kleinste Spatzenhirn sofort Bescheid beziehungsweise lässt sich täuschen. Von den krakeligen und in offensichtlicher Eile hingeschmierten Druckbuchstaben hingen Tropfnasen herab, was dem Inhalt der Botschaft vielleicht einen gewissen Nachdruck hatte verleihen sollen. Tatsächlich wirkte die Schrift dadurch wie eine billige Halloween-Rubbel-Typo aus dem Bastelladen. Aber die Botschaft an sich verstörte dann doch.
»Leckmiamarsch!«, sagte ich und nahm meinen Rucksack ab, der mir schon am Rücken klebte.
»Gell!«, sagte die Poldi zufrieden. »Meine Worte.«
Ich wollte gerade nachfragen, was es damit auf sich hatte, doch in diesem Moment stürmte mir Totti aus dem Haus entgegen, der Hund meiner Tante Teresa. Schier außer sich vor Begeisterung sprang er mich an, warf mich beinahe um und schleckte mich von oben bis unten ab. Und, Ehrensache, furzte natürlich sofort wieder. Mein müdes Herz ging auf, knuffend und kraulend erwiderte ich die Begrüßung meines stinkenden Freundes.
»Was macht der denn hier?«
»Mei, die Teresa hat g’meint, es wär besser, wenn i für eine Weile nicht alleine im Haus bin.«
Allerdings taugt kein Hund auf der Welt weniger zum Wachhund als Totti. Er ist eine typisch sizilianische Promenadenmischung, gelb mit schwarzer Schnauze und riesigen Fledermausohren, durch und durch verbaut, wie aus Einzelteilen sämtlicher Hunderassen zusammengeschraubt, und liebt einfach alle und jeden. Und dass seine unerträgliche Furzerei ausreichte, um Mörder und Gesindel auf Abstand zu halten, wagte ich zu bezweifeln.
»Ist das die einzige Drohung?«
»Drüben in der Via Filandieri hat er so was auch noch auf Italienisch und Englisch g’sprüht. Wahrscheinlich um anzugeben, dass man auswärts spricht. Natürlich hab i die alle umgehend sachgemäß dokumentiert.«
Stolz zeigte sie mir die Fotos der gesprayten Morddrohungen auf ihrem Handy. Auf einer Wand stand nur: »POLDI GO HOME!« Fand ich eher so mittelbedrohlich.
»Damit hat’s ang’fangen«, erklärte die Poldi. »Aber schon ein bisserl missverständlich, weil ›home‹ ist für eine Weltbürgerin wie mich ja ein relativer Begriff. Außerdem ist ›home‹ für mich ja eh hier in Torre Archirafi. Und weil der Troll sich des wahrscheinlich auch gedacht hat, ist er dann lieber gleich zu den Morddrohungen über …«
»Er?«, unterbrach ich sie aus einem Impuls heraus.
Die Poldi sah mich überrascht an. »Mei, Bub, da schau her! Bravo! Cento punti! In die Falle der ersten Hypothese bist diesmal nicht hereingetappt.«
Sie trat einen Schritt zurück, legte den Kopf schräg und betrachtete die Drohung an ihrer Hauswand wie eine Kunstexpertin.
Was mir wiederum Gelegenheit gab, meine Tante einen Augenblick zu betrachten, denn wir hatten uns über drei Wochen weder gesehen noch gesprochen. Bis sie mich am Tag zuvor unmissverständlich und unverzüglich zurück nach Sizilien zitiert hatte.
Der Schweiß troff ihr unter der schwarzen Perücke in Bächen die Stirn herab, aber trotzdem sah sie gut aus, fand ich. Sie hatte ein wenig Farbe bekommen und trug knappe Hotpants aus abgeschnittenen Jeans, die ein kleines bisschen unvorteilhaft an den Oberschenkeln spannten. Dazu ein knallenges orangenes Top mit tüchtig Dekolleté, das ihre bajuwarisch-barocke Erscheinung speckröllchenweise betonte. Der tätowierte Phönix auf ihrer linken Brust lugte keck heraus. Unten goldene Riemchensandalen und obenrum eine ganze Sammlung von Ketten aus Kaurimuscheln, die bei jeder Bewegung leise klickerten und klackerten. So ein Hippie-Look mit fast einundsechzig geht nur mit dem Selbstbewusstsein meiner Tante Poldi.
Was mir aber wirklich die Sprache verschlug, war der Aufdruck auf ihrem Top. Eine Art Scherenschnitt von ihr selbst im Profil, darüber in fetter Blockschrift »DONNA« und darunter »POLDINA«.
»Hast du dir dieses Shirt machen lassen?«, platzte ich heraus.
»Nein, des hat dein Cousin Marco designt. Des ist ein Logo. Weil, weißt schon, i hab mir doch überlegt, eine kleine verschwiegene Detektei aufzumachen. Quasi Start-up, weißt.« Die Poldi zupfte sich das Top ein wenig zurecht und streckte sich, damit ich alles gut sehen konnte. »G’fällt’s dir? I hab auch eins in deiner Größe.«
Ich stöhnte. »Ja, weiß schon. Dezenz ist Schwäche.«
»Den Sarkasmus kannst dir fei sonst wohin stecken. Des nennt man Imagebildung. Der Marco hat g’sagt, des müsste man von Anfang an richtig aufziehen, mit Internetseite, Blog und Logo und Merchandising und allem Pipapo.«
Die Poldi wandte sich wieder dem Graffito zu.
Aus der offenen Haustür wehte mir ein Schwall kühler Klimaanlagenluft entgegen, vermischt mit Patschuli und leise jammernden Sitarklängen. Die Poldi war also offenbar auf einer spirituellen Reise, sie hatte eine Geschäftsidee und wirkte tatendurstig wie eine Hummel im Frühling. Was nur bedeuten konnte, dass ihr Projekt »Totsaufen mit Meerblick« vorläufig on the rocks lag, was unterm Strich eine erfreuliche Entwicklung war. Wenn da nicht »KRAZZZ AB!« auf ihrer Hauswand gestanden hätte.
Die Poldi beendete ihre Kunstexpertise und schüttelte den Kopf. »Naaa! Des war ein Kerl. Drei ›Z‹ – da spricht doch die ganze Verdruckstheit eines pubertären Spruchbeidls ohne Freundin heraus, meinst nicht? Einer, der sein Leben nicht mehr im Griff hat, den ganzen Tag Filmchen im Internet anschaut und sich daran aufgeilt, wenn er jemand eine Angst einjagen kann. Magst ein Bier?«
»Na endlich«, stöhnte ich, nahm meinen Rucksack und trat ins Haus.
Totti folgte mir und furzte.
Ich meine, natürlich war ich neugierig wie Bolle auf den Hintergrund dieser Drohungen, auf alles, was die Poldi in der Zwischenzeit erlebt, angestellt, vermurkst und wieder geradegebogen hatte. Ich platzte geradezu vor Neugier auf ihre Abenteuer und Eskapaden in den vergangenen drei Wochen. Denn, gebe ich zu, ich hatte sie vermisst. Sogar ihre ewige Schurigelei, und ich sah ihr auch an, dass sie sich selbst nur mühsam beherrschen konnte, nicht gleich alles herauszuposaunen. Aber erstens darf man die Poldi niemals drängen, wenn man etwas von ihr will. Zweitens verbietet das italienische Bella-Figura-Prinzip ohnehin allzu aufdringliche Neugier. Und drittens war es wirklich heiß, und nach der Reise und dem ganzen Chaos in Frankreich konnte ich wirklich ein Bier vertragen. Um nicht zu sagen, ich hatte nicht übel Lust, mir so richtig die Kante zu geben. Aber ich hab’s nun mal nicht so mit Kontrollverlust, und außerdem kriege ich nach dem dritten Glas immer schon Kopfschmerzen.
Das Erste, was mir im Haus auffiel, war der schwere süßliche Geruch von Räucherstäbchen, die vergeblich gegen Tottis Fürze anräucherten. Ansonsten wirkte die Via Baronessa 29 aufgeräumt, nirgendwo Schnapsflaschen. Und dann natürlich die Sitarmusik. Die kam nämlich nicht vom Band.
Als ich gerade die Treppe hinaufsteigen wollte und einen flüchtigen Blick in Poldis schattigen cortile warf, sah ich dort einen etwa zwanzigjährigen Mann in einem weißen Salwar Kamiz sitzen, also der Kombination aus weiter Hose und langem Hemd, wie man sie traditionell in Indien oder Pakistan trägt. Der junge Mann spielte versonnen auf einer Sitar und nickte mir freundlich zu. Ein bisschen perplex von dem Anblick nickte ich zurück. Hinter mir rief die Poldi schon: »Geh, sperr die Goschen zu! Des ist der Ravi, der gibt mir Unterricht.«
Kopfschüttelnd stapfte ich hinauf in Poldis Gästezimmer unter dem Dach, das ich inzwischen als mein Zimmer betrachtete. Das frisch bezogene Bett schien auf mich gewartet zu haben und war über und über mit einem kleinen Flor von Tottis Haaren bedeckt. Ich pfefferte meinen Rucksack in die Ecke und setzte mich an den kleinen wackeligen Schreibtisch am Fenster, wo ich nach längerer Unterbrechung endlich wieder so richtig an meinem großen sizilianischen Familienroman und Sittengemälde eines ganzen Jahrhunderts weiterarbeiten würde. Ich checkte mein Handy auf Nachrichten (keine), genauer gesagt, ob Valérie gerade online war (ja, war sie), starrte das Handy mit wachsender Verzweiflung an, schaltete es aus und sofort wieder ein, hörte die Poldi zu Sitarklängen unten klappern und versuchte vergeblich, mich zuhause zu fühlen. Man ahnt schon: Ich war irgendwie voll von der Rolle.
»Herrgott, wo bleibst du denn?«
»Bin gleich da!«, rief ich zurück, aber das war voll gelogen.
Ich war vierunddreißig, ohne Abschluss, derzeit ohne Job und ohne Plan, nur mit einem vermurksten Romanfragment und einem angeknacksten Herzen, ganz was Neues. Ich war so was von nicht da, und nichts und niemand schien diesen Zustand jemals wieder ändern zu können.
Ich stieg hinauf auf die Dachterrasse, um eine zu rauchen und mich ein wenig zu sammeln. Die Mittagssonne blendete mich, die Hitze semmelte mir eine links und rechts und verdampfte gerade den letzten Rest Frühling. Und das schon Mitte Mai. Kein Lüftchen rührte sich. Über die Hausdächer hinweg konnte ich das Meer sehen, das sich glitzernd und reglos bis zum Horizont aufspannte. Hinter mir ragte der Ätna im Mittagsdunst auf, sein Gipfel schon frei von Schnee, eine unentschlossene Rauchwolke quoll träge über dem Hauptkrater. In der ganzen Via Baronessa summten die Klimaanlagen, es roch nach Tomatensauce und Kaffee. Vom lungomare her schallte das Gehämmere der Handwerker, die auf den scharfkantigen Lavafelsen wieder Imbissbuden und Holzplattformen zum Sonnenbaden errichteten, zu mir herüber.
Der sizilianische Sommer ließ seine Muckis spielen. Er würde wieder sämtliche Bewegung dämpfen wie ein zähes Öl, würde das Land mit Tigermücken und Waldbränden überziehen, würde mit dem Schirokko an den Herzen scheuern und die Menschen hinter ihren geschlossenen Fensterläden noch misstrauischer machen. Aber der Sommer gehört eben zu Sizilien wie die Berge zur Schweiz. Erst in den langen, heißen Monaten von Mai bis Oktober ist dieses Land ganz bei sich selbst, findet zu seinem Rhythmus zurück wie eine Katze, die sich verlaufen und wieder nach Hause gefunden hat. Der Sommer würde auch Maulbeergranita bringen, seidene Nächte, ganz aus Jasminduft und Verheißung gewebt, Tage, überzogen von diesem sandfarbenen Licht, von dem du nie genug kriegst. Der caffè würde wieder schmecken wie nirgendwo sonst, überhaupt alles würde wieder schmecken wie beim ersten Mal. Denn das ist der hypnotische Trick des sizilianischen Sommers: Alles fühlt sich an wie beim ersten Mal, immer und immer wieder.
Überrascht sah ich, dass die Poldi ein paar Blumenkübel mit verschiedenen Sukkulentenarten, einer kleinen Palme und einem Zitronenbäumchen heraufgeschafft hatte. Sogar einen kleinen Bistrotisch mit zwei Korbstühlen und einem Sonnenschirm. Richtig nett sah das alles aus. Auf dem kleinen Tischchen entdeckte ich einen Aschenbecher, und gerührt verstand ich, dass sie das alles für mich arrangiert hatte.
Die Poldi erwartete mich im Innenhof. Auf dem Tisch stand eine Flasche Birra Moretti, die Poldi dagegen trank etwas, das so aussah wie eine Mischung aus Entengrütze und Morast aus dem Tümpel in einem Horrorfilm. Ravi saß mit untergeschlagenen Beinen auf einem bestickten Kissen auf dem Boden und spielte lächelnd Sitar. Ich stellte mich kurz vor.
»My pleasure!«, sagte er strahlend und spielte weiter, schlug die Spielsaiten mit einer Art Plektrum aus Draht auf seinem rechten Zeigefinger an und ließ das seltsame Instrument zärtlich mit allen Obertönen seiner zwanzig Saiten wimmern.
Und meine überreizten Nerven wimmerten mit.
Totti lag im Schatten unter dem Tisch und blinzelte nur kurz.
»You look kind of tired, my friend«, rief Ravi mit indischem Singsang. »I will play something cheerful for you.«
Nicht gut, dachte ich alarmiert, gar nicht gut.
Aber Ravi wechselte schon den Rhythmus, und die Sitar summte blumig und kokett in allen Quinten und Terzen.
Totti stieß einen Seufzer aus.
»Can you take a break, please?«, unterbrach ich sein Spiel.
Gut, ein bisschen zu brüsk vielleicht, aber Ravi schien es nicht übel zu nehmen. Er hörte auf zu spielen und strahlte einfach weiter wie der reine Sonnenschein.
»No problem, my friend.«
»Geh, was hast du denn? Ist dir nicht gut?«
»Alles okay«, murmelte ich und zündete mir eine Zigarette an. »Was trinkst du denn da eigentlich?«
»Des ist ein ayurvedischer Smoothie zum Entschlacken. Alles bio.«
»Genau so sieht’s aus. Was ist denn drin?«
»Frag nicht.«
»Und schmeckt?«
»Greißlich, aber gut fürs Anāhata.«
»Das was?«
»Mei, des Herzchakra halt, der Sitz der bedingungslosen Liebe, weißt schon. Magst probieren? Du wirkst herzmäßig so ein bisserl blockiert.«
Ich ignorierte das Angebot.
»Wohnt der jetzt hier?«, fragte ich, ohne Ravi anzusehen.
»Kreuzsacklzement!«, rief die Poldi amüsiert. »Hör i da etwa die Eifersucht rascheln?«
»Was sagt Montana dazu?«
Ich hätte es besser wissen müssen. Rote Linie. Die Poldi funkelte mich einen Moment an. Und dann faltete sie mich nach Strich und Faden zusammen.
»Du oida Kletzensepp!«, donnerte sie wie ein alpines Sommergewitter über mich hinweg. »Du bleder Gloifl, diesen ätzenden Ton kannst dir fei sonst wohin schieben, hast mi, du Nullchecker? Was fällt dir ein, du g’scherter Lackl! Des ist immer noch mein Haus und mein Leben, und i bin da weder dir noch dem Vito irgendeine Rechenschaft schuldig, dass des klar ist! Und wenn i jeden Kerl von Taormina bis Siracusa flachleg, geht des nur mich was an! Wenn dir des nicht passt, du schwindsüchtig’s Zigarettenbürscherl, nachert kannst gleich wieder zusammenpacken und abzischen. Haben wir uns da verstanden?«
Für einen Moment herrschte Stille. Die Poldi funkelte mich noch einmal an.
»I like the sound of the german language«, rief Ravi strahlend. »Very lovely.«
»’tschuldigung«, murmelte ich kleinlaut, hustete verlegen und drückte die angerauchte Zigarette aus. »Tut mir leid, Poldi. Echt jetzt. Ich, äh … mach gerade eine schwierige Zeit durch.«
»Ja, des hab i mir fei gedacht. Wie du schon wieder ausschaust, zurück in deinem Spießerlook in Jeans und Polo in Navy Blue, wirkst irgendwie emotional dehydriert. Läuft’s nicht so gut mit Valérie? Oder ist was mit deinem pesciolino? Kriegst ihn nicht hoch?«
Ich griff mir eine weiße Papierserviette vom Tisch und schwenkte sie durch die Luft. »Poldi, bitte!«, ächzte ich. »Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leidtut.« Ich wandte mich auch an Ravi und sagte: »Sorry.«
»You’re welcome.« Ravi faltete die Hände vor der Brust und verneigte sich. »Namaste!«
»Lecktsmialleamarsch.«
Totti furzte.
Da ist es wieder, dachte ich, das Poldi-Paralleluniversum. Und dabei floss ein bisschen von dem Kummer der vergangenen Wochen ab, ich atmete tief durch, spürte so etwas wie eine frische Seebrise durch meine Brust wehen und fühlte mich endlich wieder ein bisschen da. Mit einem Wort: zuhause.
Ein bisschen versöhnter mit der Welt wechselte ich das Thema. »Sag mal, Poldi … Warum hast du mich eigentlich aus Frankreich zurückzitiert? Und jetzt bitte keine blöden Sprüche. Augenhöhe bitte, ja?« Ich wedelte mit zwei Fingern zwischen unseren Augen hin und her, um zu verdeutlichen, was ich damit meinte.
Die Poldi sah mich erstaunt an. »I hab dich nicht ang’rufen. I hab gedacht, du hast mich vermisst.«
»Äh … Moment! Du hast mich angerufen und gesagt, ich soll meinen, ’tschuldigung, Arsch nach Torre bewegen, und zwar zackzack. Ich kenn’ doch deine Stimme!«
Die Poldi wirkte auf einmal irgendwie angespannt.
»Fake-News«, sagte sie bemüht locker. »Des war i nicht, des ist doch gar nicht meine Ausdrucksweise.«
»Nicht??? Und wer, bitte, soll das dann gewesen sein?« Mir kam ein Verdacht. »Du hast doch nicht etwa wieder einen Absturz mit Filmriss gehabt?«
Die Poldi winkte gereizt ab. »Ah, geh!«
»Erklärst du’s mir dann?«
Die Poldi atmete tief ein. »Mei, es gibt halt Dinge zwischen Himmel und Erde, die lassen sich nicht mit den Bordmitteln des sogenannten gesunden Menschenverstandes erklären. Magst noch ein Bier?«
Das ist ja immer ihre Floskel, um bei unliebsamen Themen scharf rechts abzubiegen. Nichts zu machen, ich kenne das. Sie wechselte einen Blick mit Ravi. Ravi schien es auf einmal irgendwie eilig zu haben und verabschiedete sich. Die Poldi begleitete ihn zur Tür und brachte mir ein zweites Bier mit.
»Der Ravi ist mein neuer Putzboy«, stellte sie klar, bevor ich irgendetwas sagen konnte.
»Aha.«
»Ja, nicht des, was du jetzt meinst, gell. Putzboy, nicht Toyboy. Und außerdem hat sich herausgestellt, dass Sitarmusik einen positiven Effekt auf Totti hat. Er furzt dann nicht mehr.«
Wie zur Bestätigung ließ Totti unter dem Tisch von sich hören, und ich hielt reflexhaft den Atem an. Die Poldi ließ eine Playlist mit klassischer Sitarmusik laufen, und tatsächlich – die elende Furzerei hörte auf.
»Wann, hast du gesagt, haben diese Morddrohungen angefangen?«
»Kurz nachdem du wie der größte verliebte Trottel aller Zeiten nach Frankreich abgerauscht bist.«
Ließ ich mal so stehen.
»Und seit wann kommt Ravi?«
»Geh, Schmarrn!« Die Poldi winkte ab. »Der Ravi ist eine Seele von Mensch. Absolut delizioso!«
»Vielleicht hat ja jemand im Ort was gegen Inder. Beziehungsweise Ausländer im Allgemeinen.«
»Leckmiamarsch!«, entfuhr es der Poldi. »Meinst?«
Ich hob die Arme.
»Der Ravi kommt aus allerbestem Hause!«, erklärte sie. »Vor drei Wochen ist er hier im Ort von Tür zu Tür gestromert und hat sich überall als Putzhilfe angeboten, und ein bisschen Hilfe im Haushalt konnt’ i ja schon gebrauchen, seitdem du mit der Valérie … Mei, ist ja auch wurscht. Und dann hat der Ravi mir verraten, dass er einen Master in Wirtschaft aus Harvard hat. Und dass er auf einer Selbstfindungsreise durch Europa ist und völlig abgebrannt. Weil sein Vater, pass auf, des ist ein Multimilliardär aus Mumbai, und der will halt, dass der Ravi eines Tages des ganze Hotel-Imperium übernimmt, aber der Ravi, der hat ein großes Talent, der will halt lieber Sitar spielen, und deswegen hat sein Vater ihn brutal enterbt und sämtliche Kreditkarten g’sperrt. Traurig, gell?«
Ich fasste es nicht. »Und diese Räuberpistole hast du geglaubt?«
»Herrgott, für wie deppert hältst du mich? Aber es ist eine gute Story. Und eine gute Story krümmt die Wirklichkeit, hier ein bisserl, da ein bisserl, bis eine eigene Wahrheit draus wird. Merk dir des für deinen Roman. Und gell, da musst jetzt nachert gar nicht so mit den Augen rollen. Erzähl halt lieber endlich, was in Frankreich passiert ist! Habt’s ihr euch getrennt?«
Statt zu antworten deutete ich auf ihren ayurvedischen Tümpeldrink. »Herzchakra, sagst du?« Und noch ehe sie etwas sagen konnte, tauschte ich mein frisches Moretti gegen den schleimigen Anāhata-Smoothie. »Ich glaub, so rum ist eh besser für uns beide! Auf ex! Hau weg!«
»Hört des denn nie auf mit dem ganzen Herzscheiß!«, seufzte die Poldi, und wir stießen an.
Der Smoothie war lauwarm und schmeckte in etwa so, wie ich mir den Mageninhalt einer Schildkröte vorstellte.
»Sag mal, ist da etwa Alkohol drin?«
»Ja, freilich! I hab ihn geschmacklich mit einem Schuss Grappa verfeinert. Alles vegan.«
»Hau weg!«, seufzte ich, trank den pürierten Schildkrötencocktail auf ex, schüttelte mich heftig und knallte das leere Glas stöhnend auf den Tisch.
Der »Schuss« Grappa stieg mir bereits in die Birne.
»Und nun will ich alles hören!«, rief ich. »Mit allen Details und Dings und Bums und lass nix aus. Ach, und ich will wissen, wie du dir deine Geburtstagsparty vorstellst.«
Denn – wer hätte es gedacht, nach allem, was passiert war – die Poldi würde in fünf Wochen ihren einundsechzigsten Geburtstag feiern.
Vor inzwischen nun fast einem Jahr, an ihrem sechzigsten Geburtstag, war meine Tante Poldi aus München nach Sizilien ins verschnarchte Torre Archirafi gezogen, um sich dort aus Schwermutsgründen gepflegt und mit Blick aufs Meer totzusaufen. Aber bislang war einiges dazwischengekommen. Konkret drei Mordfälle nämlich, die die Poldi, in dramatischen Outfits, selten ganz nüchtern, aber unter vollem Körpereinsatz aufgeklärt hatte. Plus ein gut aussehender Commissario (und – O-Ton Poldi – sexuelle Naturgewalt) mit pulsierender, nie ermüdender sicilianità, den die Poldi regelmäßig flachlegte, sowie ein paar neue Freunde. Zum Beispiel die traurige Signora Cocuzza aus der Bar an der Piazza. Oder Padre Pio, der kettenrauchende Priester von Torre Archirafi. Oder Valérie, die Besitzerin von Femminamorta, aber darauf möchte ich aus emotionalen Gründen an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Oder ihr seltsamer, käsig riechender imaginärer Freund mit dem Kapuzenpullover und dem Klemmbrett, von dessen Überraschungsbesuchen meine Tante Poldi gern erzählt, von dessen Existenz wir alle aber nicht restlos überzeugt sind.
Mit »wir« ist meine Familie aus Catania gemeint, vor allem meine Tanten Teresa, Caterina und Luisa und mein Onkel Martino. Die hatten ausgerechnet mich, den Neffen aus Deutschland mit dem abgebrochenen Studium und dem miserablen Italienisch, regelmäßig einfliegen lassen, um auf die Poldi aufzupassen und die Schnapsvorräte zu vernichten. Sisyphosaufgabe nix dagegen, kann ich nur sagen.
Mit einer kleinen Erbschaft und dem Rest ihres Ersparten hatte sich die Poldi das kleine Häuschen in der Via Baronessa gekauft, von dessen Dachterrasse aus man aufs Meer und auf den Ätna blicken konnte. Meistens sitze ich da alleine, denn die Poldi hat ja das schlimme Knie.
Ich bin gern allein, aber die Poldi braucht Menschen um sich herum. Die braucht den großen Auftritt, die braucht eine Bühne, auf der sie sich krachledern entfalten, streiten, flirten, granteln, fluchen, helfen, Pläne schmieden und im Leopardenlook flanieren kann. Und nach drei aufgeklärten Mordfällen hatte sie im beschaulichen Torre Archirafi mit seinem kleinen lungomare und der Mineralwasserquelle genau diese Bühne gefunden.
Kometengleich war sie zur lokalen Berühmtheit aufgestiegen. In der ganzen Gegend zwischen Catania und Taormina kannte man »Donna Poldina« inzwischen, was der Poldi bei aller natürlichen Bescheidenheit runterging wie Mandelöl und ihr möglicherweise ein wenig zu Kopf gestiegen war. Praktisch täglich klingelte jemand bei ihr, um sie um Rat zu bitten, um ein Autogramm oder ein Selfie, um den fremdgehenden Gatten zu überführen oder den, der Giftköder für die Hunde auslegte, um ein Fischerboot zu taufen, in einem Familienstreit zu vermitteln oder eine pubertierende Angelica zu finden, die mit irgendeinem pickeligen Enzo durchgebrannt war. Aber das waren natürlich alles kleine Fische für eine Spürnase vom Format meiner Tante Poldi. Die brauchte schon härtere Nüsse zum Knacken, denn sie war für die ganz großen Verbrechen geschaffen. Das wäre ja sonst, als würde man einen Hochleistungspräzisionslaser für Laubsägearbeiten verwenden. Nur, dass ein Hochleistungspräzisionslaser sich nicht gleich totsäuft, wenn man ihn zwischendurch ausstöpselt.
Meine Tanten befürchteten, dass zu viel Untätigkeit die Poldi früher oder später wieder in die Schwermut und den Suff treiben würde. Deswegen hatten sie Marco während meiner Abwesenheit auf die Poldi angesetzt. Daher die Idee mit der Detektei, dem Business-Plan, Logo, den T-Shirts, Kaffeetassen und allem. Alles nur, um die Poldi auf Trab und vom Alkohol fernzuhalten. Vielleicht hatten sie den Bogen dabei dann doch ein wenig überspannt. Denn Erfolg, Unternehmergeist und ein gesundes Selbstbewusstsein ziehen ja unvermeidlich Neider und Trolle an, die einem griesgrämig in die Suppe spucken, das Auto demolieren, tote Katzen vor die Haustür legen oder den Tod androhen müssen, nur so zum Spaß.
Denn der Neid, muss man leider sagen, gehört eben auch zu Sizilien wie der Ätna, die Zyklopen, die Cosa Nostra, pasta alla Norma, das Misstrauen, die Melancholie und der Fatalismus. Ganz gleich, ob du ein Unternehmen gründen, ein Haus bauen, eine Bar eröffnen oder dich zur Wahl stellen willst – sobald du dich aus der Deckung der allgemeinen Gleichgültigkeit wagst, schlägt der Neid zu, vermiest dir die Laune, prüft dein Durchhaltevermögen und stellt dir Fallen, bis du endlich scheiterst. Der sizilianische Neid ist ein Erbe jahrhundertelanger Besatzung, er hat die Sizilianer genauso durchweicht wie die omertà, das Gesetz des Schweigens. Er konserviert den Status quo und sorgt dafür, dass sich das herrschende Gefüge von Geld, Macht und Misere nicht verschiebt. Der Neid gehört wie das Bella-Figura-Prinzip einfach zum Leim der sizilianischen Gesellschaft dazu und dokumentiert meist nur, dass man – hoppala! – das nächste Level des sozialen Aufstiegs geschafft hat und da bitte schön jetzt auch bleiben möge.
Nachdem sie den Owenya-Fall auf so spektakuläre Weise aufgeklärt hatte und John nach Tansania zurückgekehrt war, war die Poldi mit Montana zunächst für eine Woche zum Knutschen und Fummeln in Rom abgetaucht. Danach war ich wiederum zu Valérie nach Frankreich geflogen und hatte nichts mehr von der Poldi gehört. Null. Niente. Zero.
»Und warum sagst des jetzt so indigniert?«, fragte mich die Poldi im Hof. »Bist schon wieder beleidigt?«
»Nö, alles gut.«
»Ah, daher weht der Wind. Mei, i hab halt gedacht, ihr seid da eh nur die ganze Zeit mit voulez-vous-coucher-avec-moi-ce-soir beschäftigt.«
Ich stöhnte. »Schon vergessen, Poldi? Ich dachte, wir wären jetzt ein Team.«
»Du hast dich ja auch nicht gemeldet.«
»Hallo? Ich hab dir jeden Tag drei Nachrichten geschickt!«
»Ach, geh! Du weißt doch, dass i meine Nachrichten eh nur ganz selten check. Wegen der negativen vibes von dem ganzen elektronischen Dreckszeug, weißt schon. Gell, wenn’st mir einen Brief g’schickt hättest, nachert hätt’ i dir schon geantwortet.«
»Ich hab dir einen Brief geschrieben.«
»Mei, einen richtigen Brief halt!«
»Er war sechs Seiten lang, handgeschrieben, Schönschrift, mit kleiner lustiger Skizze dabei. Was hat da gefehlt?«
»Himmelherrgott, i war halt auch sehr beschäftigt.«
»Mit Sitarspielen und Dings, oder was?«
Die Poldi schüttelte tadelnd den Kopf und trank seelenruhig ihr Bier.
»Mit einem neuen Mordfall freilich«, verkündete sie lässig. »Was hast denn du gedacht?«
Ich starrte sie an. »Dein Ernst jetzt?«
»Ja, glaubst du etwa, diese Graffiti kommen aus dem Nichts?« Sie beugte sich ein wenig vor und raunte: »I sag nur: Schwarze Madonna!« Nach einer kurzen dramatischen Pause fuhr sie fort: »Irgendwie bin i da wieder in ein Riesenschlamassel reing’schliddert. Also magst es jetzt nachert hören, oder magst lieber noch ein bisserl rummaulen und Mimimi und Pipapo?«
»Forza Poldi!«, seufzte ich und ging mir noch ein Bier holen.
Der Kühlschrank war voller kleiner Moretti-Flaschen, keine harten Sachen dabei. Da die Poldi offensichtlich gerade ayurvedisch ihre Chakren aktivierte, schloss ich, dass sie mich also erwartet hatte. Und aus der Menge des Vorrats schloss ich, dass sie vorhatte, mir alles haarklein zu erzählen. Und das zusammen elektrisierte mich und schmeichelte mir, gebe ich zu. Denn, muss man sagen, von Mord und Durst verstand meine Tante Poldi schließlich was.
Aber vielleicht alles schön der Reihe nach.
Nachdem John nach Tansania zurückgekehrt war, hatte Vito Montana, der vollbärtige Commissario ihres Herzens mit den zerknitterten Anzügen, der Zornesfalte zwischen den Augen, der dichten Macchia Brustbehaarung, dem kompakten Bäuchlein und der zyklopischen Virilität, die Poldi mit einem kleinen Trip nach Rom überrascht, wo er in den Achtzigerjahren bei der Anti-Mafia-Sondereinheit gearbeitet hatte und wo seine Tochter Marta Medizin studierte.
Für die Poldi klares Zeichen: Der Mann meinte es ernst. Und wie immer, wenn ein Mann es wirklich ernst meinte, sobald sie bekam, was sie eingefordert hatte, sobald sie der Familie vorgestellt werden sollte, wenn Urlaube und Weihnachten geplant, wenn überhaupt mittelfristige Pläne gemacht wurden, bekam sie kalte Füße. Nichts zu machen, da schlug die Ampel auf Rot um, da packte sie stets ein bisschen die Panik. Das war schon bei meinem Onkel Peppe so gewesen, immerhin Poldis ganz große Liebe. Gegen diesen Fluchtimpuls kam meine Tante Poldi einfach nicht an. Dennoch hatte mein Onkel Peppe es irgendwie geschafft, sie zu halten und sogar zu heiraten. Denn – um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen – die Poldi glaubte durchaus an die Liebe, an Treue und Verbindlichkeit. So flatterhaft sie sein konnte – und trotz ihrer kleinen Fixierung auf gut gebaute und uniformierte Verkehrspolizisten –, zog sie den sicheren Hafen der offenen See vor. Aber eben nur, solange sie jederzeit nach Gutdünken aus der Hafeneinfahrt segeln konnte. Denn meine Tante Poldi, stelle ich mir vor, war im Grunde ihres Herzens eine Piratin, und Piraten müssen eben gelegentlich auf Kaperfahrt gehen, um den Horizont zu spreizen und die Welt für uns alle ein Stückchen weiter zu machen. Ich kenne keinen Menschen, der das besser könnte als meine Tante Poldi.
Inzwischen, da ich sie etwas besser kenne, frage ich mich oft, wie mein Onkel Peppe und die Poldi es über so viele Jahre zusammen ausgehalten hatten, denn auch der Peppe war schließlich ein Wilder gewesen, ein Stenz, ein Lucki, ein Hallodri mit unstetem Lebenswandel, zu wenig Schlaf und zu viel Lebenshunger. Die Poldi weicht mir aber immer aus, wenn ich die Sprache darauf bringe, genauso wie in der Perückenfrage, und meinen Onkel Peppe kann ich nicht mehr fragen, der ist ja schon tot. Vielleicht, denke ich manchmal, war es wirklich die ganz große Liebe gewesen. Vielleicht auch der Sex. Oder vielleicht die gemeinsame Sauferei. Oder Schicksal. Oder mein Onkel Peppe hatte einfach verstanden, dass er der Poldi genug Luft lassen musste.
Und ob Montana das ebenfalls verstehen würde, musste sich noch erweisen.
»Nur unter einer Bedingung, tesoro«, sagte die Poldi daher sanft, als Montana mit dem Vorschlag ankam.
»Ich höre.«
»Dass du in Rom keinen Ring auspackst, mir keine Anträge machst oder sonst irgendwas in der Richtung, haben wir uns da verstanden?«
»Keine Sorge«, knurrte Montana, und das erleichterte die Poldi erstens, und zweitens wurmte es sie dann prompt doch ein bisschen.
Aber so ist sie. Denn vom Lebenshunger und von der Zerrissenheit des Herzens versteht sie schließlich auch was.
Der Haken an dem kleinen Rom-Trip war die Anreise. Denn Montana bestand darauf, sie beide persönlich mit dem einmotorigen Privatflugzeug eines Freundes zu fliegen, und vor nichts hat die Poldi so viel Angst wie vorm Fliegen. Aber da blieb Montana stur. Er brauchte ohnehin noch ein paar Stunden für die Verlängerung seiner Fluglizenz, und außerdem, glaube ich, wollte er ein Statement setzen.
»Kannst du dir abschminken, tesoro!«, erklärte die Poldi kategorisch. »Ich brauche keinen Urlaub und schon gar keine Lektion in Sachen Demut.«
»Darum geht es nicht«, erwiderte Montana ernst.
»Sondern?«
»Vertrauen.«
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nach allem, was wir durchgemacht haben?«
Montana zuckte nur mit den Schultern.
Die Poldi überzog ihn mit Verwünschungen auf Italienisch und Bairisch. Sie schickte ihn zum Teufel, sie blockierte ihn drei Tage auf ihrem Messenger, sie schmiss ihn aus dem Bett, sie schimpfte, wetterte und feilschte wie ein usbekischer Teppichhändler, sie zog sämtliche Register. Doch keine Chance.
Am Abend vor der geplanten Romreise klingelte es spät an Poldis Haustür. In der Annahme, dass es sich um den endlich zermürbten Montana handelte, nun bereit, die Reise bequem im Auto anzutreten, schwebte die Poldi zur Tür, bereit zu milder Vergebung und hemmungslosen Versöhnungssex, und öffnete huldvoll.
Doch statt eines zerknirschten Commissarios standen da zwei fremde Männer im Schein der Straßenlaterne. Ein junger Priester in einer Soutane und ein Polizist so Mitte vierzig in einer blauen Uniform mit Käppi, die die Poldi trotz ihrer Expertise in dieser Hinsicht nicht gleich zuordnen konnte. Der Priester wirkte blass und abgehetzt, auf seiner Stirn glänzte ein leichter Schweißfilm. Der bläuliche Bartschatten verstärkte noch den rundum eher ungesunden Eindruck. Er knetete unablässig seine stark behaarten Hände, als müsse er sich irgendwas abwischen. Staub vielleicht oder eben die Erbschuld, der Mann war schließlich Katholik. Jedenfalls sah er nicht gut aus, fand die Poldi. Der Polizist dagegen sah hammer aus, fand sie, genau ihre Kragenweite: kräftig, nicht zu groß, mit einem kantigen, glatt rasierten Film-Cop-Gesicht.
»Ein G’sicht wie eine neofaschistische Bronzeskulptur«, schwärmte sie mir vor. »Testosteron pur, sag i nur, da hab i gleich ein bisserl Schnappatmung gekriegt. Und natürlich hat der keine Miene verzogen. Weil g’lächelt wird höchstens nach Dienstschluss oder nach Dings, weißt schon.«
»Poldi, bitte!«, stöhnte ich.
Nun weiß ja selbst die Poldi, dass man fremde Männer, die des Nachts bei einem klingeln, nicht gleich ins Haus bittet, selbst wenn sie eine Polizeiuniform oder eine Soutane tragen. Das Verbrechen kennt schließlich viele Verkleidungen. Aber auf der anderen Seite war die Poldi seltsamen Besuch zu ungewöhnlichen Tageszeiten gewohnt. Außerdem hat die Poldi, was Menschenkenntnis und Intuition betrifft, ja einen Gang mehr als wir Normalos. Das Oberreitersche Superhirn erfasste in Sekundenbruchteilen die gesamte Erscheinung des blassen Priesters – den Schweißfilm, sein Blinzeln, die sich knetenden Finger –, scannte seine Gestalt auf versteckte Mordinstrumente ab, registrierte die hohe Qualität der Soutane und des exquisiten Schuhwerks und kam zu dem Schluss, dass es sich bei diesem jungen Mann tatsächlich um einen Geistlichen handelte.
»Und zwar einen«, erklärte mir die Poldi, »der sich die klerikale Dienstbekleidung bei Gammarelli in der Via di Santa Chiara in Rom schneidern lassen kann. Des ist die klerikale Edelboutique in Rom. Da kaufen nur Kardinäle und Päpste, merk dir des, falls du doch einmal umschulen musst.«
»Äh, woher weißt du denn so was?«
»Mei, weil i damals in meinem Job als Kostümbildnerin halt hin und wieder mit denen zu tun g’habt hab, darum. Jedenfalls sah mir dieses Bürscherl nicht so aus, als ob er einer alten Schachtel eins überziehen und den Tinnef stehlen wollte. Kam nur noch Killer infrage. Aber dafür war er halt nicht cool genug.«
Und das alles registrierte die Poldi, wie gesagt, in nur wenigen Augenblicken.
Bei dem Polizisten war sie sich ohnehin sicher, denn für Cops aller Couleur hat die Poldi einfach einen Riecher. Nur aus seiner Uniform wurde sie nicht gleich schlau. Im Geiste ging sie in Sekundenbruchteilen ihre fünf Fotoalben mit all den Polizisten durch, die sie in den vergangenen dreißig Jahren überall auf der Welt fotografiert und, na ja, gelegentlich auch gedingst hatte. Aber erst, als sie das Abzeichen auf dem linken Ärmel mit der dreifachen Krone und den gekreuzten Schlüsseln erkannte, fiel der Groschen.
»Jalecktsmiamarsch!«
»Signora Oberreiter?«, schnarrte der Polizist.
»Bitte entschuldigen Sie die späte Störung«, raunte der Priester. »Ich bin Padre Stefano. Das ist Commissario Morello von der vatikanischen Gendarmerie. Wir kommen gerade aus Rom.«
»Oha!«
»Dürfen wir reinkommen?«, knurrte der Commissario.
Da hatte die Poldi ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz, einen nicht ganz jugendfreien Impuls, denn bekanntlich ist der Kriminalkommissar ja die höchste Erscheinungsform des Menschen, vor allem sexuell. Aber sie hatte sich gerade noch im Griff.
»Um was, bitte, geht es denn?«
»Wir haben nur ein paar Fragen«, brummte der vatikanische Commissario.
Und wie immer, wenn ein Polizist in diesem Ton: »Wir haben nur ein paar Fragen«, zu ihr sagte, wusste die Poldi, dass sie wieder mal in Schwierigkeiten steckte.
2. Kapitel
Erzählt von Respekt, heißen Blicken, dem Hohelied, Improvisation und Pin-ups. Die Poldi zofft sich mit dem Neffen, wird verdächtigt und bietet einen schmutzigen Deal an. Sie macht aus einem Nein ein Ja, trinkt Tomatensaft und kauft einen Kalender. Dann muss sie zwei Typen abwimmeln, einen Friedhof besuchen und ein Museum durchqueren. So weit der Plan. Aber wie so viele Pläne endet auch dieser vor einer Tür, durch die man besser nicht geht.
Wie üblich an solchen Stellen, machte die Poldi hier eine kleine Pause und sah mich zufrieden an.
»I mach mir noch einen Wurzelchakra-Schmusi. Magst auch einen?«
Kenne ich ja schon. Das ist so unser kleiner battle, wer als Erster die Nerven verliert. Ich versuchte, sämtliche Neugier in mir in Frieden loszulassen. Ich war ein Zen-Meister der absoluten Leere.
»Nö, danke. Gönn dir, ich warte.«
»Bist gar nicht neugierig?«
»Hat keine Eile. In der Ruhe liegt die Kraft.«
Die Poldi sah mich prüfend an. »Früher warst ungeduldiger.«
»Früher war mehr Lametta«, sagte ich.
Die Poldi funkelte mich grantig an. »Vielleicht ist auch einfach des Feuer der Neugier in dir erloschen. Für immer erloschen.«
Ich hielt ihrem Blick stand. »Vielleicht brauchst du ja einfach eine Pause, um dir was auszudenken.«
»Zefix, denkst etwa, i spinn mir des alles nur zusammen?«
Ich zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Hast du vorhin doch selbst gesagt: Eine gute Story krümmt die …«
Weiter kam ich nicht. Die Poldi schnappte mich am Ohr und zog mich vom Stuhl hoch.
»Auuuaaa! Eh, das tut voll weh!«
»I bin fei immer noch deine Tante und damit quasi Respektsperson, hast mich?«
Sie zog mich am Ohr in die Küche.
»Glaubst etwa, i hätt’ die Morddrohungen da selbst an die Wände hing’schmiert, nur so aus Langeweile?«
»Hör mal, Poldi, ich …«
»Kein Wort!«, fuhr sie mich an. »Während du in Frankreich Amore g’macht hast, bin I da unschuldig in den Strudel einer Verschwörung reingezogen worden. Von wegen ausgedacht.«
Grantelnd, tadelnd und schurigelnd hackte sie Gemüse, knallte Sellerie, rote Bete, Spinat und Maulbeeren in den Mixer, tüchtig Kreuzkümmel dazu, heißes Wasser und großzügig Grappa drauf und ließ den Mixer röhren. Die braune Pampe roch nach Männerschweiß. Die Poldi füllte zwei Gläser und reichte mir eines.
»Lass mal«, ächzte ich. »Mir ist schon ein bisschen flau von dem Bier, ehrlich gesagt.«
»Du trinkst des jetzt, sonst erzähl i dir gar nix mehr.«
Meine Tante Poldi ist eine Meisterin der subtilen Überzeugung, und ich weiß immer, wann ich verloren habe, denn davon verstehe nun ich was. Stoisch, wie Sokrates den Schierlingsbecher leerte, so leerte auch ich das Glas auf ex, und wie schon vorhin fand der Grappa zielsicher den kürzesten Weg in meine Blutbahn.
»Warte kurz«, ächzte ich. »Ich muss nur rasch was von oben holen.«
»Was denn?«
»Siehsudann.«
Auf der Treppe musste ich mich kurz am Geländer festhalten. Irgendwas war mit meinen Beinen.
Ich war froh, als ich mich wenig später unten im Hof wieder in den Plastikstuhl fallen lassen konnte, und schlug das große schwarze Notizbuch auf, das ich mir in Paris gekauft hatte.
»Jalecktsmiamarsch!«, rief die Poldi. »Der Herr Autor macht sich Notizen.«
»Nur so«, murmelte ich. »Man wird ja auch nicht jünger.«
»Jetzt zeig schon her!« Sie schnappte mir das Notizbuch aus der Hand und sah es sich genau an. »Und da schreibst jetzt alles rein, was i dir erzähl?«
Sie klang ein bisschen gerührt.
»Stichworte«, sagte ich schulterzuckend. »Mehr so als Gedächtnisstütze.«
Sie nickte, strich noch einmal zärtlich über das Notizbuch und reichte es mir dann zurück.
»Und dann machst ein Buch draus? Über eine alte mannstolle Krampfscherben, die sich totsaufen will und nie dazu kommt? Über die Kriminalfälle einer oiden Schludern?«
»Poldi! Ich mach mir nur ein paar Notizen, okay? Entspann dich.«
Die Poldi zog ein zerknülltes Taschentuch aus ihrer Hosentasche und schnäuzte sich geräuschvoll. »I bin halt ein emotionaler Mensch«, näselte sie, trötete noch mal ins Taschentuch, schniefte und fuhr dann endlich fort.
»Ein bisschen konkreter geht’s aber vielleicht schon, oder?«, hakte sie tapfer nach, denn so leicht lässt sich meine Tante Poldi auch von einem kantigen Prachtexemplar von Commissario, das nachts vor ihrer Haustür steht, nicht ins Bockshorn jagen.
Commissario Morello zog ein Foto aus der Jackentasche und hielt es der Poldi hin. »Kennen Sie diese Frau?«
Das Foto zeigte eine etwa vierzigjährige Frau in einem billigen gemusterten Trainingsanzug. Die halblangen brünetten Haare hatten keine klare Frisur, die Frau sah aus, als habe man sie bei irgendwas ertappt.
»Ihr Name ist Rosaria Ferrari«, fuhr Morello fort.
»Und was ist mit ihr?«, fragte die Poldi ahnungsvoll.
»Sie ist verschwunden.«
Da war die Poldi dann doch ein bisschen enttäuscht.
»Also ist niemand ermordet worden?«
»Doch!«, platzte der Padre heraus. »Das heißt, wir wissen noch nicht, ob …«
»Padre!«, zischte Morello genervt.
»Entschuldigung.«
Die Poldi strahlte die beiden an. »Nennen Sie mich Poldi. Obwohl, das ist vielleicht doch zu privat. Nennen Sie mich – Donna Poldina.«
Sie bugsierte den Padre und den Commissario eilig ins Wohnzimmer und setzte in der Küche Kaffee auf. Als sie zurückkam, saß der Priester brav auf dem Sofa, die Hände im Schoss gefaltet, Commissario Morello dagegen tigerte im Wohnzimmer herum. Er hatte sein Käppi abgenommen und sah sich mit diesem Scannerblick um, den die Poldi von Kriminalbeamten gut kannte.
»Des ist so ein spezieller Blick, der mir immer durch und durch geht«, erklärte sie mir zwischendurch. »Also ob i überall mit großen, forschenden Händen abgetastet würde, innerlich und äußerlich, verstehst. Des macht mich immer ganz wuschig. Des darfst aufschreiben.«
»Poldi!«, stöhnte ich.
»Mei, sind wir heute wieder verklemmt. Jedenfalls sah er noch viel heißer aus, der Herr Gendarm, mit seinem kahl rasierten Schädel auf dem muskulösen Hals. Da hab i mir gleich vorstellen müssen, wie der Rest wohl noch ausschaut, also i mein, ganz ohne die Uniform. Aber natürlich hab i gleich g’schnallt, dass der mich verdächtigt, i bin ja nicht blöd.«
Die Poldi bewahrte daher die Fassung, setzte sich geduldig in einen Sessel und schenkte Kaffee ein.
»Setzen Sie sich doch, Commissario.«
Morello deutete auf die antiquarischen Musketen an der Wand, die die Poldi von ihrem Vater geerbt hatte.
»Sind die funktionstüchtig?«
Die Poldi hatte die Frage erwartet.
»Nein«, flötete sie unschuldig. »Also falls Sie sich verteidigen wollen, Commissario, müssten Sie schon Ihre Dienstwaffe bemühen oder mich niederringen.«
Denn von der Kunst, mit einem Kriminalkommissar zu flirten, verstand meine Tante Poldi was.
Morello verzog keine Miene und ging zum Sofa. Er räusperte sich kurz, weil der Padre in der Mitte saß.
»Entschuldigung«, murmelte Padre Stefano und machte hastig Platz.
»Es gab einen Vorfall«, begann Morello. »Vor zwei Tagen. Bei einem Exorzismus.«
Er hielt kurz inne und sah die Poldi an. Aber die Poldi, völlig cool und Ringelsocke, hielt seinem Blick stand. Sie hätten Wer-zuerst-blinzelt-hat-Verloren spielen können.
»Geben Sie mir ein bisschen Kontext, Commissario?«
Morello wandte sich an Padre Stefano.
»Natürlich, Entschuldigung«, murmelte der Padre, als er kapierte, dass er jetzt dran war. »Ich bin der Assistent von Monsignore Amato, dem Chefexorzisten des Vatikan.«
»Gratuliere.«
Der Priester ignorierte die Ironie.
»Monsignore Amato hat in seinem Leben über fünfzigtausend Exorzismen durchgeführt. Niemand kennt den Teufel besser als er.«
»Aber Sie sehen es mir trotzdem nach, wenn ich das jetzt ein bisschen putzig finde, nicht wahr?«
»Es gibt über eine Milliarde Dämonen auf der Welt«, fuhr der Padre lebhaft fort. »Der Satan ist überall.«
»Ich bitte Sie, Padre! Wenn Sie die Leute zu guten Psychiatern schicken würden, wäre ihnen sicher mehr geholfen.«
»Wenn Sie gesehen hätten, was Monsignore Amato gesehen hat, würden Sie nicht so reden, Signora Oberreiter.«
»Donna Poldina.«
»Entschuldigung. Der Monsignore hat schon gesehen, wie Menschen vor ihm in der Luft geschwebt sind oder Nägel gespuckt haben!« Er holte kurz Luft. »Außerdem schicken wir die meisten Leute ja zu Ärzten. Aber manchmal schicken die Ärzte sie dann eben zu uns, wenn sie nicht weiterkommen.«
Die Poldi seufzte. »Um was für einen Vorfall geht es denn nun?«
»Entschuldigung. Ich habe eine Aufnahme gemacht. Erlauben Sie, dass ich Sie Ihnen vorführe?«
»Na dann los«, seufzte die Poldi.
Padre Stefano fummelte umständlich ein großes Smartphone aus seiner Hosentasche, tippte mit seinen haarigen Händen auf das Display und reichte der Poldi das Handy.
»Einfach auf ›Play‹ tippen.«
Die Poldi nahm das Smartphone in beide Hände, beugte sich weit vor, um besser sehen zu können, und tippte erst ein bisschen ungeschickt herum.
»Moment, ich hab’s gleich!«
Und dann sah sie die Verwandlung von Rosaria auf der alten Massageliege. Sie sah, wie Rosaria sich aufbäumte und grunzte, sie sah, wie sie mit Weihwasser bespritzt wurde, und ganz am Ende dann hörte sie Rosaria auf Bairisch fluchen. Mit ihrer Stimme.
Das Video endete abrupt, als wäre es geschnitten worden. Die Poldi starrte noch einen Moment auf das Display, um sich zu sammeln und an etwas Schönes zu denken. Dann atmete sie tief durch und schob dem Padre das Handy über den Tisch zurück. Morello hatte sie anscheinend die ganze Zeit über fixiert.
»Ich weiß, es muss erschütternd für Sie sein, Donna Poldina«, wisperte der Padre. »Als Sie vorhin an der Tür auf Deutsch geflucht haben, habe ich mich ebenso erschrocken. Madonna, dieselbe Stimme!«
Die Poldi unterbrach ihn mit einer Handbewegung. »Was sagt sie da auf Latein?«
»›Nigra sum sed formosa‹«, wiederholte der Padre. »›Schwarz bin ich, aber schön.‹ Im hebräischen Original ist die Konjunktion allerdings einfach ›we‹, was sowohl …«
Morello sah den Padre missbilligend an.
»Entschuldigung«, murmelte der Padre.
»Aber sie ist doch gar nicht schwarz!«, rief die Poldi.
»Sie sprach sonst auch weder Latein noch Deutsch«, knurrte der Commissario.
»Hohelied eins, fünf«, erklärte Padre Stefano. »Das Lied der Königin von Saba. ›Schwarz bin ich, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, schwarz wie die Hütten Kedars, schön wie die Teppiche Salomons.‹« Er warf dem Commissario einen Blick zu. »Entschuldigung.«
»Soso«, sagte die Poldi, die das Hohelied wegen seiner Poesie und der erotischen Anspielungen immer gemocht hatte, nachdenklich. »Und wer soll da sterben?«
»Das wird nicht konkretisiert«, behauptete Morello.
»Aber das Video geht doch noch weiter. Was passiert denn anschließend? Hat sie sonst irgendwas gesagt?«
Morello und der Padre wechselten einen raschen Blick.
»Monsignore Amato hat die Sitzung unmittelbar nach diesem Ausbruch beendet«, erklärte der Padre. »Rosaria konnte sich danach an nichts erinnern.«
»Sie kennen diese Frau wirklich nicht?«, setzte der vatikanische Commissario jetzt wieder ein. »Nie gesehen?«
Die Poldi schüttelte den Kopf.
»Denken Sie nach.«
»Herrgott, Sie sehen doch, dass ich nachdenke! Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen!«
»Sie müssen aber schon zugeben, dass das ein bisschen unglaubwürdig ist, oder?«
»Gütiger Himmel, was soll daran unglaubwürdig sein?! Sie schneien hier mitten in der Nacht herein und zeigen mir ein Video, das ich noch nicht mal auf seine Echtheit überprüfen kann. Und dann stricken Sie nach Herzenslust Zusammenhänge und gar einen Verdacht. Ist das etwa glaubwürdig?«
»Niemand verdächtigt Sie, Signora Oberreiter«, flüsterte der Padre.
»Donna Poldina.«
»Entschuldigung.«
»Wer ist denn nun gestorben?«, wollte die Poldi wieder wissen.
Morello zeigte ihr das Foto einer jungen Nonne mit einem Engelsgesicht in einem weißen Habit.
»Das ist Suor Rita.«
»Von der Genossenschaft der Barmherzigen Schwestern von der allerseligsten Jungfrau und schmerzhaften Mutter Maria«, präzisierte Padre Stefano.
»Eine Clemensschwester«, erklärte Morello.
»Entschuldigung.«
Die Poldi sah sich das Foto genau an. Wie die junge Nonne die Lippen schürzte, fand sie zwar ein wenig ordinär, so, als ob Suor Rita für ein Spiegelselfie posen wollte, dennoch war ihre Schönheit selbst durch das Habit und die strenge Haube unübersehbar.
»Ich glaube, ich hab sie schon mal irgendwo gesehen.«
»In dem Video«, sagte Morello. »Suor Rita hat bei dem Exorzismus assistiert.«
»Und wie ist sie gestorben?«
»Sie ist vom Dach gestürzt«, wisperte der Padre schaudernd. »Genauer gesagt, von der Dachterrasse des Apostolischen Palastes. Vier Stockwerke sind das.«
Commissario Morello stöhnte genervt auf. Offenbar war die Informationsstrategie der beiden anders besprochen gewesen.
»Entschuldigung«, murmelte der Padre.
»Die Dachterrasse gehört zur päpstlichen Wohnung, dem appartamento«, präzisierte der Commissario. »Das allerdings immer noch leer steht, da der Heilige Vater es vorzieht, im …«
»Ich weiß«, winkte die Poldi ab. »Was heißt gestürzt? Einfach so? Oder … wurde nachgeholfen?«
»Es deutet alles auf Suizid hin«, sagte der Commissario.
»Unmittelbar nach dem Exorzismus?«
»Gute vier Stunden danach. Wir sind noch dabei, zu rekonstruieren, was in dieser Zeit passiert ist. Wir sind auch noch dabei, zu rekonstruieren, wie lange sich Rosaria überhaupt auf dem Staatsgebiet des Vatikan aufgehalten hat. Wen sie möglicherweise getroffen hat.
»Vor allem fragen Sie sich doch bestimmt, wie Suor Rita auf die Dachterrasse der päpstlichen Wohnung gelangt ist.«
Morello schüttelte den Kopf. »Das ist nicht mehr so schwer. Seit F1 im Gästehaus Santa Marta wohnt, wird die Terrasse gern von kurialen Beamten genutzt.«
»F1?«
Morello räusperte sich verlegen. »Papst Franziskus. Der Heilige Vater.«
»Entschuldigung«, sagte Padre Stefano.