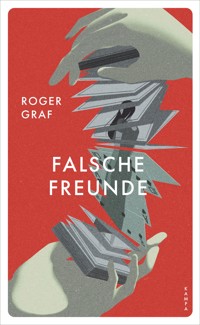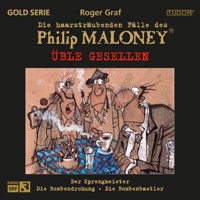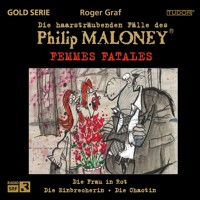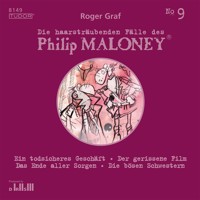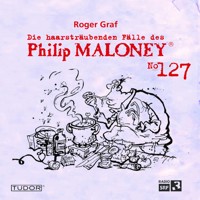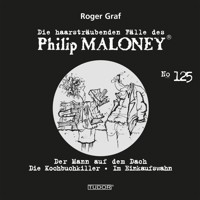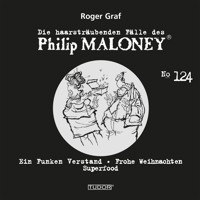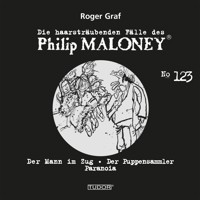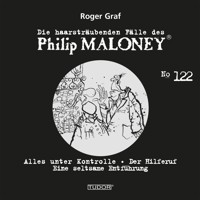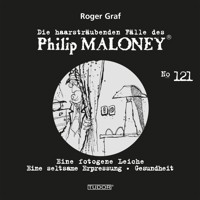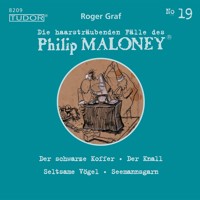16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sandra war drei Jahre alt, als ihre Mutter Helen von einem Tag auf den anderen spurlos verschwand. Zwanzig Jahre später – die Tochter ist nun so alt wie die Mutter damals, als sie ging – werden Sandra von einem Notar die Hinterlassenschaften ihrer Mutter übergeben: Notizhefte, Tagebücher und ein Brief. Sandra, die immer den Verdacht hatte, dass Helen sie nicht freiwillig im Stich gelassen hat, sieht in den Dokumenten Beweise für die Ermordung ihrer Mutter. Marco Biondi ist eigentlich Drehbuchautor fürs Fernsehen. Aber er ist auch sehr neugierig und bietet als Privatdetektiv Nachforschungen aller Art an. Sandra beauftragt ihn, der Sache nachzugehen, und nennt ihm einen Namen: Moritz Kobel. Wenige Tage später ist Kobel tot – und Sandra verschwunden. Eine Spur führt Biondi zurück in die siebziger Jahre, als an der Zürcher Riviera der Tanz um die harten Drogen begann. Doch die Gründe für Helens Verschwinden liegen ganz woanders …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Roger Graf
Tanz an der Limmat
Ein Fall für Marco Biondi
Kriminalroman
Atlantis
1
Der Kies knirschte unangenehm laut, als ich den Friedhof Manegg betrat. Es war ein viel zu heißer Tag im Spätsommer, die Sonne hing drohend über meinem Kopf und brannte sich in meinen Nacken. Schweißperlen bildeten sich unter meinem Hemd, flossen wie ein kleiner Bach. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass ich zu spät dran war, noch später als ich es gewollt hatte. Ich war nicht oft in Wollishofen unterwegs. Ging ich früher noch ab und zu an Konzerte in der Roten Fabrik, so beschränkten sich meine Besuche im Quartier seit einiger Zeit hauptsächlich auf jene Tage, an denen ich im Pflegeheim an der Paradiesstraße einen Mann besuchte, der leise vor sich hin sabbernd dem Tod entgegendämmerte. Dieser Mann war einst ein bekannter Fußballer gewesen, der es aber später im Leben zu nichts gebracht hatte. Ein Tyrann, der seinen Kindern das Leben zur Hölle machte, so sehr, dass sie sich von ihm abwandten, ihn alleine ließen, bis er eines Tages in seiner Wohnung gefunden wurde, unfähig, sich zu bewegen, im eigenen Kot liegend, halbseitig gelähmt nach einem Schlaganfall. Marianne, die Tochter, war eine Zeit lang meine Freundin gewesen. Sie war es, die mich dazu überredet hatte, ihren alten Vater, vor dem sie sich ekelte, ab und zu einen Besuch abzustatten. Da eine Kommunikation mit dem alten Mann nicht mehr möglich war, oder er sich weigerte, meine Versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen, zu beachten, waren die Besuche nicht unangenehm. Ich erzählte ihm die Resultate der aktuellen Fußballmeisterschaft, redete manchmal auch über Dinge, die er nicht verstanden hätte, selbst wenn er noch hätte verstehen können. Marianne war längst verheiratet, meine Besuche wurden unregelmäßiger, doch ich brachte es nicht übers Herz, ganz damit aufzuhören, auch wenn ich mir oft genug einredete, dass das nur sentimentaler Blödsinn war. Marianne hatte seit drei Jahren nicht mehr nach ihrem Vater gefragt.
Während ich ein wenig orientierungslos auf den Kieswegen des Friedhofs herumschlurfte, dachte ich daran, dass Mariannes Vater auch eines Tages an diesem Ort beerdigt sein würde, und dass dann vielleicht Besuche am Grab für Marianne wieder denkbar würden, da der Tod immer auch der Beginn des großen Vergessens ist, und Vergebung oft nur durch Vergessen möglich ist.
Ich ging an Gräberreihen vorbei, las zwischendurch Namen, die mir nichts bedeuteten und zuckte jedes Mal ein wenig zusammen, wenn einer der Grabsteine enthüllte, dass darunter das Skelett eines Menschen lag, der weniger alt geworden war als ich, der Betrachter, der schwitzend die oft gleichlautenden Inschriften las.
Meine Begeisterung für Friedhöfe hielt sich in Grenzen. Ich benötigte keine Grabsteine, um mich an Menschen zu erinnern, die ich mochte und die nicht mehr waren. Als Jugendlicher machte ich mir einen kleinen Sport daraus, stundenlang Gräber abzugehen und mir Geschichten auszudenken über die Toten, wie sie gelebt hatten, wie sie gestorben waren. Absurde Geschichten oft, aber auch traurige, entsetzlich romantische, wie sie nur Jugendliche und Greise träumen können. Die Nüchternheit zürcherischer Friedhöfe lädt allerdings kaum zum Träumen ein. Deshalb bevorzugte ich in meiner Jugend Spaziergänge auf südländischen Friedhöfen, auf denen die Grabsteine mit Fotos der Toten geschmückt waren.
Weiter vorne hörte ich Geräusche, ich atmete tief durch, zog mein Jackett zurecht und ging durch eine Reihe von Gräbern, die links neben dem Kiesweg lagen, weil ich mir erhoffte, von da aus einen besseren Überblick zu haben. Eine Parkbank war leer, ich setzte mich. Drei Grabreihen vor mir standen zwei ältere Frauen, beide mit dem Rücken zu mir. Anhand der leichten Zuckungen, welche den Körper der einen Frau unruhig wirken ließen, nahm ich an, dass sie weinte. Die andere Frau stützte ihr einen Arm, vermied es aber nach unten auf den Grabstein zu schauen. Sie reckte ihren Kopf nach oben, als wolle sie die Wetterlage erkunden.
Ich kramte in meiner Jackettasche nach der Todesanzeige, die keine war. Die Beerdigung wurde nur in der kleinen Spalte links außen angekündigt. Da es schon eine Weile her war, seit ich zuletzt einer Beerdigung beigewohnt hatte, rätselte ich darüber, wie lange die Prozedur dauern würde, die Begegnung mit dem Pfarrer und all den Trauernden wollte ich vermeiden, da ich selbst keine Trauer verspürte und nur Trauer das Ritual einer Beerdigung erträglich macht, denn wie jedes Ritual, neigen auch Beerdigungen dazu, für Außenstehende entsetzlich komisch zu sein.
Nachdem eine weitere Viertelstunde verstrichen war, stand ich auf und suchte nach dem Schild, auf dem die Richtung zu den Erdbestattungen angezeigt wurde. Ich näherte mich langsam den frisch aufgeschütteten Gräbern mit den schlichten, provisorischen Holzkreuzen und stellte mir die Steinmetze vor, die gerade dabei waren, Namen und Jahreszahlen in den Stein zu hämmern. Weiter vorne sah ich ein älteres Paar, einen Pfarrer und einen Sarg, der neben dem Erdloch aufgebahrt war. Als ich mich näherte, schauten mich sechs Augen erwartungsvoll an. Es war zu spät, um umzukehren, der Pfarrer lächelte, als ich mich neben das Paar stellte, die Frau beäugte mich misstrauisch, der Mann gähnte.
»Fangen Sie endlich an!« Die Stimme der Frau war viel zu hoch, sie piepste beinahe wie ein Singvogel. Der Mann neben ihr erschrak ob der Heftigkeit der Worte, während der Pfarrer betreten dreinschaute und nach einer kurzen Atempause seinen Text aufsagte. Er wusste offenbar nicht viel über den Toten, begnügte sich mit Allgemeinplätzen und versuchte krampfhaft, würdevoll zu wirken, was absurd war angesichts der Hitze und der Lächerlichkeit der Situation, wenn er beispielsweise von der Trauergemeinde sprach und gleichzeitig der alte Mann laut in sein Taschentuch schnäuzte, und selbst ich befürchtete, meine Atemzüge könnten unangenehm auffallen.
»Reden Sie nicht so viel, sorgen Sie dafür, dass er begraben wird und seine Ruhe hat.« Sie trat einen Schritt vor, was der Pfarrer wohl als Bedrohung empfand. Er winkte die Friedhofangestellten herbei, die sich sogleich daran machten, den Sarg in das Erdloch abzuseilen.
»Haben Sie ihn gut gekannt?« Sie sprach leiser, doch noch immer piepste ihre Stimme, ein unangenehmer Klang, den ich nicht sehr lange ertragen hätte. Ich überlegte mir, ob eine Stimme ein plausibler Scheidungsgrund sein könnte, der Mann neben ihr schien sich allerdings daran gewöhnt zu haben, er zuckte nur zusammen, wenn die Worte der Frau Befehlscharakter hatten.
Ich sagte ihr, dass ich den Toten nicht gekannt hätte, was auch der Wahrheit entsprach.
»Sehr gut. Freunde hatte er nämlich genug. Falsche Freunde. Sie sehen ja, wo sie geblieben sind. Jetzt hat er nur noch mich.« Ich wunderte mich darüber, dass die Frau nicht wissen wollte, weshalb ich der Beerdigung beiwohnte, doch sie war so erregt, dass sie mich kaum zu beachten schien.
Sie zeigte auf den Mann neben ihr. »Das ist Eugen. Wir sind zusammen im Heim. Ich habe ihm gesagt, dass er mitkommen soll, ich wollte nicht allein auf dem Friedhof herumstehen. Moritz war ein armer Kerl, aber er war auch selbst schuld. Mich hat er auch nicht mehr besucht, hat nur noch gesoffen und gejammert.«
Ich nickte. Eugen war das alles sichtlich peinlich, er schaute abwechselnd auf seine viel zu große Armbanduhr und auf den Horizont, der noch immer wolkenfrei war. Er schwitzte stärker als ich, nur die alte Frau schien nicht zu schwitzen, obwohl sie dickere Kleider trug, als ich im Januar zu tragen pflege.
»Dass es so enden musste. Dabei hatte er alle Möglichkeiten. Mein Mann und ich haben gerackert für ihn. Mein Mann starb während der Arbeit, zwei Jahre vor der Pension, der hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen, das war ein guter Mann.«
Als sie dies sagte, zuckte Eugen zusammen, berührte ihren Arm, versuchte ihren Ellbogen festzuhalten, doch die Frau machte einen Schritt in meine Richtung, beachtete den Pfarrer nicht mehr, ein sehr junger Pfarrer, wie mir erst jetzt auffiel, der hilflos herumstand.
»Da hat man einen Buben großgezogen, bärenstark war er, ich habe dafür gesorgt, dass er jeden Tag Fleisch auf dem Teller hatte als Kind, das ist wichtig, Fleisch und Fisch, und jetzt? Ist er vor mir tot und war doch noch so jung. Er hätte doch noch Chancen gehabt im Leben.«
Sie drehte sich zu Eugen um, dieser nickte, wagte aber noch immer nicht, etwas zu sagen. Vermutlich dachte er an das wohlige Prickeln eines kalten Biers auf der Zunge, etwas, dem auch ich nicht hätte widerstehen können. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie der junge Pfarrer wegging, kopfschüttelnd, während das Grab zugeschaufelt wurde. Die Mutter des Toten blieb neben dem Grab stehen, schaute aber in eine andere Richtung. Ich drehte mich in ihre Blickrichtung und sah, wie ein Mann, auffällig gekleidet, viel zu elegant, viel zu hell, mit einer modischen Sonnenbrille auf der Nase, sich abwandte und durch das Labyrinth der Kieswege umständlich davoneilte. Die Mutter des Toten tat etwas, was Eugens Augen vor Entsetzen weit öffnete und wohl dem jungen Pfarrer eine Glaubenskrise beschert hätte, wäre er Augenzeuge der Tat geworden. Sie spuckte auf eines der noch frischen Gräber und zeigte mit gestrecktem Zeigefinger in die Richtung, in die der Mann mit der Sonnenbrille verschwunden war.
»Das war sicher einer der falschen Freunde. Genau so sehen sie aus. Elegant angezogen und darunter ein Haufen Scheißdreck.«
»Luisa, das ist die Beerdigung deines Sohnes«, stammelte Eugen. Sie wischte den Satz mit einer energischen Handbewegung weg.
»Der Moritz hat es nicht verdient, dass wir uns hier wie Idioten benehmen. Er hatte immer eine Vorliebe für das Deftige, weshalb also soll ich mich zurückhalten? Was haben Sie hier überhaupt verloren, junger Mann?«
Ich hatte gewusst, dass die Frage noch kommen würde, und ich wusste, dass meine Antwort keine gute Antwort war.
»Mich interessiert, wer ihr Sohn war.«
»Das ist typisch. Als er lebte, interessierte sich niemand für ihn. Und jetzt? Ich habe all die Artikel in den Zeitungen gelesen, sogar im Fernsehen haben sie es gezeigt, all diese Leute, die den Moritz nicht gekannt haben und jetzt so tun, als wüssten sie alles über ihn. Lassen Sie den Moritz in Ruhe. Wenn es so kommen musste, hat das schon seine Richtigkeit.«
Eugen nickte eifrig, doch die Mutter des Toten kümmerte sich nicht um sein Einverständnis. Sie zeigte in Richtung Ausgang.
»Lass uns gehen, ich habe Hunger. Das Leichenmahl gehört schließlich dazu. Möchten Sie mitkommen?«
Ich schüttelte überrascht den Kopf, ich hatte keinen Hunger.
»Auch gut. Schreiben Sie etwas Gutes über meinen Sohn?«
Ich schüttelte erneut den Kopf. »Ich werde nicht über ihn schreiben. Mich interessiert sein Schicksal.«
»Haben Sie nichts Gescheiteres zu tun?«
Ihr Piepsen ging in ein lautes Kreischen über, so laut, dass sich Eugen einen Moment lang abwandte, er drehte den Kopf, vielleicht war er auf einem Ohr taub und bemühte sich, dieses Ohr dem Kreischen zuzuwenden.
»Kann ich Sie im Altersheim besuchen?«
Meine Frage malte tiefe Falten um ihren Mund, sie grinste und zeigte ein gut gefertigtes Gebiss.
»Warum nicht? Hat viel zu wenig junge Männer im Heim.« Eugen räusperte sich, legte einen Arm um die Schulter der Frau, so wie ich das auch bei jungen Paaren beobachtete, wenn sich der Mann der Liebe der Frau nicht sicher war. Die Frau nannte mir ein städtisches Altersheim und zog danach ihren Eugen weg. Er schlurfte träge neben ihr her, in schwarzen Lackschuhen, die an frühere Zeiten erinnerten, als er vielleicht ein eleganter Tänzer gewesen war.
Ich wartete eine Weile und ging schließlich zurück zu dem frischen Grab. Keine Blumen. Gleich dahinter war ein Grab kaum zu sehen inmitten all der Kränze und Gebinde. Ich wunderte mich ein wenig darüber, dass keine Journalisten zu sehen waren, keine Neugierigen, ertappte mich sogleich dabei, mich selbst als Gaffer zu fühlen, an einer Beerdigung, die mich nichts anging. Moritz Kobel stand auf dem Kreuz, ob je ein Grabstein das Holz ersetzen würde? Dieser Kobel hatte sich keine Freunde gemacht, selbst sein altes Mütterchen hatte er enttäuscht. Ich dachte an Marianne und ihren Vater, an die Trostlosigkeit einer Beerdigung, bei der kaum jemand Abschied nehmen möchte, weil sich zuvor alle längst verabschiedet hatten. Die Sonne tat ihr übriges, wie ein heiteres Signal strahlte sie auf den Friedhof. Regen, dachte ich, passt besser zu einer Beerdigung. Ich blieb noch einen Moment stehen, dachte an den Mann, der unten im Sarg lag und fragte mich, ob sie ihn präpariert hatten, ob man die Wunde zugenäht hatte, bevor man ihn einsargte. Moritz Kobel war in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Nackt auf dem Bett liegend, in seinem eigenen Blut. Jemand hatte ihm die Kehle durchgeschnitten.
2
Die Tage verbrachte ich mit Lesen und Faulenzen, abends telefonierte ich mit Melanie, die sich in Innsbruck aufhielt, dort mit einer Autorin an der Illustration eines Kinderbuches arbeitete. Es waren seltsam bemühte Gespräche, wir waren es nicht gewohnt, uns unsere Nähe mit Worten zu erläutern, das Schweigen gehörte zu unserem Zusammensein. Ihr fiel es hörbar schwer, Worte zu finden für das, was in ihr vorging, sie behalf sich damit, mir ihren Tagesablauf zu schildern, es hörte sich an wie ein Tagebuch. Ich wurde informiert über das Wetter in Innsbruck, über einen Ausflug nach Salzburg, eine Stadt, die sie als »putzig« bezeichnete und in der sie sich gewundert hatte, dass nirgendwo Mozart erklang, obwohl die ganze Stadt wie ein Mozartmuseum wirkte. Sie schilderte mir eine Fahrt mit der Stubaitalbahn, einer Straßenbahn, die durch die Berge kurvte, an weidenden Kühen vorbei, wie eine Fahrt durch Heidiland. Melanie gefiel es in Innsbruck, sie mochte die Berge, sie mochte aber auch die Weite, die etwas Ungewohntes ist für uns Schweizer. Sie fragte nach meinen Erlebnissen, und ich erzählte von Büchern, die ich las, und aus Verlegenheit beschrieb ich ihr das Wetter in Zürich, die ungewöhnliche Hitze eines ungewöhnlich trockenen Herbstes, der eigentlich noch kein Herbst war, wenn man nach dem Kalender ging. Melanie wirkte gelassen, die Arbeit machte ihr Spaß, sie freute sich auf die Rückkehr, sagte aber, dass sie nicht genau wisse, wie lange sie noch bleibe. Mein Angebot, sie in Innsbruck zu besuchen, hing seit Tagen in der Telefonleitung, ich wartete auf ein Zeichen, eine Einladung, doch Melanie erwähnte nie eine Sehnsucht, der nur mit der Bahn beizukommen war. Die Sehnsucht, die sie beschrieb, war eine aufschiebbare, eine, die auf Zürich ausgerichtet war, nicht auf den Moment unserer Gespräche. Ich wusste natürlich, dass sie Mühe damit hatte, konzentriert zu arbeiten, wenn ich in ihrer Nähe war. Stunden konnte sie zeichnen in Innsbruck, während sie in Zürich, von einer ständigen Unruhe geplagt, zwischen ihrem Atelier und meiner Wohnung hin und her pendelte, oft mehrmals täglich, kaum fähig, eine Stunde auszuharren, sei es bei mir oder an ihrem Arbeitsplatz. Ich stellte verblüfft und ein wenig beunruhigt fest, dass bei mir genau das Gegenteil zu beobachten war. Arbeitete ich in den Wochen, in denen Melanie in meiner Nähe war, sehr produktiv und ohne mich überwinden zu müssen, so klebte ich dann, wenn sie weg war, in einer süßen Lethargie, von der ich wusste, dass sie trügerisch war, dass sie jederzeit in ein bedrückendes Tief münden konnte, vor dem ich mich fürchtete. Deshalb kam mir der Tod von Moritz Kobel nicht ungelegen.
In den Zeitungen wurde der Mord reißerisch mehrere Tage lang auf den Frontseiten abgehandelt. Ich ärgerte mich über den Bericht im Lokalfernsehen, über den jungen Reporter, der mit bitterer Miene vor dem Haus stand, auf den Balkon im zweiten Stockwerk zeigte und von einem äußerst brutalen Mord faselte. Die lächerlichen Bezeichnungen für verschiedene Mordarten zeigen nur auf, wie gedankenlos Journalisten ihre Berichte zusammenschreiben. Als äußerst brutal werden beispielsweise Morde beschrieben, bei denen jemand erschossen und die Leiche danach zerstückelt wird. Genauso könnte man die Urnenbestattung als äußerst brutal bezeichnen, obwohl beides letztlich nur dazu dient, einen toten Körper zu entsorgen. Kobel wurde die Kehle durchgeschnitten, doch war das brutaler, als beispielsweise ein Mord, bei dem einer alten Frau ein Kopfkissen aufs Gesicht gedrückt wurde? Sicherlich spektakulärer, und genau das war wohl auch damit gemeint, wenn der Jungreporter vom brutalen Mord redete, aber wer ist schon ehrlich genug, einen Mord als spektakulär zu bezeichnen, obwohl dies das einzige Kriterium für Sendezeit und Beitragslänge ist? Die Medien hatten sich längst eine Meinung zu dem Mord gemacht. Kobel hatte nicht allein in der Wohnung gelebt. Ein junger Untermieter galt seit der Tat als vermisst. Ein deutlicher Hinweis. Zudem war der Untermieter in Geldnöten und Kobels Schlafzimmerschrank durchwühlt, genauso wie ein alter Reisekoffer, der unter Kobels Bett gelegen hatte.
Die wenigen Fakten, die ich der Zeitung entnahm, zeichneten das Bild einer gescheiterten Existenz. Kobel war arbeitslos und mehrfach wegen Betrugs vorbestraft gewesen. Ein Hochstapler, einer, der gern über seine Verhältnisse lebte, ein Angeber, der mit Prahlereien Freunde gewinnen wollte und doch nur einsamer wurde in der Welt seiner Lügen. Ich erzählte Melanie nichts über Kobel, über mein Interesse an ihm, ich wusste selbst nicht, ob ich nicht schnell wieder in die Lethargie verfallen, mir noch ein paar Bücher kaufen und auf meinem kleinen Balkon durch die Geschichten anderer Menschen spazieren würde. Melanie lachte, als ich ihr schilderte, wie sich einer meiner Nachbarn einen Finger gebrochen hatte, als er ein Fenster putzte und die Zugluft das Fenster zuknallen ließ, als er sich gerade am Rahmen festhielt. Ich sah, wie er seine Hand schüttelte, wie er ungläubig auf den seltsam verkrümmten Finger starrte.
»Das hätte ich gerne gezeichnet«, sagte sie. Melanie hatte eine Vorliebe für krumme Gliedmaßen, Buckel, schlecht verheilte Knochenbrüche und anatomische Absonderheiten. An ihrem eigenen Körper vermisste sie solche Absonderheiten, natürliche, nicht durch Unfälle und Krankheiten hervorgerufene. Ihr Körperbau entsprach eher dem Idealbild, das für die Werbeblöcke modelliert wird, gerade deshalb jammerte sie mir oft vor, sie finde ihren Körper langweilig. Sie fragte mich nach einem Drehbuch, an dem ich seit einigen Wochen arbeitete, ohne Auftrag, nur so zum Spaß.
»Ich habe es weggelegt«, sagte ich.
»Das ist schade.«
»Es ist nicht gut.«
»Das sagst du immer.«
Natürlich hatte sie recht damit. Ich erzählte ihr von einer anderen Geschichte, die mir im Kopf herumschwebte, leicht, noch viel zu leicht, um sie auf Papier einfangen zu können.
»Schön. Schreib die Geschichte. Ich zeichne den Umschlag, und dann lassen wir es drucken.«
»Warum nicht? Weihnachten ist nicht mehr weit. So hätten wir schon ein nettes Geschenk.«
»Gehst du nachher noch essen?«
»Ja, ich bin mit Fabienne verabredet.«
»Pass auf, dass sie dich nicht verhaftet. Ich freue mich auf dich. Ich ruf dich an.«
Wir alberten noch ein wenig herum, doch irgendwann trennten sich unsere Stimmen, und für einen Moment fühlte ich mich elend in meiner Wohnung, verlassen, so wie ich mich oft fühlte, manchmal mitten unter Menschen, manchmal mitten in der Nacht, grundlos oft. Ich trank einen Kaffee, duschte und setzte mich an den Computer. Die Figuren begannen sich zu bewegen, formten Sätze, ich brauchte alles nur einzufangen, doch schon nach einer Seite schlichen sich Zweifel zwischen die Figuren, wozu, fragte ich mich, und schrieb trotzdem weiter.
3
Wir saßen am Wasser und tranken Wein aus einer Flasche. Ein langhaariger Mann drehte einen Joint, um ihn herum saßen zwei Frauen, nicht um ihn zu decken, sein Tun zu verstecken, sie sorgten sich nur um den starken Wind, der jetzt über die Limmat wehte und die feinen Haschkrumen wegwehen könnte. In einer Ecke saß ein bleicher junger Mann, dünn und in viel zu engen Kleidern, die seine Magerkeit noch betonten. Er las Stiller von Max Frisch, trank dazu eine Cola und rauchte filterlose Zigaretten. Laura hustete und spuckte grünen Schleim in den Fluss. Um ihre Arme trug sie breite Reifen, Indianerschmuck, dazu knallrote Hosen mit gelben Spickeln und eine schwarze Bluse. Darunter trug sie nichts, keinen BH, keinen Slip. Wir hatten eine Stunde zuvor noch gevögelt auf ihrer schmutzigen Matratze in der Mansardenwohnung an der Josefstraße. Laura ertrug keine Stille, immer lief das Radio, hörte sie Musik, manchmal auch Kassetten, die sie unzählige Male schon zusammengeflickt hatte mit Klebestreifen, Kassetten, die mit Pink Floyd, Procol Harum und »In a gadda da vida« bespielt waren. Immer wieder dieses Lied. Noch Jahre später werde ich mich daran erinnern, wenn ich mit anderen Frauen zusammen bin, auf schöneren Betten, in ruhigeren Wohnungen. Immer wenn ich in Laura eindrang, lief »In a gadda da vida«. Das Lied, das ich eigentlich nicht besonders mochte, bei dem aber Laura ganz anschmiegsam wurde und mit verträumten Augen seltsame Dinge flüsterte in einer Sprache, die ich nicht verstand, die es nicht gab, ein Vokabular der Lust und der Liebe, das sie mit niemandem teilte und das trotzdem jeder verstand, der mit ihr zusammen war. Laura verkehrte mit richtigen Hippies, seltsamen Gestalten, deren Rituale ich nicht kannte, die sich nie grüßten, dann aber lagen sie sich plötzlich in den Armen, durcheinander, meist aber saßen sie nur auf dem Boden einer Wohngemeinschaft und pafften und hörten Musik. Laura traf sich mit den Hippies einmal in der Woche, es kam mir mit der Zeit vor wie ein regelmäßiger Arztbesuch. Tatsächlich sprach sie oft von der Medizin, die sie brauche. Erst viel später, als es schon zu spät war, erfuhr ich, was für eine Medizin Laura meinte. Heroin, so sagte sie, ist wie ein guter Song, nur viel stärker, viel ehrlicher. Wir waren alle gierig nach guten Songs, suchten nach einem Leben, das die Kraft eines packenden Refrains hatte, lauschten den Geschichten anderer, die erzählten, wie sie durch Afghanistan trampten, oder durch Südamerika, die Landkarte war eingeteilt in guten Stoff, in Gras und Shit, und wer etwas auf sich hielt, besaß eine Wasserpfeife, trank ekelhaften Tee, der angeblich das Gehirn explodieren ließ, und doch nur Übelkeit verursachte. Und unten am Fluss, an der Riviera, lauschten wir den Gitarristen, den Trommlern, und die Musik und der Qualm mischten sich zu einem kleinen Paradies, ein Paradies der Geschichtenerzähler, der Aussteiger und Abgestürzten. Wer seinen Job hingeschmissen hatte, wurde als Held gefeiert, wer davon sprach, seinen Job hinschmeißen zu wollen, wurde bewundert, und wer nur davon träumte, eines Tages alles hinzuschmeißen, wurde in seinen Träumen bekräftigt. Andächtige Stille herrschte, als ein Deutscher davon erzählte, dass er die Meinhof persönlich gekannt und er selbst Kontakte zum Untergrund hatte. Jeder am Fluss hatte entweder eine Bombe oder eine Spritze in der Hand, unsichtbar noch, so viel Frieden war nur möglich unter Kriegern und Selbstmördern. Laura sah stundenlang auf das Wasser, drehte an ihrem Kofferradio, setzte sich den kleinen Hörer ins Ohr und wiegte ihren Kopf im Rhythmus der neuesten Scheiben. An einem Nachmittag, mitten im heißesten Sommer seit Langem, saß ich neben Laura und sagte mir, dass das alles nur ein Traum sei, nichts anderes sein konnte als ein Traum. Und es war gut so.
Neben uns setzte sich eine Gruppe von Leuten, die älter waren als wir. Laura, keine sechzehn, reagierte nicht, während ich eingeschüchtert auf die bärtigen Männer und die hagere Frau schaute. Einer der Männer trug ein buntes Halstuch und einen Patronengürtel, ein anderer einen schwarzen Anzug und darunter ein Batikshirt und bunte Schuhe mit hohen, dicken Absätzen. Die Frau lächelte, als sie sah, dass ich sie beobachtete. Eine schöne Frau, erwachsen, breite Ketten um den Hals und Augen wie eine Reise in ein fremdes Land. Blaue Augen. Einer der Männer stellte einen schmalen Kassettenrekorder auf, spulte mehrmals vor und zurück, bis er die passende Stelle gefunden hatte. Die Frau sah jetzt zu ihm. Ich wusste sofort, dass sie verliebt war in den Mann. Eifersucht kam in mir hoch, Laura war jetzt weit weg, an einem anderen Fluss, in einer anderen Zeit. Das Lied spülte sanft wie eine kleine Welle über die Treppe am Fluss. Laura sah zuerst missmutig auf, ärgerte sich darüber, dass jemand sich einmischte in ihre eigenen Träume, ihre eigene Musik. Doch dann schaltete Laura ihr Radio aus, schloss ihre Augen und lehnte sich mit dem Rücken an meine Beine. Die schöne Frau bewegte sanft ihren Körper, wechselte die Position, schmiegte sich an den Körper des Mannes, dessen lange dunkle Haare bis über die Schultern reichten. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Der Magere klappte sein Buch zu, stand auf und ging. Schräg hinter mir fragte eine Frau: »Kennst du das?« Und ein Mann antwortete: »Ja, aber ich weiß nicht, von wem es ist.« Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Lauras Kopf war jetzt weit nach hinten gebogen, ihr Gesicht entspannt, ein zartes Lächeln tanzte über ihre Wangen bis zum Mund. Ein Zauber lag über der Limmat, lag über der ganzen Stadt. Linger on, you pale blue eyes. Neben mir hörte ich, wie die schöne Frau mitsang, ganz leise, wie ein Chor im Hintergrund. Linger on, you pale blue eyes. Es war ihr Song, er gehörte ihr und dem Mann, der sie liebte.
4
Fabienne saß an einem der hinteren Tische, die nicht von der Straße aus einsehbar waren. Das Restaurant lag in der Nähe der Urania-Sternwarte, einer Sehenswürdigkeit der Stadt, die zu den ewigen Versuchungen gehörte, deren Besuch ich unzählige Male in Erwägung gezogen hatte, doch ich war noch nie oben gewesen. Das Restaurant war gut gefüllt, viele schicke Leute an schicken Tischen, einige davon ausgestellt zur Straße hin, sodass jeder Passant einen Blick durch die große Glasscheibe auf die Teller werfen konnte, eine seit einiger Zeit grassierende Unsitte modischer Esslokale, eine obszöne Peepshow, die mir jeden Appetit nahm, wenn ich selbst an einem dieser Ausstellungstische saß. Fabienne bestellte uns zwei Cüpli, sie trug ein blaues Kleid, ich machte ihr Komplimente, obwohl sie mir in ihrer Alltagskluft aus Jeans und Lederjacke besser gefiel. Wir tranken und unterhielten uns locker über ihre Tochter, ihren Freund, der ebenfalls bei der Polizei arbeitete, über Melanie, die sie nur einmal getroffen hatte, bei einem Nachtessen bei mir zu Hause, mit der sie sich aber auf Anhieb gut verstanden hatte, was bei Melanie nicht üblich war, wirkte sie doch auf viele Menschen unnahbar, unheimlich sogar. Erst als wir auf das Dessert warteten und Fabienne gierig an einer Zigarette sog, fragte ich sie beiläufig nach Kobel. Sie lächelte.
»Erstaunlich, dass du damit so lange gewartet hast.«
»Ich wollte dir nicht den Appetit verderben.«
»Kein Problem. Ich besitze die Fähigkeit, selbst die blutigsten Leichen als etwas Abstraktes anzusehen, wie ein Kunstwerk. Das hilft. Natürlich nicht am Tatort, aber später, wenn ich mir die Fotos anschaue.«
»Du warst am Tatort?«
»Nein. Aber ich habe die Fotos gesehen.«
»War er völlig nackt?«
»Ja. Er lag auf dem Rücken. Vielleicht hat er geschlafen, als es geschehen ist.«
»Wer leitet die Ermittlungen?«
»Bezirksanwalt Mühlhaupt. Wieso interessierst du dich für den Fall?«
Ich zuckte die Schultern, es fiel mir nicht leicht, locker zu wirken. Die Hitze im Lokal tat ein Übriges. Ich schwitzte, schaute an Fabienne vorbei auf einen Spiegel, in dem ich eine rothaarige Frau sah, die ständig ihre Haare hinter ihre Ohren strich und dabei ihre Lippen hastig bewegte.
»Dieser Kobel interessiert mich. Ein armes Schwein, das erst durch seine Ermordung interessant wird.«
»Möchtest du über ihn schreiben?«
»Vielleicht. Ich weiß es noch nicht.«
»Einige Informationen darf ich dir nicht geben, das weißt du.«
Ich nickte. Fabienne wusste zwar, dass ich kein Journalist war, auch nie etwas für Zeitungen schrieb, und trotzdem behandelte sie mich oft wie einen Journalisten, was mich ärgerte.
»Und wenn ich den Verdächtigen Nummer eins finde?«
»Du verheimlichst mir etwas, Marco.«
»Nein. Aber so wie es aussieht, kriegt ihr ihn nicht, vielleicht kann ich euch behilflich sein.«
»Du weißt, was ich davon halte. Es stimmt zwar, dass wir den Tatverdächtigen noch suchen, aber die Erfahrung zeigt, dass er früher oder später wieder auftauchen wird, irgendwo.«
»Und die Polizei ist immer und überall.«
»Du sagst es.«
»Gibt es keine Hinweise auf einen möglichen anderen Täter?«
»Soviel ich weiß, hat man Kobels Bekanntenkreis abgegrast, was nicht einfach ist bei einem Mann wie ihm. Einsamer Kerl, ein Betrüger, der jeden hereinlegte, früher oder später. Typen wie er sozialisieren sich nicht.«
»Klingt gut. Eine Polizistin, die von Sozialisierung redet.« Der Kellner erschien und servierte den Nachtisch. Ich bestellte einen Espresso.
»Heimlich hältst du mich noch immer für beschränkt, mich und alle meine Kollegen, oder?«
»Lass mir doch ein kleines Feindbild, Fabienne, sonst wird mein Leben noch differenzierter und komplizierter.«
»Vielleicht wirst du sowieso bald auf meine Informationen verzichten müssen.«
»Möchtest du etwa heiraten? Noch ein Kind kriegen?«
»Nein. Aber ich schaue mich intern nach einem neuen Job um. Polizeidetektivin ist ganz nett für eine Weile, aber irgendwann habe ich es satt, ständig nur Laufarbeit zu verrichten.«
»Auch du wirst also in der Verwaltung enden. Kriegst einen Stempel und tausend Formulare.«
»Keine Überstunden mehr, keine Verfolgungsjagden.«
»Klingt tatsächlich verlockend. Vielleicht sollte ich mich auch bewerben. Ist doch wie im Gefängnis, du bist zwar gefangen, dafür hast du einen geregelten Tagesablauf und immer wieder nette Menschen, die dir genau sagen, was du tun darfst und was nicht.«
»Ach, manchmal ist es einfach mühsam, immer hinter Verbrechern herzujagen, Marco. Es ändert sich ja doch nichts. Ich sehe, wie meine Kollegen mit jedem Dienstjahr konservativer werden. Viele reden zwar nicht darüber, aber dieser Beruf schlaucht extrem. Ich möchte nicht eines Morgens aufwachen und mir selbst zuhören, wie ich die Todesstrafe fordere.«
»Machen das deine Kollegen?«
»Einige. Die müssten weg von der Straße, das ist gefährlich, die persönliche Überforderung führt zu einem Dauerfrust. Andererseits glaube ich manchmal, dass ich fehl am Platz bin in meinem Job, nicht hart genug, zu nachgiebig.«
Sie zündete sich eine neue Zigarette an. Ihre Tochter, die mitten in der Pubertät steckte, hatte Probleme mit der Polizistenmutter, noch mehr aber mit Fabiennes neuem Freund, einem Beamten der Kantonspolizei, um einiges jünger als Fabienne. Ihre Tochter hatte ihm anfangs schöne Augen gemacht, wollte die Mutter ausstechen, als das nicht klappte, kippte ihr Interesse in Verachtung um. Ich versuchte das Gespräch wieder auf Kobel zu lenken.
»Dieser Untermieter, den ihr sucht, weißt du mehr über ihn?«
»Leon Brügger heißt er, ist zur Fahndung ausgeschrieben. Hat seit acht Monaten bei Kobel zur Untermiete gewohnt. Ein Kleinkrimineller, saß ein Jahr wegen bandenmäßigem Autodiebstahl, ist im Milieu kein Unbekannter.«
»Weshalb hat er bei Kobel gewohnt? Waren die beiden befreundet?«
»Das wissen wir nicht genau. Kobel war in Geldnot, Brügger kam aus dem Knast, muss wohl Kobel in einer Bar kennengelernt haben. Kobel war oft im Salambo.«
»Das ist doch eine Schwulenbar, oder?« Ich sah, wie am Nebentisch ein junger Blondschopf mit dünner Halskette den Kopf kurz zu uns drehte. Fabienne bemerkte es auch und senkte ihre Stimme ein wenig.
»Nicht nur. Ein Teil der Lederszene verkehrt da, das Salambo ist aber auch ein Treffpunkt ziemlich zwielichtiger Gestalten. Keine der üblichen Homobars wie das Fuss. Aber natürlich kann man einen Zusammenhang nicht ausschließen.«
»Vor allem, wenn der Ermordete nackt auf seinem Bett lag.«
»Kobel war nicht schwul, wenn du das meinst.«
»Vielleicht ein Spätberufener?«
Sie schüttelte energisch den Kopf.
»Kobel war mit einem der Barkeeper im Salambo befreundet.«
»Schöne Freunde sind das, die nicht mal an die Beerdigung kommen.«
»Du warst an Kobels Beerdigung?« Fabienne schaute mich verblüfft an, sie machte eine unkoordinierte Handbewegung, sodass Zigarettenasche auf den Tisch fiel. Sie pustete die Asche auf den Fußboden, was am Nebentisch mit einem Stirnrunzeln quittiert wurde.
»Ich habe dir schon gesagt, dass mich Kobels Vorleben interessiert.«
»Tu mir einen Gefallen, Marco, misch dich nicht in unsere Ermittlungen ein.« Der Spruch kam mir bekannt vor. Seit ich Fabienne einen Mörder frei Haus geliefert hatte, vermutete sie jedes Mal, wenn wir uns trafen, dass ich wieder dabei war, heimlich Polizist zu spielen. Oft war es jedoch reine Neugier, die mich dazu trieb, sie auszufragen. Diesmal war allerdings mehr im Spiel, aber das sagte ich ihr nicht. Ich lächelte und hauchte ihr einen Kuss über den Tisch zu. Am Nebentisch errötete eine junge Frau, als ich ihr fast gleichzeitig zuzwinkerte. Sofort schnellte die Hand des Begleiters über den Tisch und legte sich auf die Finger der Erröteten.
Ich erzählte Fabienne von der Beerdigung und dem auffälligen Mann mit Sonnenbrille, der mir wie ein verkleideter Polizist vorkam, der sich alles aus Distanz angeschaut hatte. Sie runzelte die Stirn.
»Das war keiner von uns. Meine Kollegen glauben, dass Leon Brügger der Mörder ist, und der lässt sich sicher nicht an der Beerdigung blicken. Das machen die Mörder nur in Filmen.«
»Dann hätten wir ja eine interessante Frage zu klären. Wer war der Mann mit der Sonnenbrille?«
»Vielleicht auch ein Journalist, der etwas über Kobel schreiben möchte.«
»Ich bin kein Journalist, Fabienne.«
»Das ändert nichts daran, dass du neugierig bist.«
Ich grinste. Sie schaute auf die Uhr und verlangte die Rechnung. Ich klaubte eine Kreditkarte hervor und schob sie Fabienne zu. Sie schüttelte den Kopf.
»Ist mein Beitrag zur Zürcher Kulturpolitik.«
»Heißt das, dass ich jetzt doch noch meinen Jahrhundertroman schreiben muss?«
»Ist mir lieber, als wenn du dich in unsere Arbeit einmischst.«
»Fragenstellen muss erlaubt sein.«
»Ich sehe schon, du bist ein hoffnungsloser Fall. Wenn du was rauskriegst, melde es Bezirksanwalt Mühlhaupt.«
»Aber ja doch.«
Ich begleitete sie die paar Schritte bis zu ihrem Motorrad und verabschiedete mich mit einem Wangenkuss.
5
Wir gingen am Stadion Letzigrund vorbei, und ich machte Rolf darauf aufmerksam, dass wir bereits zweimal vergeblich zwischen dem Albisriederplatz und dem Stadion auf und ab gegangen waren. Die neuen Schuhe drückten am Rist, und ein unangenehmer Wind fegte uns entgegen. Rolf hatte von irgendwem im Fernsehen gehört, dass in der Gegend am Albisriederplatz ein Brockenhaus existierte, von dem kaum jemand etwas wusste. In einem Keller, direkt an der Badenerstraße, man musste jedoch um das Haus herumgehen, bis man zu einer Rampe kam. Diese Angaben hatte er mir erst gemacht, nachdem er seinen Wagen geparkt hatte. Ich ging davon aus, dass er genau wusste, wo sich das Brockenhaus befand, doch schon bald stellte sich heraus, dass er fast gar nichts wusste. Nachdem wir eine Stunde lang vergeblich umhergegangen und wie zwei Idioten jeden Hinterhof, der nicht vergittert oder durch tollwütige Hunde geschützt war, betreten hatten, räumte er schließlich ein, dass er sich vielleicht geirrt habe.
»Es könnte auch an der Baslerstraße sein«, sagte er lachend.
»Bist du noch bei Trost?«, sagte ich. »Die Baslerstraße ist noch länger und noch öder als die Badenerstraße.«
»Das stimmt nicht. Sie ist kürzer. Komm, sei kein Spielverderber, wer ist hier eigentlich der Freischaffende? Ich opfere schließlich einen Freitag.«
»Mir trommelt das Herz vor Rührung. Ich dachte, wir seien hier, weil du für eure Wohnung unbedingt scheußliche Bilder kaufen möchtest.«
Rolf und Marianne hatten sich einen Spaß daraus gemacht, ihre Wohnung mit billig erstandenen und dementsprechend aussehenden Bildern vollzuhängen. Sie luden regelmäßig Leute ein, denen sie vorgaukelten, dass es sich bei den Bildern um Kunstwerke handelte. Natürlich fielen eine ganze Menge Leute darauf herein, oder getrauten sich aus Höflichkeit nicht zu widersprechen. Rolf und Marianne lachten sich halb tot über die Deppen, vor allem über jene, die zur Sorte hochnäsiger Kulturtrottel gehören, von denen es auch in Zürich eine Menge gibt.
»Vielleicht findest du auch für dich etwas, oder? Das ist mein Verhängnis. Ich zeige den Leuten die heißesten Adressen in der Stadt, und sie schnappen mir vor der Nase all die schönen Dinge weg.«
»Ich mache mir nichts aus Sperrmüll«, sagte ich.
»Denk an Melanie. Sie mag doch Nippes, oder?«
Wir gingen hastig, weil Rolf immer hastig ging. Neben uns fuhren regelmäßig Trams vorbei, doch für Rolf schienen das keine nützlichen Fortbewegungsmittel zu sein. Er vertraute ganz auf seinen Instinkt und seine Schuhe, die offenbar bequemer waren als meine.
»Moment mal«, sagte er plötzlich. »Könnte es sein, dass wir vorhin in die falsche Richtung gegangen sind?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Lebst du in dieser Stadt, oder nicht?«
»Ich habe noch nie etwas von einem geheimen Brockenhaus gehört.«
»Nicht geheim. Bloß ein Geheimtipp. Wer kommt schon auf die Idee, hier nach einem Brockenhaus zu suchen?«
»Das klingt einleuchtend.«
»Sarkasmus hilft uns jetzt auch nicht weiter.«
»Weshalb rufst du nicht einfach deinen Informanten an?«, schlug ich vor. Rolf winkte heftig ab.
»Weiß nicht mal, wie er heißt. Habe das bloß in der Kantine aufgeschnappt. Lass uns jetzt erst mal zum Albisriederplatz gehen. Dann sehen wir weiter.«
»Da vorne ist eine Tramstation.«
»Ach, bis wieder eins kommt, sind wir längst am Ziel unserer Träume.«
Wir gingen schweigend weiter. Rolf beschleunigte seine Schritte, meine Füße schmerzten noch etwas stärker, doch ich jammerte nicht. Auch nicht, als ein Tram an uns vorbeifuhr. Immerhin schafften wir es gerade noch, das zweite Tram zu schlagen, was Rolf erfreut zur Kenntnis nahm.
»So. Und jetzt gut überlegen. Diese Richtung hatten wir schon. Der Typ sagte, es sei auf der Nova-Park-Seite.«
»Vorhin warst du nicht mal sicher, ob du die Straßenbezeichnung richtig mitbekommen hast.«
»Es muss hier sein. Los, gehen wir weiter.«
Widerspruch war zwecklos. Ich fragte ihn nach Marianne, die Probleme mit ihren Bronchien hatte, sie röchelte manchmal wie eine Sterbenskranke, wenn ich sie am Telefon hatte.
»Ist schon wieder besser geworden. Sie schluckt Tabletten und Hustensaft. Sie raucht jetzt nicht mehr vor dem Frühstück, aber natürlich raucht sie immer noch ihre zwei Päckchen. Ich bin wieder auf eins runter, aber Probleme mit Husten und so hatte ich nie. Mein Magen ist viel schlimmer dran. Da vorne, was ist das?«
Er zeigte auf ein Schild, auf dem ein Metzger seine Tagesaktionen ankündigte. Rolf sah seit ein paar Jahren alles um ihn herum nur noch verschwommen, doch er weigerte sich, eine Brille zu tragen. Nur im Auto setzte er manchmal eine auf, getarnt als Sonnenbrille. Es gehörte zu den Rätseln des Alltags, weshalb er noch nie einen Totalschaden verursacht hatte. Wir kamen an einer Einfahrt vorbei, Rolf marschierte stramm weiter, während ich einen Seitenblick wagte und ein verwittertes Holzschild sah, auf dem in schrägen Buchstaben das Wort Flohmarkt zu entziffern war. Ich zupfte Rolf an der Jacke, er stoppte theatralisch und stöhnte auf.
»Das ist tödlich für meinen Kreislauf. Wenn ich beschleunige, darfst du nicht einfach abbremsen, in unserem Alter geht so etwas nicht mehr.« Ich zeigte auf das Schild. Er schüttelte den Kopf, ging aber darauf zu. Erst zwei Meter davor gelang es ihm, die Buchstaben zu entziffern. Ich stellte mich neben das Schild und klopfte an das Holz. Ein Pfeil zeigte nach links. Wir gingen um das Haus herum und landeten vor einem riesigen Berg alter Kleider. Ein Mann war dabei, die Kleider in einen kleinen Laster zu schaufeln.
»Das hier also ist der Geheimtipp«, sagte ich. »Sieht mir eher wie eine improvisierte Müllkippe aus.«
Rolf ging unverzagt auf den Mann zu und fragte ihn, ob neben den Kleidern auch noch andere wertvolle Sachen in dem Haus lagerten. Der Mann verstand kein Wort, zeigte aber mit seinem Arbeitshandschuh hinter sich. Es sah aus wie die Einfahrt zu einer Tiefgarage, tatsächlich führte aber eine Rampe nach unten in ein dunkles Loch. Eine Tür stand offen, und von weit hinten drang dämmriges Licht nach draußen. Wir betraten den seltsamen Laden. Ein Mann in blauem Arbeitsoverall begrüßte uns laut und fragte, ob er uns behilflich sein könne. Rolf winkte ab und sagte, dass wir uns umschauen wollten. Der Mann brummte etwas und verschwand im hinteren Teil des Ladens, der eigentlich ein Keller war. Rolf klatschte in die Hände und zeigte in eine Ecke. Am Boden standen mehrere Schichten Gemälde und Drucke. Porträts von Hunden, fürchterliche Stillleben, ein grimmiger alter Mann mit Schnurrbart und jede Menge abstrakte Scheußlichkeiten. Ich schaute mich bei den Nippessachen um, wurde aber ständig von Rolf gestört, der mir ein Gemälde nach dem anderen unter die Nase hielt. Eines zeigte eine nackte, schwangere Frau, gemalt in dunklen Farben, die Schwangere seltsam verrenkt. Das Gesicht hatte Ähnlichkeiten mit einem ehemaligen Bundesrat. In besondere Verzückung geriet Rolf, als er ein Bild fand, auf dem ein unbegabter Kopist versuchte, Mondrians Flächen und Linien zu imitieren, und ein farbiges Gitternetz pinselte, in das er zur Auflockerung auch noch ein paar Kreise gekleckst hatte. Ich blätterte in einem alten Fotoalbum, das voll war mit Familienbildern aus den dreißiger Jahren. Einige Fotos zeigten Ferienbilder aus der Toskana, aus einer Gegend, in der ich selbst schon war und die ich wiedererkannte, obwohl viel gebaut worden war in der Zwischenzeit. Ich überlegte lange, ob ich das Album kaufen sollte, doch der Mann erschien plötzlich und zeigte auf seine Armbanduhr. Er müsse noch etwas abholen. Ich stellte das Album zurück ins Regal. Rolf hatte zwei Bilder gefunden, die geschmacklos genug waren, um seine Wohnung zu zieren. Das eine sah aus wie das Selbstporträt eines Schimpansen, das andere war eine mit mehreren Schichten Farbe wahllos vollgeschmierte Leinwand. Rolf ließ sich Packpapier um die Bilder wickeln und bezahlte fünfzig Franken, was ich für einen völlig überrissenen Preis hielt, doch er sagte bloß, dass Kunst etwas kosten dürfe. Der Mann schaute ihn ein wenig ratlos an, wahrscheinlich überlegte er sich gerade, ob ihm ein wertvoller Kunstschatz durch die Lappen ging, denn Rolf war so aufgekratzt wie ein Galerist, der gerade in einer Mülltonne einen unbekannten Cézanne entdeckt hatte. Zusammen mit den zweifelhaften Gemälden verließen wir den Geheimtipp. Rolf bestand darauf, mich zum Essen einzuladen. Es war drei Uhr. Ich schlug vor, in einem Fast Food-Restaurant zu essen, doch das behagte Rolf nicht, weil ihn die vielen jungen Menschen angeblich deprimierten. Nach langen Diskussionen und einem noch viel längeren Fußmarsch, landeten wir schließlich in der Wengi und gingen ins Migros-Restaurant. Es war ein angenehm großer Raum, mit schönen Metalltischen und Stühlen. Die meisten der Gäste tranken Kaffee, aßen Süßigkeiten und unterhielten sich. Wir drückten den Altersdurchschnitt ein wenig nach unten. An einem Tisch entdeckte ich einen Mann in einem dicken, schmutzigen Pullover, ein Handy neben dem Teller. Wir aßen vom Salatbuffet, und Rolf ereiferte sich über Marianne, die immer nur in teure Restaurants wollte.
»Kein Wunder, dass ich nie Reserven habe. Dabei müsste man jetzt an die Börse mit seinem Geld. Da wird gewaltig abgezockt. Und ich arbeite wie ein Trottel und komme auf keinen grünen Zweig.«
Ich reagierte nicht, denn ich kannte diese Leier nur zu gut. Rolf verdiente seit über zehn Jahren hervorragend, doch er schaffte es nie, auch nur 10000