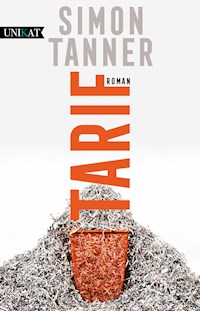
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unikat Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johannes Trappe ist am Ziel seiner Wünsche angekommen. Als jüngster Gewerkschaftssekretär, den die Vereinigte Gewerkschaft Metall je hatte, führt er die Tarifrunde mit dem großen Metallunternehmen Stinzigwerke. Ein erbitterter Kampf um das Schicksal tausender Arbeitsplätze und mit ihnen das Leben und die Zukunft ganzer Familien beginnt. Auf der Suche nach einer Lösung des Konflikts stößt Johannes auf immer mehr Hinweise, wie eng seine eigene Familie mit der Geschichte der schwerreichen Stinzigs verbunden ist. Plötzlich sieht er sich verstrickt in kompromisslos gehütete Geheimnisse, uralte Tarifversprechen, milliardenschwere Drohungen und eine tragische Liebesgeschichte. Am Ende muss er ganz allein eine folgenschwere Entscheidung treffen. Ein Roman, der die engen Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch den Einfluss von Familiengeschichte auf individuelles Handeln thematisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Simon Tanner
Tarif
Unikat Verlag
1. Auflage, 2022
Lektorat: Juri Pavlovic, Textehexe.comKorrektorat: Marleen WalterCovergestaltung: FAVORITBUERO GbR, Lena Kleiner, Favoritbuero.de
Marketing: Mainwunder Media House, mainwunder.de
Ebook und Buchsatz: Corinna Rindlisbacher, ebokks.deBestellung und Vertrieb: Nova MD GmbH, Vachendorf
Text Copyright © 2022 Simon Tanner
im Unikat Verlag
Dorotheenstr. 6
61348 Bad Homburg
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Handlung und handelnde Personen des Romans sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.dnb.de abrufbar.
Für Mira und Sebastian
Prolog
15. März 1957
„Einverstanden“, zischte er.
Der Hagere nickte. „Aber das bleibt unter uns. Sonst können Sie das Ganze vergessen, Herr Trappe.“ Dabei betonte der Sprecher die letzte Silbe des Namens überdeutlich – Trappeee, so als wolle er wenigstens auf diese Weise deutlich machen, wer hier eigentlich das Sagen hatte.
„Wann kann ich das bekannt geben?“, fragte Trappe mit heiserer Stimme, die nicht so recht zu seinem athletischen Körper passen wollte.
„Ich brauche wenigstens sechs Monate, um alle einzubinden. Erst dann.“
„Und Sie erwarten, dass ich so lange stillhalte und mitspiele?“
Der Hagere erhob sich. „Das – oder Sie zerstören mutwillig alles, was wir zusammen aufgebaut haben.“
„Schon gut“, beschwichtigte Trappe. „Ich bin für die Kollegen und ihre Arbeitsplätze da. Aber wir machen alles hier fertig und unterschreiben.“
„Und ein Exemplar für jeden mit einem Sperrvermerk für den Veröffentlichungszeitpunkt“, warf der Hagere ein.
„Brauchen wir das wirklich?“
„Sie haben Recht“, sagte der Hagere nach kurzem Zögern. „Wir sind sowieso auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.“
Stuttgarter Nachrichten vom 08. August 1957
Am gestrigen Abend wurde Wilhelm Trappe bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei kam der Gewerkschaftssekretär aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Trappe hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.
Kapitel 1
60 Jahre später
Dies war der perfekte Moment, um mit dem Rauchen anzufangen.
Johannes stellte sich vor, wie er in aller Ruhe eine Zigarette aus der Packung klopfte. Wie er sie zwischen die Lippen steckte und sie mit einem schweren silbernen Feuerzeug anzündete. Der Rauch würde aufsteigen und geheimnisvoll sein Gesicht umwölken, genau wie auf dem Foto seines Großvaters, das bei Oma Anna über dem Sofa hing. Gediegen würde er aussehen, souverän, wie einer, der wusste, wo es langging. Wie Opa Wilhelm.
Was natürlich Quatsch war. Er ging nicht viermal die Woche zum Sport, um sich dann ein Asthma zuzulegen.
Er tastete nach der Kaugummipackung in seiner Hosentasche. Nein. Kein angemessener Ersatz.
„Hannes? Kommst du? Wir müssen wieder rein. Drei Uhr war abgemacht.“
Fabians Worte färbten sich vor Johannes’ innerem Auge in einem Wirbel von Dunkelblau und Violett. Anspannung und Ungeduld. Er konnte es ihm nicht verdenken.
„Nur die Ruhe. Lass die noch ein bisschen schmoren.“
„Ich weiß nicht. Das ist doch nicht deine Art, solche Mätzchen zu machen. Das ist doch Schnee von gestern.“
„Quatsch, das ist Psychologie und die ist nie von gestern“, beharrte Johannes. „Du weißt doch, dass Erfolge bei Tarifverhandlungen nicht auf dem Papier erreicht werden. Ich will die erst noch ein bisschen mürbe machen.“
„Püschlogie“, äffte ihn Fabian nach. „Als ob wir damit etwas erreichen könnten. Die reagieren auf Druck und sonst auf gar nichts.“
Johannes zuckte mit den Schultern und steckte sich doch noch einen Kaugummi in den Mund. Er schmeckte fad. Er schluckte ihn runter.
Gemeinsam gingen sie den langen Hotelflur entlang, schweigend, der Teppich verschluckte ihre Schritte. Ganz hinten blieb Fabian vor einer Tür stehen und klopfte. Johannes atmete durch, räusperte sich und trat ein. Fabian folgte ihm.
Gelassenheit. Souveränität. Denk an den Großvater.
Seine Verhandlungspartnerin, Susanne Meinel, gab sich offenbar die gleiche Mühe. Sie saß, die Beine elegant übereinandergeschlagen, und wippte mit dem Fuß. Hochhackige Schuhe – vielleicht blieb sie auch nur deshalb sitzen, weil sie darin schlecht stehen konnte. Sie war die neue Frau im Vorstand der Stinzigwerke und zuständig für das Personal. Werner Hausmann, der Personalchef, saß neben ihr und blätterte in seinen Unterlagen. Er stand schon kurz vor der Rente, ein typischer Schwabe. Fleißig und sparsam, dazu nicht sonderlich redselig. Im Moment sah er aus, als würde er sich Sorgen machen.
Meinel lächelte kühl. Johannes setzte sich an den Konferenztisch und faltete locker die Hände auf der spiegelnden Tischplatte. Neben ihm zog Fabian sich einen Stuhl heran.
„Nun, meine Herren“, begann Meinel, „haben Sie über unseren Vorschlag nachgedacht?“ Fragend zog sie die dunklen Augenbrauen nach oben, die einen interessanten Kontrast zu ihrem roten Haarschopf bildeten.
„Ja, Frau Meinel, das haben wir“, antwortete Johannes. „Wir können Ihr Angebot auf dieser Basis leider nicht annehmen.“
„Ist das Ihr letztes Wort?“ Meinels Stimme klang ruhig und sachlich, aber die Temperatur im Raum sank augenblicklich auf den Gefrierpunkt. „Ich hoffe, Sie sind sich über die Konsequenzen im Klaren.“
„Natürlich,“ antwortete Johannes. „Sie hören von uns.“
„Könnten wir nicht doch …“, machte jetzt Hausmann einen Versuch, sich in das unerfreuliche Gespräch einzuschalten. Aber Meinel schnitt ihm das Wort ab.
„Ich denke, Herr Hausmann, es ist alles gesagt. Auf Wiedersehen, meine Herren.“
Johannes brauchte einen Moment, um den Affront als solchen zu begreifen. Sie verhandelte nicht? Missachtete damit die ungeschriebenen Regeln? Sie musste jetzt einlenken, eine neue Gesprächsbasis anbieten.
Aber das tat sie nicht.
Johannes und Fabian blickten Meinel ungläubig an, aber sie schien es ernst zu meinen. Also stand Johannes auf und verließ den Raum, Fabian direkt hinter ihm.
„Ein Rausschmiss erster Klasse, und wie sie Hausmann vor uns bloßgestellt hat – das sieht man nicht alle Tage“, sagte Fabian verwirrt. „Und was machen wir jetzt? Sie kann uns doch nicht so einfach im Regen stehen lassen! Ohne jedes weitere Angebot.“
„Warum soll sie das nicht können?“, fragte Johannes zurück.
„Na, weil wir ihr sonst die Hölle heißmachen! Urabstimmung, Streik und dann ist hier Leben in der Bude. Gerade jetzt, wo das Werk diese Mega-Aufträge hat. Da muss einfach termingerecht produziert werden. Die können unmöglich einen Streik riskieren.“
Johannes nickte. Anspannung machte sich in ihm bemerkbar. Ein Hotelflur, eine Treppe und zwei Türen – dann würde er seiner Tarifkommission gegenüberstehen und das Ergebnis der Verhandlung verkünden, wenn man es als solches bezeichnen konnte.
Er war der jüngste Verhandlungsführer, den die Vereinigte Gewerkschaft Metall – oder kurz VGM – je gesehen hatte. Die Kommission vertraute ihm. Eigentlich. Aber es gab auch Stimmen, die ihm seine fehlende Erfahrung zum Vorwurf machten. Jetzt würde sich zeigen, ob er in der Lage war, trotz allem ihr Vertrauen zu gewinnen.
Flur, Treppe, Glastür. Tür zum Konferenzraum.
Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit.
Diese Phase gab es häufig in Tarifrunden. Die Verhandlungen wurden auf Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite zwar von Verhandlungsführern geleitet. Das waren in der Regel einerseits der Personalvorstand eines Unternehmens und auf der anderen Seite ein Gewerkschaftssekretär. Aber am Ende mussten alle Entscheidungen von den Tarifkommissionen der jeweiligen Seiten vorbereitet und mitgetragen werden. Dort spielte also die Musik, egal wie einig sich Vorstand und Gewerkschaftssekretär während der Verhandlungen schon geworden waren. Natürlich gab es immer wieder Alleingänge selbstbewusster Verhandlungsführer, aber dazu musste die Tarifkommission bedingungslos hinter ihm stehen.
Ob das der Fall war, würde sich gleich zeigen.
„Versuchen wir also, ihr Vertrauen zu gewinnen“, murmelte er.
Als sie die Tür öffneten, blickten ihnen dreißig Augenpaare erwartungsvoll entgegen.
„Und?“, kam es wie aus einem Mund.
„Nichts“, sagte Johannes. „Sie sind nicht bereit, ihr Angebot zu verbessern. Nachdem wir gesagt hatten, dass es so nicht reicht, wollten sie überhaupt nicht mehr mit uns reden.“
„Wie, nicht mehr reden? Was soll das denn?“, platze Gerd Fiebinger heraus.
Natürlich. Vertrau auf Gerd, dass er die Sache hochkocht.
„Ich weiß es nicht“, sagte Johannes. Er spürte, dass die Kommission jetzt eine Erklärung von ihm erwartete – gerade so, als wäre er es gewesen, der die Verhandlungen beendet hatte, nicht Susanne Meinel.
Ich habe die Kommission noch nicht im Griff. Das Alter. Die fehlende Erfahrung. Wenn sie könnten, würden sie Opa Wilhelm als Verhandlungsführer zurückhaben wollen. Gewerkschaftslegende Wilhelm Trappe – aber der könnte hier auch nichts ausrichten. Wer nicht will, der hat schon.
„Warum nimmt die Meinel so eine Haltung ein?“, kam es dann auch prompt aus der anderen Ecke des Raumes.
„Das kann ich euch auch nicht sagen“, antwortete Johannes spontan und bemerkte sofort seinen Fehler. Die Mitglieder der Tarifkommission erwarteten Erklärungen, keine Hilflosigkeit. Wie zur Bestätigung erhöhte sich der Geräuschpegel im Raum deutlich.
Ich muss etwas tun. Jetzt.
Aber was?
„Hört mal alle her. Ich habe mit dieser Entwicklung gerechnet und natürlich einen detaillierten Plan. Wir treffen uns morgen früh um neun, um meine Ideen zu besprechen.“
Sein Ton ließ weder Diskussion noch Widerspruch zu. Fiebinger nickte beifällig und auch alle anderen murmelten Zustimmung. Johannes atmete auf. Die Kuh war vom Eis. Bis morgen früh.
Die Tarifkommission löste sich auf. Fabian blieb bei Johannes stehen.
„Du hast einen Plan?“, flüsterte er. „Echt? Welchen?“
„Weiß ich noch nicht“, gab Johannes leise zurück. „Frag mich morgen um kurz vor neun.“
Kapitel 2
Werner Hausmann wusste, er würde keine Antwort bekommen, nur wieder eine Gegenfrage, aber fragen musste er trotzdem, er drohte sonst vor Zorn zu platzen.
„Warum haben Sie das gemacht?“
„Was gemacht?“, fragte Susanne Meinel zurück, so gelassen, als wäre nichts gewesen.
„Warum haben Sie Trappe im Regen stehen lassen?“
„Was sprach dagegen?“, antwortete Meinel und verschränkte lässig die Hände auf der Tischplatte. Das verdross den erfahrenen Personalchef nur noch mehr. Seit sie vor knapp einem Jahr Personalvorstand geworden war, ging das so. Auf beinahe jede Frage zunächst eine Gegenfrage. Und nichts von dem, was bewährt und richtig schien, blieb ohne Widerspruch. Vorhin hatte sie ihm sogar das Wort abgeschnitten, als sei er ein Schuljunge. Er ballte die Fäuste, schüttelte dann aber den Kopf und fuhr betont ruhig fort.
„Dagegen spricht ein längerer Arbeitskampf, den wir uns angesichts der konkreten Auftragslage einfach nicht leisten können.“
Meinel sah ihm direkt in die Augen. „Glauben Sie wirklich, dass Johannes Trappe einen Arbeitskampf riskiert? Es ist seine allererste Runde als Tarifsekretär. Er ist vollkommen unerfahren und seine Kommission scheint er auch nicht im Griff zu haben.“
„Damit haben Sie wahrscheinlich recht“, entgegnete er. „Aber das sind doch rein taktische Erwägungen. Sollten wir nicht auf einen vernünftigen Ausgleich mit unserem Tarifpartner hinarbeiten? Am Ende müssen wir einen Kompromiss finden. Tarifpartnerschaft ist wie eine Ehe, die nicht geschieden werden kann. Deshalb sollten wir größere Eskalationen vermeiden. Wir müssen auch morgen und übermorgen miteinander auskommen.“
„Im Moment sehe ich gar nicht, wie es wirklich zu einem Konflikt kommen sollte, weil Trappe den gar nicht organisieren kann“, entgegnete Meinel. „Einen Streik können die doch nie auf die Beine stellen. Und einen Ausgleich suchen wir doch nicht um seiner selbst willen. Tarifpolitik ist nicht nur die Vermittlung von Interessen, sondern auch ein Machtkampf. Der Stärkere und Klügere behält die Oberhand.“
Mit ihrem Gesichtsausdruck und der hochgezogenen Augenbraue ließ sie keinen Zweifel daran, wer das nach ihrer Ansicht war. „Es wird Zeit, dass wir ein paar Dinge etwas moderner angehen“, setzte sie hinzu, und Hausmann hörte die Warnung, die an ihn gerichtet war. „Für den Moment ist die VGM am Zug, und sobald dort etwas geschieht, setzen wir uns zusammen und beraten die konkreten nächsten Schritte.“
Sie erhob sich, um deutlich zu machen, dass das Gespräch für sie beendet war. Hausmann folgte ihrem Beispiel. „Natürlich,“ antwortete er. Äußerlich blieb er gelassen, aber in ihm rumorte es. Er verstand seine Chefin und die Welt nicht mehr.
Meinels Blick folgte Hausmann, bis er das Büro verlassen hatte. Sie war sicher, dass er sie weder verstand noch mochte. Wahrscheinlich wünschte er ihr sogar die Pest an den Hals. Dabei verstand sie ihn bestens. Werner Hausmann war der redlichste Mann, den sie sich nur vorstellen konnte. Nach über dreißig Jahren im Beruf noch immer motiviert und ständig das Wohl der Firma und ihrer Mitarbeiter im Auge. Wie gerne hätte sie ihm gesagt, dass sie das nicht nur respektierte, sondern sogar bewunderte.
Aber sie hatte einen anderen Auftrag, direkt von ganz oben.
„Erweitern Sie unseren strategischen Spielraum. Die Kosten sind Nebensache.“
Das waren seine Worte gewesen. Und sie als neuer Personalvorstand wusste, was gemeint war. Strategische Fragen im Personalbereich berührten fast immer das Verhältnis des Unternehmens zu seiner Gewerkschaft. Innerhalb dieser Beziehungen wurden die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter per Tarifvertrag geregelt. Eine Erweiterung des Spielraums zog zwangsläufig einen Konflikt mit der Gewerkschaft nach sich, die naturgemäß auf Erreichtes und Vereinbartes in den Tarifverträgen pochte. Um diese Botschaft zu empfangen, war sie extra einbestellt worden, ganz diskret. Sven Stinzig hatte sie persönlich eingeladen. Er war sehr nett gewesen, hatte sie in keiner Sekunde spüren lassen, dass er der künftige Erbe eines gigantischen Firmenimperiums war, der einmal über viele Tausend Mitarbeiter gebieten würde.
Sie hatte ihm das hoch angerechnet. Sie, Susanne Meinel, die wusste, wie es sich anfühlte, nichts zu besitzen und ganz unten zu sein. Sie erinnerte sich an ihre triste Kindheit in Berlin-Marzahn. Drei Geschwister, nach der Wende arbeitslose Eltern und tagein, tagaus dieser harte Existenzkampf, der aus jeder Ritze quoll. Dahin wollte sie nicht zurück. Niemals. Und hier, bei den Stinzigwerken, hatte sie Gelegenheit, sich zu beweisen. Den finalen Schritt zu tun und sich endgültig zu etablieren.
Ein Klopfen an der massiven Tür unterbrach ihre Gedanken.
„Ja?“
Die Tür öffnete sich und ihre persönliche Assistentin erschien. „Frau Meinel? Es ist Zeit für das Mittagessen.“
„Vielen Dank, Mila, ich komme sofort.“
Das hatte sie ja beinahe vergessen! Das wöchentliche Mittagessen der Vorstände der Stinzigwerke, zu dem der Vorstandsvorsitzende Stefan Gruber persönlich einlud. Sie würde dort über den Fortgang der Tarifverhandlungen berichten müssen. Susanne Meinel straffte sich, warf noch einen prüfenden Blick in den Spiegel und verließ ihr Büro.
Kapitel 3
Der Feierabendverkehr raubte ihm den letzten Nerv. Als er endlich zu Hause ankam, wollte er nichts als eine heiße Dusche, eine Pizza und eine Serie, bei der er nicht nachdenken musste. Aber die Uhr tickte. In fünfzehn Stunden erwartete die Tarifkommission einen ausgefeilten Plan.
Er stellte die alte Ledertasche, die schon seinem Großvater gehört hatte und für die er mehr als einmal verspottet worden war, sorgsam neben den altersschwachen Ikea-Schreibtisch. Schuhe und Jacke flogen achtlos auf den Boden.
Tarifkommission. Ideen. Er brauchte Ideen.
Das Summen seines Smartphones riss ihn aus seinen Gedanken. Seine Mutter.
„Ja, Mutti?“
„Junge, kannst du nicht mal deinen Namen ordentlich sagen“, erscholl es am anderen Ende. „Das geht doch nicht. Du bist doch jetzt jemand. Was, wenn ein Verhandlungspartner dich anruft?“
„Aber ich sehe doch im Display, dass du es bist. Was gibt’s?“, fragte er lahm.
Hoffentlich nichts Kompliziertes. Und hoffentlich will sie nicht nur jammern.
„Du musst herkommen, und zwar sofort“, sprudelte es aus ihr hervor.
„Wohin? Nach Hause?“, fragte er erstaunt.
„Ja, das heißt nein …“
„Sei doch nicht so konfus“, unterbrach er sie rüde. „Soll ich nun nach Hause kommen oder nicht?“
„Nicht zu mir“, gab sie zurück. „Zu Onkel Eduard. Er liegt im Krankenhaus. Sein Lungenkrebs – die Chemo hat nicht angeschlagen. Es geht ihm sehr schlecht, und er möchte dich sehen.“
„Mich? Warum? Ich hatte seit Jahren nichts mehr mit Onkel Eduard zu tun, das weißt du doch. Ich hab ihn vielleicht zweimal getroffen, seit Papa tot ist.“
„Ich habe ihn nicht gefragt, warum, aber ich habe ihm versprochen, dass du kommst.“
Johannes seufzte. „Ausgerechnet jetzt? Ich stecke mitten in schwierigen Tarifverhandlungen und muss bis morgen früh noch etwas vorbereiten.“
„Aber du wirst doch einem Sterbenden seinen letzten Wunsch nicht abschlagen?“
Den Ton kannte er. Wenn seine Mutter sich aufs gebieterische Bitten verlegte, konnte er einfach nicht nein sagen.
„Also gut. Welches Krankenhaus?“
„Nordwest-Klinik in Frankfurt. Weiß du, wo das ist?“
„Navi macht’s möglich“, gab er lakonisch zurück. „Ich werde etwa zwei Stunden brauchen.“
„Danke, Hansi. Ich werde dann auch da sein.“
„Bis dann“, seufzte er ergeben. „Und nenn mich bitte nicht immer Hansi.“
„Aber natürlich, Hansi.“ Seine Mutter legte auf.
Johannes seufzte. Anscheinend hatte ihm jemand einen gebrauchten Tag angedreht. Er fand seine Schuhe unter der Garderobe, schlüpfte in seine Jacke und verließ seine Wohnung nur wenige Minuten, nachdem er sie betreten hatte.
„Warum nur in aller Welt mache ich das jetzt?“, murmelte Johannes zu sich selbst. „Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte!“
Wie lange hatte er Eduard nicht gesehen? Fünf, sechs Jahre? Und was wollte er ausgerechnet von ihm? Beim letzten Treffen waren sie sogar aneinandergeraten, weil Onkel Eduard so komplett flach und selbstgerecht über die junge Generation hergezogen hatte und er, Johannes, der einzige Vertreter eben dieser Generation am Tisch gewesen war. Er erinnerte sich lebhaft an die meckernde Lache von Eduard. Er saß jetzt nur im Auto, weil er seiner Mutter nichts abschlagen konnte.
Wenn er sich ranhielt, war er gegen Mitternacht wieder zu Hause. Neun Stunden, um die Kuh vom Eis zu schaffen. Das war knapp, musste aber reichen.
Er fand das Krankenhaus, parkte das Auto auf einem menschenleeren Besucherparkplatz und irrte herum, bis er den Haupteingang gefunden hatte. Drinnen fragte er sich durch zur Onkologie. Endlich fand er das richtige Zimmer. Für eine Sekunde fühlte er sich, als würde auf der anderen Seite der Tür eine misstrauische und aufgebrachte Tarifkommission auf ihn warten. Er schüttelte den Kopf. Zu viel gearbeitet in letzter Zeit. Seine Nerven waren nicht mehr die besten.
Gerade als er die Tür öffnen wollte, ging sie von selbst auf und seine Mutter erschien.
„Hannes, da bist du ja! Ich wollte dich gerade anrufen.“
In dem spärlich ausgeleuchteten Zimmer lag Onkel Eduard in einem viel zu großen Bett. So klein und zerbrechlich hatte Johannes ihn nicht in Erinnerung gehabt. Eduard hatte die Augen geschlossen und atmete schwer. Als die Tür leise ins Schloss rollte, schlug er die Augen auf. Er blickte sich irritiert um, dann blieb sein Blick an Johannes hängen. „Th… Johannes“, keuchte er. „Das ist gut.“
Es dauerte einen Moment, bis er erneut Atem geschöpft hatte. „Komm näher.“
Zögernd gehorchte Johannes. Eduard winkte ihn schwach näher, bis Johannes sich auf die Bettkante seines Onkels setzte. Er fühlte sich unbehaglich. Eduard sah fremd aus – die spärlichen Haare waren verklebt und standen ihm in seltsamen Büscheln vom Kopf ab. Seine Haut wirkte wächsern, als sei er schon tot, und sein Atem roch schlecht.
„Johannes … dein Großvater war ein großer Mann …“
„Onkel Eduard, schone dich. Du kannst mir von den alten Zeiten erzählen, wenn es dir besser geht.“
Doch Eduard schüttelte den Kopf und griff nach Johannes’ Hand. Seine Finger waren knöchern und kalt, und Johannes bemühte sich, seine Hand nicht wegzuziehen.
„Dein Großvater Wilhelm hatte ein großes Geheimnis. Bedeutsam. Für viele Menschen. Du musst es jetzt erfahren.“
„Äh – okay?“
Johannes wechselte einen Blick mit seiner Mutter, die ratlos die Achseln zuckte.
„Krieg und Frieden“, flüsterte Eduard. „Neunzehneinundfünfzig. Daheim, im Regal im Arbeitszimmer. Du musst es holen.“
„Mit Verlaub, Onkel Eduard, aber hätte Mama dir das nicht bringen können? Ich hatte zwei Stunden Anfahrt, nur für ein Buch?“
Eduard schüttelte schwach den Kopf. „Nicht bringen. Du musst es behalten. Es ist wichtig für Stinzig.“
Die letzten Worte gingen in einem Hustenanfall unter, so dass Johannes nicht sicher war, ob er richtig verstanden hatte. Wahrscheinlich höre ich wegen der Tarifauseinandersetzung schon überall Stinzig. Onkel Eduard ließ ihn los und sank in sein Kissen zurück.
„Schlüssel“, flüsterte er heiser und deutete mit einem zittrigen Finger hinüber zum Schrank. Johannes’ Mutter sprang auf, holte eine altmodische Reisetasche aus einem der Fächer und kramte darin, bis sie einen Schlüsselbund gefunden hatte. Zögernd nahm Johannes ihn entgegen.
„Ich bin jetzt nicht so die Leseratte“, machte er einen letzten Versuch.
Eduard winkte ab. „Du bist ihm so ähnlich, wusstest du das? Deinem Großvater.“
„Onkel Eduard …“
Aber der hielt die Augen geschlossen. Nur sein rasselndes Atmen war zu hören.
„Komm“, sagte Johannes’ Mutter leise. „Lass ihn ausruhen.“
Johannes hatte nichts dagegen. Die Uhr tickte, die Kuh musste vom Eis. Er folgte seiner Mutter nach draußen.
„Hast du eine Ahnung, was das sollte?“, fragte er. Sie zuckte die Achseln.
„Vielleicht eine besonders wertvolle Ausgabe, die er dir vererben will?“
„Bevor er überhaupt tot ist? Außerdem, warum sollte er mir irgendetwas vererben? Wir kennen uns kaum.“
„Geh es besorgen, dann wissen wir vielleicht mehr. Eduard wohnt in Rödelheim, das ist nicht so weit. Wenn du willst, kommst du danach noch bei mir vorbei. Ich könnte uns noch etwas kochen. Ist schon spät, aber für dich würde ich das machen.“
„Mutti, ich muss zurück. Ich hab morgen eine wichtige Sitzung der Tarifkommission, das hab ich dir ja am Telefon schon gesagt. Die muss ich noch vorbereiten.“
„Dann hol wenigstens das Buch noch ab, wenn du schon für deine Mutter keine Zeit hast. Immer ist alles wichtiger.“
„Nein, Mutti, du bist die Wichtigste“, sagte er pflichtschuldigst und küsste sie auf die Wange. „Und okay. Wenn dir so viel dran liegt, hole ich das Buch noch. Hast du die Adresse für mich?“
Kurz darauf saß er im Auto und folgte einer Stadtautobahn in Richtung Süden. Der Feierabendverkehr war abgeflaut. Johannes kam zügig voran, trotzdem ärgerte er sich. Der Umweg würde ihn mindestens eine halbe Stunde kosten. Nur weil er ein altes Buch aus einer staubigen Büchersammlung holen sollte. Krieg und Frieden. Wer las denn heute noch solche Schinken?
Nein. Wenn er ehrlich war, fuhr er nach Rödelheim, weil er mal wieder nicht hatte „nein“ sagen können. Er musste das dringend lernen.
Die Straße, in der Eduard wohnte, war schmal, nur einbahnig befahrbar und völlig zugeparkt. Johannes suchte die richtige Hausnummer und hielt schließlich vor einem Betonkasten, der die weniger charmanten Seiten der Siebzigerjahre repräsentierte. Er sah sich um. Selbst in die Feuerwehrzufahrt hatte jemand seine Karre gezirkelt. Er hatte doch jetzt keine Zeit, einen Parkplatz zu suchen!
Kurz entschlossen fuhr er so nah an die Reihe der parkenden Autos heran, wie es sein Außenspiegel zuließ. Er aktivierte den Warnblinker, sprang aus dem Auto und rannte zum Haus.
Sechs Parteien, Eduards Name stand ganz unten. Erdgeschoss. Glück gehabt. Johannes sperrte die Haustür auf und tastete nach dem Lichtschalter. Zwei Türen zur Wahl, an der rechten hing ein spektakulär hässliches, getöpfertes Namensschild. Links war richtig.
Die Wohnung empfing ihn mit dem Mief von abgestandener Luft und altem Zigarettenrauch. Johannes warf einen flüchtigen Blick in eine kleine Einbauküche und ein Schlafzimmer mit einem ungemachten Bett. Am Ende des engen Flures fand er das Arbeitszimmer. Es war mit zwei großen Bücherregalen und einem schweren Eichenschreibtisch vollständig ausgefüllt. In aller Eile überflog Johannes die Bücherrücken. Dostojewski, die Gesamtausgabe.





























