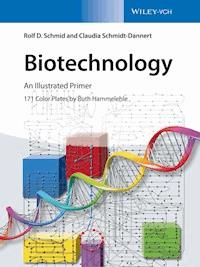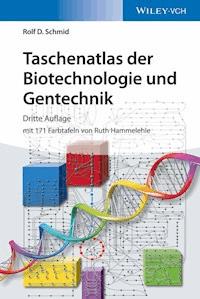
42,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Taschenatlas der Biotechnologie und Gentechnik hat seit dem ersten Erscheinen 2001 bereits etliche Jahrgänge von Studenten und Schülern und interessierte Quereinsteiger in die Grundlagen diese wegweisenden Zukunftstechnologien eingeführt und sich als anschaulicher und unersetzlicher Begleiter etabliert.
Biotechnologie und Gentechnik gelten als Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Sie sind Motor für die Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel und Therapieformen, von Nutzpflanzen und Lebensmittel sowie von modernen Umwelttechnologien und innovativen industriellen Verfahren.
Diese neue Auflage wurde grundlegend aktualisiert sowie um die Themen Tissue Engineering, Protein Design und Proteomics erweitert. Der neue Atlas wird damit weiterhin seiner Rolle als reichhaltige und aktuelle Quelle zu den spannendsten Themen innerhalb dieses wichtigen Forschungszweiges gerecht.
aus einer Rezension der 1. Auflage:
"... Der Atlas ist Studenten der Naturwissenschaften und der Medizin ebenso zu empfehlen wie allen, die einen Überblick über Produkte, Methoden, Anwendungen sowie wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen der Bio- und Gentechnologie suchen."
Chemie in unserer Zeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Decken
Abkürzungen
Titel
Autor
Copyright
Vorwort zur 1. Auflage
Vorwort zur 2. Auflage
Vorwort zur 3. Auflage
Einführung
Einleitung
Frühe Entwicklungen
Biotechnologie heute
Mikrobiologie
Viren
Bakteriophagen
Mikroorganismen
Bakterien
Hefen
Pilze
Algen
Einige biotechnologisch wichtige Bakterien
Mikroorganismen: Isolierung, Stammhaltung, Sicherheit
Stammverbesserung von Mikroorganismen
Biochemie
Aminosäuren, Peptide, Proteine
Enzyme: Aufbau, Funktion, Kinetik
Zucker, Glykoside, Polysaccharide
Lipide, Membranen, Membran-Proteine
Stoffwechsel
Gentechnik
DNA: Aufbau und Struktur
DNA: Funktion
RNA
Gentechnik: Allgemeine Arbeitsschritte
Präparation von DNA
Weitere Enzyme zur Bearbeitung von DNA
PCR: allgemeine Methode und praktische Anwendungen
PCR: Labormethoden
DNA: Synthese und Größenbestimmung
DNA: Sequenzierung
Einführung von DNA in lebende Zellen (Transformation)
Klonierung und Identifizierung von Genen
Genexpression
Abschalten von Genen
Epigenetik
Genbanken und Genkartierung
Genome von Prokaryoten
Genome von Eukaryoten
Metagenom
Zellbiologie
Stammzellen
Blutzellen und Immunsystem
Antikörper
Reporter-Gruppen
Oberflächen-Fermentation
Mikroorganismen: Anzucht
Wachstumskinetik und Produktbildung
Zulauf-, kontinuierliche und Hochzelldichte-Fermentationen
Fermentationstechnik
Fermentationstechnik: Maßstabsvergrößerung
Kultivierung tierischer Zellen
Kultivierung tierischer Zellen im größeren Maßstab
Enzym- und Zellreaktoren
Aufarbeitung von Bioprodukten
Aufarbeitung von Bioprodukten: Chromatographie
Ökonomische Gesichtspunkte bei industriellen Verfahren
Alkoholische Getränke
Bier
Fermentierte Lebensmittel
Lebensmittel und Milchsäure-Gärung
Präbiotika und Probiotika
Backhefe und Futterhefen
Futterhefen aus Chemie-Rohstoffen, Einzelleröl
Aminosäuren
L-Glutaminsäure
D,L-Methionin, L-Lysin und L-Threonin
Aspartam™, L-Phenyl-alanin und L-Asparaginsäure
L- und D-Aminosäuren durch enzymatische Transformation
Vitamine
Nucleoside und Nucleotide
Industrieprodukte
Bio-Ethanol
Butanol
Höhere Alkohole und Alkene
Essigsäure
Citronensäure
Milchsäure, 3-Hydroxy-Propionsäure
Gluconsäure und andere „grüne“ Zucker-Bausteine
Dicarbonsäuren
Biopolymere: Polyester
Biopolymere: Polyamide
Polysaccharide
Biotenside
Fettsäuren und Ester
Enzymtechnologie
Biotransformation
Enzyme in der Technik
Angewandte Enzymkatalyse
Regio- und enantioselektive enzymatische Synthesen
Enzyme als Verarbeitungs-Hilfsmittel
Enzyme und Waschmittel
Enzyme zum Stärkeabbau
Enzymatische Stärkehydrolyse
Enzyme und Süßkraft
Enzyme zum Abbau von Cellulose und Polyosen
Enzymatische Verfahren bei der Zellstoff- und Papierherstellung
Pektinasen
Enzyme und Milchprodukte
Enzyme zur Bearbeitung von Backwaren und Fleisch.
Neue Enzyme für Lebensmittel und Tierfutter
Enzyme zur Leder- und Textilbehandlung
Neue Wege zu technischen Enzymen
Protein Design
Antibiotika
Antibiotika: Vorkommen und Anwendungen
Antibiotika: Screening, Herstellung und Wirkungsmechanismus
Antibiotika-Resistenz
β-Lactam-Antibiotika: Struktur, Biosynthese und Wirkungsmechanismus
β-Lactam-Antibiotika: Herstellung
Aminosäure- und Peptid-Antibiotika
Glykopeptid-, Lipopeptid-, Polyether- und Nucleosid-Antibiotika
Aminoglykosid-Antibiotika
Tetracycline, Fluorochinolone, andere aromatische Antibiotika
Polyketid-Antibiotika
Neue Wege zu Antibiotika
Medikamente und Medizintechnik
Insulin
Wachstumshormon und andere Hormone
Hämoglobin, Serumalbumin, Lactoferrin
Gerinnungsfaktoren
Antikoagulanzien und Thrombolytika
Enzym-Inhibitoren
Interferone
Interleukine
Erythropoietin und andere Wachstumsfaktoren
Andere therapeutische Proteine
Monoklonale Antikörper
Rekombinante Antikörper
Therapeutische Antikörper
Vakzine
Rekombinante Vakzine
Steroid-Biotransformationen
Enzyme für die Analytik
Enzym-Tests
Biosensoren
Immunanalytik
Glykobiologie
Landwirtschaft und Umwelt
Tierzucht
Embryotransfer, geklonte Tiere
Genkartierung
Transgene Tiere
Züchtung,
gene pharming
und Xenotransplantation
Pflanzenzucht
Pflanzliche Zellkulturen: Oberflächen-Kulturen
Pflanzliche Zellkulturen: Suspensionskulturen
Transgene Pflanzen: Methoden
Transgene Pflanzen: Resistenz
Transgene Pflanzen: Wertstoffe
Aerobe Abwasserbehandlung
Anaerobe Abwasser- und Schlammbehandlung
Biologische Reinigung von Abluft
Biologische Reinigung von Böden
Mikrobielle Erzlaugung (Biolaugung) und Biokorrosion
Megatrends
Human-Genom
Funktionsanalyse des Humangenoms
Pharmakogenomik,
Nutrigenomics
DNA-Analytik
Gentherapie
Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS)
Tissue Engineering
Wirkstoff-Screening
Hochdurchsatz-Sequenzierung
Proteomics
DNA- und Protein-Arrays
Metabolomics
und
Metabolic Engineering
Synthetische Biologie
Systembiologie
Bioinformatik: Sequenz- und Struktur-Datenbanken
Bioinformatik: Funktionsanalysen
C-Quellen
Bioraffinerien
Sicherheit und Ethik
Sicherheit in der Gentechnik
Zulassung bio- und gentechnischer Produkte
Ethik und Akzeptanz
Patente in der Biotechnologie
Biotechnologie im internationalen Leistungsvergleich
Literatur
Sachverzeichnis
Bildquellen
End User License Agreement
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
Pages
C1
A
iii
iv
v
ix
x
xi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
Rolf D. Schmid
Taschenatlas der Biotechnologie und Gentechnik
Dritte Auflage
171 Farbtafeln von Ruth Hammelehle
Autor
Prof. Dr. Rolf D. SchmidBio4BusinessJagdweg 370569 Stuttgart
Grafikerin
Ruth HammelehleMarktplatz 573230 Kirchheim unter Teck
Cover
DNA Helix von fotolia©A-Mihalis
3. Auflage 2016
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2016 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 978-3-527-33514-5
Vorwort zur 1. Auflage
Die Biotechnologie, eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, ist in besonderem Maße interdisziplinär. Je nach Aufgabenstellung erfordert sie Wissen aus der allgemeinen Biologie, der Molekulargenetik und der Zellbiologie, der Humangenetik und der molekularen Medizin, der Virologie, Mikrobiologie und Biochemie, der Enzymtechnologie, der Bioverfahrenstechnik und der Kybernetik; dazu in immer stärkerem Maße auch umfangreiche Computer-Kenntnisse, vor allem für die Bioinformatik und die Systembiologie. Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder, dass es so gut wie keine kurz gefassten Lehrbücher gibt, die das gesamte Gebiet abdecken. Selbst vielbändige Monographien lassen meist wichtige Teilgebiete wie Tier- und Pflanzenzucht oder Bioinformatik außer acht.
Andererseits habe ich selbst als lebenslang Lernender und über viele Jahre hinweg auch bei meinen Studenten erlebt, wie anregend und motivierend der Blick aufs Ganze sein kann, gerade wenn das Studium die Aufnahme Tausender anscheinend zusammenhangloser Einzelheiten erfordert.
Mit dem Taschenatlas Biotechnologie/Gentechnik liegt nun ein kleines Handbuch vor, das eine Lösung für dieses Dilemma sucht. Die verschiedenen Themen dieses Buches, die von „Bier“ und „Ethanol“ über „Rekombinante Vakzine“ bis zu „Humangenom“ und „Proteomics“ reichen, lassen sich zwar fast nicht auf einer einzigen Text- und Bildseite zutreffend darstellen; schließlich findet man für jedes dieser Einzelthemen ganze Monographien, Buchkapitel und Hunderte von wissenschaftlichen Veröffentlichungen (einige davon werden jeweils im Literaturverzeichnis zitiert). Andererseits ist gerade der Zwang zur knappen Darstellung die rechte Herausforderung, die wesentlichen Gesichtspunkte jedes Einzelthemas herauszuarbeiten und in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
Ich hoffe, dass mir dies wenigstens teilweise gelungen ist und dass ich dem Leser hier und dort den roten Faden in die Hand geben kann, der ihn aus dem Labyrinth einer von Anglizismen geprägten Kunstsprache wieder sicher in den Alltag einer zwar anspruchsvollen, aber durchaus zugänglichen und faszinierenden Wissenschaft herausführt. Sollte dies gelingen, so wäre es auch das Verdienst von Ruth Hammelehle, die mit großem Gespür für den logischen Aufbau von Schemazeichnungen (und für deren Ästhetik) dem knappen Text eine zweite Dimension verliehen hat. Auch den am Entstehen dieses Buchs beteiligten Redakteurinnen Barbara Frunder, Ute Rohlfs und Karin Dembowsky, möchte ich herzlich für ihre Sorgfalt und ihre Kommentare danken.
Mein besonderer Dank gilt den zahlreichen Kollegen, die einzelne Themen oder Abschnitte des Buchs kritisch durchgesehen und durch Anregungen und Kommentare ganz entscheidend verbessert haben. Dies waren: Max Roehr, Wien; Frank Emde, Bonn; Maria-Regina Kula und Hermann Sahm, Jülich; An-Ping Zeng, Braunschweig; Volker Kasche, Hamburg-Harburg; Peter Dürre, Ulm; Ulf Stahl, Edeltraud Mast-Gerlach und Dietrich Knorr, Berlin; Udo Graefe, Jena; Günter Schmidt-Kastner, Wuppertal; Karl-Heinz Maurer, Düsseldorf; Wolfgang Barz und Alexander Steinbüchel, Münster; Frieder Scheller, Potsdam; Bertold Hock und Wolfgang Ludwig, Weihenstephan; Reinhard Krämer, Köln; Thomas von Schell, Hans-Joachim Knackmuss, Karl-Heinrich Engesser, Jörg Metzger, Peter Scheurich, Ulrich Eisel, Matthias Reuss, Peter Stadler, Klaus Mauch, Christoph Syldatk, Michael Thumm und Joseph Altenbuchner, Stuttgart; Helmut Geldermann, Rolf Claus, Gerd Weber und Rolf Blaich, Stuttgart-Hohenheim; Helmut Uhlig, Breisach; Joachim Siedel, Claus Wallerius, Anton Haselbeck und Ulrich Behrendt, Penzberg; Wolfgang Wohlleben und Claus Schuldt, Tübingen; Rolf Werner, Biberach; Wieland Wolf und Andreas Lorenz, Laupheim; Frank-Andreas Gunkel, Wuppertal; Michael Bröker, Marburg; Bernhard Hauer, Wolfgang Pressler und Dieter Jahn, Ludwigshafen; Dieter Man-gold und Julia Schueler, Mannheim; Frank Zocher und Paul Habermann, Hoechst; Tilmann Spellig, Bergkamen; Dieter Oesterhelt, Friedrich Lottspeich und Bernd Gänsbacher, München. Unter den vielen Mitarbeitern meines Instituts, die mir geduldig auf zahllose Fragen antworteten, möchte ich stellvertretend Jutta Schmitt, Isabelle Kaufmann, Markus Enzelberger, Till Bachmann und Jürgen Pleiss danken.
Es wäre ein Wunder, wenn trotz dieser vielfältigen Hilfe nicht Unklarheiten und Fehler geblieben wären. Um diese in Zukunft auszumerzen, bitte ich meine geneigten Leser, mir Unklarheiten oder Fehler unter der Web-Adresse meines Instituts, www.itb.uni-stuttgart.de/taschenatlas mitzuteilen, um das Buch ständig verbessern zu können.
Rolf D. Schmid Stuttgart, Dezember 2001
Vorwort zur 2. Auflage
In den 5 Jahren, seit die 1. Auflage dieses kleinen Buchs erschien, haben sich Biotechnologie und Gentechnik stürmisch weiterentwickelt. Abzulesen ist dies zum einen an der gesteigerten Mengenprodukten fast aller traditionellen Fermentationsprodukte. So verdoppelte sich beispielsweise die Jahresproduktion von L-Glutamat in nur 5 Jahren auf ca. 1,5 Millionen to, was auf veränderte Ernährungsgewohnheiten, aber auch auf den Eintritt Chinas in die Weltwirtschaft hinweist. Zum anderen hat sich die Entschlüsselung von Genomsequenzen fortgesetzt. Unser Wissen um ihren Aufbau beruht heute auf der Sequenzinformation von mehr als einem Dutzend Pflanzen und Tieren und hunderten von Mikroorganismen. Die funktionelle Analyse von Genomen hat zu grundlegend neuen Erkenntnissen geführt, beispielsweise zur Aufklärung der Rolle von small interfering RNAs (siRNA); in Verbindung mit Proteomics und Metabolomics hat sie eine ganzheitliche Analyse der Lebensvorgänge mit Hilfe der Systembiologie ausgelöst. Und sollte die Vorhersage einer individuellen Genomanalyse zum Preis von etwa 1500 € eintreffen (und bis dahin um grundlegende kausale Kenntnisse für Erkrankungsursachen, Altersvorgänge und Stoffwechselstörungen erweitert werden können), so wäre der Weg für eine personenbezogene Diagnose, Therapie und Ernährungsberatung offen.
In der industriellen Biotechnologie haben die in den letzten Jahren dramatisch gestiegenen Erdölpreise und die mit der Industrialisierung des Planeten einhergehende Erwärmung der Atmosphäre in Industrie und Wissenschaft das Gefühl verstärkt, dass zum Erhalt des „Raumschiffs Erde“ neue, nachhaltige Technologien zur Energie-Erzeugung und zur Versorgung mit Grundchemikalien entwickelt werden müssen. Bioethanol und Biodiesel als Treibstoffe, die vergleichende Bewertung von Prozessen der Chemie-Produktion mittels Ökobilanzen und der Bau der ersten „Bioraffinerien“, in denen Chemieprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden, geben klare Signale für das große Entwicklungspotenzial der „weißen Biotechnologie“.
Neben einer grundlegenden Überarbeitung aller Einträge enthält die 2. Auflage dieses Buchs deshalb auch 4 neue Stichworte: Tissue Engineering, RNA, Systembiologie und „Weiße Biotechnologie“.
Mein Dank für sehr wertvolle Informationen aus der biotechnologischen Industrieforschung gilt den Herren Waander Riethorst (Sandoz), Bernhard Hauer und Uwe Pressler (BASF), Andreas Leuchtenberger (Degussa) und Karlheinz Maurer (Henkel). Für aktuelle Informationen aus der akademischen Forschung danke ich besonders Frau Susanne Grabley (Jena), Frau Sibylle Thude (Stuttgart) und den Herren Wolfgang Wohlleben (Tübingen), Matthias Reuss, Klaus Pfizenmaier und Klaus Mauch (Stuttgart).
Mein Dank geht auch erneut an Frau Ruth Hammelehle und Herrn Bernhard Walter von der Firma epline, Kirchheim/Teck, für die ausgezeichnete grafische und drucktechnische Gestaltung sowie an Frau Dr. Romy Kirsten für die hervorragende verlagsseitige Betreuung.
Rolf D. Schmid Stuttgart im Herbst 2005
Vorwort zur 3. Auflage
In den 14 Jahren seit der 1. Auflage dieses Bands hat sich die Entwicklung der Biotechnologie weiter beschleunigt. Das gilt sowohl für die Wissenschaft, die mit neuen Methoden zur „synthetischen Biologie“, zum Editieren ganzer Genome oder mit big data aus der Massensequenzierung von Genomen die belebte Welt immer genauer erschließt, wie auch für industrielle Anwendungen – im Pharma-Bereich stehen dafür immer zahlreichere Beispiele für therapeutische Antikörper, für companion diagnostics, also Bausteine einer individualiserten Medizin und für aus induzierten Stammzellen regenerierte Körperzellen, im technisch-industriellen Bereich der Megatrend zu einer Bioökonomie auf Basis nachwachsender Rohstoffe.
Eine grundlegende Überarbeitung aller Einträge wird in der dritten Auflage begleitet von einer Neugliederung: die grundlegenden Disziplinen der Biotechnologie, Mikrobiologie, Biochemie, Molekulargenetik, Zellbiologie und Bioverfahrenstechnik, werden nun in einer Einleitung dargestellt – darüber hinaus werden zahlreiche neue Trends wie Algentechnologie, Epigenetik, Metagenomics, oder Glykobiologie in eigenen Einträgen behandelt. Unter „Megatrends“ finden sich nun genauere Beschreibungen der Hochdurchsatz-Sequenzierung und der „synthetischen Biologie“, aber auch Beispiele für eine individualisierte Medizin oder die Bedeutung der Kohlenstoffquellen für die Bioökonomie.
Es versteht sich von selbst, daß die kurze Form eines Taschenatlas derartige Themen nur anreißen kann. Ich habe versucht, dieses Defizit durch aktuelle Hinweise auf weiterführende Literatur auszugleichen.
Mein herzlicher Dank gilt erneut meinen Kollegen und Freunden, die mich bei der Ausarbeitung der einzelnen Kapitel beraten haben. Ergänzend zu meiner Danksagung im Vorwort der 1. und 2. Auflage möchte ich hier nennen: Wolfgang Wohlleben, Universität Tübingen; Karin Benz, NMI Reutlingen; Ulrike Konrad, Protagen; Karl Maurer, ABEnzymes, Darmstadt; Bernhard Hauer, Georg Sprenger und Jürgen Pleiss, Universität Stuttgart; Ulrich Behrendt, München; Dirk Weuster-Botz, Universität München; Jörn Kalinowsky, Universität Bielefeld; Vlada Urlacher, Universität Düsseldorf und Frieder Scheller, Universität Potsdam.
Mein Dank geht erneut an Frau Ruth Hammelehle und Herrn Bernhard Walter von der Firma epline, Kirchheim/Teck, für die ausgezeichnete grafische und drucktechnische Gestaltung, sowie an Herrn Dr. Cicchetti, Herrn Dr. Sendtko und Frau Dr. Ley für die hervorragende verlagsseitige Betreuung. Frau Dr. Alexandra Prowald danke ich für die Erstellung eines ausgezeichneten Index.
Rolf D. Schmid Stuttgart, im Herbst 2015
Einführung
Dieser Taschenatlas wendet sich an Studierende der Biologie, Biochemie und Bioverfahrenstechnik, die einen Einstieg in die vielen Arbeitsgebiete der modernen Biotechnologie suchen. Es soll aber auch Pädagogen, Patentanwälten, Managern und Investoren ermöglichen, sich schnell ein aktuelles Bild zu machen über ein gerade interessierendes Thema der industriellen Biotechnologie und ihrer wissenschaftlichen Grundlagen. Auf 171 Farbtafeln wird dazu Wissen aus zahlreichen Einzeldiszip-linen angeboten, auf der dazugehörigen Textseite erläutert und mit einem umfangreichen Literaturverzeichnis ergänzt. Viele Seitenangaben in den Texten erlauben es zudem, Grundlagenwissen und Anwendungsgebiete besser miteinander zu verbinden.
Diese grundlegend überarbeitete und um viele neue Themen ergänzte 3. Auflage ist noch immer modular aufgebaut, aber anders gegliedert. Nach einem kurzen historischen Überblick beginnt das Buch nun mit knappen Abrissen der Grundlagen der modernen Biotechnologie: Mikrobiologie, Biochemie, Molekulargenetik, Zellbiologie und Bioverfahrenstechnik. Im zweiten Teil des Buchs folgen dann Übersichten zu den vielfältigen Anwendungen der Biotechnologie bei Lebensmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen, bei Industrieprodukten, bei der Enzymtechnologie sowie, besonders umfangreich, auf vielen Gebieten der Medizin, z. B. bei der Herstellung von Antibiotika, anderen Medikamenten, aber auch in der Medizintechnik. Abgeschlossen wird dieser zweite Teil mit vielen Beispielen für die Anwendung der Biotechnologie in der Landwirtschaft und beim Schutz der Umwelt. Ein dritter Teil des Buchs behandelt die großen aktuellen Megatrends der Biotechnologie: dazu gehören Genomanalysen und die Methoden der Bioinformatik zur Beherrschung von “big data” ebenso wie die großen Fortschritte bei der Zelltechnologie und Gentherapie, aber auch die Fortschritte hin zu einer „Bioökonomie”, die eines Tages das Erdöl-Zeitalter ablösen wird. Den Abschluss des Buchs bilden fünf Seiten zu den Themen Sicherheit und Ethik, die sich u. a. mit Patent- und Zulassungsfragen beschäftigen.
Ich hoffe, dass es gelungen ist, die wichtigsten Grundlagen, Ergebnisse und Trends dieser sich so schnell entwickelnden Querschnitts-Technologie auf wenig Raum zusammenzufassen und dem Leser/der Leserin nicht nur eine ansprechende und stimulierende Lektüre zu bieten, sondern ihn oder sie zu vertieften Studien anzuregen.
Einleitung
Frühe Entwicklungen
Geschichte. Die Ursprünge dessen, was wir heute Biotechnologie nennen, reichen in die Vorgeschichte zurück. Vermutlich standen am Anfang Erfahrungen um den Verlust von Nahrungsmitteln durch mikrobiellen Verderb und um deren Konservierung durch Trocknen, Salzen oder Zuckern, wahrscheinlich auch der „heilige Rausch“ nach dem Genuss vergorener Getränke. Wie frühgeschichtliche Dokumente belegen, entstanden mit der Entwicklung arbeitsteiliger Stadtkulturen erste Verfahrensvorschriften, in Europa zur Herstellung von Brot, Bier, Wein und Käse und zum Gerben von Haut zu Leder, in Asien zur Gewinnung von Essig, Reiswein und fermentierter Lebensmittel wie Sauerkraut (China), Kimchi (Korea) oder Gari (Indonesien). Im Abendland waren es die Klöster mit ihrer guten Infrastruktur, die seit dem 6. Jahrhundert die Kunst des Brauens, Kelterns und Backens weiterentwickelten. Der Devise Liquida non fragunt ieiunium („Flüssiges bricht nicht das Fastengebot“) verdanken wir die kräftigen und alkoholreichen Starkbiere. Die moderne Biotechnologie nahm ihren Ausgang von der stürmischen Entwicklung der Mikrobiologie im späten 19. Jahrhundert und wurde im Schatten der beiden Weltkriege durch die Leistungen von Chemikern, Mikrobiologen und Ingenieuren im Umfeld der Lösemittel- und Antibiotika-Herstellung industriell etabliert. Viele großartige Entdeckungen der Biochemie, der Genetik und der Zellbiologie legten den Grundstein für die molekulare Biotechnologie, die seit ca. 1970 mit der Gentechnik, seit ca. 1980 mit der Zelltechnologie, seit ca. 1990 mit der Bioinformatik und in jüngster Zeit mit der Genom- und Proteomforschung eine Querschnitts- und Schlüsseltechnologie für das 21. Jahrhundert bildet.
Frühe Pioniere und Produkte. Die Biotechnologie ist eine anwendungsbezogene Wissenschaft – viele ihrer Aufgabenstellungen haben wirtschaftliche Motive. Louis Pasteur, ein französischer Chemiker, setzte erstmals 1864 das Mikroskop zur Verlaufskontrolle der Weinund Essigherstellung ein. Mit zwei technischen Kunstgriffen – der Reinkultur von Mikroorganismen und der Sterilisation ihrer Nährmedien (Pasteurisieren) – legte er den Grundstein für die angewandte Mikrobiologie und weitete sie mit seinen Schülern auf die Erforschung und Bekämpfung pathogener Mikroorganismen aus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen der deutsche Chemiker Otto Röhm und der Japaner Jokichi Takamine auf die Idee, Enzyme aus Schlachttierabfällen bzw. aus Kulturlösungen von Schimmelpilzen als technische Hifsmittel einzusetzen. Röhm revolutionierte damit die Lederverarbeitung (als Enzymquelle wurde bis zu diesem Zeitpunkt Hundekot verwendet), Takamine die Verarbeitung von Malz und Stärke. Im öffentlichen Bereich war die Einführung der aeroben und anaeroben Abwasserreinigung um 1900 ein Meilenstein bei der Prävention von Seuchen. Während des 1. Weltkriegs entwickelte Carl Neuberg in Deutschland die Herstellung von Glycerin mit Backhefe, Charles Weizmann, ein russischer Emigrant jüdischer Herkunft, in England die fermentative Herstellung von Aceton durch anaerobe Fermentation von Clostridien-Stämmen. Beide Rohstoffe waren kriegswichtig zur Herstellung von Sprengstoffen (Nitroglycerin bzw. Cordit) und gaben der Fermentations-Industrie einen ersten Auftrieb. Die Balfour-Deklaration und die spätere Gründung des Staates Israel, dessen erster Präsident Weizmann wurde, geht unmittelbar auf dessen Verdienste im 1. Weltkrieg zurück. In der Nachkriegszeit erreichte das Koppelprodukt der Aceton-Fermentation durch Clostridien, 1-Butanol, als Lösemittel für Autolacke große Bedeutung. Die Zufallsentdeckung der antibakteriellen Wirksubstanz Penicillin durch Alexander Fleming (1922), durch Howard Florey erstmals als chemische Substanz isoliert, löste während des 2. Weltkriegs die industrielle Produktion von Antibiotika aus. 1950 hatte man bereits über 1000 verschiedene Antibiotika isoliert, von denen viele in großer Menge für die Humanmedizin und zunehmend auch für die Tierproduktion und den Pflanzenschutz eingesetzt wurden. Seit ca. 1950 begann die Industrialisierung der analytischen Biotechnologie, bei der man für die hochselektive Detektion von Metaboliten in Körperflüssigkeiten oder Lebensmitteln zuerst Enzyme, später Antikörper verwendete. Ab ca. 1965 diskutierte man, im Schatten der Ölkrisen und der Bevölkerungsexplosion, die Konversion von Biomasse zu den Energieträgern Ethanol und Methan und die Herstellung von Einzellerprotein. Auch jetzt, 2014, sind Bioraffinerien und Biotreibstoffe aktuelle Themen.
Biotechnologie heute
Gentechnik und Zellbiologie. 1973 gelang es Stanley Cohen und Herbert Boyer in San Francisco zum ersten Mal, ein fremdes Gen gezielt in einen Wirtsorganismus zu übertragen und dort zur Expression zu bringen. Von da ab dauerte es etwa 10 Jahre, bis das erste gentechnisch erzeugte Medikament zugelassen wurde. Heute sind hunderte gentechnisch hergestellter Medikamente und Therapeutika zugelassen, darunter Produkte wie Insulin (bei Diabetes), Erythropoietin (bei Blutarmut), Faktor VIII (bei Bluterkrankheit) und β-Interferon (bei multipler Sklerose), rekombinante Antikörper und Vakzine – und viele weitere befinden sich in der Entwicklung. Stand in den Anfangsjahren die medizinische Forschung im Mittelpunkt, so verfiel man bald darauf, die neuen gentechnischen Methoden auch auf landwirtschaftliche Fragestellungen anzuwenden. So züchtete man transgene Pflanzensorten, die Resistenz-Faktoren gegen Herbizide oder Insektenfraß enthalten. In der chemischen Industrie wächst die Zahl der Syntheseschritte mit Hilfe von Mikroorganismen oder Enzymen (Biokatalyse), seit diese gentechnisch an die industriellen Erfordernisse angepasst werden können. Aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugte Biopolymere beginnen, petrochemisch erzeugte Kunststoffe zu ersetzen und begründen damit eine „Bioökonomie“, zu der auch neue Energieträger wie Bioethanol, Biogas oder Biodiesel gehören werden. Sie verändern das Gesicht der Landwirtschaft in großem Stil. Im Mittelpunkt des wissenschaftlichen wie auch des medizinischen Interesses stehen heute die Genomforschung und die Zelltechnik. Angetrieben von immer leistungsfähigeren Geräten und der Rechenkraft von Supercomputern, ist die Sequenzierung eines menschlichen Genoms bereits fast Routine. Man nutzt Genom-Daten, um durch funktionelle Genomforschung Aufschluss über die molekularen Ursachen komplexer Krankheitsbilder zu erhalten, und mit Gentherapie unternimmt man Versuche, kranke durch gesunde Gene zu ersetzen. Auch die Tier- und Pflanzenzucht kommt durch genomische Informationen immer schneller voran. Können Pflanzen bereits seit ca. 50 Jahren aus undifferenzierten Zellkulturen regeneriert werden, so ist das bei menschlichen Zellen seit einigen Jahren mit embryonalen oder induzierten pluripotenten Stammzellen ebenfalls möglich, woraus sich völlig neue Ansätze für eine „Reparatur“ kranker Gewebe ergibt.
Akzeptanz. Das 1998 geborene Schaf Dolly war das erste aus den Körperzellen der Mutter klonierte und mit dieser genetisch identische Lebewesen. Die Stoßrichtung derartiger Forschungsrichtungen, z. B. der Embryonenforschung, und die atemberaubende Schnelligkeit des Fortschritts hat viele gesellschaftliche Diskussionen in Gang gesetzt. In welchem Zellstadium soll der Schutz menschlichen Lebens beginnen? Wie soll der Einzelne, die Gesellschaft und die Versicherungswirtschaft mit deterministischen Einsichten in das Krankheitsrisiko eines Individuums umgehen? Wie verändern erfolgreiche genetische Therapien die Altersstruktur einer Gesellschaft? Welche ökologische Risiken lösen wir mit einem mutwilligen, vorrangig ökonomisch begründeten Eingriff in die biologische Diversität aus? Welche Konsequenzen haben Biotechnologie und Gentechnik für die Entwicklungsländer?
Grundlagen. Die vielfältigen und ständig zunehmenden Anwendungen der Biotechnologie und der Gentechnik werden im Hauptteil dieses Taschenbuchs behandelt, gefolgt von aktuellen „Megatrends“ (2014), zu denen auch die Bioinformatik gehört. Im ersten Teil sollen dagegen die multidisziplinären Grundlagen der Biotechnologie skizziert werden. Der historischen Entwicklung entsprechend, ist dies zuerst einmal die Mikrobiologie. Ihr folgen wesentliche Aspekte der Biochemie, der Lehre von der Chemie lebender Organismen, von ihrem Stoffwechsel und dessen Regulation. Eine wesentliche Eigenschaft von Lebewesen ist ihre Fähigkeit zur Vermehrung – deshalb werden die Grundlagen der Molekulargenetik und der Gentechnik ausführlich dargestellt. Die Biologie höherer Zellen und um ihr Zusammenspiel in vielzelligen Organismen ist thematischer Schwerpunkt der Zellbiologie. Schließlich benötigen alle industriellen Anwendungen der Biotechnologie und der Gentechnik einen Produktionsschritt – dies ist die von Ingenieuren geprägte Disziplin der Bioverfahrenstechnik. Es versteht sich von selbst, dass diese umfangreichen Wissensgebiete in einem Taschenbuch nur angerissen werden können. Zu beinahe jeder Themenseite wird deshalb auf weiterführende Literatur verwiesen.
Mikrobiologie
Viren
Allgemeines. Viren sind infektiöse Partikel ohne eigenen Stoffwechsel. Ihr genetisches Programm ist entweder in DNA oder RNA niedergelegt, deren Replikation mit Hilfe lebender Wirtszellen erfolgt. Bei der Vermehrung des Virus wird meist eine Protein-Hülle (Capsid) gebildet, die außerhalb der Wirtszelle die virale Nucleinsäure umschließt (Viruspartikel, Nucleocapsid). Viren können die meisten lebenden Organismen infizieren, sind dabei aber fast immer wirtsspezifisch und oft sogar auf bestimmte Gewebe oder Zellen spezialisiert. Man unterscheidet Viren nach ihrer Wirtsspezifität, ihrer Morphologie, dem Nucleinsäure-Typ (DNA/RNA) und dem Aufbau des Capsids. In der medizinischen und veterinärmedizinischen Forschung spielt die Diagnose und Behandlung von Virus-Erkrankungen wie AIDS (HI-Virus), Vogelgrippe (H5N1-, H7N9-Virus), hämorrhagischem Fieber (Ebolavirus) oder Rinderpest (Morbillivirus) eine sehr wichtige Rolle (→248). In der Biotechnologie verwendet man Viren zur Entwicklung von Komponenten-Vakzinen (→250) und zur Herstellung von Vektoren und Promotor-Elementen, z. B. für die Gentherapie und die Expression von Genen in tierischen Zellkulturen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!