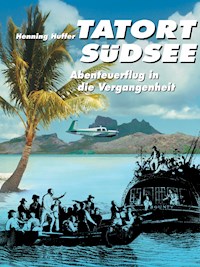
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Weltrundflug in einer einmotorigen Sportmaschine gelang Henning Huffer mit eben 60 Stunden Flugerfahrung. Es folgten vier weitere. Einer von ihnen ist Gegenstand dieses Buches. Mehr als 40 Flugzeugüberführungen von Amerika über die Ozeane dieser Welt und etliche tausend Stunden als Linienpilot im europäischen Streckennetz der Lufthansa verstand der promovierte Jurist offenbar mühelos mit seiner Rechtsanwaltskanzlei in Karlsruhe und ausgedehnter Vorlesungstätigkeit über internationale Rechtssysteme zu verbinden. Er selbst bezeichnet sich salopp als Berufsabenteurer und Hobbyanwalt. Aus einer Arztfamilie stammend gingen seine Neigungen zunächst in andere Richtung. Die Grundlage für Studium und Pilotenschein schuf sich der regsame Autor als Skilehrer, wirkte später als Keyboarder in einer Rockgruppe, ehe er mit moderner Lyrik den Fuß aufs literarische Parkett setzte. Über seine Flugabenteuer sind wiederholt Beiträge im Fernsehen und der Zeitschrift GEO erschienen. Wolfgang Freund
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henning Huffer
Tatort Südsee
Abenteuerflug
in die Vergangenheit
Vorwort
Bis heute zählt die Meuterei auf der Bounty zu den bekanntesten Schiffsrevolten der christlichen Seefahrt. Seit im Jahre 1789 jene Handvoll Männer den Dreimaster in ihre Gewalt brachte und sich auf eine Reise ohne Wiederkehr begab, ist die Südsee der Inbegriff nostalgischer Verheißung.
Vieles von dem, was sich damals zwischen Tonga und Tahiti zugetragen hat, zerfloß mit der Intuition kreativer Romanschreiber. Anderes verschwand hinter der Fassade glitzernder Hollywood-Produktionen. Einiges ist noch heute dunkel und geheimnisvoll.
Wieviel vom Bounty-Mythos ist Wahrheit, wieviel Legende? Was sind das für Inseln, die der Bounty zum Schicksal wurden? Welches waren die wirklichen Hintergründe der Meuterei? Und: Was ist aus den Meuterern und ihren Nachkommen geworden?
Dort, wo alles geschah, habe ich versucht, Antworten zu finden. Die Ereignisse, denen ich nachgegangen bin, sind Geschichte. Und doch sind sie voll lebendiger, mitreißender Anziehungskraft. Kaum jemand, der inmitten der vielen so vollendet ineinander greifenden Sachzwänge nicht selber schon mit der Idee geliebäugelt hat, einen Strich zu ziehen, auszubrechen aus dieser spröden Assekuranzwelt, irgendwo auf einem fernen, sauberen Stückchen Erde neu anzufangen. Und wer spürt nicht dann und wann in sich die Sehnsucht nach dem großen Abenteuer?
Mir ist es so ergangen. Mein Element wurde die Fliegerei. Und beim Entdecken neuer Horizonte kam es zu diesem Flug in die Vergangenheit, zu einer Zeit, als die Satellitennavigation noch nicht in Gebrauch war.
Henning Huffer
„Das ist die beste Beschreibung, welche ich von diesen Inseln zu geben vermochte und von ihren Bewohnern, die zweifellos die Glücklichsten sind auf dem Antlitz der Erde.“
Aus dem Tagebuch von Bounty-Meuterer James Morrison, 1792
In der Hoffnung, daß es nach 200jähriger Kolonialepoche auch den letzten Bewohnern der Südseeinseln gelingt, aus noch immer andauernder französischer Abhängigkeit freizukommen.
Henning Huffer, 1998
1. Begegnung in Tonga
Es war Mitsommernacht gegen 3.00 Uhr morgens. Über zehn Stunden saß ich bereits im Cockpit, umgeben von Zusatztanks und in einem Zustand visionärer Müdigkeit. Unter mir, knapp 4 km weg, lag der Stille Ozean in samtenem Schwarz, darüber wölbte sich ein sternenklares Firmament von poetischem Tonus. Nach meinen Berechnungen befand ich mich halbwegs zwischen Samoa und Hawaii.
In dieses Schweben zwischen Wachsein und Traum stiegen Erinnerungen auf an meine zu Ende gegangene Zeit in der Inselwelt der Südsee, von der ich mit geschätzten 230 km/h in Richtung Norden Abstand gewann. Einer, der mir dabei in den Sinn kam, war Bill Verity. Der Amerikaner durchstreifte damals auf ähnlich unkonventionelle Weise den Pazifik wie ich. Ihm war es geglückt, einer Fernsehgesellschaft ein bescheidenes Reisebudget abzuhandeln mit der Idee, in einem offenen, bloß 7 m langen Boot von Tonga6000 km über offene See nach Indonesien zu kreuzen. Er nahm aus freien Stücken das bedauernswerte Los einer Gruppe von Seeleuten auf sich, die diese halsbrecherische Tour vor 200 Jahren unfreiwillig durchstehen mußten. Es war die Fahrt von Captain Bligh und seiner Getreuen, die Verity sich zur Nachahmung auserwählt hatte. Diese Herren waren bekanntlich im Anschluß an eine Meuterei mitten im Pazifik in einem Ruderboot ausgesetzt worden.
Ich war Verity zufällig auf Tonga begegnet, einige Tage vor meinem Abflug. Schon ein kursorischer Blick auf sein Duplikat des Bounty-Kutters weckte Zweifel, ob Verity sich wirklich mit der nötigen Präzision dem Original verpflichtet fühlte.
„Hm, ich bin nicht sicher, Bill“, gab ich vorsichtig zu bedenken „ob Captain Bligh damals einen Außenbordmotor mit ...“
„Dafür hatte er 18 Begleiter in seinem Boot, die er bei Windstille abwechselnd rudern ließ“, fiel Verity mir ins Wort und zog trotzig an seiner Pfeife.
Okay, den Motor konnte man durchgehen lassen. Denn Verity nahm tatsächlich keine Ruderer mit. Nicht so gut konnte er freilich seine 5 m hohe Gitterantenne am Heck des Bootes verteidigen, die zusammen mit einem Funkgerät die Verbindung zur Außenwelt sicherte. Ansonsten war aber das Schiffchen samt Ausrüstung der historischen Vorlage exakt nachempfunden, wie Verity seinen Besuchern anhand eines zeitgenössischen Bauplans nachwies.
Obwohl das Vorhaben keine besondere Faszination auf mich ausübte, hätte ich hier oben in meinem Cockpit gerne gewußt, wie es Verity unterdessen ergangen war und wo in diesem endlos weiten Weltmeer er sich mit seinem Boot gerade befand.
Mein Flugzeug jedenfalls lag gut in der Luft, ruhig wie ein Brett. Der Motor lief gleichmäßig. Die Breiten um den Äquator („Kalmen“) sind ja bekannt für Windstillen, früher ein spürbares Handikap für die Seefahrer.
Warum es Verity ausgerechnet das strapaziöse Erlebnis des harschen Kapitäns angetan hatte? Mein Interesse und meine Sympathien galten eher den Meuterern. Diese Leute hatten sich gewiß eine prächtige Zeit gemacht, nachdem sie den alten Scharfmacher los waren.
Ich vermochte mich mühelos in ihre Lage zu versetzen. Ja, es bedurfte nicht viel Phantasie, genau das Empfinden aufkommen zu lassen, welches diese Männer gehabt haben mußten: allein inmitten eines unermeßlichen Ozeans, abgeschnitten von allen Verbindungen zur Heimat, die Inseln der Träume in Griffweite und doch insgeheim die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Sicher war für sie nur eines: Ein Zurück gab es nicht mehr. Immerhin war nicht ausgeschlossen, daß Capt. Bligh nach England durchkam. Und dann würde die britische Admiralität gewiß nichts unversucht lassen, dieser Männer habhaft zu werden.
Wenn alles nach Plan lief, lagen noch rund 11 Stunden Flugzeit, also etwas mehr als die Hälfte der Strecke vor mir. Der rückwärtige Zusatztank, ein 200-Liter-Faß, war bereits leer geflogen. Der Tank rechts neben mir, wo sich normalerweise der Copilotensitz befand, sollte noch etwa dreiviertel voll sein, und die beiden Standardtanks in den Tragflächen waren noch unangetastet. Insgesamt konnte ich noch mit einem Spritvorrat von ca. 350 Litern rechnen. Das entsprach 12 Stunden Flugzeit und ergab, wenn die meteorologischen Daten zum Höhenwind zutrafen, eine Reserve von einer guten Stunde.
Was wohl aus den Bounty-Meuterern geworden ist? Die Frage begann mich zu beschäftigen. Wie hatten sie ihr Los gemeistert? Auf welchen Inseln hatten sie Zuflucht gesucht? Vielleicht war eine darunter, auf der auch ich gewesen bin und gleichfalls mit dem Gedanken gespielt habe, nicht mehr nach Hause zurückzugehen.
Situationen so überwältigender Verlassenheit öffnen das Gemüt offenbar besonders tief für Eingebungen jenseits von Zeit und Raum. In mir jedenfalls setzte sich in jener Nacht eine sehnsuchtsvoll-schwerblütige Neugier nach dem Geschick der Bounty-Meuterer fest.
Über 21 Stunden Flugzeit waren es am Ende, als ich zur Mittagsstunde in Honolulu eintraf. Einige Tage später brachte ich auch die4000 km nach San Francisco hinter mich. Nach drei ruhelosen Monaten in Amerika traf ich Ende Oktober auf meinem Heimatflugplatz Karlsruhe ein. Und noch immer gingen mir die Bounty-Meuterer durch den Sinn und jene nächtlichen Träumereien über dem Pazifik.
Die Idee saß tief. Das Herz war voll. Die Sehnsucht brannte. Ein intensives Arbeitspensum, unerwartet günstige Geschäfte, eine Reihe intelligenter Weichenstellungen mit diversen Geldgebern und schon sieben Monate später fand ich mich wieder hinter dem Steuerknüppel meiner Mooney, um in der Südsee nach den Spuren längst verstorbener Seefahrer zu suchen, nach den Schicksalen der Bounty-Meuterer, denen ich mich schon so nahe gefühlt hatte.
2. Gegenwart und Geschichte
„Ich benötige Material über Capt. Bligh und die Bounty“, sagte ich. Dr. Vincent S. Kitching, ein jüngerer Gelehrter mit weit geschnittener, brauner Tweedjacke und moosgrünem Binder, war augenblicklich im Bilde. Er entfernte sich mit einem kurzen, indifferenten Kopfnicken. Zehn Minuten später erschien er wieder und legte behutsam einen schweren, handgeschriebenen Folianten auf den Tisch: das Original-Logbuch der Bounty, verfaßt von Captain William Bligh.
Mein Anliegen war vordergründig nicht das Analysieren historischer Dokumente. Entschieden mehr zog mich der Gedanke an, die Uhr in jene Zeit zurückzudrehen und ebenso verwegen wie die Bounty-Besatzung, sozusagen mit der Hand am Pulse des Lebens, der Vergangenheit vor Ort auf den Grund zu gehen. In der endlosen Weite des Stillen Ozeans wollte ich herausfinden, womöglich nacherleben, was jener Handvoll Männer widerfahren war, als sie in einem spontanen Handstreich der Heimat für immer Lebewohl sagten und ihre lebenslange Flucht im sagenumwobenen Inselreich der Südsee besiegelten.
Gleichwohl: Ganz ohne Quellenstudium einem so geschichtsträchtigen Ereignis nachzuspüren, erschien mir dann doch zu oberflächlich. Als ich an einem sonnigen Maitag am Flugplatz Karlsruhe den Triebwerkshebel auf Vollgas schob und meine kleine Mooney Chaparral steil in Gottes blauen Himmel zog, hatte ich mir bereits vorgenommen, erst einmal in London Station zu machen und nach bewährtem wissenschaftlichem Brauch in den Archiven der britischen Admiralität den Forscherpult zu drücken.
Um hohe Landgebühren und Wartezeiten in der Luft zu vermeiden, entschied ich mich für Stansted, den ruhigsten der vier Londoner Flughäfen. Stansted liegt 40 km nordöstlich von London. Mein Flug dauerte etwas über drei Stunden. Ein Taxi brachte mich in das nahe gelegene Städtchen Bishop’s Stortford. Dort nahm ich einen Vorortzug, der nach einer knappen Stunde Fahrzeit in den belebten Bahnhof Liverpool Street Station in Londons Stadtzentrum einrollte.
Am Beginn der Chancery Lane, nur ein paar Straßenecken entfernt von der Stelle, wo ich nach kurzer Fahrt im ersten Obergeschoß eines scharlachroten Doppeldeckerbusses mich zu Fuß weiterbegab, dirigierte mich ein hilfsbereiter Passant zum Public Record Office, dem meine Reise galt.
In diesen düsteren Mauern wob der Geist der Geschichte. Man brauchte nur den Fuß über die Torschwelle des neugotisch gestalteten, reich verzierten Baues zu setzen, um den Atem vergangener Jahrhunderte zu spüren. Bis unters Dach waren die weitläufigen Lesesäle und Wandelgänge des königlich-britischen Staatsarchivs gefüllt mit Urkunden, Büchern und Handschriften, unbestechlichen Zeugen von Englands leuchtender Vergangenheit.
In einer ebenmäßigen, leicht lesbaren, wenn auch stark vergilbten Schreibschrift war auf dem schweren Pergament des Logbuchs minuziös der wechselvolle Verlauf von Capt. Blighs Fahrt in die Südsee aufgetragen. Doch nicht nur das. Das Logbuch enthielt umfangreiche völkerkundliche Detailschilderungen, liebevoll eingeflochtene Beobachtungen aus der Tierund Pflanzenwelt. Es war gleichzeitig noch Tagebuch und Reisebericht.
Ausgiebig schildert Capt. Bligh die Meuterei und liefert genaue Personenbeschreibungen der Meuterer.„Piraten“brandmarkt er sie, weil sie ihm ja nicht nur das Kommando entrissen, sondern obendrein noch das Schiff weggenommen haben.
Noch während ich staunend dieses erstaunliche Schriftwerk in mich aufnahm, ließ Dr. Kitching durch einen Mitarbeiter bereits das nächste Aktenkonvolut auf meinem Lesepult absetzen. Es enthielt die Originalprotokolle des Kriegsgerichtsverfahrens, in dem die Meuterei auf der Bounty verhandelt worden war. Auch darin fand sich eine Fülle aufregenden Lesestoffs. Bei den umfangreichen Zeugenverhören, Urkundenverlesungen und Plädoyers, die peinlich genau aufgezeichnet waren, blieb kaum ein Detail des dramatischen Geschehens unerwähnt.
Das Public Record Office entpuppte sich als eine Fundgrube von Format. Ich fand mehrere Briefe, die Capt. Bligh von unterwegs an die Admiralität geschrieben hatte. Selbst ein vergleichsweise so nebensächliches Schriftstück wie die Musterrolle der Bounty war noch erhalten. Sie gab Auskunft über die Namen aller Besatzungsmitglieder, ihren Rang, ihr Alter. Sogar ihre Geburtsorte waren notiert.
Dr. Kitching wies mich darauf hin, daß zu diesen Originalia populärwissenschaftliche Abhandlungen und Monografien erschienen waren. So wechselte ich später zur Bibliothek im Britischen Museum und begann, das Bounty-Schrifttum zu sichten. Das erwies sich als eine literaturwissenschaftliche Aufgabe ungeahnten Ausmaßes. Was seit 1789 zu diesem Thema (ganz überwiegend in englischer Sprache) publiziert worden ist, läßt sich nicht mehr überblicken. In mein Literaturverzeichnis trug ich ein: „Die wahre Geschichte der Meuterei auf der Bounty“, „Die Ursachen der Bounty-Meuterei“, „Was geschah auf der Bounty“, „Die ereignisreiche Historie der Meuterei und des Piratenraubs der H.M.S. Bounty“ und Ähnliches in großer Zahl. Mit jedem weiteren Buch, das ich aufschlug, stieß ich auf neue, verblüffende Quellen.
Drei Wochen sah man mich als emsigen Bücherwurm von früh bis spät zwischen Public Record Office und Britischem Museum hinund hereilen im eifrigen Bemühen, den Überblick über die immer weiter anschwellende Literatur zu behalten.
Es kam die Zeit, die Gedanken auf die Reiseroute zu richten. Daß ich meinen Transport in eigene Hände genommen hatte, erwies sich als eine Maßnahme von feinem Gespür. Nur wenige Inseln, an denen die Bounty anlegte, lassen sich ohne weiteres mit dem erreichen, was man gemeinhin unter öffentlichen Verkehrsmitteln versteht. Vorteile versprach vor allem der kompakte Zuschnitt meines Flugzeugs. Diese Eigenschaft ermöglichte mir Zugang auch zu den lauschigen Korallenpisten entlegener Atolle, dorthin also, wo Interkontinentaljets für immer ausgeschlossen waren.
Auf der anderen Seite finden sich im Pazifik Strecken von beträchtlicher Abmessung. Hier hätte unstreitig ein stabileres Gefährt die Aussichten auf eine sichere Rückkehr in die Heimat vergrößert. Freilich ohne den Kitzel des Abenteuers, ohne das schwärmerische Gefühl, sich den Pazifik mit eigener Kraft und Tüchtigkeit zu erobern, äußert eine solche Reise nur den halben Reiz.
Beladen mit Manuskripten, Büchern und neuen, beachtlichen Geschichtskenntnissen strebte ich von der Themsestadt in Richtung Schweden.
3. Nach dem höchsten Willen seiner Majestät
„Seine Majestät der König geruhet gnädigst die Vorstellung der Kaufleute und Pflanzer seiner westindischen Besitzungen für gut zu finden, daß die Einführung des Brotfruchtbaumes in den dortigen Inseln den Einwohnern eine Art Nahrung und dadurch den wesentlichsten Vorteil gewähren würde. So werdet Ihr, Lieutenant William Bligh, hiermit, zufolge des höchsten Willens seiner Majestät, requiriert und angewiesen, mit dem Euch untergebenen Schiffe in See zu gehen und Euch so schnell als möglich um das Kap Hoorn nach den im Südlichen Ocean gelegenen Societätsinseln zu begeben, woselbst zufolge der Nachrichten des seligen Capt. Cook der Brotfruchtbaum in seinem üppigsten Wachstum angetroffen wird. Nachdem Ihr so viele Bäume und Schößlinge, als nöthig erachtet werden dürfen, an Bord genommen habt, sollt Ihr um das Vorgebirge der Guten Hoffnung nach Westindien gehen und die alsdann noch am Leben gebliebenen, vorerwähnten Bäume in Seiner Majestät botanischen Gärten zu St. Vincent und zu Jamaica abliefern.
Gegeben, den 20sten November 1787.
Die Lordscommissarien der Admiralität von Großbritannien und Irland.“
Mit dieser schriftlichen Orderan Bord ließ Capt. Bligh am 29. November 1787 in Spithead, dem Ankerplatz der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, Segel setzen. Das ihm untergebene Schiff war die Bounty, zu deutsch „Wohltat“. Sie galt schon damals als nicht gerade groß. Ganze 28 m war sie lang und wog 250 Tonnen, also so viel wie ein heutiger Hafenschlepper. Das Marinedirektorium hatte den Dreimaster gebraucht zum Preis von1950 Pfund Sterling gekauft, für Umbau und Ausrüstung allerdings über 4000 Pfund aufwenden müssen. Ein Großteil davon war in die Vorrichtungen geflossen, die der Aufnahme und dem sicheren Transport der Brotfruchtpflanzen dienen sollten. Die große Kajüte, die den gesamten rückwärtigen Teil des Schiffes einnahm, war dafür in eine Art Treibhaus umgewandelt worden. Stellagen für über 1000 Töpfe, Zuber und Kasten füllten den Raum bis zum letzten Winkel. Es gab Öffnungen für Licht und Luft sowie ein feinsinniges Röhrensystem, welches das von den Pflanzen ablaufende Wasser zur Wiederverwendung in Tonnen ableitete.
Zweck aller früheren Reisen in die Südsee, so Capt. Bligh, war die Erweiterung der Wissenschaft und die Vermehrung der Kenntnisse gewesen. Die jetzige Reise hingegen stelle eigentlich die erste dar, die zur Absicht habe, aus den gemachten Entdeckungen in fernen Gegenden Vorteile zu ziehen. Um was für Vorteile es sich dabei handelte, war in dem königlichen Erlaß mit majestätischer Noblesse umschrieben. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das Unternehmen aber als gar nicht so edel und selbstlos, wie die galanten Formulierungen glauben machen könnten. In dem Brotfruchtbaum, der in Westindien unbekannt war, erhofften sich die englischen Plantagenbesitzer nämlich nichts anderes als eine neue, billige Nahrungsquelle für ihre Negersklaven.
Den Anstoß hatte ein zeitgenössischer Bericht gegeben. Wenn jemand, heißt es darin, in seinem Leben zehn Brotfruchtbäume pflanzt, wozu er allenfalls eine Stunde benötigt, so hat er für seine Familie und kommende Generationen seine Pflicht so vollständig erfüllt wie ein Bewohner unseres weniger gemäßigten Himmelsstrichs, der im kalten Winter pflügt und in der Sommerhitze die Ernte einbringt, so oft diese Jahreszeiten wiederkehren.
Was ist das für eine erstaunliche Pflanze, der Brotfruchtbaum?
Von den Seefahrern, die im 17. und 18. Jahrhundert die großen Entdeckungsreisen in den Pazifik unternahmen, stammen die ersten genauen Beschreibungen des Brotfruchtbaumes. Danach läßt er sich am ehesten mit einer mittelgroßen Eiche vergleichen. Gewöhnlich hat er eine weit ausladende Krone. Seine Blätter werden bis zu einem halben Meter lang und haben tiefe, bogenförmige Einschnitte. Wie Feigenblätter geben sie einen weißen Milchsaft von sich, wenn man sie verletzt. Die Früchte selbst haben die Größe und Gestalt eines Kinderkopfes. Sie wachsen allein und bilden keine Trauben. Ein feines, netz förmiges Gewebe überzieht ähnlich wie bei einer Trüffel die hellgrüne Oberfläche.
Ehe man die Brotfrucht ißt, wird sie im Feuer geröstet. Dabei verkohlt die Rinde. Zieht man die äußere schwarze Borke ab, kommt das Eßbare zum Vorschein. Es ist weiß wie Schnee und hat beinahe die Festigkeit von frisch gebackenem Brot. Die Frucht enthält weder Samen noch Steine, sondern alles ist reine, brotähnliche Masse. Außer vielleicht einem geringen Grad von Süße besitzt das Fruchtfleisch keinen hervorstechenden Geschmack.
Mit diesem Manna, das sich buchstäblich vom Baume pflücken ließ, sollte also fortan das Gesinde auf den westindinischen Baumwollplantagen seinen Hunger stillen.
Kaum daß die Bounty ihre Anker gelichtet hatte, änderte sich das bis dahin so günstige Wetter. Ein genau von vorn einfallender, stürmischer Wind hinderte das Schiff immer wieder daran, aus der Meerenge zwischen Portsmouth und der davorliegenden Insel Isle of Wight herauszukommen. Mehr als drei Wochen lavierte Bligh mit seinen Leuten zwischen St. Helens und Spithead hin und her, ehe er am 23. Dezember 1787 bei günstigerem Wind endlich offene See gewann und im Ärmelkanal seinen Kurs in Richtung Südatlantik aufnehmen konnte.
Die Bounty hatte Proviant für ein halbes Jahr an Bord. Weil damals noch keine Kühleinrichtungen existierten, klingt die Auswahl an Lebensmitteln, mit denen die Vorratskammern im Schiffsbauch bestückt waren, für Feinschmeckerohren einigermaßen deprimierend. Neben dem obligaten Schiffszwieback fanden sich dort etwa Sauerkraut, Suppengallerte, getrocknetes Malz, Käse, Gerste und Weizen. Allerdings war Vorsorge getroffen, daß das Menü dann und wann durch eiweißreichere Kost ergänzt wurde. Zum Proviant gehörten nämlich auch einige Stücke lebendes Vieh. Leider gerieten diese armen Schweine, Schafe und Hühner bei monotoner Kost, eingepfercht in dunkle, enge Käfige und verängstigt durch das Schwanken des Schiffs, so aus ihrem seelischen Gleichgewicht, daß, wenn sie schließlich in den Kochtopf gelangten, nur selten eine größere Ausbeute an genießbarem Frischfleisch zu erzielen war.
Um mit den Insulanern Handel treiben zu können, hatte Bligh von der Admiralität einen Vorrat an Spielsachen und Eisenwaren mitbekommen. Dort, wo die Bounty hinsegelte, herrschte Steinzeit, und so konnte man die Eingeborenen mit einem Nagel, einer Schere oder ein paar Glasmurmeln in einen Taumel der Begeisterung versetzen.
Das Gebiet, in dem diese Steinzeitmenschen lebten und in dem der Brotfruchtbaum so prächtig gedieh, hieß damals der„Südliche Ocean“, heute bekannt unter dem Namen Südpazifik, kurz auch Südsee geheißen. Es ist der südlich vom Äquator liegende Teil des größten Weltmeeres. Im Westen von Australien und Asien, im Osten von Amerika begrenzt, bedeckt der Stille oder Pazifische Ozean mehr als ein Drittel der gesamten Erdoberfläche.
Die Mehrzahl der zigtausend kleinen und kleinsten pazifischen Inseln liegt in der Südsee, so auch die Gruppe der Societätsinseln, zu denen die Bounty unterwegs war. Dieses Archipel, das in modernen Karten den Namen Gesellschaftsinseln trägt, besteht aus 14 Inseln. Die größte und bekannteste unter ihnen ist Tahiti, und auf ihr sollte sich Capt. Bligh die Brotfruchtbäume besorgen.
18000 km waren es bis Tahiti, vorausgesetzt die Reise verlief nach Plan. Doch kaum auf hoher See wurden Bligh und seine Männer bereits auf die erste Zerreißprobe gestellt. Einen Tag nach dem Weihnachtsfest, das sie noch froh hatten begehen können, wurden sie von einem gewaltigen Sturm überrascht.
„Eine Welle brach über uns und schwemmte unseren Vorrat an Stengen und Rahen von einer Seite des Püttings gänzlich mit sich fort; eine andere noch furchtbarere Welle kam in das Schiff und zertrümmerte unsere Boote. Einige Fässer mit Bier, die wir auf dem Verdecke befestigt hatten, wurden losgerissen und weggeschwemmt, und es kostete viel Mühe und Gefahr, die Boote so zu sichern, daß sie nicht ganz über Bord gingen.“
Drei Tage wütete der Sturm, und die Mannschaft mußte viel ausstehen. Die Bounty schwamm auf der Höhe von Portugal, als sie von dem Unwetter heimgesucht wurde. Wie sich zeigte, war dies allerdings erst ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.
4. Westwärts
Christer Friberg war Schwede und Seemann von Beruf. Das Leben zwischen Hafenstädten und Meer, Wohnen und Arbeiten in der Fortbewegung, verlangt eine elastische, leichtfüßige Wesensart. Sie war bei Chris spürbar.
Im Vorjahr, an einem klaren, sonnigen Morgen, hatte er mich auf der Uferpromenade in Samoa unweit des Aggie Grey’s Hotels angesprochen. Ihm war zu Ohren gekommen, daß zu der kleinen, überschaubaren Gemeinde durchreisender Weltenbummler einer gestoßen war, der diesen Ozean im Sportflugzeug durchquerte.
Ohne viel Umschweife äußerte er seine Interesse, sich mir anzuschließen, und er nannte auch gleich seine Vorstellungen, was das Reiseziel betraf: die Cook Inseln mit anschließendem Abstecher nach Tahiti.
Ich befand mich damals im Zustand nie gekannter Glückseligkeit, trotz verfahrener Lage. Meine Südsee-Expedition ging in den achten Monat, mehr als das Doppelte dessen, was das Reisebudget selbst bei gewagter Kalkulation hergab. Für den gut 25000 km langen Heimflug incl. fälliger Wartungsarbeiten an meinem Flugzeug reichte die verbliebene Liquidität schon nicht mehr.
Obwohl sich mit jedem weiteren Südseetag die Deckungslücke vergrößerte, war mein Gemüt von Sorge oder gar Zukunftsangst frei. Ich hatte ich mich lose mit der Idee angefreundet, die Passage quer über den Pazifik zu wagen und in den USA auf eine glückliche Fügung meines Geschicks zu vertrauen. Diese Route machte freilich den Einbau weiterer Zusatztanks notwendig, auf Samoa keine im Handumdrehen lösbare Aufgabe.
Meine mit geringem Enthusiasmus vorangetriebenen Planspiele wurden schlagartig Makulatur, als Chris seinen Vorschlag mit der Erklärung verband, „selbstverständlich“ für alle weiteren Reisekosten aufzukommen. Er hatte erst wenige Tage zuvor abgeheuert und nach elfmonatigem Dienst auf dem Tanker eine Brieftasche mit vielen frischen Dollarnoten im Gepäck.
Unser aus dem Stand heraus eingegangenes, zufälliges Interessenkonsortium ging ganz unverhofft in eine runde, kurzweilige Abenteurergemeinschaft über. Ihr vorzüglicher Kameradschaftsgeist überdauerte unsere gemeinsame zweimonatige Exkursion durch Polynesien und hielt sich, nachdem jeder von uns wieder in sein bürgerliches Leben eingetreten war, über einen regelmäßigen Briefwechsel lebendig. Hierbei hatte ich Chris beiläufig von meinen neuen Reiseplänen wissen lassen. Postwendend meldete er sich per Fax von hoher See: „Ich fliege mit. Wann ist Starttermin?“
Sein Heimatort Kalmar an der schwedischen Südostküste war als Treffpunkt bestimmt worden. Und dorthin begab ich mich auf direktem Weg nach Abschluß meines Londoner Studienaufenthalts.
Der Zwischenstopp in dem hübschen skandinavischen Städtchen gestaltete sich länger als erwartet. Kaum von Bord hatte Chris sein Herz an das blonde, gefühlvolle Mädchen Christina Haglind verloren. Die Beziehung war allem Anschein nach der Grund, daß er seine Reisevorbereitungen noch nicht abgeschlossen hatte, als ich in Kalmar eintraf.
Nach Erledigung der notwendigen Geschäfte und Förmlichkeiten war das traditionelle schwedische Mitsommerfest in unmittelbare Nähe gerückt und nötigte uns, den Abflug ein weiteres Mal hinauszuschieben.
Die innige Verbundenheit des jungen Liebespaares, das beständig die Hände ineinander verschlungen hielt und sich mit seelenvollem Blick süße Dinge sang, ließ mir im Verlauf dieser durchaus schönen, erlebnisreichen Tage bewußt werden, daß im Grunde ich es nun war, der dieses junge Glück so jäh unterbrach.
„Keine Sorge“, beschwichtigte mich Chris, als ich meine Bedenken zu artikulieren suchte, „wenn ich zurückkomme, heirate ich Stina. Gestern habe ich ihr den Verlobungsring geschenkt.“
„Das ist ein feiner Zug von dir“, sagte ich und ergriff seine Hand, „eine schöne Entscheidung. Ich werde euer Trauzeuge sein.“
Ein Blick auf den Globus veranschaulicht, wie weit die Südsee und Europa auseinander liegen. Die ozeanische Inselwelt findet sich einen netten halben Erdumfang von uns entfernt auf der anderen Seite dieses Planeten. Was die Distanz angeht, ist es deshalb einerlei, ob man den Weg über Amerika oder in die entgegengesetzte Richtung über Asien einschlägt. Ganz nebenbei und ohne Extrakosten eröffnet eine Südseereise den Bewohnern unseres Kontinents das Zusatzerlebnis, den Erdball zu umrunden.
„Hallo Südsee, hier kommen wir“, rief Chris vergnügt beim Abheben von der Startbahn und wies mit beiden Daumen nach oben.
Sein Abschied von Christina, von Mutter Inez, Schwester und Nichten war intensiv gewesen, aber schmerzfrei. Die Sonne lachte, als wir das traute Kalmar hinter uns ließen, und es war sommerlich warm.
Mit überschlägig veranschlagten drei Wochen fiel die Zeitspanne, die unsere Flugreise von Schweden zu den Inseln im Stillen Ozean in Anspruch nehmen würde, beträchtlich aus dem heute im Luftverkehr üblichen Rahmen. Insgesamt lagen mehr als 200 Flugstunden über Meere und Kontinente vor uns.
Gemessen an dieser Wegstrecke war unser weiß-grünes Reisegefährt nichts weiter als ein Knirps. Bei einer Länge von 7 m kam das Höchstabfluggewicht des von Mooney Aircraft in Texas hergestellten Tiefdeckers auf1160 kg zu stehen, entsprach also gerade demjenigen eines Kleinwagens. Die Kabine bot Platz für drei schlanke Passagiere und einen Piloten. Maximal 50 kg Gepäck faßte der kleine Kofferraum hinter den Rücksitzen. Den Antrieb besorgte ein 200 PS-Einspritzmotor, der je nach Triebwerkeinstellung und Flughöhe Geschwindigkeiten von immerhin 230 bis 270 km/h ermöglichte.
Die ersten Ausläufer des norwegischen Mittelgebirges zeichneten sich am Horizont ab, als sich der Himmel zu verdüstern begann. Mehr und mehr Gewölk schob sich in unsere Flugbahn und ließ meine anfängliche Zuversicht schwinden, in dem Labyrinth pilzförmig emporquellender Cumuli noch einen Pfad zu finden, der den Namen Sichtflug verdiente.
Ein kurzer Druck auf den Steuerknüppel ließ die Flugzeugnase nach unten tauchen. Auf über 350 km/h schnellte die Tachonadel hoch. Rund 1000 m tiefer hörten die Wolken auf, und dort fühlten wir uns beträchtlich wohler.
Was sich unserem erstaunten Auge darbot, war ein Anblick von bizarrer Schönheit. Zum Greifen nah breitete sich ringsum eine kahle, menschenleere Bergwelt aus. Vereinzelte Schneefelder unterstrichen den Eindruck von Strenge und Unwirtlichkeit. Aus der wie mit dem Lineal gezogenen Wolkendecke brach sich die Sonne Bahn und durchschnitt in einem fächerartigen Strahlenkranz das fahle, beklemmende Zwielicht. Kleine, verschwiegene Seen verstärkten den Zauber geheimnisvoller Unberührtheit. Die Szenerie erinnerte intensiv an Götterdämmerung und hätte jeden Liebhaber von Wagner-Opern in einen Taumel schaurigen Entzückens versetzt.
„Zum Kuckuck! Hier kommen wir nicht durch“, entfuhr es mir in die heilige Stille.
„Sieht so aus, als ob die Wolken da vorn irgendwo aufliegen“, sagte Chris, der den hartnäckig zum Schlechteren geneigten Wettertrend ebenfalls erfaßt hatte.
„Damit müssen wir rechnen. Der Abstand zu den Bergspitzen nimmt jedenfalls seit einer Viertelstunde ständig ab. Noch eine Viertelstunde so weiter, und es macht rums.“
„Am besten wir kehren um“, sagte Chris und kratzte sich am Kopf.
„Das wäre eine Möglichkeit“, gab ich zurück. „Aber wollten wir nicht in die Südsee?“
Mit Hilfe zweier Funkpeilungen ermittelte ich geschwind unsere genaue Position, notierte auf meinem Kniebrett verschiedene Flugdaten und griff dann zum Mikrofon:
„Oslo Control, hier Mooney November 9608 Victor, 30 Meilen südöstlich Kalhovd, Höhe6500. Können Flug nicht nach Sichtflugregeln fortsetzen. Erbitten Übergang auf IFR-Flugplan.“
„08 Victor, hier Oslo, verstanden. Instrumentenflug ist genehmigt. Ihre Route: Kalhovd VOR direkt. Danach Green 3. Steigen Sie sofort auf dem 160 Radial von Kalhovd auf 8000, QNH 1011. Schalten Sie Transponder auf 2355 und drücken Sie ident. Geben Sie geschätzte Überflugzeit Kalhovd und Ankunftszeit Bergen Fresland durch.“
„08 Victor, verlassen 6500 für 8000 auf QNH 1011. Transponder 2355. Schätzen Kalhovd 16, Bergen Fresland 59.“
„Oslo hat verstanden. Radarkontakt. Melden Sie Erreichen 8000 und Kalhovd.“
Nichtflieger werden diese nach Buchhaltung schmeckenden Zahlenund Buchstabenkombinationen vielleicht spröde oder wichtigtuerisch empfinden. Eine solche Geringschätzung wäre indes ungerecht, hing doch fortan, um es feierlich auszudrücken, von der korrekten Entgegennahme und Befolgung dieser Software unser Leben ab. Jetzt auf war es vorbei mit dem idyllischen Dahinschweben über Berg und Tal, bei dem es jene vom Auge leicht faßbaren Landschaftselemente wie Flußbiegungen oder eine malerische Schlußruine sind, die einen in der schilderlosen Luft den rechten Weg finden lassen. Kaum hatte ich Vollgas eingestellt und die Maschine auf Steigflug getrimmt, verschwanden wir in dem weitläufigen Wolkenmeer. Nun zählten nur noch die Instrumente und, was aus dem Kopfhörer zu vernehmen war.
Wer noch nie in Wolken geflogen ist, wird es vielleicht nicht glauben. Aber dort geht nicht nur die Sicht, sondern auch das so selbstverständliche Gefühl für oben und unten verloren. Am Anfang passiert einem immer wieder, daß man meint, in der Waagerechten zu sein, während der künstliche Horizont beharrlich eine Schräglage anzeigt. Es braucht ein gehöriges Stück Konzentration, sein Raumempfinden ganz von einem kleinen, runden Instrument steuern zu lassen und alle anderen Eindrücke auf den Gleichgewichtssinn auszuklammern.
„Sobald wir über dem Flugplatz sind, fällt dieses weiße Feld nach unten“, erklärte ich Chris und wies mit dem Finger auf ein kleines, rundes Instrument namens CDI. Erst begann die Marke leicht zu zittern, als gelte es, den Vorgang ein wenig spannend zu gestalten. Erwartungsvoll starrten wir auf die Stelle am Panel. Das Zeichen verschwand, kam wieder. Mit einem Mal schlug es um. Genau unter uns im undurchdringlichen Grau dieser Polarfront konnten wir nun also den Flugplatz wähnen, der uns zur Landung erwartete. Durch Nebel und Regen überbrachte uns das kleine weiße Dreieck diese willkommene Botschaft. Wenn das nicht ans Wunderbare grenzt!
„08 Victor, sinken Sie auf 3000. Frei zum Localizer-Anflug, Landebahn 18. Melden Sie Askoy outbound“, sprach der Fluglotse.
In Bergen-Fresland erwartete uns keine gewöhnliche Landung, sondern ein Instrumentenlandeanflug. Und davor hat jeder Pilot, sofern er nicht gerade einen computergesteuerten Passagier-Jet bedient, einen gewissen Respekt. Um solch einen Anflug mit karger Instrumentierung und ohne Autopiloten korrekt auszuführen, ist maximale Konzentration am Platze.
„Hier 08 Victor, wir sind Askoy outbound.“
„Verstanden. Gehen Sie auf Fresland Turm und melden Sie auf dem Localizer.“
Mit der Anflugkarte auf dem Knie und dem Auge auf ein gutes Dutzend Instrumente gleichzeitig geheftet, gilt es, sich in komplizierten, teils tropfenförmigen, teils ovalen Verfahrenskurven zu bestimmten, imaginären Punkten hinzuwinden. Falls man schön aufmerksam war, trifft man auf der dort jeweils vorgeschriebenen Höhe ein, gerät indes immer wieder ins Grübeln, ob der noch immer unsichtbare Flugplatz nun eigentlich rechts oder links, vorn oder hinten ist.
„Fresland Turm, hier 08 Victor, auf dem Localizer inbound.“
„Verstanden, melden Sie Outer Marker.“
Ist alles richtig ausgeführt, findet man sich auf dem Gleitpfad wieder. Dieser schöne Erfolg wird sogleich dem Turm gemeldet, und dann gleitet man hinab, bis vor einem, dem Herrn sei Dank, die Landebahnlichter auftauchen.
„08 Victor, Outer Marker.“
„Landung frei, Landebahn 18. Wind 220 mit 15 Knoten.“
Beim Ringen um die korrekten Kurse und Richtungsänderungen schenkte ich für einen Moment dem Höhenmesser zu wenig Beachtung. Als wir aus den tief hängenden Wolken herausstießen, lag die regennasse Landebahn zwar genau vor uns; gemessen an der noch verbliebenen Distanz war unsere Anflugbahn indes ein Stück zu hoch geraten.
„Besser als zu tief“, sagte ich, zog den Gashebel zurück und versetzte dem Steuerknüppel eine beherzten Stoß.
Es war in der Tat nicht weiter von Bedeutung. Von der 2500 m langen Piste beanspruchte mein Flugzeug nur ein bescheidenes Quantum. So blieb uns noch reichlich Auslauf, obwohl wir wegen meiner Unaufmerksamkeit erst einen halben Kilometer nach der Landebahnschwelle aufsetzten.
5. Angriff auf den Nordatlantik
„Das wird echtes, klassisches Abenteuer“, sagte ich und verschränkte meine Arme hinter dem Kopf.
Ein gleichförmiger Landregen setzte seine Tropfen auf die Fensterscheiben des „Fantoft Sommerhotel“. Die Zeitspanne bis zum Beginn der Abendmahlzeit gab uns Gelegenheit für ein kurzes Entspannungsintervall auf den hellen Liegemöbeln unseres kleinen, reinlichen Hotelzimmers, das zusammen mit seinem übrigen Inventar den klaren, unpompösen Habitus skandinavischer Wohnlichkeit ausstrahlte.
Unsere Absicht war, trotz ungünstiger Witterung am nächsten Morgen die erste Etappe unserer Atlantiküberquerung in Angriff zu nehmen. Nach Einschätzung der Meteorologen versprach Zuwarten kaum Aussicht auf Besserung. Mit einer Änderung der tristen, von Tiefdrucksystemen gekennzeichneten Wetterlage war so bald nicht zu rechnen. Nach einem längeren Aufenthalt in dem regenverhangenen Städtchen Bergen aber stand keinem von uns der Sinn.
„Wäre es nicht besser, wenn wir uns doch noch einen Zusatztank leisten“, erkundigte sich Chris nach einer Weile nachdenklichen Schweigens.
„Wieso?“
„Na ja, wir bräuchten dann wohl nicht so weit nach Norden hinauf.“
„So einfach ist das leider nicht. Die kürzeste Strecke weiter südlich geht von Irland nach Gander, Neufundland. Das sind über3000 km non-stop. Der Sprit für diese Distanz übersteigt die Kapazität eines Zusatztanks. Und bei zwei Tanks in der Kabine bleibt nur noch Platz für einen von uns.“
„War nur ein Gedanke.“
„Laß uns offen reden“, sagte ich und schlug meine Beine übereinander. „Ich bin dir nicht böse, wenn du für dieses Stück eine Linienmaschine nehmen möchtest. Wir können uns dann ohne weiteres in New York treffen.“
„Unsinn“, rief Chris entrüstet und richtete sich von der Liegestatt auf. „Du meinst wohl, ich kneife. Versteh bitte, daß es mir lediglich darum ging, die Sache für uns beide sicherer zu machen. Ich hätte den Tank ja bezahlt, wenn er etwas gebracht hätte.“
„So gesehen: Mehr Reichweite bringt immer etwas“, sagte ich und erhob mich ebenfalls. „Auch für unsere jetzige Route hätte das nicht schaden können. Nur liegt hier das Problem nicht so sehr bei den Kosten. Allein für die Einbauarbeiten kannst du eine Woche ansetzen. Dann müssen sie ja noch von einer US-Flugbehörde abgenommen werden. Alles in allem dürfte uns das 10 Tage kosten oder mehr, und in der Zeit sind wir hoffentlich schon halbwegs in der Südsee.“
„Hoffentlich! Wenn ich an die vielen Eisberge denke...“
„Auch mir ist wohler, wenn wir drüben in Amerika sind“, sagte ich und schlüpfte in meine Schuhe.
„In Amerika? Ich wünschte, wir wären schon in der Südsee. Stell dir vor, wir lägen am Strand in Rarotonga, von Palmen eingerahmt, draußen das Korallenriff und jeder von uns eine gut gebaute Insulanerin im Arm“, sprach Chris, während er vom Bett wegtrat und mit ausgreifender Geste hinaus in die trübe Regenlandschaft wies.
„Na, na“, sagte ich mit erhobenem Zeigefinger, „eben erst der Liebsten Adieu gesagt, und schon träumt er von anderen Mädchen. Los, wir gehen runter zum Abendessen. Sonst kriegen wir am Ende nichts mehr.“
Kurz vor 7.00 Uhr am nächsten Morgen, akkurat nach Plan, ließen wir die zerklüftete norwegische Küstenregion hinter uns und nahmen Kurs auf den offenen Atlantik. Von einem überaus kräftigen Gegenwind abgesehen zeigte sich das Wetter nicht einmal übel. Zwischen verstreuten Wolkenfeldern kamen unten auf dem Meer immer wieder Bohrinseln mit hell lodernden Brandfackeln zum Vorschein und ließen vorerst ein Gefühl ozeanischer Weite und Verlassenheit nicht aufkommen.
Im Grunde bedeutete auch der Gegenwind kein wirklich ernstes Problem. Die Distanz zu unserem ersten Zwischenstopp auf den Färöerinseln kam auf gerade 700 km zu stehen. Demgegenüber ließ der Treibstoffvorrat meines Flugzeugs, bei etwas erhöhter Sicherheitsreserve über Wasser, Strecken bis 1300 km zu.
„Mooney 08 Victor, hier Stavanger Control. Können Sie uns hören?“
„Ja, hier 08 Victor, was gibt’s?“
„Stavanger hat soeben die neuesten Wettermeldungen von den Färöerinseln erhalten. Dort hat sich die Lage deutlich verschlechtert. Sicht 1500 m, Wolken teilweise unter Minimum, Regenschauer. Vorhersage unbeständig.“
„08 Victor, verstanden.“
„Halten Sie Ihren Flugplan aufrecht, 08 Victor, oder wollen Sie zu den Shetlandinseln ausweichen? Von dort wird besseres Wetter gemeldet.“
„Wir bleiben einstweilen auf Kurs 296 und machen Entscheidung über Ausweichlandung von weiterem Wettergeschehen auf Färöer abhängig.“
„Okay, Stavanger hat verstanden. Wir bekommen in 20 Minuten einen neuen Wetterbericht von Färöer und melden uns dann wieder.“
Anders als Bergen verfügten die Färöers über keine Einrichtungen für Schlechtwetteranflüge. Dort ließ sich praktisch nur nach Sicht landen. Damit war erneut alles offen, und ich sah mich vor die Entscheidung gestellt, ob wir unseren Flug nicht besser gleich abbrechen und zu den Shetlands ausweichen sollten. Wir waren im Begriff, den Shetland-Flugplatz Sumburgh zu unserer Linken in einer Entfernung von 150 km zu passieren. Eine Kursänderung um 90° nach Süden, und in einer knappen dreiviertel Stunde könnten wir in Sumburgh landen. Je länger wir dagegen unseren augenblicklichen Kurs beibehielten, desto weiter galt es, wieder zurückzufliegen, falls eine Landung auf den Färöers schließlich doch am schlechten Wetter scheitern sollte, und desto mehr würde dabei natürlich unsere Treibstoffreserve schrumpfen.
Andererseits hatte ich die Färöerinseln noch nie bei strahlendem Sonnenschein erlebt. Die kleine, entlegene Inselgruppe im Atlantischen Ozean war bekannt für konstant regnerische, stürmische Wetterlagen. Morgen würden wir uns voraussichtlich dem gleichen Dilemma gegenübersehen. Also weiterfliegen. Ich sprach kurz mit Chris über das Problem. Auch er war einverstanden.
Für kurz nach 9.00 Uhr war die neue Wettermeldung versprochen. Doch nichts rührte sich im Kopfhörer. Ich setzte mehrere Funksprüche nach Stavanger ab. Ohne Ergebnis.
„Scottish, hier Mooney 08 Victor, wie verstehen Sie mich“, rief ich gespannt, nachdem ich auf die schottische Flugsicherung umgeschaltet hatte.
„Hier Scottish, laut und klar.“
„Erbitte das letzte Wetter von den Färöers.“
„Wetterbericht Färöers von 08.20 Uhr: Wind 290 mit 20 Knoten, Böen bis 30; Sicht 4000 m, zeitweise nur 800 m in heftigen Regenschauern; Temperatur 8° C.“
Nach etwas über drei Stunden bekam ich Funkverbindung mit Vagar, dem Flugplatz der Färöerinseln.
„Sicht und Wolken sind hier zur Zeit unter Minimum“, war die erste Nachricht, die uns aus dem Lautsprecher erreichte. „Welches ist Ihre geschätzte Ankunftszeit für Vagar?“
„08 Victor, schätze Landung Vagar in 25 Minuten.“
„Möglich, daß es bis dahin ein wenig aufklart. Beachten Sie, daß die Berge in Wolken sind. Ich empfehle Ihnen, die Inseln unterhalb der Wolken anzufliegen.“
„08 Victor verstanden. Wir haben voraus gerade eine freie Stelle und würden gerne gleich nach unten gehen.“
„Ist nach Sichtflugregeln genehmigt. Melden Sie Färöer in Sicht.“
Zehn Minuten später tauchte die Inselgruppe auf. Von unserer einstigen Reiseflughöhe waren noch knapp 300 m übrig geblieben, die uns von der stahlgrauen Wasseroberfläche trennten. Trotzdem schien es, als streifte unser Kabinendach an der Wolkendecke entlang.
Voraus, von Nebelschleiern durchzogen, zeichnete sich ein langgestrecktes, kahles Felseneiland ab, dahinter Umrisse einer größeren Landzunge, an der sich die aufgewühlte See in einem schäumenden Brandungsgürtel brach. So willkommen der Anblick von Land in einer derartigen Situation normalerweise ist, so schroff und abweisend wirkte diese finstere, meerumtobte Felsenbastion inmitten des Atlantiks.
„08 Victor, Färöer in Sicht. Wie ist das Wetter am Platz?“
„Wir haben noch immer Regen und einige tiefhängende Wolken, aber von Nordwesten her scheint es etwas heller zu werden. Rufen Sie 10 Meilen südlich Vagar noch mal. Kennen Sie sich hier aus?“
„08 Victor, ich bin wohl schon mehrmals durchgekommen; aber heute ist alles so umnebelt, daß mir im Moment die genaue Route zum Flugplatz noch nicht klar ist.“
„Okay. Sehen Sie eine kleine schmale Insel, ca. 10 km lang in Nord-Süd-Richtung?“
„In Sicht!“
„Gut. Das ist Nolso. Fliegen Sie daran südlich vorbei und passieren Sie noch die dahinter liegende Südspitze der großen InselStreymoy. Dann Rechtskurve und Kurs Nordwest. Damit müßten Sie genau auf Vagar stoßen.“
Mit dem Herannahen der Inselgruppe wurde die Luft merklich unruhiger. Als Nolso rechts vorbeizog, nahm der Flug einen betont unbehaglichen Verlauf. Böen und Luftlöcher trafen uns mit einer Heftigkeit, als gelte es herauszufinden, wie lange Holme und Spanten einer Mooney wohl zusammenhielten. Fast gleichzeitig setzte Regen ein.
Die beiden Landmarken, an denen ich mich zu orientieren suchte, versanken in Wolkenschleiern, kamen wieder zum Vorschein und waren kurz darauf wieder verschwunden. An anderer Stelle tauchten wie aus dem Nichts neue Inseln auf. Die Gefahr, den Kontakt mit dem Boden zu verlieren, zwang mich, die Maschine tiefer und tiefer zur Wasseroberfläche hinabzuführen.
Das Tauziehen mit Wolken, Sturm und Klippen wogte zwischen Bangen und Hoffen hin und her, als unsere Flugbahn in der zerklüfteten, verhangenen Inselgruppe endlich den Fjord traf, an dessen Ende sich zu unserer großen Erleichterung die ersehnte Landepiste fand. „Das stand auf Messers Schneide“, ließ mich der Herr im Kontrollturm wissen, während wir auf der kleinen, von Hügeln eingebetteten Asphaltbahn ausrollten. „Ich will mal zu Ihren Gunsten annehmen, daß wir Mindestwetterbedingungen hatten. Sonst müßte ich nämlich eine Meldung nach Kopenhagen absetzen.“
„Aber bitte! Daß die Wolkenuntergrenze den Vorschriften entsprach, konnte ich gerade am Höhenmesser ablesen“, funkte ich gekränkt zurück. „Und die Sicht ist jetzt doch klar über Minimum.“
„Schon gut, 08 Victor; es will Sie keiner verhaften. Wie lange bleiben Sie?“
„Circa eine Stunde. Wir tanken nur und fliegen dann weiter nach Island.“
„Okay, parken Sie links neben den roten Fässern. Ich setze den Tankwart in Marsch.“
Unser Frühstück in der karg bestückten Flughafenbar bestand aus lauwarmer Milch und einem schlohweißen, nur durch überstehende Salatblätter etwas belebten Käse-Sandwich. Er fühlte sich an wie Verbandsmull und wies auch geschmacklich in diese Richtung. Die Kombination mit dem kontrastarmen Getränk ließ jedenfalls eine Empfindung von Melancholie und Vergeblichkeit zurück.
Der Fjord, der uns schon kurz nach 11.00 Uhr wieder hinaus aufs offene Meer führte, war noch schlanker und tiefer eingeschnitten als jener auf der Südseite der Insel, über den uns der Anflug geglückt war. Wie ein Deckel schlossen die Wolken mit den oberen Bergränder ab. In dieser engen Röhre schien es, als reichten die Tragflächenspitzen bedrohlich nahe an die rechts und links aufragenden Steilhänge. Starke Windstöße und Wirbel warfen unser kleines Gefährt immer wieder aus der Flugbahn, die ich unter allen Umständen in der Mitte dieser Gefahrenzone zu halten suchte.
Sobald sich die offene See auftat, stiegen wir einesteils erleichtert, anderenteils auf neue Beschwernisse gefaßt hinein in die dunklen Regenwolken.
Zuerst schien es, als wären wir dem tristen Nebelszenario bis Reykjavik ausgeliefert. Nach ungefähr einer Stunde aber löste sich der Dunst. Zwischen zwei Wolkenschichten öffnete sich eine Nische mit guter, klarer Fernsicht. Die Luft war ruhig. Laut Wetterbericht drehte der Wind zwischen den Färöers und Island nach Norden. Und siehe: Es zeigte sich, daß die Vorhersage zutraf. Unsere Passage über das UKW-Funkfeuer Ingolfshofdi an der Südostflanke von Island erfolgte sogar ein wenig früher als von mir berechnet.
Vor uns lagen noch knapp 300 km über Land. Bei schönem Wetter ist dieses Stück über den Südteil der Insel von ungewöhnlichem landschaftlichem Reiz. Landeinwärts steigt das Gelände rasch an. Auf den Höhen, die 2000 m überragen, wechseln gewaltige Gletscherareale und Eisbrüche mit schwarzen, erstarrten Lavafeldern. Über die tiefer liegenden Regionen erstreckt sich in saftigem Grün das unberührte, baumlose Weideland, auf dem die berühmten Islandponys und Schafe grasen. In niedriger Flughöhe und mit ein wenig Glück lassen sich Geysire ausmachen, die heißen Springquellen, aus denen sich in regelmäßigen Abständen Wasserund Dampffontänen in den Himmel ergießen.
Ein ausgedehntes Tiefdrucksystem entzog all diese hübschen Naturerscheinungen unserem Auge und hatte stattdessen dieses von Heldensagen umwobene nordische Land in eine schiefergraue, düster verhangene Wolkenlandschaft eingetaucht. Ab und zu ragte wie aus dem Nichts ein Bergwipfel zwischen den Regenund Nebelschleiern auf. Allerdings ließ sich meist erst im Näherkommen sagen, ob es tatsächlich ein Stück der Erdoberfläche war oder nur ein flüchtiges Wolkengebilde. Immer häufiger fanden wir uns selbst in dem undurchdringlichen Dunst einer der vielen Wolkenbänke aufgesogen, die gerade unseren Flugweg kreuzten. Und darin konnten wir gar nichts mehr sehen.
Diese enge Tuchfühlung mit Gebirge und Wolken entwickelte sich zu einem Quell wachsender Sorge. Bereits draußen über dem Meer, während wir uns noch der Insel näherten, hatte ich die Bodenstelle ersucht, mir eine neue Flughöhe zuzuweisen. Die Nadel des Höhenmessers stand bei 6000 Fuß [1800 m], und für eine 120 km lange Teilstrecke, die laut Flugkarte ungefähr auf halben Weg zwischen der Ostküste und Reykjavik verlief, fehlten damit einige hundert Fuß zur Sicherheitsmindesthöhe.
Seit wir über Land waren, bedrängte ich die Flugsicherung unablässig mit meinem Anliegen. Doch jedesmal erhielt ich das Gleiche zur Antwort: Ich solle zuwarten; man würde mich zurückrufen.
Nur noch fünf Minuten trennten uns vom Meldepunkt Miklafell, an dem die neue Flughöhe erreicht sein mußte. In meiner Ratlosigkeit erwog ich, Warteschleifen zu drehen, kam dann aber zu dem Schluß, daß dies wegen der früheren Instruktionen auch nicht das Richtige sein konnte. Die Situation war verworren, und ich begriff nicht, wo eigentlich das Problem lag.
„Iceland Control, hier Delta 057. Der Pilot in der Mooney bittet nun schon seit 20 Minuten um Freigabe zum Steigflug. Soweit wir das verfolgen konnten, befindet er sich über Island und braucht jetzt unbedingt eine Entscheidung. Auf seiner gegenwärtigen Flughöhe hat er doch keine ausreichende Hindernisfreiheit mehr.“
„Jawohl Delta 057, Iceland hat verstanden. Wechsel. Mooney 08 Victor, frei zum Steigflug auf 8000. Melden Sie Erreichen der neuen Flughöhe.“
Über den wirkungsvollen Beistand dieses unbekannten Flugkapitäns war ich nicht wenig verblüfft, und es dauerte ein paar Sekunden, bis ich mich gefaßt hatte:
„He, Delta 057, hier Mooney 08 Victor. Falls Sie auch nach New York unterwegs sind, spendiere ich Ihnen dort einen Drink.“
„Haha, gute Idee. Nun wir gehen zwar nach New York, dürften aber ein bißchen vor Ihnen ankommen. Mit einer MD 11 können Sie wohl kaum mithalten. In ca. vier Stunden landen wir auf dem Kennedy Airport.“
„Oh, bei uns geht es noch mindestens drei Tage.“
„Na, dann geben Sie mal Gas. Ich warte an der Bar auf Sie.“
6. In der Arktis verirrt
„Sie müssen mit einem leichten Südwest rechnen“, murmelte der Herr, indem er sich tief über eine bunt bemalte Wetterkarte beugte. Er war mit üppigem, weißgoldenem Haupthaar, einer kleinen Nickelbrille und breiten, lebhaft gemusterten Hosenträgern bestückt. Wir hatten die Wetterstation von Reykjavik nach erquickender, wenn auch kurzer Nachtruhe im nahen Hotel Loftleidir frühmorgens mit dem ersten Hahnenschrei aufgesucht. Ein-, zweimal wiegte der Meteorologe den Kopf hin und her und fuhr dann fort: „Ich schätze um 30 km/h. Weiter oben dreht der Wind allerdings nach West bis Nordwest. Es wäre also von Vorteil, wenn Sie hoch fliegen.“
„Gut, wir gehen auf4000 m“, sagte ich.
„Dort würde ich einen Gegenwind von, sagen wir mal, 20 km/h einkalkulieren.“
„Wie sind die Wettermeldungen aus Narsarsuaq“, erkundigte ich mich.
„Die letzte Information stammt von gestern abend. Einen neuen Lagebericht kriegen wir erst in ca. zwei Stunden.“
„Hm, wir hatten eigentlich vor, in einer halben Stunde zu starten.“
„Tja, wenn Sie es riskieren wollen, können Sie losfliegen, und wir geben Ihnen das Wetter dann über Funk durch. Sollte es ungünstig ausfallen, haben Sie immer noch die Möglichkeit umzukehren.“
1300 km Wasser mit Temperaturen um den Gefrierpunkt lagen vor uns, und am Ende dieses langen Weges fand sich nur eine einzige Landemöglichkeit weit und breit: Narsarsuaq. Die Gegend um diesen Flugplatz an der Südspitze Grönlands war öd und rauh. Bei einem geringfügigen Kursfehler nach links erwartete uns der offene Ozean. Rechts faltete sich die menschenleere grönländische Eiskappe in nicht zu knappen Ausmaßen auf.
Um Punkt 7.00 Uhr kam vom Turm das „Start frei“. Bei 120 km/h hob die Maschine ab. Sekunden später überflogen wir die Küste und nahmen Kurs auf Grönland.
Das Wetter zeigte sich keine Spur besser als am Vortag. Die Klappen waren kaum eingefahren, da hatte uns der graue, regenverhangene Himmel auch schon verschluckt.
Obwohl eine Notwasserung in diesen Breiten nur geringe Überlebenschancen eröffnet, hatten wir mit Umsicht für einen solchen Fall Vorsorge getroffen. Jeder von uns trug eine raffiniert konstruierte Schwimmweste. Sie war bestückt mit Wasserfärbemittel, Radarreflexkappe, Erste-Hilfe-Kit, Notration und Angelausrüstung. Selbst eine Trillerpfeife und ein Pülverchen gegen Haie fehlten nicht. Meine Weste enthielt außerdem ein taschenbuchgroßes Notfunkgerät. Kam die Schwimmweste mit Wasser in Berührung, blies sie sich nach wenigen Sekunden automatisch auf. Gleichzeitig fuhr die Antenne hoch. Mit einem Handgriff konnte ich das Funkgerät in Betrieb setzen, und ohne weiteres Zutun übermittelte es dann 24 Stunden lang Notsignale. Selbst Sprechfunk war mit diesem kompakten Wunderding möglich.
Zwei handliche Einmann-Rettungsschlauchboote auf dem Rücksitz rundeten unsere Notausrüstung ab. Auch sie enthielten nützliches Zubehör, u.a. Fallschirmraketen, Meerwasserentsalzungstabletten, Sturmstreichhölzer und sogar Wollsocken; denn in einem Schlauchboot soll man bekanntlich keine Schuhe tragen.
„Ich habe eine Überraschung“, sagte ich zu Chris, nachdem ich den Funkspruch aus Island aufnotiert hatte. „In Narsarsuaq erwartet uns ein Wetter wie an Kaisers Geburtstag: wolkenlos mit leichtem Wind aus wechselnden Richtungen.“
„Na, das war aber nun wirklich fällig“, rief Chris erleichtert. „Es kann doch in dieser Gegend nicht nur Regen und Trübsal geben. Sonnenschein, das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Ab wann ist denn mit dieser schönen Wendung zu rechnen?“
„Es heißt hier, daß die Tiefdruckausläufer bis 32° West reichen. Das bedeutet, daß du in etwa zwei Stunden die Bräu-nungsmilch richten kannst.“
Gegen 9.00 Uhr verlor ich Kontakt mit dem Peilsender Keflavik und navigierte dann mit ungerichteten isländischen Funkfeuern im Langwellenbereich, sogenannten NDBs, bis auch ihre Signale verklangen. Dann wies nur noch der Kompaß die Richtung, genau wie bei Kolumbus. Just als unser Flug in dieses romantische Stadium trat, begann das Wetter aufzuklaren. Die Wolken gingen zurück, verwandelten sich in durchsichtige Gazeschleier, und ehe wir’s uns versahen, waren wir von strahlendem Sonnenschein umgeben.
„Anerkennung! Die hohe Kunst der Wettervorhersage“, sagte ich.
„Wunderbar“, jubelte Chris und klatschte in die Hände, „einfach wunderbar.“
Mit einem Male herrschte in unserer kleinen Mooney hochdroben über den kalten Fluten des Nordatlantiks eine Stimmung, als wäre gerade der Herr auferstanden. Mit viel Dankbarkeit genossen wir das Licht, die Farben und den grenzenlosen Blick von Horizont zu Horizont, und für eine Weile war vergessen, daß wir über arktischen Gewässern mehr als 600 km entfernt vom nächsten Land dahinbrummten.
„Du, schau mal dort hinten“, stieß Chris mich in die Seite und deutete nach vorn.
„Wo?“
„Da am Horizont. Siehst du das nicht, diesen hellen Streifen?“
„Tatsächlich! Du hast recht. Das muß Grönland sein.“
„Hurra! Land in Sicht! Und ich hab’s zuerst gesehen.“
So früh hatte ich nicht damit gerechnet. Aber es gab keinen Zweifel. Was wir vor uns in der Ferne immer deutlicher erkennen konnten, waren die ersten Konturen der schneebedeckten grönländischen Küstengebirge. Damit jedenfalls erübrigte sich meine Sorge, uns an Grönland vorbeizulenken.
Höher und höher erhob sich eine mächtige, weiß glänzende Gebirgskette über den Horizont. Bald war deutlich die stark zergliederte Steilküste zu erkennen. In dem unübersehbaren Labyrinth von Buchten und Fjorden schwammen die Splitter des zerbrechenden Packeises. Dazwischen ragten größere, leuchtend weiße Eisberge auf, Ableger der gewaltigen Gletscherströme, die landeinwärts immer breiter wurden, allmählich alles überdeckten und sich im Gleichmaß der grönländischen Eiskappe verloren.
Von dieser völlig planen Hochebene aus kilometerdickem Eis und Schnee ging eine besondere Faszination aus. Unter einem stahlblauen Himmel dehnte sich ein weißes Plateau in die Unendlichkeit, so makellos und unberührt wie vor Urzeiten. Wer bedenkt, daß der grönländische Eispanzer ein Gebiet von der Größe Westeuropas bedeckt, dem erklärt sich sofort, welch ehrfürchtige, ja weihevolle Atmosphäre unser Cockpit durchzog, als wir auf diese gleißende Einöde zusteuerten.
Obwohl der Würde des Augenblicks nicht eben angemessen, versuchte ich beim Überqueren der Küstenlinie festzustellen, auf welchen Punkt der grönländischen Ostküste wir hier auftrafen. Auf meinen Knien lag eine detailgenaue, topographische Karte von Südgrönland. In dem Gewirr von Meeresarmen, Inseln, Felsenklippen und Eisbergen hielt ich Ausschau nach einem einprägsamen Geländestück und suchte die Stelle dann auf meiner Karte. Als das nicht zum Ziel führte, ging ich die Suche andersherum an: erst der Blick in die Karte, dann die Suche nach dem realen Korrelat. Bei richtiger Navigation mußten wir uns in der Nähe von Kap Daniel Rantzau befinden, und darauf hatte ich der Einfachheit halber meinen Zeigefinger fixiert.
Daß wir uns fortbewegten und deshalb die Landschaft sich ständig unter einem anderen Blickwinkel darbot, erschwerte das Puzzlespiel beträchtlich. Viel Zeit blieb leider auch nicht. Denn der geographisch aufschlußreiche Streifen zwischen Küste und Inlandeis war nur schmal. So wurde das Ganze ein Wettlauf gegen die Zeit. In einem fort spähte ich hinaus, sah in meine Karte, verglich und suchte weiter.
Meine Bemühungen blieben ohne sicheres Resultat. Als wir das Küstengebiet hinter uns gelassen hatten, konnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen, an welcher Stelle wir auf Grönland gestoßen waren.
Einstweilen jedenfalls bestand die Welt für uns nur noch aus Himmel und Eis, und wir hatten Mühe, unsere Augen an dieses absolut reine, faltenlose, unendliche Weiß zu gewöhnen, das jetzt ringsherum bis an die Grenzen unseres Gesichtskreises reichte. Beim Blick rechts aus dem Fenster versuchte ich mir vorzustellen, daß man in diese Richtung nicht weniger als2400 km zurücklegen mußte, um an das Ende des Inlandeises zu gelangen.
Verglichen damit war die Strecke, die vor uns lag, nicht mehr als ein Spaziergang um die Ecke. In Ost-West-Richtung nämlich maß die Eisbarriere hier am Südzipfel keine 100 km. Allerdings zog sich diese überschaubare Distanz merkwürdig in die Länge. 20 Minuten vergingen, und noch immer war nichts von den Bergen auf der gegenüberliegenden Küste zu sehen.
Ich wurde nervös.
Der Verdacht, daß etwas nicht mit rechten Dingen zuging, verstärkte sich rasch. Auf der Karte waren entlang unserer Flugstrecke mehrere einzeln stehende Gebirgsgrate, sog. Nunataks, verzeichnet. Da sie ganz isoliert aus der topfebenen Eisplattform herausragen, hätten sie eigentlich schon aus großer Entfernung ins Blickfeld gelangen müssen. Doch wohin der zunehmend sorgenbeladene Blick schweifte: nichts als eine durchgehende, gnadenlose Eiswüste.
„Zum Henker! Wir haben uns verflogen“, platzte ich schließlich heraus und riß das Steuer nach links.
„Wir? Ich glaube, das warst du“, sagte Chris und wies mit dem Zeigefinger auf mich.
„Na schön, dann war es eben ich.“
„Aber in Grönland sind wir hier doch, oder?“
„Hawaii dürfte das kaum sein, du Schelm. Das Problem ist nur, daß dieses Bettlaken unter uns mehr als zwei Millionen Quadratkilometer groß ist.“
„Jetzt mal im Ernst: Wo hast du uns hingeflogen?“
„Das wüßte ich selbst gern. Sicher ist im Augenblick nur, daß unsere Route nach Narsarsuaq viel weiter im Süden liegt. Meine Funkpeilungen müssen allesamt gestört gewesen sein. Denn sie zeigten uns ständig südlich von unserem Kurs. In Wirklichkeit waren wir wohl genau drauf. Ein Verhängnis! Statt vom falschen auf den richtigen Kurs dürften uns meine laufenden Kurskorrekturen vom richtigen auf den falschen Kurs gebracht haben.“
„Wie, um Himmels willen, ist denn so etwas möglich?“
„Langund Mittelwellen sind einfach störanfällig. Die Signale könnten durch die Berge abgelenkt worden sein. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo elektrische Stürme, die die Nadel verrückt haben spielen lassen.“
„Du hast also keine Ahnung, wie weit es uns nach Norden verschlagen hat?“
„Es muß ein ganzes Stück sein. Wir haben Grönland ja eine halbe Stunde früher erreicht, als ich berechnet hatte, und inzwischen ist mir auch klar, warum. Die Ostküste Grönlands verläuft nämlich nach Norden hin auf Island zu.“
„Was machen wir jetzt?“
„Ich habe die Maschine auf Südkurs gebracht. Wir müssen unbedingt diesen Berg hier finden. Er ragt rund 600 m aus der Eiskappe heraus und dürfte schon aus großer Entfernung zu sehen sein. Von dort weiß ich dann den Weg nach Narsarsuaq.“
„Werden wir es schaffen?“
„Das ist die Frage! Auf jeden Fall wird es jetzt kolossal eng.“
Wir waren inzwischen schon über fünf Stunden in der Luft. Beide Tanks waren auf weniger als ein Viertel leer geflogen. Um Benzin zu sparen, nahm ich das Gas zurück und brachte den Motor auf extremen Sparflug. Wir wurden dadurch zwar langsamer, aber am Ende ergab es doch eine größere Reichweite.
Wichtig war jetzt, so genau wie möglich herauszufinden, wieviel Flugzeit uns bei diesem Tankinhalt noch blieb. Wenn sich irgendwann unser genauer Standort wieder ermitteln ließ und dann klar würde, daß der Sprit nicht mehr bis Narsarsuaq reichte, war es sinnvoller, hier oben auf der Eiskappe eine Notlandung zu versuchen, als das Risiko einzugehen, daß uns in einem engen Tal oder über einem verkarsteten Gletscher plötzlich der Motor stehen blieb.
Das Verfahren, unsere Restflugzeit festzustellen, war einfach. Ich schaltete den Benzinhahn auf den volleren Tank und wartete, bis die Nadeln beider Tankuhren die gleiche Restmenge anzeigten. Dann drückte ich auf die Stoppuhr. Die Zeit, die verging, bis der eine Tank leer geflogen war, blieb uns nochmal vom zweiten Tank.
Um 12.05 Uhr begann der Sekundenzeiger zu ticken. Die Spannung im Cockpit stieg nun von Minute zu Minute. Wie weit hatte uns der Kursfehler tatsächlich irregeleitet? Wie groß war die Entfernung nach Narsarsuaq? Falls wir notlanden mußten: Wie fest war der Untergrund auf der Eiskappe? Sollte das wirklich schon das Ende unserer Südseereise werden?
Während wir fieberhaft den Horizont absuchten, rückte die Nadel der einen Benzinuhr langsam aber unaufhaltsam gegen Null. Vorsorglich ein Blick auf den Temperaturfühler: minus 29°Außentemperatur.
„Da vorn“, kam es beinahe gleichzeitig von uns.
Auf der schnurgeraden Horizontlinie war eine winzige Unebenheit zu erkennen. Zehn Minuten später wußte ich Bescheid.
„Das ist der gesuchte Gebirgskamm, der auf der Karte mit 9252 Fuß ausgewiesen ist. Kein Zweifel“, rief ich aufgeregt. „Und dort links, diese kleine Erhebung, das ist der Punkt hier.“
„Wie sieht es aus? Kommen wir durch“, bohrte Chris nach.
„Läßt sich noch nicht sagen. Ich schätze die Entfernung zu dem Massiv auf 60 bis 70 km. Von dort sind es noch mal 80 km bis Narsarsuaq. Insgesamt haben wir damit eine knappe dreiviertel Stunde Flugzeit vor uns. Falls der Treibstoff in dem einen Tank noch 15 Minuten reicht, könnte es hinhauen.“
Der Zeiger für diesen Tank stand inzwischen schon auf Null. Um auch nicht die geringste Menge zu verschenken, ließ ich ihn an und schaute fortan nur noch auf das Instrument, das den Benzindruck anzeigte. Sobald der Druck abfiel, war der linke Tank trocken, und ich mußte umschalten. Dann ging es im anderen Tank um den bitteren Rest.
Mit unbarmherziger Trägheit verstrichen Sekunden und Minuten. Es war zum Verzweifeln. In dieser Einöde schien es, als bewegten wir uns überhaupt nicht vom Fleck.
„Herr Jesus!“
Obwohl ich augenblicklich damit gerechnet hatte, fuhr es mir durch alle Glieder, als die Benzindrucknadel plötzlich nach unten ausschlug. Rasch, damit der Motor um Gottes willen nicht zu stottern anfing, den Benzinhahn nach rechts. Treibstoffnotpumpe an. Ein Blick nach draußen. Die Anhöhe, die sich jäh inmitten der Eiskappe erhob, lag schräg hinter uns. Die ersten Küstengebirge und Gletscher der Westseite waren in Sicht.
„Was ist jetzt“, wollte Chris wissen. „Wir packen es, ja? So rede doch!“
„Einen Moment“, sagte ich ernst und griff nach dem Mikrofon. „Sei bitte nicht so aufgeregt. Es nützt nichts“, fügte ich mit hochgezogenen Augenbrauen noch hinzu und ging dann auf Sendung:
„Narsarsuaq, Narsarsuaq, hier Mooney 9608 Victor, wir sind 40 Meilen nordöstlich des Platzes auf Flugfläche 120. Werden in 18 Minuten bei Ihnen sein.“
„Verstanden, 08 Victor. Landebahn 25 in Betrieb. Nach Ihrem Flugplan sind Sie hier seit einer knappen Stunde überfällig, Sir!“
„Äh ... hm, eine Stunde? Sind Sie sicher“, fragte ich unschuldig, setzte aber gleich nach: „Nun ... äh, an der Ostküste hatten wir ... also da gab es ein kleines Problem mit ... äh, da war eine ... ja, Schlechtwetterzone zu umfliegen. Mag sein ... ja, das könnte etwas Zeit gekostet haben. Jedenfalls sind wir wohlauf und in Kürze bei Ihnen.“
„Okay, melden Sie 15 Meilen.”
Ich ging mit der Motorleistung zurück und brachte uns in einen leichten Sinkflug. Wie geschaffen für ein brausendes Finale war das Szenario dieser letzten Flugminuten. In einem weiten Bogen zog ich die Maschine kaum 100 Meter über einen gewaltigen, mit Spalten und Rissen übersäten Gletscherstrom hinein in das Tal von Narsarsuaq, an dessen Ende ein smaragdgrüner, mit Eisbergen besprenkelter Fjord schimmerte. Rechts und links standen mächtige Felsengebirge Spalier, in unserem Rücken bezwungen das gleißende Eisinferno der größten Insel der Welt.
7. Kampf um Kap Hoorn
Am 5. Januar 1788 tauchte Teneriffa in der Ferne auf. Dichter Nebel verhüllte fast die ganze Insel. Nur das eigenartig geformte Vorgebirge an der Nordwestecke war zu sehen. Auf der Reede von Santa Cruz ließ Capt. Bligh die Anker auswerfen.
Umsichtig und mit Eifer schritt er sogleich zur Erledigung der protokollarischen Förmlichkeiten:
„Ich schickte Mr. Christian ab, daß er dem Gouverneur aufwarten und ihm melden sollte: ich hätte hier angelegt, um meine Leute mit Erfrischungen zu versehen und den Schaden auszubessern, den wir während des Sturms erlitten hätten. Der Gouverneur, Marquis von Branciforte, ließ mir sehr höflich antworten, daß man mich mit allem, was die Insel vermöchte, versorgen würde. Ich hatte meinem Officier auch aufgetragen, ihm zu melden, daß ich Salve schießen würde, falls man den Gruß mit einer gleichen Anzahl von Schüssen erwidern wollte; allein hierauf erhielt ich die unerwartete Antwort, daß Se. Excellenz nur Personen von einem dem Ihrigen gleichen Range die gleiche Anzahl Kanonen zurückgäbe: mithin mußte die Feierlichkeit ganz unterbleiben.“
Viel Sorgfalt verwandte Bligh auf die Beschaffung neuer Lebensmittelvorräte. Was ihm dabei angeboten wurde, ließ allerdings zu wünschen übrig. Ausgiebig klagt er über hohe Preise und schlechte Qualität. Vor allem das Federvieh schien ihm stark überteuert. Das einzige, was seine Gnade fand, war der kanarische Wein, und davon deckte er sich und seine Männer mit einem ansehnlichen Vorrat ein.
Nur ein paar Tage und die Bounty war wieder auf See. Die Leute erfuhren nun den Reiseverlauf in seiner ganzen Länge und den eigentlichen Zweck des Vorhabens. Mehr als eine Andeutung hatte man ihnen in England nämlich nicht gemacht.
Bligh war entschlossen, ohne weiteren Aufenthalt nach Tahiti zu segeln, und ordnete als erste Vorsichtsmaßregel an, daß die tägliche Portion Schiffszwieback um ein Drittel gekürzt wurde. Die anderen Nahrungsmittel wurden wie bisher ausgereicht.
Es war noch nicht lange her, seit sich in der Seefahrt die Erkenntnis durchgesetzt hatte, daß Hygiene an Bord und eine gesunde, zufriedene Mannschaft solche weltumspannenden, oft jahrelangen Reisen viel eher begünstigten als gnadenlose Strenge und Bigotterie, wie sie auf den spanischen und portugiesischen Entdeckerschiffen noch üblich gewesen waren. Capt. Cook war der Pionier der neuen Ära, und bei ihm hatte Bligh gelernt.
Um seine Besatzung bei Laune zu halten und ihre„Gesundheit zu befördern“, ließ Bligh der Kürzung der Zwiebackration eine angenehme Anordnung folgen. Er teilte das Schiff in drei statt wie bisher zwei Wachen ein. Das bedeutete, daß die Männer nach jeweils vier Stunden Arbeit acht Stunden frei hatten, während sie bei nur zwei Wachen schon nach vier Stunden Pause wieder arbeiten mußten. Die Aufsicht über die dritte Wache übertrug Bligh dem„Steuermannsgehülfen“Fletcher Christian.
Noch eine erfreuliche Nachricht hatte der Kapitän für seine Männer parat:





























