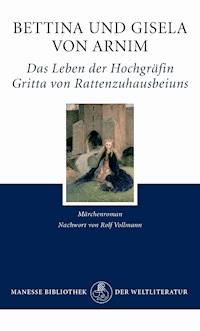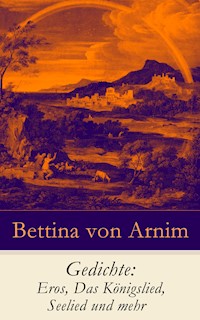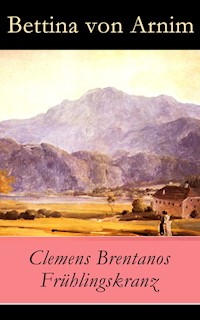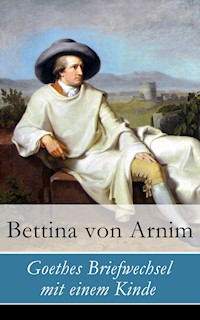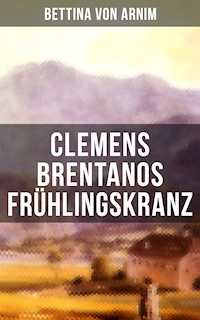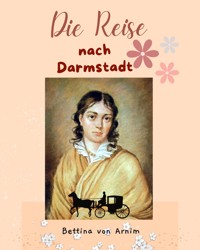7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Bettina von Arnim beschreibt die Suche nach ihrem eigenen Weg. Sie muss sich befreien vom großen Namen der Ahnin, der «wie ein zu weiter Mantel» um sie liegt. Von Berlin, wo sie an der Hochschule für Bildende Künste studiert, kommt sie nach Paris. Als sie eines Tages im Süden Frankreichs das Haus mit den Taubentürmen entdeckt, weiß sie: dieses Haus wird sie kaufen, auch wenn sie kein Geld hat, in diesem Haus wird sie eines Tages wohnen. Langsam wird die Ruine aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt … Das stimmungsvoll und sensibel gezeichnete autobiografische Bild einer Frau, die sich einen Ort erschafft, wo beides Platz hat: ihre ganz eigene unverwechselbare Persönlichkeit und Kunst und die Träume ihrer Kindheit. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Ähnliche
Bettina von Arnim
Taubentürme
Wie ich in Frankreich mein Zuhause fand
FISCHER Digital
Inhalt
Für Riki und Pauline
I Berlin
In der Malklasse von Fritz Kuhr
Am Eingang der West-Berliner Kunsthochschule saß der Pförtner in einem gläsernen Kasten. Niemand, der in das Gebäude hinein- oder hinausging, kam unbemerkt an ihm vorbei. Im Mai 1960 war ich Studentin des ersten Semesters und erschien brav und pünktlich, als ginge ich noch ins Gymnasium, um acht Uhr morgens vor der Pförtnerloge. So früh war noch kein Student und schon gar kein Professor zu sehen, um diese Uhrzeit wurde nur die Post gebracht, ein Stapel, den der Pförtner dann sorgfältig in einen hölzernen Wandkasten alphabetisch einordnete.
«Halt!», rief er, ging vom Holzkasten in seine Glaskiste zurück, öffnete eine gläserne Klappe, durch die er mir ein großes, braunes Kuvert hinhielt, das an «Bettina Brentano» adressiert war. Das habe wohl etwas mit dem Außenminister von Brentano zu tun, aber doch nicht mit mir, meinte ich und wollte weitergehen. Dann solle ich ihm doch wenigstens sagen, ob er die Post unter A oder B einordnen solle. «Warum nicht gleich unter V?», schlug ich vor, weil es schon öfter vorgekommen war, dass mir Post oder Gepäck nach langem Warten unter A schließlich erst unter V wie «Von Arnim» ausgehändigt wurde. «Besser noch unter Z wie Zernikow», sagte der Pförtner zu meinem Erstaunen.
Zernikow, mein Geburtsort, das Haus meiner Wunschträume und frühen Kindheitserinnerungen, in der Nähe von Berlin gelegen und dennoch unerreichbar und fast vergessen, wie auf einer weißen Landkarte auf verbotenem Gebiet, als läge der Ort hinter gläsernen Panzerplatten.
«Den Brief gebe ich Ihnen erst, wenn Sie mir drei Fragen richtig beantworten», sagte der Pförtner. Gut, ich war gespannt.
«Erste Frage: Wie kam der große Findling vor die Zernikower Kirche?»
«Der Teufel hat ihn dorthin geworfen, die Kirche aber hat er nicht getroffen. Seine Fingerabdrücke sind noch im Stein zu erkennen.»
«Zweite Frage: Welche ist die älteste der Zernikower Alleen?»
«Die Maulbeerallee. Fredersdorff, der Kämmerer des Alten Fritz, ließ sie für die Seidenraupenzucht anpflanzen.»
«Auch richtig. Nun die dritte Frage: Welche Position hatte der Baron auf dem Fußballfeld?»
«Links außen.»
Der Pförtner kam aus seinem gläsernen Kasten heraus. «Mein Name ist Zieske», stellte er sich vor und fügte mit Tränen in den Augen hinzu: «Mit Ihrem Vater zusammen habe ich in Zernikow Fußball gespielt, das waren schöne Zeiten!» Außerhalb seines gläsernen Kastens, an dem er sich abstützte, war zu sehen, dass Herr Zieske nur einen Schuh trug, unter dem anderen Hosenbein steckte ein schwarzer Gummipfropfen. Er sagte, in Zernikow habe er in der Forstwirtschaft gearbeitet. «Ein guter Chef, richtig kameradschaftlich war Ihr Vater, außerdem ein großer Land- und Forstwirt. Dann wurde ich aber als Soldat eingezogen.» Er blickte an sich herunter und fragte, ob mein Vater noch lebe. Nein, er sei im Frühjahr 1945, als er mit Zernikowern und den französischen Kriegsgefangenen noch das Saatgut unter die Erde bringen wollte, weil er eine Hungersnot voraussah, als «Junker» denunziert, von den Sowjets festgenommen und nach Russland abtransportiert worden. Im darauf folgenden Januar war er dort in einem Lager an Hunger und Kälte gestorben. Bei diesem Kurzbericht kamen auch mir die Tränen, ich konzentrierte mich darauf, sie zu unterdrücken, und vergaß den Briefumschlag mit der kuriosen Adressierung.
Herr Zieske, wieder ganz Pförtner, überreichte mir den Umschlag mit offizieller Miene. In den folgenden Monaten begrüßten wir uns am Eingang zur Hochschule freundlich, fragten manchmal, wie es ginge, über Vergangenes und Zernikow sprachen wir jedoch nicht mehr. Diese Verschlossenheit, zumal in Gegenwart anderer, war mir nur recht, denn ich empfand es als unangenehm, mit diesem anspruchsvollen Namen herumzulaufen, als steckte ich in einem zu weiten Mantel. (Dass wahrscheinlich mein Familienname mit dem Mädchennamen meiner Urahnin verwechselt worden war, hatte ich deshalb auch nicht zur Kenntnis nehmen mögen.)
Was in dem geheimnisvollen Briefumschlag steckte, weiß ich nicht mehr. Vielleicht handelte es sich um eine Ermahnung, an den unbeliebten Fächern Methodik und Pädagogik regelmäßig teilzunehmen, um etwas ganz Banales. Dazu fällt mir die ungewöhnliche Sammlerleidenschaft eines Schriftstellers ein, der Antworten von Menschen sammelte, die nicht mehr lebten.
Meine Tante, die Malerin Bettina Encke-von Arnim, älteste Schwester meines Vaters, erzählte mir einmal, sie habe einen Brief des israelischen Schriftstellers Ben Garchem erhalten, in dem aber nichts weiter gestanden habe als die Frage, ob der Brief denn angekommen sei. Das Kuvert sei an «Bettina von Arnim, Wiepersdorf über Dahme/Mark» adressiert gewesen, also an die Adresse der Dichterin der Romantik, die Urgroßmutter meiner Tante. Aus Wiepersdorf war meine Tante 1947 vertrieben worden, so dass der Brief mit dem Vermerk «Verzogen nach Überlingen/Bodensee» erst ein Jahr nach dem Datum des israelischen Poststempels bei ihr eintraf. Verwundert über diese merkwürdige Post habe sie dem Schriftsteller geantwortet. Dieser wiederum habe ihr eine freundliche Erklärung geschrieben: Er schicke solche Briefe an die ursprünglichen Adressen von Persönlichkeiten der Vergangenheit, die er verehre. Er sammle alles, was ihm zurückgeschickt würde, auch die vielen Umschläge mit dem Vermerk «Unbekannt/Verzogen». Besonders freue er sich, wenn er tatsächlich eine Antwort erhalte, wie dieses Mal.
An der Hochschule für bildende Künste, Abteilung Kunstpädagogik, in der Grunewaldstraße studierte ich seit kurzer Zeit in der Mal- und Zeichenklasse von Fritz Kuhr. Von meiner Tante, die mit Fritz Kuhr befreundet war, wusste ich, dass er als «entarteter Künstler» verfemt, in Wiepersdorf bei meiner Großmutter Agnes von Arnim, der «Erdbeeroma», Zuflucht gefunden hatte. Ein Brief mit seinem Absender hatte mich noch in der Diakonissenanstalt Schwäbisch Hall überrascht.
Nach dem Abitur hatte ich in diesem Krankenhaus als freiwillige Schwesternhilfe für Kost und Logis gearbeitet, wusste ich doch nicht, wohin, noch wovon leben. Auf gut Glück hatte ich vorher meine Bewerbung und eine Mappe mit Aquarellen und Zeichnungen nach Berlin geschickt.
Im Krankenhaus begann der Dienst bereits um sechs Uhr morgens. Geweckt wurde um fünf Uhr zum Frühgebet, als hätten wir jungen Mädchen Nonnen werden wollen. In der Meinung, Kunst könne nicht helfen und nichts bewirken, wollte ich Ärztin werden, um einmal Leiden mindern zu können. Nach mehreren Wochen im «Diak», als ich wieder einmal den täglichen Gang auf den langen Fluren zum Tablettenverteilen antrat, winkte mir die Oberschwester der HNO-Abteilung mit einem Brief zu und rief, als ob sie sich für mich freue: «Schweschderle Bedina, da habet Sie einen Brief von einem Professor aus Berlin!»
Professor Kuhr schrieb, die Prüfungskommission habe nach Durchsicht der Mappe meinen Antrag auf das Studium an der Kunsthochschule angenommen. Daraufhin habe er darum gebeten, dass ich seiner Malklasse zugeteilt würde, denn er habe meinem Vater viel zu verdanken.
Mein Herz schlug höher, und ich tanzte nur so mit dem Tablett und dem Brief durch die Flure.
Das Atelier der «Kuhr-Klasse» lag im dritten Stock unter dem Dach. Von den großen Nordfenstern aus sah man in den Kleistpark hinunter, rechts auf die Kupferdächer der Kleistkolonnaden und links, weiter entfernt, auf das Kontrollratsgebäude, vor dem vier hohe Fahnenmasten standen. Tagte der Kontrollrat, waren alle vier Fahnen der Besatzungsmächte hochgezogen. An normalen Tagen wehte die amerikanische, englische, französische oder sowjetische Fahne, je nachdem, welche Vertretung gerade in dem Gebäude Wache hielt.
Eines Sommerabends, während einer Feier im Kuhr-Atelier, wurde eine Wette abgeschlossen: Wem es gelänge, eines der Bronzepferde im Kleistpark zu besteigen und darauf zu sitzen, der bekäme eine Flasche Rotwein. Zum Glück war gerade die französische Fahne gehisst, unter den Augen der Sowjets hätten wir die Kletterpartie nicht gewagt. Von unten aus gesehen waren die Pferde wesentlich höher als von oben geschätzt. Mit großer Anstrengung gelang es mir, mich an einem überdimensionalen Steigbügel hochzuziehen. Die Weinflasche wurde gleich nachgereicht.
Diese Begebenheit trug sich erst gegen Ende des ersten Semesters zu, vorher hätten wir Neuankömmlinge nicht den Mut zu solchem Unfug gehabt.
Frisch vom Gymnasium an die Kunsthochschule gekommen, waren wir noch voller Respekt und Bewunderung für die «Großen». Besonders einschüchternd wirkten zwei Studenten höheren Semesters, die das Privileg hatten, hinter dem großen Gemeinschaftsatelier ein kleineres für sich zu haben. Sie malten zwar nur in der «Knochenkammer», in dem Abstellraum für Gipsmodelle und Skelette, dafür aber umso größere und starkfarbigere Bilder. Was wir malten, betrachteten sie herablassend und drückten ihre Zigaretten einfach auf dem Fußboden aus. Meine Bewunderung für die beiden, Petrick und Baehr, ließ nach, als ich merkte, dass man vor ihnen seine kostbaren Farben gut wegschließen musste.
Schon von weitem war Professor Fritz Kuhr an seinem schlurfenden Gang und seinem ständigen Begleiter, dem weißen Spitzhündchen Pucki, zu erkennen, wenn er morgens aus dem Bus stieg und die Hochschule betrat. Meist schloss er sich erst einmal in seinem Privatatelier ein, bevor er zu Korrekturen beim Aktzeichnen und zu Gesprächen zu uns herüberkam. Einmal erzählte er, seine schlechte Gehweise sei die Folge einer Hungersnot. Nachdem das staatliche Bauhaus in Weimar 1926 geschlossen und in Dessau wieder eröffnet worden war, nachdem Walter Gropius alles getan hatte, um sein Werk an anderem Ort unterzubringen, sei er gefolgt und habe sich als alter Bauhäusler ohne Geld und Arbeit in Dessau durchgeschlagen. Von der wochenlangen Unterernährung sei Muskelschwund eingetreten. Um das anschaulich zu machen, krempelte er seinen linken Ärmel hoch und zeigte auf die Stelle des Bizeps, der aber kein Muskel mehr war, sondern nur eine sehnige Einbuchtung.
Als Einführung in die Grundbegriffe der Malerei erklärte Fritz Kuhr Goethes Farbenlehre und empfahl uns «Farben-Braune», eine Großhandlung in der Grunewaldstraße. Dort sollten wir uns für den Anfang billige, große Öltuben kaufen, drei in den Grundfarben Rot, Blau und Gelb und eine Tube Zinkweiß. Damit könnten wir alle anderen Farben mischen und das Malen von «lebendigem Grau» ausprobieren. Die teuren, kleinen Farbtuben besserer Qualität – die allerteuerste sei Violett – könnten wir uns nach und nach dazukaufen.
Beim Malen trug ich einen abgelegten Massagekittel meiner Mutter, blütenweiß, nur an den Ärmeln etwas abgetragen, niemand an der ganzen Hochschule hatte so schicke Malkittel. Aber die Farben von «Farben-Braune» gerieten nicht nur auf die Leinwand, und bald stand mein Kittel steif wie die «krachledernen Reithosen des Barons von Hüpfenstich», wie der Schriftsteller Fritz Reuter zu sagen pflegte, abends vor der Staffelei. Fritz Kuhr meinte schmunzelnd, ich solle mir an dem Maler Achim von Arnim in Wiepersdorf ein Vorbild nehmen, der habe früher im piekfeinen Samtanzug und Barett seine Historienbilder gemalt.
Später erzählte Fritz Kuhr, wie er selbst nach Wiepersdorf gekommen sei. Bevor er zum zweiten Mal in Berlin ausgebombt worden war, seien kontrollierende Beamte in sein Atelier gekommen. Wenn die Treppenstufen knarrten, habe er schnell über ein anderes Bild ein Hakenkreuz gestellt und so getan, als ob er daran male. Mit diesem Trick sei es eine Zeit lang gut gegangen, dann aber habe er Malverbot erhalten. Der Lichtblick für ihn als «entarteter Künstler» sei Wiepersdorf und die Zernikower Holzzaunfabrik meines Vaters gewesen. Mehrere von den Nationalsozialisten Verfolgte hätte meine Großmutter Agnes in Wiepersdorf versteckt. Sie ordneten die wertvolle Bibliothek oder arbeiteten als Angestellte im Holzbetrieb.
«Ihr Vater, der alle zwei Wochen mit dem Motorrad von Zernikow nach Wiepersdorf kam, gab mir solch eine Anstellung, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Wenn die Gestapo kam, taten wir so, als ob wir Holz sägten. Aber schwach und ungeschickt, wie wir so genannten ‹Asphaltintellektuellen› waren, wäre das nicht gut gegangen, wenn uns die wirklichen Holzarbeiter nicht geholfen hätten. Stillschweigend stellten sich diese guten, kräftigen Kerle vor uns, sägten, ließen sich leichte Holzstücke reichen und so weiter, bis die Herren in Uniform gingen.»
Zeichnen, jeden Tag sollten wir frei zeichnen, sagte Professor Kuhr. Paul Klee habe jeden Tag mindestens eine Zeichnung gemacht. Was aber nur, Stillleben oder Fantasiegebilde? Das Was und Wie müssten wir im Laufe der Zeit selbst herausfinden und würden uns durch beständige Arbeit einen persönlichen Stil aneignen.
Sowie es wärmer würde, wollte ich, wie schon mehrmals, über die Potsdamer Brücke gehen, immer weiter Richtung Osten, und zeichnen, bevor alle Spuren der Vergangenheit eingeebnet wären. Doch solange es noch so kalt war, dass einem der Bleistift in der Hand zitterte, fand ich neben den Stadtansichten andere Motive im Warmen und ganz in der Nähe.
Am Winterfeldtplatz, unterhalb eines Fernmeldeturms, lagen bis auf die Grundmauern zerstörte Häuser. In einem davon schien noch Leben zu sein. In den Fensteröffnungen des früheren Vorderhauses standen Blumentöpfe mit Schutzhauben gegen den Frost, zwischen niedrigen, weiß getünchten Mauerresten waren Holzfässer um Tische gruppiert. Diese kalte Wohnstube unter freiem Himmel hatte etwas liebevoll Improvisiertes. Über der Tür zum Hinterhaus, das nur noch aus dem Erdgeschoss bestand, hing das Schultheiß-Emblem mit seinem Bierhumpenmann, und an der Tür stand geschrieben: «Bei Elschen.»
In der Kneipe saßen Stammgäste um einen großen, runden Tisch und spielten Karten. Neben dem Eingang stand ein Bullerofen mit dem Rohr zum Fenster hinaus, links davon ein kleiner Tisch, an dem ich mich – beim ersten Mal etwas zögernd, da fremd in diesem Milieu – niederließ. Dieser kleine Tisch zwischen Fenster und warmem Ofen «Bei Elschen» sollte zu meinem Stammplatz werden.
Die Wirtin begrüßte mich freundlich, wenn auch etwas verwundert. Ich bestellte ein Bier, weil dies die anderen am großen Tisch vor sich stehen hatten. Als die Wirtin mit meiner Bestellung aus dem linken Teil des Raumes zurückkam, fragte ich, ob ich hier zeichnen dürfe. «Wat, bei mir? Da jibt’s doch nüscht Schönet abzumalen!» – «Doch, die Gesichter Ihrer Gäste sind eindrucksvoll.» – «Ja, Frollein, wenn Sie wüssten, wat die alles mitjemacht haben, diese armen Menschen. Ik möcht’s ihnen hier jemütlich machen, man tut eben, was man kann.»
Nach längerem Beobachten begann ich zu skizzieren, zunächst das Gesicht eines Mannes im Profil, es schien vom Krieg gezeichnet. Am nächsten Tag, zwischen zwei Vorlesungen, ging ich wieder zu «Elschen», das zerfurchte Gesicht einer Frau undefinierbaren Alters hatte es mir angetan. Ihre Gesichtszüge hatten etwas Animalisches, ich versuchte, dies in expressiver Weise zu betonen. «Fertig, darf man kieken?», fragte sie nach einer Weile. Ich zeigte ihr die Porträtzeichnung, erschrocken hielt sie sich den Bauch und rief: «Mensch, ik jebär gleich ’nen Orang-Utang!» – «Jut jetroffen, uns Tanja!», freuten sich die Männer.
Wann nur immer möglich kehrte ich «Bei Elschen» ein und zeichnete. Nach einem lustigen Wortwechsel rief mir ein Mann zu: «Halten Se’s graphologisch fest!» Dann wieder wurde mir vorgeschlagen, auch einmal den Schüchternen da hinten zu konterfeien, oder «uns Paula, ausn Trümmern rausjebuddelt». Die Paula war nach einigen Runden Bier recht munter, und als sie ihre Porträtskizze ansah, rief sie: «Det is aba humorvoll uffjefasst! In der Ironie liegt die Weisheit der vornehmen Gesellschaft, sagte mein Frollein Mutter imma.» Der Schüchterne, die verrückte Paula, alle ließen sich gerne porträtieren, obwohl die Zeichnungen, meist in grober, hastiger Strichführung, nichts Gefälliges hatten. Eine der Frauen sagte: «Wenn ik mein Bildnis besehe, is es ja nich so sehr schmeichelhaft, aber dat Se mir jemalt haben, det ehrt mir denn doch.»
Jedes Mal, wenn ich mit meinem Zeichenblock in die Kneipe kam, wurde mir zugerufen: «Ah, da kommt Zilles Tochter wieder!»
Vor dem 13. August 1961
Während der ersten zwei Semester wohnte ich bei meiner Großmutter mütterlicherseits in Berlin-Zehlendorf. Nach einem Faschingsfest in der Kunsthochschule am Steinplatz, dem «großen Zinnober», wusch ich mir am frühen Sonntagmorgen in Großmutters Badewanne die Silberbronze aus den Haaren. Die Folge war ein Rausschmiss wegen Badewannenversilberung. Gretchen, Großmutters Haushälterin, sei das Wegputzen meiner Farben nicht mehr zuzumuten. Dennoch durfte ich mich danach an Gretchens guten Mahlzeiten jeden Sonntagmittag satt essen.
Der Umzug von der Zehlendorfer Villa in die Elßholzstraße 7, zweiter Hinterhof, Treppeneingang links kam mir nur recht. Dort musste man sich nicht wie eine «höhere Tochter» benehmen, eher wie «Zilles Tochter». Die Elßholzstraße war die Schattenseite des Kontrollratsgebäudes. Keine Fahnen wehten in Wind und Sonne wie im Kleistpark dahinter. In der engen, dunklen Straße standen nur unheimliche Militärfahrzeuge.
Meine Zimmerwirtin, eine sehr arme Arbeiterwitwe, teilte ihr Bett mit ihrem Sohn Kurt, einem jungen Maurer, der tagsüber auf Baustellen in Ost-Berlin arbeitete. Kurts vorheriges Zimmer, Wand an Wand mit ihrem, war nun meines, weil seine Mutter das bisschen Mietgeld brauchte. Statt das Arbeitermilieu aus der Distanz abzuzeichnen, lebte ich nun darin. Das Zimmer war winzig und kahl, die Toilette auf halber Treppe, vom Küchenherd, der gemeinsamen Heizung, roch es nach Kohlsuppe. Doch das Zimmer hatte ein Fenster mit Blick auf den Hinterhof.
An einem regnerischen Morgen kramte ein zerlumpter Mann in den Mülleimern, öffnete einen Deckel nach dem anderen, steckte seinen kahlen Kopf in die Eimer und hielt sich leere Schnapsflaschen an den Mund. Dann fischte er eine schwarze Herrenjacke aus der Tiefe eines Eimers und zog sie über, verschimmelte Zitronen kullerten aus den Ärmeln über den nassen Teer im Hof – phosphoreszierendes Gelbgrün auf glänzendem Anthrazit, zum Malen schön, zum Leben jedoch nicht.
Eines anderen Morgens stand ein Leierkastenmann im Kreis der Mülleimer. Konzentriert kurbelte er an seinem bemalten Kasten. Nach drei melancholischen Stücken auf der Drehorgel blickte er zu den Fenstern des Hinterhofs hoch, Groschen wurden in seinen Hut geworfen. Dann schob er seinen Leierkasten wie einen Kinderwagen wieder zum Hof hinaus.
Beim sonntäglichen Sattessen sagte ich Großmutter nichts von den ärmlichen Verhältnissen in der Elßholzstraße, nur dass ich jetzt hinter dem Kontrollratsgebäude wohne. Sie meinte dazu: «Dann bist du ja gut bewacht!»
Als es im Sommersemester wärmer wurde, fuhr ich mit der U-Bahn zum Zeichnen nach Ost-Berlin. Durch Berlins alte Mitte lief ich vom Bahnhof Friedrichstraße zur Museumsinsel, zum ehemaligen Schlossplatz, zum Gendarmenmarkt. In Eile versuchte ich, an einem Nachmittag gleich mehrere Stadtansichten zu zeichnen, vielleicht in der Vorahnung, dass dies bald nicht mehr möglich sein würde.
Meine Entdeckungsgänge machte ich meist allein, um der Intensität des Eindrucks willen – das gemeinsame Schwatzen beim Billig-Kuchen-Essen und Juno-Zigaretten-Rauchen hätte vom Ernst der Sache abgelenkt – und auch, weil an der West-Berliner Kunsthochschule abstrakte Malerei hoch im Kurs stand. Dafür setzte man sich nicht vor ein Motiv, gar noch im Osten. Sicher hätte ein Fotoapparat die eindrucksvolle Ruinenlandschaft der alten Stadtmitte besser dokumentieren können. Aber davon abgesehen, dass ich keinen besaß, stand ich unter dem Leistungsdruck, eine künstlerische Aussage vorzulegen. Etwas abstrahierend, wie eilig hingeschrieben, überließ ich es dem Gestus der Hand, das Gesehene mit Chinatusche wiederzugeben. Ein faszinierendes Motiv war der Berliner Dom, ein schwarzer Koloss mit türkisgrüner Kupferkuppel, umgeben von Figuren ohne Köpfe. Der französische und der deutsche Dom am Gendarmenmarkt, zierlicher im Grundriss, wirkten noch verletzter. Nur die Armaturen der Kuppeln stand noch, von der Feuerhitze in die Schräge geneigt, als filigranes Gerippe gegen den Himmel. Weiter entfernt, in der Oranienburger Straße, unheimlicher als alle anderen zerstörten Gebäude Berlins, stand die Ruine der Synagoge. Nichts ragte gen Himmel, keine Kuppelreste waren zu sehen, nur dunkle Löcher in einer hohen Mauerfassade.
Einige Zeit später zeichnete ich zum wiederholten Mal den Berliner Dom. Von einer Bank vor dem Zeughaus überblickte man den Lustgarten – eine leere, gar nicht lustige Fläche –, an dessen Ende die dunkle Gebäudemasse wie aus der Wüste aufragte. Diesmal wollte ich es mit der Abstraktion etwas weiter bringen, weniger auf Einzelheiten eingehen als vielmehr das Verhältnis von Leerraum und Masse beachten. Als ich gerade dabei war, die Dunkelheit zur Mitte hin zu verdichten, kamen Gleichaltrige hinzu und sahen mir über die Schulter. Sie wollten nicht stören, sagte eine aus der Gruppe, als ich die Feder absetzte, da ich mich beobachtet fühlte. Ein junger Mann bat mich weiterzuzeichnen. Das würde ihn interessieren, er fügte leise hinzu, so modern dürften sie nicht zeichnen, das sei ihnen verboten. Ein anderer stellte die Gruppe als Studenten der Kunsthochschule Weißensee vor. Mit gedämpften Stimmen begann eine kurze Debatte, so als sollte die neu gegründete Schule Weißensee gegen die altbestehende im Westen verteidigt werden. «Verboten», das sei übertrieben, das dürfe er nicht sagen, meinte eine der Studentinnen streng zu ihrem Kommilitonen. Nein, direkt verboten sei ihnen nichts, schaltete sich vermittelnd die Studentin ein, die zu Anfang nicht hatte stören wollen. Sie in Weißensee hätten nun mal vorgegebene Regeln zum «Sozialistischen Realismus», sie selbst sei froh über solche Vorgaben, an denen man Halt fände. Ja, ihm ginge auch die Sicherheit über die Freiheit, sagte der, der die Gruppe vorgestellt hatte. Außerdem ließe sich handwerkliches Können gerechter beurteilen als …«als so ein verrücktes Gekritzel!», fiel ihm die ins Wort, die verboten hatte, «verboten» zu sagen. «Jetzt kommt schon, weiter!», forderte sie alle zum Gehen auf und murmelte: «Seid ihr denn blöde, so eine Unterhaltung mit der hier auf freier Fläche, das ist doch gefährlich.»
Die Studenten entfernten sich, schnell gingen sie am Spreeufer entlang, nur einer von ihnen trödelte etwas hinterher. Aber keiner drehte sich um, und auch ich hielt es für ratsam, ihnen nicht mehr hinterherzusehen. Gefährlich oder nicht, die Zeichnung sollte fertig werden! Es fehlten nur noch wenige Striche, damit sich Gegenstand und Raum ineinander verzahnten, nach dem Rat von Professor Kuhr: Auch die weiß gelassenen Stellen dürften nicht mehr wie Papier aussehen.
Im Kuhr-Atelier angekommen, zeigte ich die Zeichnung vom Dom unserem Professor, der für sie gelungen hielt. Auf das Lob hin sollte sie die Vorlage für ein großes Ölbild sein. Als Leinwand hierzu diente das Porträtgemälde des Rechtsgelehrten Carl von Hagens, der vom letzten Kaiser für seine Verdienste geadelt worden war. Das Gemälde in Halbfigur zeigte ihn, dessen Grundlagen zum Konkursgesetz noch heute gelten, in vollem Ornat. Meine Zehlendorfer Großmutter hatte es mir mit der Erklärung gegeben, sie wolle das Bildnis ihres Schwiegervaters los sein, ich könne es zum Trödler bringen oder sonst etwas damit anfangen. Die große Leinwand mit solidem Keilrahmen, sonst unerschwinglich, sah ich nur als geeigneten Malgrund. Fritz Kuhr machte zwar auf die gediegene Malerei von damals aufmerksam, bewunderte das Moiré der Brustschärpe, aber als ich ihn fragte, was man anstelle der üblichen Grundierung auf leere Leinwand nehmen solle, riet er zu Deckweiß. «Das war nur eine rein technische Antwort, der Rest ist Ihre eigene Entscheidung», sagte er und verließ das Atelier. Meine Entscheidung war längst getroffen, der Jurist aus Kaisers Zeiten wurde auf den Boden gelegt, zu mehreren überpinselten wir ihn von außen nach innen mit Deckweiß. Das Gesicht blieb mir vorbehalten. Erst kam es mir lustig vor, in kreisenden Bewegungen Bart und Kopfhaare verschwinden zu lassen, aber dann, als ich schnell die Augen des Urgroßvaters überstrich, damit er mich nicht mehr ansah, bedauerte ich die ganze Aktion. Zu spät.
Noch einmal fuhr ich zum Zeichnen nach Berlin-Mitte. Durch kleine Seitenstraßen gelangte ich zum Kupfergraben, betrachtete wieder der Reihe nach alle zerstörten Gebäude der Museumsinsel, vom Bode-Museum, an dem die Eisenbahnzüge direkt vorbeifuhren, bis zum klaffenden Loch vor dem Deutschen Museum mit seinen bloßgelegten Innenwänden dahinter, an denen hoch oben unzugängliche Türen zu sehen waren. Ich überquerte schnell die Brücke, vermied die große Fläche des Lustgartens und kam von dessen Rand her zur Vorderseite des Alten Museums. Seine Treppenstufen, von der Sonne durchwärmt, schienen ideal, um sich darauf niederzulassen und das Zeichenmaterial um sich herum auszubreiten. Links lag der Dom, rechts das barocke Zeughaus, doch geradeaus war nichts als eine riesenhafte leere Fläche zu sehen. Dort musste das Berliner Stadtschloss gestanden haben, vor diesen schiefen alten Häusern, die nun so unvermittelt an diesen großen Platz vorgerückt waren.
Wie aber nur die Leere zeichnen? Ohne Gegenstände ließen sich nicht einmal deren Schatten wiedergeben. Das abhanden Gekommene weckte die Erinnerung, wie meine Mutter geweint hatte, als vor zehn Jahren im Radio die Meldung kam, Walter Ulbricht habe das Stadtschloss sprengen lassen, und wie mein ältester Bruder Achim behauptet hatte, die ganze Stadtmitte würde zum militärischen Aufmarschplatz.
Erst einmal zeichnete ich die niedrigen alten Häuser, eins ums andere, wie ein dunkles waagerechtes Band am Horizont. Links verdeckte eine helle Plastikempore die weiteren Häuser. Über mein Blatt gebeugt, zeichnete ich aus der Vorstellung an der verdeckten Häuserkette weiter. Als diese fertig war, sah ich auf, doch traute ich meinen Augen nicht: Ein ganzes Heer war vor dem Gestell aufmarschiert. Die exerzieren da hinten, wo einmal das Stadtschloss gestanden hat, dachte ich, statt sofort zu gehen, und setzte diesen Strich und den auch noch. Plötzlich machten die Truppen der Nationalen Volksarmee rechtsum kehrt. Die leere Fläche füllte sich, die Masse Soldaten marschierte frontal auf das Alte Museum zu. Im Gleichschritt kamen sie näher und näher.
«Ruhe bewahren ist des Bürgers erste Pflicht», dieser preußische Anschlag vom Beginn des Siebenjährigen Krieges schoss mir durch den Kopf, mir klopfte das Herz wie wild. Sitzen bleiben, jetzt bloß nicht weglaufen, wer flieht, wird verfolgt!
Kurz vor den Treppenstufen kamen die Truppen in breiter Front zum Stillstand. Von links schritt ein Offizier die Stufen hoch, sah prüfend auf Zeichenblatt und Tintenfass, dann folgte sein Kommentar, ein verächtliches «Pft!» zur Entwarnung. «Kehrt um, marsch!», kommandierte er. Die Truppen, von der ersten bis zur hintersten Reihe, setzten sich wieder in Bewegung. In Rückenansicht verlor die militärische Masse etwas von ihrer Bedrohlichkeit. Schnell machte ich mich davon, lief den Kupfergraben entlang und atmete erst wieder auf, als die U-Bahn an einem West-Berliner Bahnhof hielt. Damit hatten die Streifzüge mit Skizzenblock in Ost-Berlin ein Ende gefunden.
Waltraut, eine Freundin aus der «Labes-Klasse», wie das Kuhr-Atelier unter dem Dach gelegen, spielte sehr schön Querflöte. Das teure Instrument hatte sie sich durch eine langweilige Arbeit in einem Versicherungsbüro verdient. Auch ich wünschte mir, Querflöte statt nur Blockflöte spielen zu können. Als Kind hatte ich einmal am Radio die g-moll-Sonate von Bach gehört, gespielt von Aurèle Nicolet. Von da an schwebte mir vor, diese Sonate irgendwann einmal spielen zu können. Während der Semesterferien arbeitete ich bei der Bausparkasse Schwäbisch-Hall oder bei der Weinlese in der Provence. Schließlich vermittelte mir ein Student von der Musikhochschule am Steinplatz die langersehnte Querflöte. Er kannte einen Musikstudenten aus dem Osten, der anonym bleiben wollte. Dieser verdiente sich sein Studium in West-Berlin, indem er Musikinstrumente von Ost nach West schmuggelte. Der Schwarzhandel verlief «eins zu vier», das hieß, eine Deutsche Mark West entsprach vier Reichsmark Ost, mein Musikinstrument aus dem Osten, in Westmark bezahlt, war entsprechend billiger. Der anonyme Musikstudent behielt zwanzig Prozent für sein Risiko ein, und ich erhielt sehr günstig eine silberne Querflöte, in die «Zeiss-Jena» eingraviert war.
Nun hatte ich eine schöne Querflöte, konnte aber nicht darauf spielen. Ich nahm Unterricht bei einer Gesangsprofessorin der Musikhochschule. Sie spielte meine neue Flöte ein, der Meinung, dass es sich um ein gutes Instrument handelte, ohne zu fragen, auf welche Weise ich die «Zeiss-Jena» erworben hatte. Danach hieß es Atemübungen machen sowie Tonleitern und nochmals Tonleitern üben. In der Flötenschule, «eins zu eins» bei «Musik-Riedel» gekauft, kam ich gerade nur über die halben Noten hinaus. Im weiteren Teil des Hefts wurde es schwarz und schwärzer vor dicht gedruckten «Vierundsechzigstel»-Noten. Immer öfter kam ich zu spät zum Unterricht, hechelnd wie ein Hund, dem die Flanken zittern – eine Zwerchfellübung, die mir die Gesangslehrerin für ein Vibrato beigebracht hatte. Nach zehn Unterrichtsstunden zu zehn Mark ging mir das Geld aus.
Doch die teuren Stunden hatten sich gelohnt. Die Grundlagen des Querflötenspielens waren mir von der Gesangslehrerin gegeben worden. Durch die Zwerchfellatmung wurden Körper und Musikinstrument sozusagen ein Herz und eine Seele. Und die ach so langweiligen Tonleiterübungen, ähnlich dem Grammatikpauken für Fremdsprachen, waren die Voraussetzung für später, für das freie Musizieren an französischen Kaminen.
Fünf Monate wohnte ich nun schon in der Elßholzstraße, inzwischen war es Ende Juli. Eines Nachts schluchzte meine Zimmerwirtin jämmerlich allein in ihrem Bett: «Kurtsche, ach, mein lieber Kurtsche, komm doch wieder von Baustelle!» Zwei Tage später legte ich ihr die Formulare zur Abmeldung des Zimmers auf den Küchentisch mit der Bitte um Unterschrift. Obwohl es mir für die arme Frau Leid tat, wollte ich für die drei Sommermonate, die bevorstehenden Semesterferien, die Miete sparen. Sie setzte ihre Brille auf, unter Tränen kam die Unterschrift für die Meldebehörde zustande. Danach sagte sie gefasst, auf geheimen Umwegen habe sie eine Nachricht von ihrem Sohn erhalten. Ihr Kurt sei auf einer Ost-Berliner Baustelle einbehalten worden, Massen von Zement würden nach Berlin transportiert, da braue sich etwas Furchtbares zusammen: «Die drüben machen dicht.»
Zu Beginn der Semesterferien ging es auf Reisen mit meiner Mutter, meinen Brüdern Peter-Anton und Wolf und mit meiner amerikanischen Freundin Mimi nach Barcelona. Mein ältester Bruder Achim hatte sich gewünscht, nach jahrelangem Aufenthalt in Afrika «von möglichst viel Familie» vom Schiff abgeholt zu werden. Für diesen Wunsch hatte der älteste Bruder dem jüngsten den Führerschein bezahlt und ihn einen Volkswagen kaufen lassen. Mit zwei Autos fuhren wir nach Spanien: Mutter und Wolf im Volkswagen, Peter-Anton und ich im geliehenen Porsche meiner Freundin Mimi.
Während seiner Heimreise wollte Achim möglichst viele bedeutende europäische Kulturstätten besichtigen. Doch Mutter und ihr Ältester wurden sich nicht einig, was denn «bedeutend» sei. Nach der Besichtigung von Carcassonne und anderen Sehenswürdigkeiten mehr hatte Mutter für den nächsten Tag, ihren Geburtstag am 14. August, einen Wunsch frei. In einem Reiseführer ihres Vaters, dem «Baedeker», tippte sie auf «Le Pont du Gard, hat drei Sterne, bringt Glück!» Wir verabredeten uns auf zwölf Uhr mittags vor diesem «bedeutenden Mauerwerk der alten Römer».
Achim, Mutter und Wolf waren mit dem Volkswagen schon zur Stelle, hinter einem Kiosk warteten sie auf uns drei im Porsche. Statt auf die Familie sah ich auf die ausgelegten Zeitungen im Kiosk und erschrak vor den Titelbildern. Aus Fenstern sechsstöckiger Häuser stürzten sich Menschen in die Tiefe, hinunter auf Planen, die Feuerwehrmänner gespannt hielten. Die Bildunterschriften: «Verzweifelte Fluchtversuche, Berlin Bernauer Straße, 13. August 1961». Die Schlagzeilen: «Berlin über Nacht durch eine Mauer geteilt». Mir wurde speiübel, vor dem Kiosk erbrach ich das Geburtstagsfrühstück.
Mutter war die Kotzerei ihrer Tochter vor aller Augen peinlich. «Reiß dich doch zusammen! Wenn dir schon übel ist, dann erledige das doch bitte sehr da hinten, hinter den Pinien!» – «Aber guck doch nur, Mutti, Berlin bei Zernikow …», da wurde mir erneut schlecht. Mutter sah zum Aquädukt hoch, mit allen anderen zusammen sollte ich dort hochklettern, Zerstreuung täte gut. Aber von bedeutenden Mauerwerken, gleich aus welchem Jahrhundert, hatte ich die Nase voll. Mutter rief heiter: «Meinen Geburtstag lasse ich mir nicht vermiesen!», nahm die drei ihrer fünf Söhne ins Schlepptau und folgte anderen Touristen einen Steilhang hinauf. Mimi, keiner Familienfolgsamkeit unterworfen, blieb unten bei mir. In Ruhe lasen wir die Berichte der französischen und englischen Zeitungen über die Berliner Mauer und schauten zwischendurch zu dem römischen Bauwerk hoch, vom brennend Naheliegenden zu der Stille vergangener Zeiten.
Das Mauerbild
Zum Wintersemester 1961/62 nach Berlin zurückgekehrt, fand ich ein Zimmer mit drei Erkerfenstern über dem Winterfeldtplatz. Am Abend des Einzugs wurde dieser «begossen». Nicht in der Ruinenkneipe «Bei Elschen», sondern in «Dietrichs Weinlokal», in einem Eckhaus zwischen Nollendorf- und Winterfeldtplatz. Es hieß, dieses sei der alten Weinstube «Lutter und Wegner» nachgebaut worden, in der E.T.A. Hoffmann mit seinem Schauspielerfreund Ludwig Devrient ganze Nächte zusammengesessen hätte.
Zu sechst feierten wir, dass ich ein schönes, großes Zimmer gefunden hatte. Zu der Clique gehörten Waltraut, die so gut Querflöte spielte, Uta, Hartmut und Dieter aus der Kuhr-Klasse und mein Freund Rudolf. Er war der Einzige der Hochschule, der ein Auto besaß, einen fast neuen Volkswagen, den ihm sein Vater überlassen hatte. Er trug das Autokennzeichen «MS» für Münster in Westfalen.
Anfang November fuhr Rudolf mit Dieter und mir in den Wedding, zur Mauer in der Bernauer Straße. An einem kalten Nachmittag zeichneten wir dort eine schwarze Häuserfront mit weißen, zugemauerten Fenstern. Die Stimmung hatte etwas Gespenstisches. Im Nieselregen hielten wir uns wie zum Schutz dicht neben dem Auto auf. Vorsichtshalber stand das Auto aber etwas entfernt in einer westlichen Seitenstraße, deren Bäume rechts und links die lange, zugemauerte Bernauer Straße verdeckten. Dieser natürliche Rahmen wirkte zu hübsch für das, was an diesem Ort geschehen war. Unzufrieden mit meiner Zeichnung, wagte ich mich von meinen Begleitern und dem Auto weg und ging ein Stück weiter durch die menschenleere Bernauer Straße. Da, eine dunkle Häuserschlucht, kahle Brandmauern, eine alte Straße nach Berlin-Mitte, versperrt von Mauer und Stacheldraht. Dieser faszinierende Eindruck, diese unheimliche Stimmung, sie ließ sich vielleicht in dunklen Farbtönen malen. Ich berichtete meinen Freunden von der Stelle und bat Rudolf, am nächsten Tag erneut hierher zu fahren. Dieter hatte keine Lust, wieder mitzukommen, gar noch zur Ölmalerei. Es sei zu kalt, zu bedrückend.
Am Abend bespannte ich einen Keilrahmen mit Nessel und trug zwei Grundierungen auf. In der Nacht, bei geschlossenen Augen, kam mir die Vorstellung von dem Mauerbild und seiner Farbgebung. Die am Tage als hell und neu wahrgenommene Mauer war nun eine pechschwarze, horizontale Querfläche, die Brandmauer dahinter jedoch ein helles Quadrat. Ein Eindruck aus der Kindheit mischte sich dazwischen, ein schwarzer Warnbalken mit giftgelber Schablonenschrift und Totenköpfen: «Minengefahr, betreten verboten» auf Englisch. In der «Muna», dem Munitionslager der deutschen Wehrmacht, das von den Amerikanern bombardiert worden war, im alten Kupfermoor unter den Waldenburger Bergen gelegen, suchte mein Bruder Toni die seltene, Fleisch fressende Pflanze Sonnentau. «Komm mit, komm mit!», rief er wie ein Käuzchen, ein Todesruf. Ich folgte ihm und kroch unter dem Warnbalken durch in das verbotene Gelände. Der Torfboden verschwand unter unseren Füßen, auf dem Bauch krochen wir weiter, um nicht einzubrechen. Da begegnete uns Auge in Auge ein Feuersalamander, der sprach: «Schaut meine Tarnfarben an, ihr rosigen Kinder, meine gelben Flecken auf schwarzem Grund, Schwefel und Ruß, einen solchen Giftteufel frisst keiner! Macht man Angst, hat man selber keine Angst; hat man Angst, hat man keine Macht.» – «Ja, Herr Feuersalamander», antwortete ich im Traum, «morgen werde ich auch eine Tube Zitrongelb mitnehmen, nicht nur die Tube Caput Mortuum für dunkles Violett.»
Am folgenden Nachmittag fuhren wir wieder in den Wedding, durch Brachland, an Bahngleisen entlang, im Zickzack an der Mauer vorbei, bis hin zu der zugemauerten Straße. Das Auto war diesmal voller Malgepäck, Rudolf hatte für das wichtige Motiv eine noch größere Leinwand als ich präpariert. Wieder standen wir in der unheimlichen Straße, in welcher die Zweiteilung der Stadt und der ganzen Welt besonders nah zu sehen war. Weniger eingeschüchtert als am Tag zuvor, bauten wir unsere Staffeleien auf dem Bürgersteig direkt gegenüber der Mauer auf. Mit der Bildvorstellung schon im Kopf, nach einigen Kohlestrichen zur Andeutung der Komposition, ließ sich schnell malen. Unten im Vordergrund die versperrte Ruppiner Straße, schwarz, quer über die ganze Leinwand die Mauer, darauf zitrongelb die Stangen des Stacheldrahts, hellgrau dahinter die Brandmauer, tiefviolett die Straßenschlucht, darüber ein Wald von Schornsteinen, die zum grauen Himmel zeigten. Es begann zu regnen. In Eile überstrich ich die unbemalte Fläche mit einer gräulichen Terpentinsuppe, damit das Wasser von der Leinwand abperlte. Dadurch geriet das Zitrongelb nicht so grell-giftig, wie ich es mir vom Rat des Feuersalamanders her vorgestellt hatte. Das fertige Bild legten wir flach in den Kofferraum. Ich hatte das Gefühl, es sei spontan gelungen. Rudolfs Leinwand war mit Kohle voll gezeichnet und vom Regen verwischt. Er wollte schon alles mit einem Lappen abwischen. «Aber nicht doch, es wird noch gut! Male es im Atelier weiter!» – «Nun ja, wenigstens tropft jetzt keine Ölfarbe auf den Rücksitz des Volkswagens meines Vaters.»
Im Erdgeschoss der Hochschule, im langen Flur von der Pförtnerloge bis hinten zur Bildhauerklasse, sollten wir Studenten des vierten Semesters ein neues Ölbild eigener Wahl ausstellen. Neben dem farbig abstrahierten Stillleben einer Freundin hängte ich mein düsteres Mauerbild auf. Am Nachmittag begutachteten alle Professoren die Ausstellung und gingen von Bild zu Bild. Doch plötzlich bildete sich eine Traube kurz vor dem Ende des Flurs. Aus der Entfernung, aus der wir sie beobachteten, war ihr Gemurmel nicht zu verstehen, dann jedoch die empört ausgerufenen Worte: «Das ist ja Politik und nicht Malerei! So etwas gehört nicht in dieses Haus, das muss sofort abgehängt werden!» Ein anderer fragte, welcher Kerl das denn verbrochen habe. In die folgende Stille hinein war Professor Kuhrs leise Stimme zu hören: «Dieses Bild hat meine Schülerin Bettina gemalt. Ich halte es für richtig, dass sie die Augen vor der Aktualität nicht verschließt. Ich plädiere dafür, dieses Bild hängen zu lassen.»
Danach bedankte ich mich bei meinem Professor, dass er sich für das Bild eingesetzt hatte. Schon gut, meinte er, Kunst habe ja auch mit Freiheit zu tun, und gerade bei einer Ausstellung wie dieser, von jungen Menschen im Rahmen der Hochschule, sollte Meinungsfreiheit herrschen, nicht nur die Auffassung der Gegenstandlosen, welche die Abstraktion fast zur westlichen Ideologie erheben würde.
Am Abend nahm ich die U-Bahn zum Breitenbachplatz und besuchte meine lieben Berliner Verwandten, Guni und Karl-Heinz von Köhler. Meine Kusine Guni, achtzehn Jahre vor mir als älteste der beiden Töchter meiner Malertante Bettina Encke ebenfalls in Zernikow geboren, dort und in Wiepersdorf aufgewachsen, war so herzlich und temperamentvoll wie ihre Mutter und hatte viel Sinn für Kunst. Ihr Mann Karl-Heinz war Jurist, und sein historisches Wissen war so erstaunlich wie sein feines Gespür und sicheres Urteil. Beide waren mit Fritz Kuhr befreundet, eine Freundschaft, die von Gunis Mutter an die nächste Generation übertragen worden war.
Noch in Aufregung über die Auseinandersetzung der Professoren am Nachmittag erzählte ich von meinem Mauerbild und wie es als «zu politisch» abgehängt worden wäre, hätte sich Professor Kuhr nicht dafür eingesetzt. «Das ist ja einfach fabelhaft, was Fritz da vor versammelter Mannschaft gesagt hat!», begeisterte sich Guni. «Du hast gut daran getan, das Bild direkt vor Ort zu malen, als Ausdruck der Zeit», sagte Karl-Heinz, «vielleicht wird es einmal zu einem historischen Dokument, das die Berliner Mauer, auf Ewigkeit angelegt, noch überdauert.»
Beide gingen während des Abendessens in die Küche, in der eigentlich nur Guni waltete, wahrscheinlich um sich abzusprechen. «Also, wir kaufen dir das Bild ab, was kostet es denn?» – «Keine Ahnung.» – «Bist du mit 300 Mark einverstanden?» – «Au ja, sehr! Aber ihr habt es doch noch gar nicht gesehen und die anderen Bilder der Ausstellung auch nicht!» – «Etwas geschäftstüchtiger müsstest du schon werden», meinte Karl-Heinz, und Guni: «Es ist ja schön und nett von dir, uns auf die anderen aufmerksam zu machen, aber deine soziale Ader steht dir wieder einmal im Wege.»
Einige Tage später, am 14. Dezember, kurz vor dem offiziellen Ausstellungsende, kamen Guni und Karl-Heinz die Ausstellung und «Das Mauerbild» besichtigen. Ich war stolz auf das elegante Ehepaar – Guni mit Hut über ihrer blonden Mähne und Karl-Heinz im schwarzen Anzug –, wie sie beide die Hochschule betraten und erst einmal mit dem Pförtner Zieske plauderten, wie sie dann sachkundig mit Fritz Kuhr zusammen die Ausstellung betrachteten. Zwischen diesen Menschen fühlte ich mich wohl. Trotzdem fragte Guni: «Was hast du denn? Siehst so ernst und verstört aus.» – «Nichts, erzähle ich euch später.» Meine «soziale Ader» hatte am Tag zuvor gefährliche Ausmaße angenommen. Mit drei gefälschten dänischen Pässen hatte ich mit Rudolf unter dem Code «MS» und im Auftrag eines geheimen Netzwerks Menschen zur Flucht aus dem Osten verholfen. Es war ein spontanes, nervenanspannendes Unterfangen gewesen. Um ein Haar hätte es schief gehen können – und damit alles Weitere im Leben auch. Auf «Fluchthilfe», wie es im Westen hieß, auf «Menschenhandel» im Osten, stand als Strafe fünfzehn Jahre Zuchthaus. Bei jeder Reise von West-Berlin in die Bundesrepublik und zurück, bei jeder der vielen Grenzkontrollen hätten wir geschnappt und eingesperrt werden können. Es schien nicht ratsam, selbst enge Vertraute in Mitwissenschaft zu ziehen, denn wer die Namen der am Netzwerk Beteiligten nicht kannte, konnte sie, selbst unter Folter, nicht nennen.
Noch einige Monate in Berlin
Am Winterfeldtplatz wiederholte sich den ganzen Winter über ein Schauspiel, das von meinem Zimmer aus besonders gut zu beobachten war. Die ausgebrannten Etagen, unbewohnte, fensterlose Räume direkt über der Wohnung meiner Wirtsleute, boten einen idealen Nistplatz für Tauben. Geweckt von Unmengen Vögeln, die frühmorgens auf den Zinkblechen der drei Fenster scharrten und gurrten, war ich immer wieder gespannt auf den Ausgang des Streits, den zwei alte Frauen täglich austrugen.
Pünktlich nach dem Glockenläuten tauchten sie hinter der Kirche auf. Die eine lief an der Ruinenkneipe vorbei, die andere unter meinem Fenster entlang. Die eine streute Körner, die andere Gift. Die eine redete laut vor sich hin: «Die armen Tierchen müssen doch im Winter Futter haben! Da, ihr Vögelchen.» Die andere rief: «Dies Ungeziefer, diese Ratten der Lüfte!» Die Körnerstreuerin antwortete über den Platz hinweg: «Engelchen sind’s, Geschöpfe Gottes, Sie ungläubiges Weib aber nicht!» Die Alte unter meinem Fenster klagte und schrie: «Pest kommt noch über unsere Stadt! Vergiften sollte man die Taubenfütterinnen!» – «Da sieht man mal, was für eine Sie sind, auch noch unschuldige Menschen umbringen wollen!» – «Und an Ihnen erkennt man die Menschenverachtung, Ungeziefer mästen, als gäbe es keine hungrigen Kinder! Verrückt so etwas!» – «Sie Verrückte, Sie! Man sieht ja, die Täubchen kommen zu mir, nicht zu Ihnen.»
Sie sind verrückt, nein Sie, Brot, Ratten, Engelchen, Gift …, das Gezeter war bis zum Ende des Platzes zu hören. In der Art verlief das Streuen und der Wortwechsel der beiden alten Frauen jeden Morgen. Nie gingen sie über den Platz hinweg aufeinander zu, sonst hätten sie sich noch die Hütchen vom Kopf gerissen und sich angespuckt. Abgesehen von Variationen, wie besonderen Leckereien und besonders starkem Gift, blieb der Ausgang dieses Schauspiels jedoch unentschieden.
Nicht nur das Leben auf den Straßen, auch das kulturelle Leben machte in Berlin über Winter keine Pause. Am 9. Januar fand eine Lesung von Uwe Johnson in der Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg statt. Er las aus seinem soeben erschienenen Roman Das dritte Buch über Achim. Es ging um die Teilung Deutschlands, der gelesene Text war aber kaum zu verstehen.
Drei Abende darauf – die Lesung war schon vergessen – traf sich die vertraute Clique der Kunsthochschule in Dietrichs Weinlokal, meine Freundinnen Waltraut und Uta mit «die Bengels», wie wir Dieter, Hartmut und Rudolf nannten. Am späteren Abend kam ein Herr in schwarzer Lederjacke, der einsam am Tisch neben unserem gesessen hatte, mit seinem Weinglas zu uns und fragte, ob er sich dazusetzen und uns eine Runde Bier spendieren dürfe. Groß, blond mit beginnender Glatze, ein norddeutscher Quadratschädel, irgendwie kam er uns bekannt vor. Wir boten ihm einen Stuhl an, doch vier von uns, die etwas weiter weg wohnten, wollten gerade aufbrechen.
«Bier auf Wein, das lass ja sein!», sagten sie, gingen zum Garderobenständer und kamen mit Wintermänteln und Mützen wieder an den Tisch. Unser Tischnachbar stellte sich mit Uwe Johnson vor. Neugierig geworden liefen die, die es so eilig gehabt hatten, noch einige Male zwischen Garderobenständer und Tisch hin und her. Mit dem Spruch «Eichen sollst du weichen, die U-Bahn sollst du suchen!» gingen sie dann doch in die Kälte hinaus.
Nun saßen Rudolf und ich mit Uwe Johnson allein am Tisch. Nachdem sich Rudolf vorgestellt hatte, nannte auch ich meinen Namen. Um das Hochtrabende daran herunterzuspielen, machte ich möglichst unterhaltsam vor, wie meine Tante Tam früher die ganze Namensliste der sechs Geschwister ausrief, auch wenn sie nur eines der letzten meinte, wie sie immer wieder von oben anfing: «Achim, Clemens, Christof-Otto, Peter-Anton, Bettina, komm helfen!» – «Ihr ältester Bruder heißt also Achim?», fragte Johnson nachdenklich. «Ja, nach dem Dichter, seinem Ururgroßvater. Der Zweitälteste nach Clemens Brentano, der Dritte nach dem Feldherrn unter Wallenstein, weil die Dichter ausgingen …» Das interessierte nicht mehr so wie eben Achim. Ich möge ihm doch bitte meine Adresse aufschreiben. Nach Mitternacht bat uns Uwe Johnson an den Tresen. Er bestellte nochmals drei Gläser Bier und erzählte, er käme gerade aus den USA zurück. Dort bekäme man nach Mitternacht zwar noch etwas zu trinken, aber man dürfe sein Glas nicht mehr auf dem Tisch absetzen. «Schön in der Luft halten, mindestens zwanzig Zentimeter hoch!», amüsierte er sich. Es war wirklich recht schwierig, das Glas dauernd in der Hand zu halten, ohne dass während der Unterhaltung den anderen das Bier ins Gesicht schwappte. Ohne abzusetzen, tranken wir in einem Zug ein letztes Glas und verabschiedeten uns.
Wenige Tage danach brachte der Postbote ein Paket vom Suhrkamp Verlag in Frankfurt am Main. Drei Bücher waren der Inhalt, alle drei 1961 in diesem Verlag erschienen. In dem ersten lag vorne ein von Uwe Johnson handbeschriebenes Blatt: «Hier noch ein Achim!», beste Grüße, ich möge ihn doch diesen Sommer in der Villa Massimo in Rom besuchen. (Im Sommer 1962 sollte ich dann tatsächlich kurz in Rom sein, hatte aber Uwe Johnson über der Reise vergessen und er wahrscheinlich unser Treffen bei «Lutter und Wegener» im Berliner Winter auch.) Das erste Band im Paket war Das dritte Buch über Achim. Die beiden anderen Bücher, in schönem Schuber, trugen den Titel: Der Briefwechsel zwischen Achim von Arnim und Bettina Brentano. Gespannt las ich, wie meine Ururgroßeltern gelebt hatten, er als verantwortungsbewusster Verwalter seiner Landgüter in Wiepersdorf, sie im gesellschaftlichen Leben der Preußen-Hauptstadt Berlin, er arm und abgeschieden, sie wohlhabend dank des Erbes ihrer reichen Frankfurter Kaufmannsfamilie. Achim tat mir Leid, wie er sich abrackerte und dabei von ihr ausschließlich als Dichter anerkannt und zu dieser Arbeit ermahnt wurde. Über seine Geschenke, ein Kleid, Aquarellfarben, machte sie sich nur lustig, als habe er einen provinziellen Geschmack. Dann jedoch bangte ich mit ihr, wenn sie zum wiederholten Male schwanger war und ihre Todesangst mitteilte, starben doch zu dieser Zeit viele Frauen im Kindbett. In diesen Briefen war auch Interessantes über die Lebensgrundlagen von damals zu erfahren, zum Beispiel, wie die Stadt vom Land lebte: Von Wiepersdorfer Dorffrauen gehäkelte Schafwolldecken, selbst gebrautes Bier zur Genesung der Kinder, Hirschbraten, Honig, alles Mögliche wurde in den Pferdewagen nach Berlin geladen, vom Familienvater aufgelistet mit der Bitte um Antwort, ob alles gut angekommen sei. Sodann gab es Auflistungen der Preise für Butter, Schafe, Korn, Holz und der Deputate an die Landarbeiter – worüber sich ihr Urenkel Friedmund, mein Vater, hundert Jahre später immer noch den Kopf zerbrach, um die Güter schuldenfrei zu halten.
Voller Stolz, hatte ich doch einmal etwas zu bieten, nahm ich den Briefwechsel zu meiner Großmutter nach Zehlendorf mit. Nach dem sonntäglichen Sattessen legte ich die beiden Bücher neben die Mokkatassen. Großmutter bedankte sich, eben noch habe sie ein Buch auf Französisch gelesen, um ihren Geist wach zu halten. Am Sonntag darauf lagen die Bücher jedoch wie unberührt in ihrem Schuber auf dem Tisch. Die alte Dame zeigte angewidert mit ihrem Krückstock darauf und befahl: «Nimm sofort diese Wanzenbücher wieder mit!» Gehorsam trug ich sie in den Flur. Um das peinliche Schweigen während des Essens zu unterbrechen, fragte ich: «Was hast du denn gegen diese Bücher? Sie sind ganz neu, da ist doch kein Ungeziefer drin!» – «Das mit den Wanzen meinte ich doch nur im übertragenen Sinn», antwortete Großmutter und erklärte: «Für mich sind Dichter höhere Wesen und sollen es auch bleiben! Diese Einzelheiten aus ihrem Alltagsleben, einfach abscheulich, nein, so etwas darf nicht gedruckt werden! Die beiden waren etwas Besonderes, ausschließlich ihr dichterisches Werk sollte in Büchern stehen, alles andere zieht sie nur in die Banalität hinab.»
Etwas recht Banales, jedenfalls für Großmutters altmodische Auffassung, ergab sich noch während der kalten Jahreszeit: die erfreuliche Möglichkeit, Geld zu verdienen. Eine Studentin, zwei Semester unter mir, hatte den Hinweis gegeben, und über die Tätigkeit des Bilderrestaurierens befreundeten wir uns. Es fing damit an, dass Heidi ein Bild restaurieren sollte, von dem ein Trödler überzeugt war, es handle sich um einen «echten Leistikow». Auf einem hellen See, umgeben von dunklen Kiefern, klebten schwarze Flecken, die Heidi mit keinen Mitteln zu entfernen vermochte. So übermalte sie diese einfach mit schwimmenden Entchen. Ob nun der Trödler – der sich auch Antiquar oder gar Kunsthändler nannte – mit den Entchen unzufrieden war, oder ob Heidi keine Zeit zu dieser Nebentätigkeit hatte, wie auch immer, sie überließ mir das Feld. Sie gab mir die Adresse des Ladens «Antiquitäten aller Art» in der Bülowstraße und sagte, der Mann sei zwar etwas merkwürdig, würde aber nicht zudringlich und bezahle korrekt.
Der Laden war voll gestellt mit Büchern und Geschirr, mit Stehlampen und Möbeln, die mit weiterem Krempel befrachtet waren. Hinter trüben Fensterscheiben blinkte eine große Eule aus Porzellan mit ihren elektrischen Augen. Der Ladeninhaber, ein älterer Mann, der so wirr schien wie sein Inventar, brummelte etwas zur Begrüßung und kramte gleich drei kleine Bilder zum Restaurieren hervor. Bevor es jedoch an die Arbeit gehen konnte, musste ich in einem abgeschabten Sessel zwischen Eule und Ofen Platz nehmen. Beunruhigt sah ich auf das Geblinke der Eule im Halbdunkel. Hier müsse alles so unübersichtlich erscheinen, damit es für Käufer etwas zu entdecken gäbe, erklärte der Trödler, und die Eule sei seine größte Attraktion «für wenn der Amerikaner kommt». Von den Bildern, die ich restaurieren sollte, war nicht nur die Ölfarbe stellenweise abgeplatzt, sondern auch die Grundierung, zwei davon waren sogar völlig durchlöchert. Nach Gutdünken tat ich sachverständig, auf die durchlöcherte Leinwand müsse man von hinten einen Streifen Stoff mit Bienenwachs aufbügeln. Unter mehreren Bügeleisen suchte der Antiquar das neueste Exemplar heraus und gab es mir. Mit Bildern und Bügeleisen zog ich davon.
Bevor ich mich in meinem Zimmer an das Restaurieren machte, studierte ich den «Dörner», sozusagen die Bibel des malerischen Handwerks. Das Rezept mit dem Bienenwachs traf ungefähr zu, doch war es schwierig, mit dem antiquarischen Bügeleisen umzugehen, ohne einen Kurzschluss zu verursachen. Bald waren die Löcher geschlossen und alle drei Bilder auf ihrer Vorderseite schön glatt. Welch ein Vergnügen, nun Vasen, Blumen und Gesicht in Ölmalerei zu ergänzen! Die Bezahlung hätte ich gleich gebraucht, doch um vorzutäuschen, die Prozedur habe viel Zeit in Anspruch genommen, trug ich die Bilder erst nach drei Tagen in die Bülowstraße zurück. Der Antiquar nickte zufrieden, putzte ein Stück Schaufensterscheibe, stellte die Bilder dahinter und sagte: «Für wenn der Amerikaner kommt.» Pro Bild zahlte er zehn Mark, zusammen ergab das die Hälfte der Monatsmiete für mein Zimmer. Auf einer Auktion hatte er inzwischen weitere Bilder ersteigert. Die Wohnungsauflösungen der vielen alten Frauen Berlins waren eine Fundgrube für Händler wie ihn. Von Kunstgeschichte hatte er etwas Ahnung, denn er wartete nicht nur auf «den Amerikaner», sondern auch auf einen großen Fang wie «einen echten Rembrandt». Jedes Mal, wenn ich in dem Sessel neben der Eule Platz nahm, versprach er, dann würde er seiner Restauratorin dicke Prozente vom Verkaufspreis abgeben. Der «echte Rembrandt» traf nie ein. Dafür war eines Tages der Ofen neben dem Sessel nicht mehr geheizt, und zu meiner Verwunderung war auch die Eule nicht mehr da. Der Amerikaner habe sie gegen einen guten Preis mitgenommen, sagte der Antiquitätenhändler zufrieden, und besser noch: Hier, dieses riesengroße Ölgemälde wolle der «Ami» ebenfalls erwerben! Doch gäbe es da ein Problem: Er könne es nach Ablauf seiner Militärzeit in Berlin nicht in seiner vollen Größe über den Atlantik mit nach Hause nehmen, nur das Schönste davon in kleineren Teilen. Groß und prächtig stand das Gemälde inmitten des verstaubten Ladens, eine gekonnte Salonmalerei. Das Format betrug drei Meter Höhe und zwei Meter Breite, Malerei und Grundierung waren unversehrt, die Leinwand auf einem breiten Keilrahmen mit Querverstrebung im Kreuz aufgespannt.
Der Händler half, das Bild quer zu legen und durch die Ladentür zu schieben, womit die drei Hauptmotive, zwei entkleidete Frauen am Wasser und ein nacktes Kind, umgekippt wurden. Sachgerecht fasste ich das Bild an seiner hinteren Mitte an der Kreuzverstrebung. Doch draußen wehte starker Wind, wie mit einem Segel trieb er mich gegen die Eisenpfosten der Bülowbögen. Passanten sahen sich verwundert um, als würden die drei Nackten in Schräglage gleich über die Hochbahn davonfliegen. Kleiner und leichter als das Bild, konnte ich es nicht allein tragen, ohne selbst davongetragen zu werden. So stellte ich es wieder im Laden ab, um aus der Hochschule Hilfe zu holen.
Dort liefen mir zufällig Petrick und Baehr über den Weg. Von der «Knochenkammer» unter dem Dach zogen sie um, zwei Stockwerke tiefer zu Professor Volkert, bei dem sich die beiden ehrgeizigen Maler mehr Chancen erhofften als bei dem alten Fritz Kuhr. Petrick erklärte sich bereit, den Umzug allein weiterzumachen, «der Bär ist schwer», der würde nicht vom Wind weggetragen, lachte er. Ulrich Baehr trug das Bild von der Bülowstraße zum Winterfeldtplatz. Eifrig trabte ich hinterher, hielt Türen auf und versprach ihm zum Dank den großen Keilrahmen aus Eichenholz.
In meinem Zimmer stand nun das zu verkleinernde Gemälde. Zwei Badende saßen am Wasser, die eine oben in der Mitte, die andere unten rechts. Im Bild links unten haschte das Kind nach einem Schmetterling. Wasserlilien und andere Gewächse in blaugrün schillernden Farben umgaben die rosa Fleischtöne. Aber wie nun aus diesem einen großen Bild drei kleine machen? Bevor ich mit dem Messer daranging, teilte ich das Ganze mit Kreidestrichen auf. Nach dieser Vorlage besorgte ich drei neue Keilrahmen, einen für jede dargestellte Person. Aber zerschnitten und auf die kleineren Keilrahmen gespannt, sahen die nunmehr drei Bilder entsetzlich aus: Der oberen Badenden im Querformat fehlten die Beine, ohne Körper dazu standen sie vor der anderen Frau im Wasser, die wie blöde auf dieses Wunder starrte. Das Kind war unversehrt, nur sein Schmetterling war ihm entflogen.
Zunächst bekam das Kind den Schmetterling in greifbare Nähe vor seine Händchen gemalt. Sodann wuchsen blaue Lilien in Serie über die rosa Beine im Wasser hinweg, womit die Dame im Profil die Schönheit der Natur betrachten konnte. Schwierig wurde es mit der Frau ohne Beine, denn für einen quer gelegten Nixenschwanz oder etwas Ähnliches als Beinersatz fehlte der Platz. Ihre Körpermitte am unteren Bildrand verdeckte schließlich ein feiner Schleier, bestickt mit Feigenblättern. Die Unternehmung «aus eins mach drei» hatte meine Kusine Guni mitverfolgt. Sie fand es bewundernswert, wie da die Lilien und Schmetterlinge gemalt waren, sie lachte über den Schleier und sagte: «Restaurieren ist tödlich für die Kunst!» – «Hab ich doch nur gemacht, weil ich Geld brauche!» – «Na, dann sieh mal zu, dass du auch welches dafür bekommst!»
Der Händler unterdrückte seine Begeisterung und zog nur einen Hundertmarkschein hervor. «Mehr!», sagte ich wie der kleine Hävelmann, daraufhin noch ein Hunderter. «Mehr!», noch einer. Drei schienen mir für drei Bilder angemessen zu sein. Nun meinte ich, nicht nur als Restauratorin Karriere machen zu können, sondern auch geschäftstüchtiger geworden zu sein.
Die wichtigste Weichenstellung für alles Weitere bahnte sich einige Tage später mit leiser Stimme an, der meines Lehrers Fritz Kuhr. Beim Aktzeichnen sagte er wie nebenbei, unten im Sekretariat habe ihn der Direktor darauf aufmerksam gemacht, dass eine geringe Anzahl an Stipendien für Frankreich vergeben würde und dass er dafür einen Schüler seiner Malklasse vorschlagen könne, dies gelte dann als Vorauswahl. «Ich habe Sie gleich – in der Annahme, dass es Ihnen recht ist – für einen Frankreichaufenthalt an einer dortigen Kunsthochschule eintragen lassen.» – «Sehr recht ist mir das! Vielen Dank!»
Diese Stipendien wurden zum ersten Mal von der «Maison de France de Berlin» ausgeschrieben. Das Haus, die kulturelle Repräsentation des französischen Militärsektors Berlin-Tegel, ein neues Eckgebäude am Kurfürstendamm, war bekannt durch gute Filme, die in seinem Erdgeschoss gezeigt wurden.
Zum festgelegten Termin trafen eines Vormittags mehrere Anwärter auf die Stipendien in einem Wartezimmer über dem Kinosaal ein. Die meisten kamen vom Steinplatz, von der «freien Abteilung», die wenigsten von der Grunewaldstraße, der «unfreien pädagogischen». Letztere wurde manchmal spöttisch so genannt, um daran zu erinnern, dass man mit dem späteren Lehrerberuf ängstlich auf Sicherheit setzte statt auf künstlerische Freiheit ohne festen Broterwerb. Dem Spott ließ sich entgegenhalten, dass die Ausbildung in der Grunewaldstraße sehr vielfältig war, mit den Pflichtfächern von Architektur bis Philosophie, zudem handfester als für «Künstlergenies» durch die Nebenfächer Werken, dem Umgang mit Material und Maschinen. Unter den wenigen Bekannten aus der Grunewaldstraße saß auch meine Freundin Waltraut im Wartezimmer. Flüsternd wunderten wir uns darüber, dass wir beide, obwohl nur «Malweiber» und «nur Pädagogische», hier zur endgültigen Auswahl für eine französische Kunsthochschule nebeneinander saßen. Wir hätten kaum Chancen, nur drei würden überhaupt genommen, meinte sie. Keine Zeit, uns weiter auszutauschen, unter A wurde ich als Erste in den Raum der Auswahlkommission gebeten.
Eine deutsche Sekretärin hieß mich an der Frontseite eines Tisches Platz nehmen, einem französischen Offizier in Uniform gegenüber, offensichtlich der ausschlaggebenden Person. Bei den Angaben für die deutschen Formulare geriet ich ins Stottern, als man wissen wollte, ob Zernikow in Polen läge, ob mein Vater als Soldat gefallen wäre. – Nein, wegen der Bodenreform deportiert. Ob meine Familie vertrieben oder aus der DDR geflüchtet wäre. Zu kompliziert seien diese deutschen Geschichten, winkte der Offizier ab und leitete das Gespräch auf Französisch ein. Trotz meines mangelhaften Französischs verflog die Befangenheit, denn der Erwartungsdruck, auf Deutsch Kluges sagen zu müssen, und das auch noch gut formuliert, war somit genommen. Der Franzose sagte etwas von der Freiheit des Individuums und der Kunst, dann fragte er mich nach meinen bevorzugten europäischen Malern. Der Einfachheit halber nannte ich zwei Pauls, einen Franzosen und einen Schweizer: Paul Cézanne und Paul Klee. – Schicken wir sie nach Aix-en-Provence!, beschied der Militär und erklärte, für diese Provinzhauptstadt müsse man sich auch einmal einsetzen, nicht immer nur für West-Berlin. Aber besser gar kein Stipendium, als nach Aix verbannt zu werden, dachte ich mir, denn schlechte Erfahrungen verband ich mit dieser Cézanne-Stadt und mit Zollbeamten. Bevor Aix-en-Provence in die Formulare eingetragen wurde, hörte ich mich auf Französisch sagen: «Bitte, Monsieur, ich möchte nach Paris!» – «Alors, pourquoi pas?», sagte der Offizier und hieß die Sekretärin die «Ecole des Beaux-Arts de Paris» eintragen.
Damit war aber noch nicht alles gewonnen. Auf einmal kamen dem französischen Prüfer Bedenken: Für die Pariser Professoren müsse ich besser Französisch können, sonst würde ich ihre Anweisungen nicht verstehen. Was für die Provinz nicht gegolten hatte, sollte nun für die Hauptstadt gelten: eine akademische Sprache. Schon übermütig geworden, behauptete ich, es ginge doch um die sichtbare bildnerische Sprache, und erst einmal in Paris angekommen, würde ich schon richtig Französisch lernen. Nun gut, meinte der Offizier, sah auf seine Uhr und wünschte viel Glück.
Wieder draußen im Wartezimmer fragten die anderen Anwärter: «Hast du’s? Wie muss man’s machen?» – «Ich glaub, ich hab’s! Zwar noch nicht schriftlich, da wird ziemlich improvisiert. Machen muss man’s mehr nach Nase.» Meine Freundin bekam ebenfalls das Stipendium und noch ein Student vom Steinplatz, wir alle drei für Paris.
IIParis
Die Ankunft
Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters an der Ecole Supérieure des Beaux-Arts kam ich mit einem Nachtzug aus Stuttgart frühmorgens um sieben Uhr am Gare de l’Est an. Nicht ahnend, dass wir einem Professor unsere Ölbilder zeigen sollten, bevor wir von ihm aufgenommen würden und erst daraufhin das Stipendium erhalten sollten, traf ich in Paris nur mit einer Skizzenmappe aus Italien ein. Zum Glück hatte ich überhaupt diese Porträtskizzen und Landschaftszeichnungen mitgenommen und sie nicht wie die männlichen Kunststudenten, die ihre Sommerferien in Ginostra auf der Insel Stromboli verbracht hatten, verbrannt. Auf den Skizzen waren sie fast alle wieder zu erkennen, die in der alten Villa über dem steilgelegenen Fischerort Ginostra fröhlich beisammen gewesen waren: Hartmut und Ursula redend und singend, Rudolf mir still Porträt sitzend und Nik, der vermeintliche Hausbesitzer, beim Schiffezeichnen auf seinem Bett. Nik war es gewesen, der die verlassene Villa entdeckt hatte und, da er sie selbst nicht hatte kaufen können, die West-Berliner Kunsthochschule überzeugt hatte, dies an seiner Stelle zu tun. Eine gute Idee, ein schöner südlicher Studienort war diese «Academia». Feilschte er nicht gerade um das wenige Essen, das einmal in der Woche per Boot gebracht wurde, lag Nik mit einem Fernrohr auf seinem Bett. Sowie ein Schiff vor dem Ätna auftauchte, zeichnete er es akribisch ab, direkt an die Wand, bis es am Horizont Richtung Neapel wieder verschwunden war. Verschiedene Schiffe, sogar ein sowjetischer Dampfer, reihten sich auf seiner weiß gekalkten Wand, als wir Anfang Oktober zur Heimreise aufbrachen. Außer Nik, der seine Zeichnungen nicht von der Wand abnehmen konnte, trugen die anderen Künstler ihre Zeichnungen stapelweise in den Hof, zündeten ein Abschiedsfeuer damit an und pinkelten hinein. Wir jungen Frauen konnten bei diesen Atavismen nicht mithalten, so blieben unsere Zeichnungen erhalten.