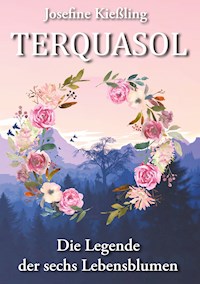
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Terquasol
- Sprache: Deutsch
Maybelle Stacks ist es leid, jeden Tag dasselbe eintönige Leben zu leben. Nur ihres Vaters zuliebe bleibt sie an seiner Seite in dem kleinen Fischerdorf in Apunima, um ihn vom Tod ihrer Mutter abzulenken. Kurz nach ihrem zwanzigsten Geburtstag beschließt sie jedoch, ihre Heimat zu verlassen und sich auf eine einmalige Reise durch die Länder von Terquasol zu begeben. Doch bereits wenige Stunden nach ihrer Abreise wird sie mit Komplikationen konfrontiert, die ihr die Reise erschweren. Sie wird nicht nur entführt, sondern muss sich plötzlich auch noch den Anhängern des Schattenmeisters stellen, der nach der Macht der sechs Lebensblumen strebt. Mithilfe ihrer neuen Weggefährten, die bald schon zu ihren Freunden werden, versucht sie alles, um die Welt, die sie kennt und die Menschen, die sie liebt, zu beschützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für meine Eltern:
Eine größere und bessere Unterstützung hätte ich mir nicht wünschen können. Danke für alles!
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Die neue Schattenspäherin
Kapitel 2: Auf der Helianthus
Kapitel 3: Der Mürrische und der Faulpelz
Kapitel 4: Der getroffene Kräutersammler
Kapitel 5: Custol Hill
Kapitel 6: Ein freudiges und eisiges Wiedersehen
Kapitel 7: Der Biss der Schlange
Kapitel 8: Die drei Wächter
Kapitel 9: Die Ausgestoßenen
Kapitel 10: Die Schaukel in die Freiheit
Kapitel 11: Aufbruch
Kapitel 12: Eine nicht ganz normale Seefahrt
Kapitel 13: Der Wächter der Sanduhr
Kapitel 14: Libellen aus Kupfer
Kapitel 15: Flucht durch den Nebel
Kapitel 16: Das Mädchen aus der Zeichnung
Kapitel 17: Entscheidung
Kapitel 18: In der Höhle
Kapitel 19: Eine wichtige Erinnerung
Kapitel 20: Weihnachten
Kapitel 21: Eine längst überfällige Erklärung
Kapitel 1: Die neue Schattenspäherin
Der Mann neben der verwilderten Stechpalmen-Hecke wippte unruhig auf den Fußballen auf und ab und warf dabei immer wieder einen Blick hinüber zu dem großen Steinbogen, dessen Schatten im Mondlicht gigantisch wirkte.
Ein kühler Windhauch blies über das Grundstück und als hinter dem nervös wippenden Mann ein dünner Zweig zu Boden fiel, wirbelte er erschrocken herum und seine Hand zuckte in Richtung seiner Manteltasche. Als sein Blick auf den Ast fiel, plusterte er erleichtert und genervt zugleich seine Backen auf und nahm seine Tätigkeit wieder auf, hin und her zu schaukeln und dem Steinbogen ungeduldige Blicke zuzuwerfen.
Dann, endlich, ertönten in der Ferne leise, schnelle Schritte und im nächsten Moment erschien eine dunkle Gestalt am Bogen, die kurz inne hielt und dann auf den Mann zulief. Nervös fuhr dieser sich durch seine braunen Haare und versuchte möglichst unauffällig seinen Mantelkragen zu richten. Als die Gestalt ihn fast erreicht hatte, fiel das fahle Mondlicht auf deren Gesicht und obwohl er es schon oft gesehen hatte, zuckte der nervöse Mann zusammen. Die Augen lagen in tiefen, schwarzen Höhlen und seine Wangen waren eingefallen und bleich. Doch das Merkwürdigste, geradezu Abstoßendste an diesem Mann waren seine Augen selbst; sie waren strahlend weiß und hatten keine Iris, es gab nur zwei winzige, schwarze Punkte, die nun den schluckenden Mann taxierten.
„Hatte ich nicht gesagt, wir treffen uns unten am Stadtrand, Marius?“, zischte der Weißäugige mit schneidender Stimme.
Abermals zuckte der Mann namens Marius zusammen und lockerte seinen Mantelkragen nun doch etwas.
„J-Ja, Mr. Cavenor“, stammelte Marius leise.
Bhatar Cavenors Augen verengten sich zu Schlitzen und nun war das Schwarz seiner Pupillen beinahe nicht mehr zu erkennen.
„Wieso bist du dann hier oben und hast meinen Anweisungen nicht Folge geleistet?“, schnarrte er kalt.
„B-Bitte, ich...ich dachte nur...“
„Du dachtest wohl, es würde einen guten Eindruck bei unserem Meister machen, wenn du früher als ich aufkreuzt?“
„Nein, Mr. Cavenor, natürlich nicht, n-niemals würde ich -“
„Schweig“, sagte Bhatar und sofort verstummte Marius mit entsetztem Gesichtsausdruck.
Langsam ließ Bhatar seinen Blick den gepflasterten Weg aus grauem Stein entlang wandern, der durch einen riesigen Vorgarten führte, in dem die verschiedensten Kräuter, Bäume und Sträucher wuchsen. Allerdings schien es ganz so, als hätte sich schon seit Jahren niemand mehr um den Garten gekümmert; an den Baumstämmen wucherten die Schlingpflanzen, Efeu und Unkraut kämpften sich ihren Weg durch den Steinpfad und die Stechpalmen-Hecke, die das gesamte Grundstück umgab, war mindestens viermal so hoch wie die beiden Männer und dreimal so breit. Der Weg endete an einer Marmortreppe, die zu einem großen Haus führte, das wie eine Burg in den Nachthimmel aufragte. Nur hinter wenigen der zahlreichen Fenstern brannte Licht.
„Du überlässt mir das Reden, verstanden?“, sagte Bhatar, ohne seinen Blick vom Haus zu nehmen.
Rasch nickte Marius und fummelte wieder an seinem Kragen herum. Der Schweiß glänzte auf seiner Stirn.
„V-Verstanden, Mr. Cavenor“, brachte er krächzend heraus.
Bhatar betrachtete ihn einen Moment lang mit einem abschätzenden Blick, dann wandte er sich von ihm ab und schritt den Weg voraus auf das alte Haus zu. Zögernd folgte Marius ihm und warf dabei immer wieder Blicke durch den Garten, als befürchtete er, die knorrigen Bäume könnten jeden Augenblick zum Leben erwachen und sich auf ihn stürzen.
Ihre Schritte hallten auf den Marmorstufen wider und Marius erschauderte beim Anblick der beiden schwarzen Statuen, die links und rechts neben den Eingangstoren standen. Sie stellten zwei Bären dar, mit weit aufgerissenem Maul und erhobenen Pranken.
Hastig folgte er Bhatar durch die Tore ins Innere und blieb verblüfft stehen, als sie in eine große Eingangshalle gelangten, die nur von ein paar wenigen Laternen an den Wänden beleuchtet wurde. Die Decke war so hoch, dass sie kaum mehr zu erkennen war und überall auf den achtlos beiseite geschobenen Möbeln sammelte sich der Staub. Marius hatte dieses Haus noch nie zuvor betreten, doch Bhatar schien genau zu wissen, wo es lang ging. Er schritt die breite Wendeltreppe empor, deren Steinstufen fast alle kaputt waren.
Allerdings fiel Marius auf, dass sich hier nicht ein einziges Staubkorn befand; anscheinend wurde diese Treppe recht häufig genutzt.
An der Spitze der Stufen erstreckte sich ein langer Flur mit verschlissenem Teppich und alten Öllampen, die flackernde Schatten auf die Dielen warfen.
Bhatar führte Marius an den vielen, geschlossenen Türen vorbei und blieb schließlich an der hintersten auf der linken Seite stehen. Gedämpfte Stimmen drangen zu ihnen auf den Flur.
„Wenn du auch nur ein Wort darüber verlierst, dass Reeder uns wieder einmal zuvor gekommen ist, dann schwöre ich dir, deiner Frau und deinen Kindern noch heute einen kleinen Besuch abzustatten“, raunte Bhatar Marius zu.
Marius‘ Lippen bebten und für den Bruchteil einer Sekunde huschten seine Finger wieder zu seiner Manteltasche. Bhatar entging diese Bewegung nicht und seine Lippen kräuselten sich zu einem hämischen Lächeln, das seine Augen nicht erreichte.
„Du würdest es nicht wagen, mit deinem Messer auf mich loszugehen, oder, Marius McMilton?“, hauchte er kalt.
Marius erbleichte, während Bhatars Lächeln nur noch größer wurde und eine Reihe gelber Zähne entblößte.
„Mit der Klinge, die der Meister für uns angefertigt hat? Für die er hart gearbeitet hat? Mit diesem Messer würdest du mich angreifen, McMilton, mich, seinen treusten Berater?“
Er trat einen Schritt auf Marius zu, der mit vor Schreck geweiteten Augen zurückwich und gegen die Wand hinter sich stieß. Atemlos schüttelte er den Kopf.
„Mr. Cavenor, b-bitte vergebt mir, ich habe nicht gewollt, ich hatte n-nicht die Absicht, Sie -“ Doch Bhatar unterbrach ihn, indem er seine Hand hob und ihn somit zum zweiten Mal in dieser Nacht zum Schweigen brachte. Drohend neigte er sein Gesicht ganz dicht zu Marius hinunter, sodass sein Atem, der erstaunlich kalt war, seine Wange streifte.
„Vergiss nicht, wo dein Platz ist, Marius oder dir wird es ergehen wie Johnson.“
Falls es überhaupt möglich war, wurde Marius noch weißer im Gesicht und er konnte gar nicht oft genug nicken. Bhatar wandte sich schlagartig um und klopfte mit dem Fingerknöchel gegen die Tür. Sofort verstummte das Gespräch dahinter und eine tiefe, raue Stimme rief sie herein.
Marius musste ein paar Mal blinzeln, bevor er sich an das plötzliche Licht gewöhnte, das sie in dem Zimmer erwartete.
Auch hier standen die unterschiedlichsten Möbel herum, allesamt verstaubt und alt und modrig. Ein muffiger, feuchter Geruch lag in der Luft und für einen Moment war nur das Prasseln des Feuers im Kamin in der hinteren Ecke des Zimmers zu hören. Dann erhob sich ein großer Mann mit breiten Schultern und stechend grünen Augen aus einem alten Polstersessel, der nahe eines der Fenster stand und blickte zwischen Marius und Bhatar hin und her.
Bhatar verneigte sich, sodass seine Nase fast den Boden berührte und zögerlich tat es ihm Marius gleich, wenn auch nicht ganz so tief.
„Das ist nicht nötig“, sagte der Mann. „Ich habe schon auf euch gewartet und hoffe doch, dass meine Erwartungen nicht enttäuscht werden.“
Marius schluckte schwer und seine Hände fingen automatisch an, sich gegenseitig zu kneten. Er warf einen kurzen Seitenblick auf Bhatar und meinte so etwas wie Furcht in seinen weißen Augen aufblitzen zu sehen. Doch schon hatte er sich wieder unter Kontrolle und trat einen ergebenden Schritt vor.
„Meister, ich versichere Ihnen, dass es uns gelungen ist, den Aufenthaltsort der Seelensucher ausfindig zu machen. Sie verstecken sich am Rand der Küste von Cantus“, sagte er und nun war nichts mehr von seiner kühlen Überheblichkeit zu spüren.
Nachdenklich sah der Mann mit den grünen Augen ihn an und schien ihn doch nicht wahrzunehmen. Für einen kurzen Moment war sich Marius sicher, dass der Schattenmeister mit seinen Gedanken weit weg an einem fernen Ort war, vielleicht sogar an den Stränden von Cantus. Dann klärte sich dessen Blick wieder und seine Züge wurden härter. Marius fröstelte und unterdrückte den Drang, seinen Mantelkragen zu richten. Er wollte um jeden Preis vermeiden, die Aufmerksamkeit des Schattenmeisters auf sich zu ziehen.
„Was ist mit der anderen Aufgabe, die ich euch übertragen habe, Bhatar?“, sagte der Schattenmeister schließlich.
Marius mied seinen Blick und starrte auf seine Schuhe und als Bhatar diesmal sprach, konnte er dessen Stimme wackeln hören.
„Ihr meint die weitere Aufgabe in Cantus, Meister?“
„Genau. Ist es euch gelungen, sie zu finden?“
Marius hörte Bhatar schlucken und sein eigener Herzschlag dröhnte auf einmal furchtbar laut in seinen Ohren.
„Nun?“, sagte der Schattenmeister nach einer Weile des Schweigens und Marius meinte, eine Spur Ungeduld herauszuhören.
„Nein, mein Meister. Wir konnten sie nicht finden, doch wir haben nichts unversucht gelassen, jeden Zentimeter haben wir durchkämmt, jeden -“ Bhatars Worte gingen in einem leisen Geräusch aus dem Schatten des Zimmers unter, einer Mischung aus Hüsteln und spitzem Lachen. Sein Ausdruck erstarrte und mit einem knirschenden Ton biss er seine Zähne fest zusammen.
„Warum ist sie hier?“, brachte er mit verächtlicher Stimme hervor.
„Weil es ihr im Gegensatz zu dir gelungen ist, ihre vom Meister aufgegebene Aufgabe zu erfüllen, Bhatar“, säuselte die Gestalt im Schatten, die nun langsam ins Licht des Kamins vortrat.
Marius fühlte sich sofort an eine zu groß geratene Krähe erinnert. Ihr Gesicht war spitz und ihre Nase gebogen. Braune, schmutzige Haare fielen der Frau über den Rücken, einige Strähnen waren zu festen, dünnen Zöpfen geflochten, andere waren so verfilzt, dass sie schon mehr nach Stroh als nach Haaren aussahen. Sie war kleiner als Marius und Bhatar, obwohl sie schwarze Stöckelschuhe trug, die gerade noch so unter ihrem grauen Rock zu erkennen waren.
„Hallo, Bhatar. Schön, dich endlich wiederzusehen“, säuselte die Frau weiter und streckte ihm die Hand entgegen.
Marius fand diese Geste recht mutig, denn Bhatar sah aus, als würde er ihr am liebsten an die Kehle springen. Als er ihre Hand nicht ergriff, schmollte sie demonstrativ und legte den Kopf schief.
„Ach komm schon, Bhatar, willst du eine alte Freundin nicht anständig begrüßen? Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen.“
„Du bist keine Freundin, Corvuna.“
Es war schwer, Bhatar zu verstehen, der immer noch angestrengt die Zähne aufeinander presste und anscheinend versuchte, die Frau vor sich mit bloßem Starren zu erdolchen.
„Ach was. Wir stehen alle auf ein und derselben Seite, das ist genauso verbindend. Wobei ich mir jetzt, im Angesicht der Tatsache, dass es dir nicht gelungen ist, die Lebensblume zu finden, doch schwer fällt, zu glauben, du stehst noch immer auf unserer Seite“, raunte Corvuna mit einem Grinsen, von dem Marius wusste, dass es Bhatar provozieren würde.
Er sollte recht behalten.
„Wie kannst du es wagen? Du hast keine Ahnung, welche Bürde ich trage, für welche bedeutsame Aufgabe ich auserwählt wurde!“, schrie er außer sich vor Zorn.
„Zufälligerweise kann ich es mir vorstellen, mein lieber Bhatar.“
Mit diesen Worten zog sie ein Messer aus ihrer Rocktasche und im schimmernden Licht des Feuers erkannte Marius das Zeichen einer brennenden Blüte auf dem hölzernen Griff. Verwundert starrte er Corvuna an. Auch auf seinem Messergriff befand sich dieses Symbol und er wusste, dass es auch den von Bhatar zierte. Vor zwei Monaten noch hatte Marius ein ganz normales Messer besessen, mit schwarzem Griff und ohne Gravierung, doch ein silberner Rubin am Griff hatte seine Zugehörigkeit zu den Schattenboten eindeutig symbolisiert. Doch dann war Bhatar eines Abends vor seiner Haustür aufgetaucht und hatte ihn aufgefordert, ihn auf eine Mission zu begleiten, die ihn zu einem Schattenspäher machen würde. Und noch am selben Abend hatte Bhatar ihm das neue Messer, mit schärferer Klinge und Holzgriff mitsamt Gravierung gegeben.
„Du bist eine Schattenspäherin?“
Bhatar spukte ihr die Worte vor die Füße, als wolle er sie möglichst schnell loswerden. Corvuna lachte, ein hohes, schrilles Lachen, das an den Wänden widerhallte und Marius eine Gänsehaut über den Rücken jagte.
„Das hättest du nicht erwartet, was?“, grinste sie.
„Dem bist du nicht gewachsen“, zischte Bhatar wütend.
„Ach, nein? Dann verrate mir doch mal, wieso es mir dann gelungen ist, etwas viel Besseres als eine der Lebensblumen zu finden, mein Guter.“
Bhatar funkelte sie nun so zornig an, dass seine Augen Funken zu sprühen schienen.
„Nichts kann bedeutsamer sein als die Lebensblumen“, meinte er leise.
Da wurde Corvunas Grinsen breiter, triumphierender und irgendwie wusste Marius sofort, dass es doch etwas geben konnte, das bedeutsamer war.
„Was würdest du sagen, wenn ich dir verraten würde, wo sich Moran Reeder aufhält?“, hauchte sie und betonte jedes Wort nahezu genießerisch.
Marius‘ Mund klappte erstaunt auf und selbst Bhatar schien vergessen zu haben, dass er eigentlich wütend auf sie war. Seine Augen weiteten sich und sein Adamsapfel hüpfte aufgeregt auf und ab. Zuletzt hatten sie Reeder auf ihrer Mission gesehen, der durch seine bloße Anwesenheit verhindert hatte, ihre Aufgabe zu erfüllen. Doch noch nie war es einem von ihnen gelungen, herauszufinden, wo er lebte.
„Moran Reeder? Der Moran Reeder?“, wiederholte er langsam.
„Wie viele mit diesem Namen kennst du noch, also bitte“, sagte Corvuna und verdrehte die Augen, doch es war ihr deutlich anzusehen, dass sie die Wirkung ihrer Worte genoss.
Bhatar räusperte sich und blinzelte ein paar Mal, als wolle er sich erst einmal wieder sammeln.
„Du willst also sagen, dass du weißt, wo Reeder steckt?“
Corvuna nickte und ging hinüber zu einem Tisch, auf dem eine große Karte ausgerollt worden war. Marius erkannte sie sofort. Wie oft hatte er diese schon in seinen früheren Schulstunden gesehen, als er noch ein Kind gewesen war?
Die Karte zeigte Terquasol und die sechs Länder, in die die Welt eingeteilt war – Patridinem, Maribiles, Albursa, Cantus, Novitera und Apunima.
Alle sechs Länder waren von unterschiedlicher Form und Größe, doch grenzten sie alle an das große Meer in der Mitte, das mit zwei Tintenworten beschriftet war: Ponte Simul. Keines der Länder war miteinander verbunden, sie wurden alle von einem breiten Zweig des Meeres getrennt.
Corvuna deutete auf eines der größeren Länder, das den Namen Patridinem trug.
„Ich weiß, dass Reeder sich dort aufhält. Sein nutzloser Gehilfe, der ihm wie eine Klette am Bein hängt, hat es zufälligerweise erwähnt, als ich in der Nähe war“, sagte sie.
„Und du bist dir absolut sicher?“, hakte Bhatar nach, als wäre er davon überzeugt, eine Schwachstelle in ihrem Triumph zu finden.
„Natürlich, du Dummkopf. Wäre ich sonst hierher gekommen, zu unserem Meister?“
Zum ersten Mal seit Minuten erinnerte sich Marius an die Anwesenheit des Schattenmeisters und zuckte zusammen, als hätte er soeben eine Ohrfeige bekommen. Vorsichtig hob er den Blick und sah zu seinem Meister hinüber. Dieser starrte jedoch gedankenverloren auf die Karte und schien ihr Gespräch nicht im Geringsten verfolgt zu haben. Keiner der drei wollten ihren Gebieter aus den Gedanken reißen und so vergingen fast fünf erdrückende Minuten der Stille, bis der Schattenmeister sich vom Tisch abwandte und ans Fenster trat.
„Es ist ein Jammer, dass euch die Aufgabe nicht geglückt ist, wahrlich ein Jammer...“, sagte er schließlich leise.
„Mein Meister, ich werde diese Aufgabe übernehmen, ich werde Euch nicht enttäuschen!“, stieß Corvuna mit schriller Stimme aus.
Bhatar murmelte etwas, doch Marius verstand es nicht, denn im selben Augenblick drehte sich der Schattenmeister wieder zu ihnen um und richtete seinen Blick direkt auf Marius. Nun konnte er nicht mehr widerstehen und zupfte fast schon gewaltsam an seinem Kragen herum. Er hatte das Gefühl, der Raum wäre plötzlich zehn Grad heißer geworden.
„Nein, Corvuna. Für dich habe ich eine andere Aufgabe“, sagte der Schattenmeister, ohne seinen Blick von Marius zu wenden. „Und dieser Bursche wird dich begleiten.“
Corvuna blickte enttäuscht zu ihm hinüber, als wäre es seine Schuld, dass ihr Meister sie abwies.
„Auch für dich habe ich eine Aufgabe, Bhatar. Und ich hoffe doch, dass du mich dieses Mal nicht enttäuschst.“
Rasch nickte Bhatar und verbeugte sich gleich zwei Mal vor ihm.
„Das werde ich nicht, Meister“, sagte er mit fester Stimme.
„Was ist meine Aufgabe, mein Meister?“, rief Corvuna.
Marius wollte es am liebsten gar nicht erfahren. Er dachte an seine Frau, die jetzt sicher schon schlief und seine Kinder, die morgen nichtsahnend in die Schule gehen würden, ohne zu erfahren, dass ihr Papa schon wieder weg musste.
„Ihr werdet nach Patridinem gehen und dort nach Moran Reeder Ausschau halten. Informiert mich über alles, was ihr herausfindet. Irgendwo dort muss er leben, ich will wissen, wo und mit wem, verstanden?“, sagte der Schattenmeister mit einer plötzlichen Härte, dass Marius nicht anders konnte, als zu nicken.
„Natürlich, mein Meister. Sie werden alles erfahren, was Sie wissen wollen“, sagte Corvuna und verneigte sich vor ihm, sodass ihr Haar den Boden streifte.
Als sie sich wieder aufrichtete, warf sie Marius einen eindringlichen Blick zu und bedeutete ihm dann, ihr zu folgen. Er sah zu Bhatar, doch der starrte angestrengt in die andere Richtung, also folgte er Corvuna widerwillig aus dem Zimmer und die Treppe wieder hinunter. Für ihre hohen Schuhe lief sie erstaunlich schnell und sicher. Als sie die Tore in der Eingangshalle aufstießen, empfing sie kühle Luft, die Marius nun viel angenehmer vorkam, als das stickige Kaminzimmer im Obergeschoss.
Kurz vor dem Steinbogen hielt Corvuna und drehte sich zu Marius um. Jegliches Grinsen war von ihren Lippen verschwunden und ihre Augen glühten.
„Erlaubst du dir auch nur einen Fehltritt, werde ich mich persönlich um deine Zukunft kümmern, wenn du dann noch eine hast. Wir verstehen uns?“, sagte sie barsch.
Marius, der an diese Behandlung schon von Bhatar gewöhnt war, nickte langsam.
„Gut. Morgen früh brechen wir auf. Sei pünktlich, McMilton.“
Überrascht, dass sie seinen Namen kannte, blickte er Corvuna nach, die unter dem Steinbogen hindurch lief und schließlich im Schatten der Nacht verschwand.
Kapitel 2: Auf der Helianthus
Ein letztes Mal strich Maybelle Stacks das Pergament glatt und las es sich durch.
Mein lieber Vater, Immer wieder habe ich dir gesagt, wie ich mich fühle und dass ich es nicht mehr aushalte, länger hier zu bleiben und nichts zu tun. Für dich mag die Fischerarbeit dein Leben sein, deine Leidenschaft, aber ich kann sie einfach nicht teilen.
Ich habe es versucht, Papa, habe es wirklich dir zuliebe versucht. Aber da haben wir uns wohl beide etwas vorgemacht. Ich möchte endlich mehr. Seit zwanzig Jahren sehe ich Tag für Tag dieselbe, alte Hütte der Forsters mit ihren Zwillingstöchtern. Seit zwanzig Jahren sehe ich denselben kleinen See, auf dem du und die anderen Fischer eure Netze auswerft. Ich glaube, mittlerweile kenne ich keinen anderen Geruch mehr als diesen Fischgeruch, der über unserem Dorf liegt.
Ich hoffe, nein, ich bete, dass du mich verstehst, auch wenn du es die ganzen Jahre nicht getan hast. Ich muss fort, Papa. Ich muss mehr von dieser Welt sehen, sonst werde ich hier noch umkommen, ganz Gewiss.
Pass auf dich auf, denn auch ich werde auf mich aufpassen, das verspreche ich dir.
Wir sehen uns bald wieder.
Ich liebe dich,
Deine May
Mit einer Mischung aus schlechtem Gewissen und kribbelnder Vorfreude faltete May den Brief und legte ihn dann auf ihr gemachtes Kopfkissen. Als sie sich wieder aufrichtete, fiel ihr Blick aus dem runden Fenster über ihrem Bett. Hinter dem Strohdach von den Forsters konnte sie das glitzernde Wasser des Meeres sehen.
Rasch schnappte sie sich ihre Ledertasche, die sie an ihr Bett gelehnt hatte und blickte sich ein letztes Mal in ihrem Zimmer um. Eigentlich war es kein richtiges Zimmer. Zu Mays sechzehntem Geburtstag hatten sie und Timothy Stacks, ihr Vater, den Dachboden der Hütte zu einem gemütlichen Schlafeckchen umgebaut. An den schrägen Wänden hingen selbstgebastelte Traumfänger aus Federn, Perlen und Muscheln und in der Holzkommode, die Pierce Worthon, der beste Freund ihres Vaters geschnitzt hatte, stapelten sich Bücher, Steine, selbstgemalte Bilder, Kohlestifte, Federkiele, eine Pfauenfeder und zwei Gläser mit funkelndem Sand.
Mays Mundwinkel zuckten, als ihr Blick an einem der Bilder hängen blieb, das sie gemalt hatte, als sie drei Jahre alt gewesen war. Aus den undeutlichen, bunten Linien und Kreisen konnte sie dennoch das strahlende Gesicht ihrer Mutter erkennen und daneben stand sie selbst und hielt ihre Hand in der einen, die ihres Vaters in der anderen. Für einen kurzen Moment hatte May das Gefühl, etwas Schweres würde sich auf ihre Brust legen, doch als sie rasch den Blick von den Zeichnungen abwendete, verstrich der Moment.
So leise wie möglich schlich sie die knarrende Holztreppe hinunter ins Wohnzimmer und vorbei an der angelehnten Tür, hinter der sie das gleichmäßige Schnarchen ihres Vaters hören konnte. Er schien so tief zu schlafen, dass ihn wahrscheinlich eine wild gewordene Horde Elefanten nicht hätte aufwecken können. Dennoch durchquerte May das Wohnzimmer auf Zehenspitzen und öffnete die Haustür so leise wie möglich.
Frische Morgenluft schlug ihr entgegen und strich ihr durchs lange, braune Haar und über ihre Waden und Arme, die vom Stoff des Rocks und der Bluse nicht verdeckt wurden. Zögernd stand sie in der Eingangstür und warf einen Blick über die Schulter.
Ein schwerer Kloß bildete sich in ihrem Hals, als sie das vertraute, kuschelige Sofa sah, auf dem ihr Vater und sie abends so oft saßen und Karten spielten.
Diesen Abend würden sie nicht dort sitzen und sie würde auch nicht in der Küche stehen und ihren Vater wie so oft mit selbstgebackenen Keksen überraschen.
„Ich komme zurück, Papa“, flüsterte sie in die Stille hinein.
Als Antwort schnarchte Timothy Stacks besonders laut und für den Bruchteil einer Sekunde überkam May der geradezu übermächtige Drang, die Tür zuzuschlagen und sich wieder oben ins weiche, warme Bett fallen zu lassen.
Doch dann erinnerte sie sich an die Nächte, in denen sie stundenlang wach gelegen und an die Decke gestiert und an allem zweifelt hatte, was sie bisher getan hatte. Sie erinnerte sich an das Gefühl der Nutzlosigkeit und der Trägheit, die sie ergriffen hatte und schließlich die frische Energie, als sie den Plan fasste, endlich etwas dagegen zu unternehmen.
Wie zur Bestätigung nickte sie sich selber zu, dann trat sie hinaus auf den schmalen Weg, der durch den winzigen Vorgarten führte und schloss die Tür hinter sich.
Ihr schien es, als würde sie dadurch auch die Schwere in ihrer Brust wegschließen. Ohne einen Blick zurückzuwerfen schritt May durch den Vorgarten, öffnete das quietschende Holztor, über das sich Pierce jedes mal beschwerte, wenn er zu Besuch kam und lief den Pfad hinab, der durch das Dorf Silver-Myers führte.
Während sie an den Häusern und Fischerhütten vorbei lief, kämpften sich die ersten rot-goldenen Sonnenstrahlen durch die Nebelschwaden und als sie den See am Rand von Silver-Myers hinter sich gelassen hatte, zwitscherten die ersten Vögel ihre Lieder. Mays Herz pochte aufgeregt in ihrer Brust und ihre Hände umklammerten den Riemen der Tasche umso fester.
Wie lange träumte sie schon von diesem Augenblick? Wie lange stellte sie sich schon vor, diesen Weg hinabzulaufen, mit dem Ziel, auf das nächste Schiff zu steigen und einfach davon zu segeln?
Ihrem Vater zuliebe hatte sie dies nie getan. Sie war immer das brave, ruhige Mädchen gewesen, das in Apunima blieb und ihn ab und zu auf einen seiner Fischerausflüge begleitete. May wusste, dass es ihm das Herz gebrochen hätte, wäre sie aufgebrochen und hätte ihn zurückgelassen.
Schon oft hatte sie versucht ihn zu überreden, dass sie doch einmal Urlaub machen könnten in einem der anderen Länder von Terquasol.
Vielleicht sogar in Patridinem, immerhin schwärmte Pierce ständig davon.
Doch die Diskussionen waren jedes Mal gleich ausgegangen – er hatte irgendwann auf stur geschaltet und sich in den Schuppen hinterm Haus verzogen, um die Netze und Angelrouten zu putzen und May war alleine im Wohnzimmer zurückgeblieben. Seit ihre Mutter gestorben war, verbrachte Timothy Stacks erstaunlich viel Zeit in diesem Schuppen. Damals nutzten sie ihn noch, um Gerümpel aller Art unterzustellen, doch weil so viel davon an Emma Stacks erinnert hat, hatte Timothy es schließlich entsorgt.
Zwar hatte er darauf beharrt, die Sachen endgültig verbrannt zu haben, doch May war sich sicher, dass er es niemals übers Herz gebracht hätte.
Und gerade deswegen musste er sie doch einfach verstehen!
Er ging in diesen Schuppen, um seiner verstorbenen Frau nahe zu sein und sie wollte auf Reisen gehen, sich die Welt ansehen, so wie Emma es in ihrer Jugend immer getan hatte. May wollte doch nichts weiter, als ihrer Mutter irgendwie nahe zu sein.
Leise Stimmen rissen sie aus den Gedanken und erschrocken sah sie auf. Sie hatte vorgehabt, bei ihrem Aufbruch nicht gesehen zu werden, das würde bloß neugierige Fragen aufbringen, die sie nicht beantworten wollte. Gerade noch rechtzeitig hüpfte sie hinter eine niedrige Hecke und kauerte sich dort nieder, da bogen auch schon zwei Männer um die nächste Ecke. May vermutete stark, dass sie aus dem Pub von Silver-Myers kamen, denn sie torkelten Arm in Arm den Weg entlang und lallten fast unverständliche Worte vor sich hin.
„Hab‘s dir nich gesacht, oder doch?“, nuschelte der Kleinere der beiden.
„Was‘n?“, gab der Andere zurück und als sie an dem Stück der Hecke vorbeikamen, hinter dem May hockte, sah sie, dass er leicht schielte.
„Die wolln den, hicks, Kirchturm neu machen...“
„Nein! Das...das können se doch nich machen!“, polterte der Schielende.
Die Antwort des Kleineren ging in einem weiteren Schluckauf unter und im nächsten Moment bogen die beiden hinter dem Metzger in eine Seitengasse und verschwanden. May wartete noch zwei Minuten, um sich zu vergewissern, dass sie auch nicht zurückkamen, dann sprang sie auf und rannte die letzten Meter zum Hafen.
Das Licht der Sonne nahm mittlerweile einen orange-gelblichen Ton an und je näher May den Anlegeplätzen von Apunima kam, desto kühler und salziger wurde die Luft. Möwen kreisten über ihrem Kopf und einige saßen auf dem Zaun der Kuhweide, an der sie vorbeikam und beobachteten sie aus neugierigen Augen. Und dann kam es endlich in Sicht. Das große Schiff, dessen drei Masten hoch in die Lüfte empor ragten und die milchfarbenen Segel in der Morgenbrise flatterten. Das Rauschen der Wellen klang wie Musik in Mays Ohren. Sie blieb stehen und atmete tief durch.Wie oft war sie schon runter zum Hafen gelaufen und hatte die Passagierboote beim An – und Ablegen beobachtet...
Wenn sie dieses Schiff betreten würde, gäbe es kein Zurück mehr. Sie würde nach Patridinem segeln, in ein fremdes Land, ohne Freunde, ohne Familie, ganz auf sich alleine gestellt. Ein mulmiges Gefühl breitete sich in Mays Magengegend aus, doch bevor sie es sich anders überlegen konnte, schwenkte einer der Besatzungsmitglieder eine große Glocke über seinen Kopf.
„Letzter Aufruf für die Helianthus, Abfahrt 6 Uhr, Route Novitera, Apunima, Patridinem!“
Mit wild hämmerndem Herzen reihte sich May hinter den letzten Passagieren ein, die die Helianthus betreten wollten. Vor ihr stand eine junge Frau, die an der Hand ihre kleine Tochter hielt, die aufgeregt auf und ab hüpfte.
„Mami, Mami, wann geht es endlich los, Mami?“, quiekte sie und versuchte, an den anderen Menschen vorbei auf das Schiff zu spähen.
„Gleich, mein Liebling. Siehst du, wir sind fast dran“, sagte ihre Mutter liebevoll und strich dem aufgeregten Mädchen eine Haarsträhne hinters Ohr.
May verspürte bei diesem Anblick einen kleinen Stich. Für einen Moment hatte sie sich selbst an der Hand ihrer Mutter gesehen.
„Können wir dann auch wieder auf die Ponyfarm, Mami? Ich möchte noch mal auf den Ponys reiten“, rief das Mädchen.
„Natürlich. Aber bis dahin musst du dich noch ein wenig gedulden, Schatz.“
Die Reihe wurde kürzer und schließlich zeigten die beiden vor May ihre Tickets vor und betraten die Helianthus.
„Ihr Ticket, bitte.“
Ein schlaksiger, pickeliger Mann mit strohblondem Haar und einer Pfeife im Mundwinkel streckte gelangweilt die Hand aus, während er rötliche Wolken aus seiner Pfeife blies.
„Ja, natürlich“, beeilte sich May zu sagen und kramte in ihrer Tasche nach dem Ticket.
Sie hatte es schon vor zwei Wochen gekauft. Selbstverständlich heimlich und ohne, dass ihr Vater es mitbekommen hatte; sie war mit der Ausrede frische Eier vom Bauern zu holen, zum Hafen gegangen und hatte sich das Ticket mit ihrem ersparten Geld gekauft. Endlich fand sie es zwischen dem Handspiegel, den ihre Mutter ihr geschenkt hatte und einem Apfel und reichte es dem Pfeife rauchenden Mann. Er warf einen vagen Blick darauf, nickte und gab es ihr zurück.
„Eine angenehme Reise wünscht Ihnen die Helianthus-Mannschaft, Ma‘am.“
Während May das Ticket wieder in ihrer Tasche verstaute, betrat sie das Schiff über die ausgelegte Planke.
An Deck herrschte ein wildes Treiben. Matrosen schleppten Fässer und Netze voller Kartoffeln, Dosen und Fisch von einer Seite zur anderen, Kinder tobten umher, eine Gruppe aus Männern mit merkwürdig hohen Zylindern und schweren Mänteln, an denen Zahnräder und Holzknöpfe hingen, lehnten an der Reling und neben einem Stapel Sandsäcken stand eine Frau mit dunklem, verfilztem Haar, die im Flüsterton eindringlich auf einen nervös vor und zurück wippenden Mann einredete.
May schlenderte an der Reling entlang und suchte einen etwas ruhigeren Platz. Nicht weit von den Männern mit den Zylindern entfernt, blieb sie stehen und stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen letzten Blick auf Apunima zu erhaschen. Da lag es, mit seinen vielen Seen und Wäldern und Feldern.
May dachte an ihren Vater. Ob er jetzt wohl schon den Brief gefunden hatte?
Wahrscheinlich nicht. Bestimmt nahm er an, dass sie noch schlafen würde, manchmal verschlief sie fast den ganzen Tag, wenn sie in der Nacht wieder einen ihrer Albträume gehabt hatte.
Ein gellender Pfeifton hallte über das Deck und nur wenige Minuten später hievten der pickelige Mann mit der Pfeife und einer seiner Kollegen die Planke an Bord und die Helianthus setzte sich unter Ächzen und Dröhnen in Bewegung. May rührte sich nicht vom Fleck. Wie gebannt starrte sie auf das immer kleiner werdende Apunima und erneut keimten die Gewissensbisse in ihr auf.
War es richtig von ihr, einfach zu gehen? Würde ihr Vater sauer sein, wenn er herausfand, was sie getan hatte? Sicherlich würde er enttäuscht und traurig sein. Bei dem Gedanken an Tränen auf seinem Gesicht und Verzweiflung in seinen blauen Auge verkrampfte sich Mays Inneres. Würde er so verzweifelt sein, wie am Tag von Mutters Beerdigung?
May schüttelte den Kopf, um die dunklen Gedanken zu vertreiben.
„Ich habe nun mal meine Entscheidung getroffen, ich werde keinen Rückzieher machen“, murmelte sie leise und wandte sich schließlich von dem winzigen Stück Land in der Ferne ab, das ihr zu Hause war.
Die nächste Stunde verbrachte sie damit, über das Schiff zu schlendern und neugierig die anderen Passagiere zu mustern. Silver-Myers war ein kleines, ödes Fischerdorf, in das sich nur selten andere Leute aus anderen Ländern verirrten. Deswegen war May nun umso gespannter, die Sitten der anderen kennenzulernen. Bald schon fand sie heraus, dass die Männer mit den hohen Zylindern aus Novitera kamen, dem Land der Künstler, Schmiede und Ingenieure. Sie unterhielten sich ausgelassen über den Stoff ihrer Mäntel, die sie allen Anschein nach selbst entworfen und geschneidert hatten.
„Und der ist wirklich aus echtem Yeti-Fell?“, sagte der eine, halb skeptisch, halb beeindruckt.
„Selbstverständlich. Ich habe ihn mit meinem Onkel monatelang gejagt, bis wir ihn endlich erwischt haben. Hat mir drei meiner gescheitesten Finger gekostet“, antwortete der Andere und hob seinen Arm hoch, sodass sein Ärmel hochrutschte.
May zog scharf die Luft ein, als sie die drei Stummel sah, an denen eigentlich sein Ringfinger, Mittelfinger und Daumen hätten sein müssen. Auch seine Freunde schienen entsetzt und starrten die verkrüppelte Hand an, als würde sie zu einem Außerirdischen gehören.
„Aber wie hast du dann diesen bezaubernden Mantel geschneidert, Olaf?“, piepste ein weiterer Zylinderträger.
„Och, mein Onkel hat mir geholfen, sozusagen als Wiedergutmachung.
Wäre er in seiner Wache nicht eingeschlafen, dann hätte der Yeti uns auch nicht überraschen können.“
Während seine Freunde in Gelächter ausbrachen, stahl sich May langsam weiter. Sie hatte noch nie einen echten Yeti gesehen, nur in einer Abbildung aus ihrem Schulbuch. Wie denn auch, sie kannte ja nur die Tiere und Geschöpfe, die in Apunima hausten und Yetis zählten ganz sicher nicht dazu. So weit sie wusste, lebten Yetis bloß in einem einzigen Land, nämlich in Albursa.
In Albursa herrschte stets Winter, es war das Land des Eises und des Schnees und noch nie hat es einen Tag gegeben, an dem dort nicht mindestens Minus Zehn Grad gemessen worden waren. Während May sich noch fragte, ob die Geschichte mit dem Yeti, der den Mann mit seinem Onkel im Schlaf überfallen hatte, bloß ausgedacht war, um die Freunde zu beeindrucken, kam sie an dem Stapel der Sandsäcke vorbei.
„Und was ist, wenn er nicht alleine ist? Die Leute erzählen sich, dass er doch recht mächtig sein soll.“
May blieb verwundert stehen, als sie die leise, verängstige Stimme hörte.
Sie sah den Mann, der so nervös hin und her wippte und die Frau mit dem schmuddeligen Haar. Nun verdrehte diese die Augen.
„Ich frage mich immer wieder, wieso er ausgerechnet dich auf diese Mission geschickt hat“, murrte sie barsch.
„Das frage ich mich auch“, nuschelte der Mann, doch die Frau schien ihn nicht gehört zu haben.
„Es gibt nur einen mächtigen Mann in Terquasol und das ist unser Meister.
Niemand wird sich je mit seinen Kräften messen können. Was er alles schon vollbracht hat...“
Ihr Ausdruck wurde geradezu schwärmerisch, was ziemlich merkwürdig auf ihrem sonst so harten Gesicht aussah.
„Aber ist es nicht seltsam, dass niemand seinen richtigen Namen kennt? Ich meine, er könnte ihn wenigstens uns verraten, oder nicht?“, sagte der nervöse Mann kleinlaut.
Die Frau warf ihm einen bösen Blick zu und zwirbelte eine eh schon verfilzte Haarsträhne zwischen den Fingern.
„Er will nur seine Identität schützen, du Trottel“, fuhr sie ihn an.
Doch der Mann zuckte mit den Schulten.
„Ich meine ja nur. Ich dachte, er vertraut uns ein bisschen mehr.“
„Zweifelst du etwa an seiner Einstellung, McMilton?“
„Was? Nein, nein, keineswegs!“, stieß er hastig aus und hob abwehrend die Hände.
Die Frau nickte, wenn auch nicht wirklich überzeugt und ihre Hand klopfte auf die Tasche ihres grauen Rocks.
„Wenn er uns nicht vertrauen würde, dann hätte er uns auch nicht diese höchst nützlichen Messer gegeben, nicht wahr?“, sagte sie hochnäsig.
Der Mann, den sie mit McMilton angesprochen hatte, zog eine Augenbraue hoch.
„Ich verstehe nicht ganz, was so besonders an ihnen sein soll. Bloß, weil dieses Zeichen da drauf ist?“
Mit diesen Worten langte er in seine Manteltasche, doch bevor er seine Hand wieder zurückziehen konnte, stürzte die Frau mit einem schrillen Aufschrei vor und packte seinen Arm. Empört und verwirrt zugleich starrte McMilton sie an.
„Nicht hier“, zischte sie und sah sich mit geweiteten Augen um.
May hockte sich rasch hinter die Säcke, um nicht entdeckt zu werden.
„Willst du die ganze Mission verderben, Schwachkopf? Wenn die rausfinden, dass wir hier sind, dass wir ihm auf der Spur sind, können wir uns gleich die Kehle durchschneiden.“
„Schon gut, ich...es wird nicht wieder vorkommen“, versicherte McMilton eingeschüchtert und zog seine Hand aus der Tasche.
„Du glaubst doch nicht wirklich, dass jemand von denen hier ahnen könnte, wer wir sind, oder?“
Diesmal hatte McMilton so leise gesprochen, dass May ihn fast nicht mehr verstanden hätte. Vorsichtig drückte sie sich näher an die Säcke, um die beiden besser verstehen zu können. Die Frau ließ ihren Blick unauffällig über die anderen Passagiere wandern und schüttelte langsam den Kopf.
„Ich denke nicht. Sieh sie dir doch an. Tollen herum wie kleine Kinder, nichtsnutzige Bälger allesamt“, sagte sie mürrisch.
McMilton schwieg, doch auch er beobachtete die Leute. Als sein Blick auf die Frau mit dem kleinen Mädchen fiel, die vor May in der Ticketschlange gestanden hatten, zuckten seine Mundwinkel und etwas Helles leuchtete in seinen Augen auf.
„Die Klingen der Messer, die der Meister uns gegeben hat, sind mit dem Blut der Flussnixen getränkt. Es macht sie schärfer, unzerstörbar und tödlicher“, sagte die Frau schließlich mit gesenkter Stimme und wieder klopfte sie auf ihre Rocktasche.
Mittlerweile vermutete May stark, dass sich dort eines dieser Messer befand.
McMilton starrte sie ungläubig an und das Leuchten war aus seinen Augen verschwunden.
„Das Blut der Flussnixen? Aber sie sind doch äußerst selten, oder nicht?“, stammelte er.
Ein hämisches Grinsen breitete sich auf den Lippen der Frau aus und May verspürte das Bedürfnis, an ihren zotteligen Haaren zu ziehen.
„Widerwärtige Kreaturen. An das niedere Leben der Armen und Dreckigen gebunden“, lachte sie.
„Und damit haben wir eine Chance gegen Reeder?“, murmelte McMilton unsicher. Mit nervösen Fingern fummelte er an seinem Mantelkragen herum.
„Wenn ich die Möglichkeit habe, diesem Kerl gegenüberzustehen, dann überlege ich mir zweimal, ob ich das Messer oder nicht doch lieber meine bloßen Hände benutze“, antwortete die Frau kalt.
May hatte genug. Langsam zog sie sich zurück, darauf bedacht, von den beiden nicht entdeckt zu werden und lief dann bis zum anderen Ende des Decks. Aus irgendeinem Grund war es ihr besonders wichtig, möglichst viel Abstand zwischen sich und diese Frau zu bringen. Erst als sie wieder an der Reling stand, hielt sie an und stützte sich schwer atmend dagegen.
Sie starrte hinunter in die Wellen, doch nahm sie kaum wahr. Ihre Gedanken rasten.
War sie gerade Zeuge geworden, wie jemand einen Mord plante? Hatten diese Frau und dieser Mann, dieser McMilton, die Absicht, nach Patridinem zu segeln, um jemanden umzubringen?
Schwer schluckend stand May da und umklammerte die Balustrade so fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. So hatte sie sich ihre ersten Stunden auf dieser Reise nicht vorgestellt. Sie versuchte sich zu beruhigen und schloss die Augen, spürte die Gischt auf ihrer Haut und den Wind in ihren Haaren.
Langsam beruhigte sich ihr Herzschlag wieder und instinktiv beugte sie sich noch ein Stückchen weiter über die Reling, um mehr von der frischen, wohltuenden Luft zu erhaschen.
„Passen Sie lieber auf, wir wollen Sie doch nicht aus dem Wasser fischen müssen.“
May schlug die Augen auf und drehte sich um. Ein Mann stand vor ihr, die Hände in die Hüften gestemmt und ein freundliches Schmunzeln im Gesicht. Graues, dichtes Haar bedeckte den Großteil seines kleinen Kopfes und seine schütteren Augenbrauen waren kaum zu erkennen. Kleine Lachfältchen umspielten seine Mundwinkel und seine blauen Augen strahlten May an.
„Zum ersten Mal auf dem Wasser, Miss?“, fragte er lächelnd.
„Zum ersten Mal auf dem Ponte Simul unterwegs, ja. Zum ersten Mal auf dem Wasser, nein“, erwiderte May.
Der Mann lachte und streckte ihr die Hand entgegen.
„Shaun Gosnell, Miss.“
„Maybelle Stacks, aber meine Freunde nennen mich einfach May“, sagte sie und schüttelte seine Hand.
„Perfekt, ich habe noch nie viel von Höflichkeitsfloskeln gehalten. Nenn mich einfach Shaun“, sagte er und sein Lächeln wurde noch breiter.
Er stellte sich neben sie, verschränkte seine Arme auf dem Geländer und blickte hinaus auf die Weites des Meeres. May musterte ihn von der Seite.
„Woher kommst du, Shaun?“, fragte sie und konnte die Neugier in ihrer Stimme nicht verbergen.
„Aus Patridinem. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, endlich wieder zurückzukommen. Meine Heimat hat mir wirklich gefehlt in den letzten Tagen, das kann ich dir sagen“, meinte er, ohne den Blick von den Wellen abzuwenden.
„Dann warst du vorher in Apunima?“
„In Novitera. Ich bin schon etwas länger auf diesem Schiff unterwegs, meine Liebe und kann es deswegen kaum erwarten, endlich wieder im Sattel meiner Fanny zu sitzen“, antwortete Shaun mit einem träumerischen Ausdruck.
Er schien Mays Stirnrunzeln zu bemerken.
„Meine Stute heißt Fanny“, erklärte er. „Und du kommst also aus Apunima?“
May nickte.
„Woher weißt du das? Ich hätte doch genauso gut aus Novitera kommen können“, sagte sie erstaunt.
„Erstens habe ich dich dort nicht unter den Passagieren gesehen, die in Novitera in der Schlange standen und zweitens meintest du, dass du noch nie auf dem Ponte Simul warst“, sagte Shaun lächelnd.
„Du merkst dir jeden, der dieses Schiff betritt?“, sagte May verblüfft.
„Natürlich. Heutzutage ist das mehr als ratsam, meine Liebe.“
„Wieso?“, wollte May rasch wissen.
Doch Shaun schüttelte langsam den Kopf und sein Strahlen verrutschte etwas.
„Frag mich etwas Leichteres“, sagte er entschuldigend.
„Gut. Wie ist es so in Patridinem?“
Schlagartig hellte sich Shauns Miene auf.
„Oh, das ist leicht. Wo soll ich da nur anfangen? Es gibt die herrlichsten Wildpferde, die spannendsten Schießduelle und den stärksten Whiskey weit und breit. Aber es kann auch ein gefährlicher Ort sein. Wenn du nicht aufpasst, erwischen dich die Roten Hyänen.“
„Die Roten Hyänen?“, wiederholte May.
„So nennt sich die Bande aus den schlimmsten Falschspielern und hinterhältigsten Halunken, die mir je untergekommen sind. Naja, bis auf...“
Er brach ab und strich sich gedankenverloren über die wenigen grauen Barthaare. Für einen Moment schien er vergessen zu haben, dass May da war, dann schüttelte er den Kopf, als wolle er eine lästige Fliege vertreiben.
„Nun, nicht so wichtig. Was treibt dich denn nach Patridinem, May?“, sagte er dann bemüht lässig.
„Ich dachte, ich könnte mir etwas von der Landschaft dort ansehen. Ein Bekannter von mir schwärmt schon seit Jahren von Patridinem und ich wollte es mir schon immer einmal gerne selber ansehen“, sagte sie.
„Wieso hast du es dann noch nicht getan? Dir ist die Jahre etwas entgangen, meine Liebe“, entgegnete Shaun gespielt entrüstet.
„Es...es hat sich bis jetzt keine Gelegenheit geboten“, sagte May ausweichend.
Shaun zog die Augenbrauen hoch, doch zu Mays Erleichterung ging er nicht weiter darauf ein.
„Du hättest dir keinen ungünstigeren Zeitpunkt für deine Reise aussuchen können“, seufzte er schließlich und sah wieder hinaus aufs Wasser.
Jegliches Lächeln war verschwunden und ein plötzlicher Schatten lag auf seinem Gesicht. May runzelte die Stirn. Sie wusste nicht recht, was er damit meinte, wollte ihn jedoch ungern darauf ansprechen.
Er schien nicht sonderlich erpicht auf dieses Thema zu sein. Sie öffnete den Verschluss an ihrer Tasche und holte den Handspiegel heraus, den ihre Mutter ihr kurz vor ihrem fünften Geburtstag geschenkt hatte.
Kurz bevor sie starb...
Der Handspiegel bestand aus glänzendem Mahagoniholz und in der Rückseite waren sechs unterschiedliche Blumen eingraviert. Jede Blume sah anders aus und die Details jeder von ihnen waren fein und höchst ordentlich herausgearbeitet. May betrachtete sich kurz im Spiegel und reichte ihn dann Shaun.
„Könntest du ihn kurz halten?“
„Na klar.“
Rasch zupfte sie ein Haarband aus der Tasche und band sich ihre widerspenstigen Haare zu einem lockeren Knoten nach oben. Als Shaun ihr den Spiegel wiedergab, fiel sein Blick für den Bruchteil einer Sekunde auf die Rückseite und auf die Gravierungen und er erstarrte in der Bewegung. May, der der Spiegel ihrer Mutter heilig war, zog ihn rasch und etwas grob aus seiner Hand und stopfte ihn wieder zurück in die Tiefen ihrer Tasche. Als sie wieder aufsah, hatte sich Shaun immer noch nicht geregt und starrte auf die Tasche, in der der Spiegel gerade verschwunden war.
„Von...von wem hast du diesen Spiegel, May?“, hauchte er mit heiserer Stimme.
„Von meiner Mutter, weshalb?“, sagte May misstrauisch.
„Ich....“
Shaun brach ab und schüttelte den Kopf, strich sich wieder übers Kinn und schüttelte abermals den Kopf.
„Tut mir leid, ich muss da etwas verwechselt haben“, sagte er schließlich und schenkt ihr ein beruhigendes Lächeln.
Die restliche Fahrt tauschten sie sich über Geschichten aus ihren Ländern aus; Shaun erzählte von Patridinem und Jagdausflügen auf seiner Fanny und May berichtete von Apunima und der Fischerarbeit mit ihrem Vater.
Und doch fiel ihr auf, dass der nachdenkliche Ausdruck auf Shauns Gesicht, den er aufgesetzt hatte, seitdem er Mays Spiegel gesehen hatte, nicht mehr verschwinden wollte.
Kapitel 3: Der Mürrische und der Faulpelz
„...und dann ging er zu ihm hin, hat die Kröte aufgehoben und sie ihm einfach auf den Kopf gesetzt. Du hättest sein Gesicht sehen müssen, es war köstlich.“
May stimmte in Shauns Lachen mit ein. In den letzten anderthalb Stunden war ihr eines bewusst geworden: Shaun Gosnell war ein hervorragender Geschichtenerzähler. Wenn er von seinen wahnwitzigen, lustigen und spannenden Reisen erzählte, hatte May jedes Mal das Gefühl selbst dabei gewesen zu sein. Als sie sich wieder beruhigt hatten, lehnte sich May an der Wand des Kapitänshäuschen zurück und legte ihre Arme auf den Knien ab. Sie waren sich beide einig gewesen, den letzten Rest der Fahrt im Sitzen zu verbringen und da alle Bänke belegt waren, hatten sie es sich im abgelegenen Winkel des Kapitänshäuschen gemütlich gemacht.
„Wie lange wohnst du schon in Patridinem?“, fragte May nun neugierig.
Shaun winkelte ein Bein an und legte seinen Kopf in den Nacken. Er musste seine Augen mit einer Hand vor der herabbrennenden Sonne abschirmen.
„Mein ganzes Leben, würde ich sagen. Jedenfalls wurde ich dort geboren und bin seitdem immer wieder dorthin zurückgekehrt, nicht wahr? Auch wenn ich mal Wochen, sogar Monate außer Lande war, hat es mich am Ende immer wieder dahin zurückgezogen“, sagte er langsam.
„Hast du nie darüber nachgedacht, in ein anderes Land zu ziehen?“
„Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Stell dir vor, du lebst in Albursa, nie wieder schwitzen und du musst auch keine Angst mehr vor ausgetrockneten Seen haben“, grinste Shaun.
Doch dann wurde er wieder ernst und verfolgte mit den Augen eine vorbeiziehende Möwe.
„Aber ich hätte es nicht übers Herz gebracht, Patridinem zu verlassen. Endgültig, meine ich. Es ist mein zu Hause, weißt du?“
Sie nickte und doch war sie sich im selben Moment nicht sicher, ob sie verstand. Apunima war zwar ihre Heimat, sie war dort geboren, dort aufgewachsen, ihr Vater war dort und nie hatte sie einen anderen Ort gesehen.
Doch konnte sie sich wirklich vorstellen, für immer dort zu bleiben? Alt zu werden zwischen den engstirnigen Fischersleuten, die sich bis in die frühen Morgenstunden mit Alkohol zuschütteten? Ihr Vater war wie sie in Apunima groß geworden und kannte nichts anderes. Doch im Gegensatz zu ihr hatte er nie den Wunsch verspürt, sein Nest zu verlassen und über seinen Tellerrand hinauszublicken.
May seufzte und strich sich eine lose Haarsträhne zurück. Es war das erste Mal, seit anderthalb Stunden, dass sie an ihren Vater dachte. Mittlerweile stand die Sonne hell am Horizont. Er musste inzwischen bemerkt haben, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht stieg er ja sogar in diesem Augenblick die knarzenden Stufen empor und fand das verwaiste Bett mit nichts als einem bloßen Brief.
May schluckte. Es war nicht richtig gewesen, flüsterte ihr eine Stimme in ihrem Kopf zu. Hatte es nicht genauso bei ihrer Mutter angefangen? Hatte sie nicht einen Tag vor Mays fünftem Geburtstag einen Brief bekommen und war kurz darauf gestorben?
„Man kann schon die ersten Bergspitzen sehen, May.“
Shauns Stimme riss sie aus den Gedanken und doch fühlte sie sich ein wenig beklommen, als sie ihre Tasche schulterte und sich an die Reling stellte. Als ihr Blick auf die verschwommenen Umrisse von Hügelketten und gewaltigen Bergspitzen fiel, rückten ihre Gedanken allerdings immer weiter in den Hintergrund und als der pickelige Ticketkontrolleur auftauchte und verkündete, sie würden in weniger als zwanzig Minuten anlegen, machte Mays Herz einen euphorischen Hüpfer.
„Was wirst du tun, wenn wir erst einmal in Lofall sind?“, fragte Shaun.
„Lofall?“
„Na, so heißt die Stadt, an der der Hafen von Patridinem liegt“, erklärte er ihr.





























