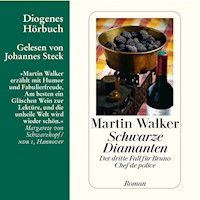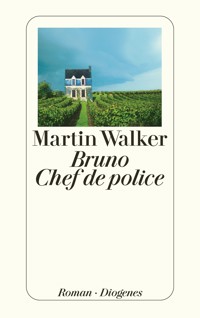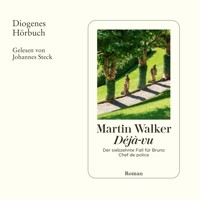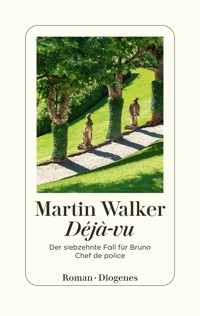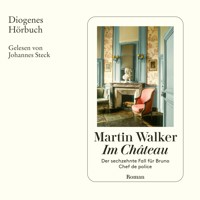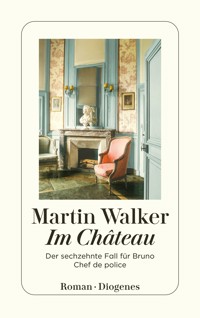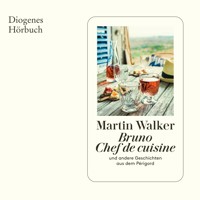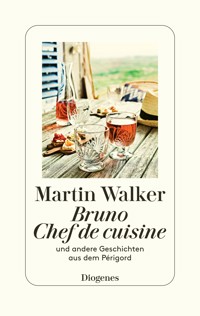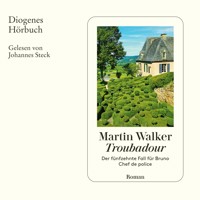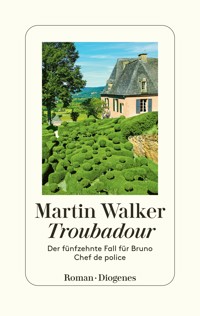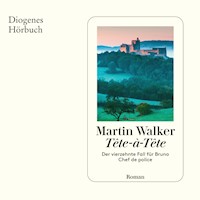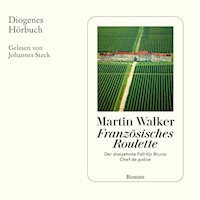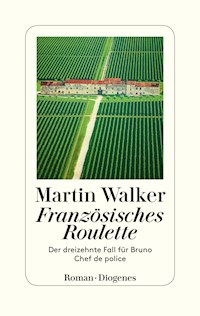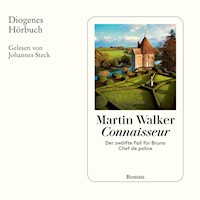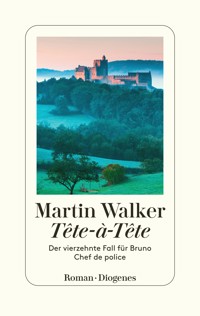
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Bruno, Chef de police
- Sprache: Deutsch
Brunos Vorgesetzten lässt ein Mordfall bis heute nicht los. Im Wald bei Saint-Denis hatte man die Leiche eines jungen Mannes gefunden, die nie identifiziert werden konnte. Bei einem Besuch im Prähistorischen Museum in Les Eyzies sieht Bruno, dass sich aus Knochenfunden rekonstruieren lässt, wie ein Mensch zu Lebzeiten aussah. Er schlägt vor, dieses Verfahren auch bei dem ungelösten Mordfall zu versuchen. Damit beginnt endlich die Suche nach dem Mörder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Martin Walker
Tête-à-Tête
Der vierzehnte Fall für Bruno, Chef de police
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Diogenes
Der Freiwilligen Feuerwehr des Périgord
1
Die drei Schädel zogen ihn in ihren Bann. Der eine war ein Originalschädel, rund 70000 Jahre alt, aber nicht ganz vollständig. Daneben befand sich eine Rekonstruktion, eine genaue Kopie, die man um die fehlenden Teile an Kiefer und Schädelkapsel nachträglich ergänzt hatte. Hinter den Exponaten, von der Beleuchtung raffiniert in Szene gesetzt, war ein künstlerischer Versuch einer Nachbildung des Gesichts, das zu dem Schädel gehört haben mochte. Es schimmerte schaurig. Vielleicht war es eine optische Täuschung, hervorgerufen durch das Licht, das das Gesicht größer erscheinen ließ. Zögernd richtete Bruno Courrèges den Blick zurück auf das Original, von dem es in einer Erklärung auf der Hinweistafel hieß, dass es sich um den besterhaltenen Neandertaler-Schädel handele. Er stammte aus der Felsgrotte La Ferrassie, an der Bruno tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit im Bürgermeisteramt von Saint-Denis vorbeikam. Von dort aus übte er nun schon zehn Jahre seinen Dienst des chef de police für die Stadt und Umgebung aus.
Die Region verfügte über einen außergewöhnlichen Schatz an prähistorischen Zeugnissen wie Höhlenmalereien oder Stoßzähnen von Mammuten. Bruno begeisterte sich zunehmend dafür und wollte jetzt unbedingt alle bekannten Höhlen und abris im weiteren Umkreis mit eigenen Augen sehen. Außerdem war er regelmäßiger Besucher des Prähistorischen Museums von Les Eyzies, das ganz in der Nähe seines Zuhauses lag und in dem er gerade war. Das nachgebildete Gesicht brachte ihn ins Grübeln. Es ließ ihn an die seltsame Obsession seines Freundes Jean-Jacques hinsichtlich eines anderen, sehr viel jüngeren Schädels denken. Bruno kannte diesen Schädel, zumal eine vergrößerte Fotografie davon Jean-Jacques’ Aufstieg zum ersten Ermittler für das Departement Dordogne begleitet hatte. Seit mittlerweile dreißig Jahren wanderte das Bild in jedes neue Büro mit, das Jean-Jacques bezog. Jetzt hing es an der Tür; so hatte er von seinem imposanten Schreibtisch aus – dem Standardrequisit eines Beamten seines Ranges – den Schädel jederzeit im Blick. Seine Kollegen rätselten häufig, weshalb Jean-Jacques ständig an seinen ersten großen Fall erinnert werden wollte, den er als junger Polizist nicht hatte aufklären können.
Jean-Jacques behauptete, nicht mehr zu wissen, warum er den Schädel »Oscar« getauft hatte, dabei kannte jeder Polizist im Südwesten Frankreichs die Geschichte. Ein Trüffelsammler, der mit seinem Hund die Wälder in der Nähe von Saint-Denis durchstreift hatte, war auf einen Baum gestoßen, den ein Sturm gefällt und in einen Bach hatte stürzen lassen. Die vom Stamm umgelenkten Fluten hatten an einer Böschung Erde weggeschwemmt, unter der etwas freigespült worden war, das der Hund des Sammlers aufgespürt hatte: einen menschlichen Fuß, halb verwest und von Tieren angeknabbert. Der Sammler hatte Joe angerufen, Brunos Vorgänger als Stadtpolizist von Saint-Denis, worauf dieser nach Sichtung des Fundes die Police nationale in Périgueux eingeschaltet hatte. Jean-Jacques, ihr jüngster Beamter, wurde mit den Ermittlungen betraut.
Entschlossen, sich mit diesem unerwarteten Fall einen Namen zu machen, war Jean-Jacques zum Fundort geeilt, hatte ihn abgesperrt und Schaufeln, einen Fotografen der Mairie und die Hilfe der örtlichen Gendarmerie angefordert. Mit deren tatkräftiger Unterstützung barg er vorsichtig die Überreste eines jungen Mannes mit langen blonden Haaren und makellosen Zähnen. Er war mit einem T-Shirt bekleidet, auf dem immer noch das verblichene Logo einer vergessenen Rockband zu erkennen war. Körpereigene Bakterien, Insekten und Mikroben hatten etwa ein Jahr lang, wie die Rechtsmedizin vermutete, ganze Arbeit geleistet. Dass die Leiche offenbar gezielt versteckt worden war, hatte Jean-Jacques auf ein Tötungsdelikt schließen lassen.
Zum Schrecken der anwesenden Gendarmen hatte Jean-Jacques Latex-Handschuhe angezogen und die Leiche vorsichtig von der Erde befreit. Inzwischen war auf seine Veranlassung ein Gabelstapler von einem nahe gelegenen Betriebshof eingetroffen, der mithilfe eines ein mal zwei Meter großen Stahlblechs die Leiche auf vier bereitliegende Holzpfosten hob, worauf der Körper von acht Gendarmen abtransportiert und auf dem unterhalb gelegenen Campingplatz zwischengelagert wurde. Von dort brachte ein Transporter den Toten zur Autopsie ins Leichenschauhaus von Périgueux.
Derweil hatte Jean-Jacques mehr als eine Stunde damit verbracht, den Fundort nach eventuellen Spuren abzusuchen, nach einem Geschoss etwa oder einer Patrone. Doch selbst die Hilfe von Freiwilligen vom örtlichen Jagdverein und Gendarmen mit Metalldetektoren blieb erfolglos. Gefunden wurden nur zwei kleine Feuerstellen, die kreisförmig mit Steinen umgeben waren, und aufgewühlte Erde an einer Stelle, die, wie sich herausstellte, als Latrine genutzt worden war. In der Nähe der Fundstelle befand sich ein wilder Campingplatz, das, was Franzosen le camping sauvage nannten und wo man für kurze Zeit kostenlos zelten konnte.
DNA-Analysen waren damals noch unbekannt, und so standen Jean-Jacques nur die herkömmlichen Ermittlungsmethoden zur Verfügung. Er stand mit am Seziertisch, als das, was von dem Toten übrig geblieben war, nach allen Regeln der forensischen Kunst untersucht wurde, und taxierte mit eigenen Augen jede Rippe, weil er hoffte, Spuren eines Messerangriffs oder dergleichen entdecken zu können. Letztlich blieb die Obduktion jedoch ergebnislos. Frustriert wandte sich Jean-Jacques an den mit diesem Fall betrauten Staatsanwalt und überredete ihn zu einer letzten, verzweifelten Maßnahme. Er kaufte einen großen Topf, den er aus eigener Tasche bezahlte, trennte den Kopf der Leiche ab und ging damit in die Küche des Präsidiums, wo er nach einem Campingkocher verlangte. Im Innenhof kochte er daraufhin den Schädel aus, bis alles Gewebe von ihm abgefallen war.
Das Ganze dauerte ziemlich lange, und der Geruch, der sich dabei entwickelte, griff schnell auf die umliegenden Gebäudeteile über. Anfangs nur neugierig, reagierten Kollegen und all diejenigen, die sich in der Nähe aufhielten, zunehmend entsetzt. Schließlich wurden auch zwei Reporter der Lokalpresse darauf aufmerksam, die ihr Büro neben dem Präsidium hatten. Der Gestank war durchdringend, blieb aber zum Glück auf die unmittelbare Nachbarschaft begrenzt. Gleichwohl beschwerten sich bald betroffene Ladenbesitzer, und schließlich verlangten der Bürgermeister und der Präfekt nach einer Erklärung. Beide trugen eine Mund-Nasen-Maske, die mit einer mentholhaltigen Flüssigkeit getränkt war. Als sie im Präsidium eintrafen, hatte sich über den Lokalsender bereits die Nachricht verbreitet, dass die Polizei eine Leiche kochen würde.
Während sich die Verärgerung unter den Kollegen hochschaukelte, wurde Jean-Jacques ins Büro des Polizeipräsidenten zitiert, wo er seine Vollmacht zur Präparierung des Schädels vorlegen konnte. Sie war unterzeichnet vom Staatsanwalt, der allerdings eine von langer Hand geplante Wochenendreise zu seinen Eltern in der Bretagne angetreten hatte, und weil es damals noch keine Handys gab, war es nicht möglich, ihn gleich zu erreichen. Der Polizeipräsident erklärte darauf hin, dass er dringenden Geschäften in der Polizeistation von Bergerac nachkommen müsse, und verabschiedete sich. Inzwischen waren Bürgermeister Gérard Mangin und der Präfekt mit dem Stellvertreter des Polizeipräsidenten zusammengekommen, der von der Vollmacht des Staatsanwalts Kenntnis hatte und den beiden gegenüber einräumen musste, dass er in dieser Angelegenheit nichts weiter tun könne. Sein jüngster Mitarbeiter sei nun einmal mit den Ermittlungen betraut worden und lasse nichts unversucht, um den Mord aufzuklären.
»Sie hätten wenigstens darauf bestehen sollen, dass diese unappetitliche Maßnahme in irgendeinem entlegenen Winkel vorgenommen wird und nicht hier, mitten in der Stadt«, sagte der Bürgermeister mit ausdrucksloser Miene, die so sehr im Widerspruch zur Schärfe seines Protests stand, dass der stellvertretende Amtsleiter des Präsidiums verunsichert um eine Wiederholung des Gesagten bitten musste. Schließlich führte er die beiden bedeutenden Herren – der eine repräsentierte die Stadt Périgueux, der andere die Französische Republik – in den Innenhof, in den auch Jean-Jacques zurückgekehrt war, wo er, umweht von dichten Dampfschwaden, aber vom Gestank offenbar unbeeindruckt, erneut in seinem Topf rührte.
Mangin ging auf ihn zu und drehte den Gashahn des Campingkochers ab. Im selben Augenblick zog Jean-Jacques den mittlerweile kahlgekochten Schädel mit einer großen Zange aus dem Topf und schwenkte ihn seinen Besuchern entgegen, die nervös zurückwichen. Mit stolzer Miene verkündete er: »Na bitte, hab ich’s mir doch gedacht. Sehen Sie selbst, Messieurs. Er wurde erschlagen. Wegen der starken Verwesung haben wir es auf den ersten Blick nicht sehen können.«
Der Bürgermeister, der Präfekt und der stellvertretende Polizeipräsident musterten die Bruchstellen im rechten Schläfenbein des weiß schimmernden Schädels, als zwei Nachrichtenreporter mit gezückten Notizbüchern den Hof betraten.
»Wir suchen einen Täter, der Linkshänder ist«, fuhr Jean-Jacques fort, der schon als Junge den detektivischen Spürsinn von Sherlock Holmes bewundert und beschlossen hatte, selbst Polizist zu werden. »Wie man an den Rissen im Knochen sehen kann, stand er seinem Opfer gegenüber und hat von der linken Seite zugeschlagen.«
»Hätte man das nicht auf elegantere Weise herausfinden können, vielleicht mithilfe von Röntgenstrahlen?«, fragte der Präfekt.
»Durchaus, Monsieur«, antwortete der stellvertretende Amtsleiter. »Sie werden sich aber wohl daran erinnern, dass Sie unseren Vorschlag, das Polizeilabor zu modernisieren, aus Geldgründen abgelehnt haben.«
Jean-Jacques, der immer noch nur auf den Schädel und die Hinweise, die er verbergen mochte, konzentriert war, achtete nicht auf die Reporter, die sich eifrig Notizen machten. Der Bürgermeister aber hatte ein Gespür für heikle Angelegenheiten und erinnerte sich vage daran, dass er dem örtlichen Krankenhaus geraten hatte, Anfragen der Polizei, deren Röntgengeräte nutzen zu dürfen, zurückzuweisen mit der Begründung, dass die allgemeine Gesundheit Vorrang habe. Jetzt bedauerte er, von der Polizei eine Erklärung verlangt zu haben. Noch mehr bedauerte er, dass er dem Präfekten vorgeschlagen hatte, ihn zu begleiten. »Nun, hier gibt’s nichts mehr zu sehen«, sagte er. »Der Gestank wird sich bald verzogen haben. Bleibt nur noch, der Polizei zu ihrem Einfallsreichtum unter schwierigen Umständen zu gratulieren. Wir, mein lieber Amtsleiter, sollten uns jetzt lieber wieder an die frische Luft begeben und Ihren jungen unternehmungslustigen Mitarbeiter seine Pflicht tun lassen.«
An diesem Tag machte sich Jean-Jacques einen Namen, nicht nur in Presse und Öffentlichkeit, sondern auch und vor allem unter seinen Kollegen. Selbst der Polizeipräsident konnte ihm verzeihen, als der Präfekt seine frühere Entscheidung revidierte und die Finanzierung eines Labors auf dem neuesten Stand der Technik bewilligte, zu dem auch ein Röntgengerät gehören sollte. Aber davon hatte Jean-Jacques einstweilen nichts, und so machte er sich an die langwierige, letztlich erfolglose Arbeit, den Toten zu identifizieren. Immerhin ließ sich das städtische Krankenhaus dank der Intervention des Bürgermeisters dazu bewegen, sein Röntgengerät zur Verfügung zu stellen. Mit ihm konnte festgestellt werden, dass der Tote mehrere Jahre zuvor eine ungewöhnliche Doppelfraktur erlitten hatte. Jean-Jacques war zuversichtlich, über entsprechende Arztberichte die Identität des Toten ermitteln zu können. Das Corpus Delicti sollte als eines der berühmtesten in die Geschichte der Polizei des Périgord eingehen.
Die Rechtsmedizin datierte den Todeszeitpunkt auf rund zwölf Monate zurück. Während dieser Zeit war in ganz Frankreich kein junger Mann mit hellblonden Haaren als vermisst gemeldet worden. Jean-Jacques veranlasste, dass Interpol in anderen europäischen Ländern Nachforschungen anstellte. Er wandte sich an einschlägige Stellen in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, hatte aber auch damit keinen Erfolg. Als in Berlin die Mauer fiel und die Beziehungen zu den Ermittlungsbehörden in Russland und ganz Osteuropa besser wurden, weitete er seine Suche auf eben diese Gebiete aus. Über die französischen Botschaften nahm er Kontakt mit Ärztekammern und Gesundheitsministerien in ganz Europa auf, um einen Arzt oder eine Ärztin ausfindig zu machen, die sich daran erinnerte, eine ungewöhnliche Beinfraktur behandelt zu haben. Er beschäftigte sich nicht zuletzt auch mit dem T-Shirt des Toten und kam einer österreichischen Rockband auf die Spur, die über kurze Zeit recht erfolgreich gewesen war und in Deutschland und der Schweiz mehrere tausend T-Shirts verkauft hatte. Monate vergingen, schließlich Jahre, doch Jean-Jacques’ Arbeit, der er auch einen Großteil seiner Freizeit widmete, blieb vergebens.
Er hatte eine Leiche oder zumindest ein Skelett. Es gab ein Tötungsdelikt und die Tatwaffe – einen Klappspaten aus Beständen der US-Armee, wie er überall auf der Welt in Military Shops und auf Campingplätzen zu kaufen war. Was er nicht hatte, war den Namen des Toten, nur das Foto von Oscars Schädel, der als Memento mori beziehungsweise die Erinnerung an einen ungelösten Fall an seiner Bürotür hing.
Als nun Bruno die künstlerische Nachbildung des Neandertalergesichts betrachtete, das aus dem Originalschädel abgeleitet war, kam ihm eine erste Idee. Das Gesicht wirkte ganz und gar nicht primitiv. Es hätte einem auf der Straße begegnen können, hatte aber mit dem kräftigen Kiefer und den Knochenwülsten über den Augen einen durchaus primatenhaften Einschlag. Die Rekonstruktion schien deshalb so lebensecht zu sein, weil der Künstler nicht bloß ein Gesicht nachgeformt hatte, sondern aus dem prähistorischen Skelett von La Ferrassie den ganzen Körper. Der Mann saß und hatte den muskelbepackten Arm ausgestreckt, um einem Kind, das neben ihm hockte, etwas zu zeigen. Auch dessen Gesicht war einem Schädel nachempfunden worden. Auf Bruno wirkte die dargestellte Szene vollkommen überzeugend.
Auch vor der nächsten Schauvitrine blieb er stehen, beeindruckt vom Anblick einer jungen Frau mit trotzig oder vielleicht auch stolz erhobenem Kopf. Sie trug Felle und eine Perlenkette um den Hals. Ihre Augen waren auf eine Szene gerichtet, die sie, wie es schien, argwöhnisch machte. Sie hatte eine hohe Stirn, hohe Wangenknochen und volle Lippen. Vorlage für sie waren Skelettreste einer achtzehnjährigen Frau gewesen, die man im Abri Pataud gleich neben der Hauptstraße von Les Eyzies gefunden hatte, zusammen mit dem Skelett eines neugeborenen Kindes. Ihr Schädel hatte vier Meter entfernt davon gelegen, unter Steinen, die anscheinend absichtlich dort angehäuft worden waren. Sie war ein Cro-Magnon, also anatomisch schon ein moderner Mensch, und hatte vor etwa zwanzigtausend Jahren gelebt, fast zwanzigtausend Jahre nachdem ihr Volk die Neandertaler abgelöst hatte.
Bruno schüttelte den Kopf, verwundert über den Anblick dieser Frau, deren Gesicht ihn berührte. Ihre Züge verrieten eine lebhafte Intelligenz, ihre ganze Haltung sprach für Eigenständigkeit, und zu seiner eigenen Überraschung stellte er fest, dass die Frau attraktiv auf ihn wirkte. Er konnte sich durchaus vorstellen, sie in einer Menschenmenge oder hinter dem Fenster eines vorbeifahrenden Zuges oder auch am Tisch eines Straßencafés sitzen zu sehen. In seiner Fantasie tauschte er Blicke mit ihr und sprach sie an, vielleicht um sich mit ihr zu verabreden. Seine Gedanken spielten »Was-wäre-wenn«, ja, er konnte sich vorstellen, sich über Jahrtausende hinweg in sie zu verlieben.
Er trat nun vor eine Büste, deren Gesicht er schon kannte, wenn auch nicht in der hier gezeigten Aufmachung. Den rekonstruierten Kopf schmückte ein Scheitelkäppchen aus zahllosen kleinen Muscheln, die sorgfältig durchbohrt und zusammengenäht worden waren. Er hatte ihn schon an anderer Stelle gesehen, nämlich in der berühmten Felsgrotte von Cap Blanc, nur wenige Kilometer entfernt an der Straße Richtung Sarlat, wo urzeitliche Menschen ein gewaltiges Halbrelief von Pferden, Hirschen und Wisenten geschaffen hatten. Die Tiere waren so meisterhaft in den Felsen gemeißelt worden, dass man fast den Eindruck haben konnte, sie sprängen daraus hervor.
Im Jahr 1911 hatten Archäologen ein fast vollständiges menschliches Skelett unter den Hufen des Pferds in der Mitte des Wandreliefs gefunden. Füße und Kopf waren mit Steinen bedeckt. Anfangs nahm man an, es handele sich um männliche Überreste. Der Landbesitzer verkaufte schließlich 1926 das Skelett für eintausend Dollar an das Field Museum in Chicago. Henry Field, der das Skelett in New York in Empfang nahm und, in Baumwolltücher gewickelt, nach Chicago brachte, bemerkte anhand der Beckenknochen sofort, dass es sich um ein weibliches Individuum handeln musste. Es sorgte für so viel öffentliche Aufmerksamkeit, dass am ersten Ausstellungstag über zwanzigtausend Besucher ins Museum strömten, um das für die Vereinigten Staaten erste prähistorische Skelett zu bestaunen.
Fünf Jahre später, als sich schon über eine Million Menschen von dieser Attraktion hatten anlocken lassen, wurde das Skelett gründlich untersucht. Man stellte fest, dass es sich um die sterblichen Überreste einer etwa zwanzigjährigen, einen Meter sechsundfünfzig großen Frau handelte, die vor dreizehn- bis fünfzehntausend Jahren gelebt haben musste. Sie war mit einer circa acht Zentimeter langen Elfenbeinspitze begraben worden, die vielleicht von einem Wurfspeer oder einer Harpune stammte und auf ihrem Bauch gelegen oder im Leib gesteckt hatte. Manche spekulierten, dass die Frau mit dieser Waffe womöglich getötet worden war. Auch Henry Field propagierte die Vermutung einer Mordtat in der Urzeit, um die Besucherzahlen des Museums noch weiter in die Höhe zu treiben. Außerdem schloss er aus der Lage der Grabstätte unter dem Relief, dass die Frau zu den Bildhauern gehörte, die das einzigartige Meisterwerk geschaffen hatten.
Ihr rekonstruierter Kopf hatte Bruno, als er ihn im Cap Blanc das erste Mal sah, auf Anhieb begeistert, nicht nur weil die Frau mit ihren großen Augen, dem schlanken Hals und den hohen Wangenknochen ausgesprochen hübsch war, sondern auch wegen der Muschelkappe, die sie trug. Sie sah damit aus wie eine elegante Kaffeehausdame der 1920er Jahre. Bruno konnte sich gut vorstellen, sie Charleston tanzen zu sehen.
»Wie findest du die Ausstellung, Bruno? Du nimmst dir immerhin viel Zeit dafür«, fragte Clothilde Daumier, ein kleines, rothaariges Energiebündel, die eine der Kuratoren des Museums war und als Expertin der regionalen Frühgeschichte galt. Sie und ihr deutscher Ehemann, der Archäologe Horst Morgenstern, waren gute Freunde von Bruno, und er hatte jüngst auf ihrer Hochzeit als Trauzeuge fungiert. Clothilde kam auf ihn zu und umarmte ihn.
»Sie ist einfach fantastisch«, antwortete Bruno. »Danke, dass ich sie mir schon vor der Eröffnung anschauen durfte. Diese Rekonstruktionen sind umwerfend.«
»Das kannst du der Künstlerin selbst sagen«, entgegnete Clothilde und führte ihn auf eine attraktive, grauhaarige Frau zu, die ihnen mit anmutigen Bewegungen entgegenkam und ihm die Hand gab. Clothilde machte sie miteinander bekannt: »Elisabeth Daynès, das ist Bruno Courrèges, unser chef de police und ein guter Freund, der sich sehr für Archäologie interessiert. Er hat sogar schon einmal ein Skelett aus unserer Zeit in einem unserer prähistorischen Gräber gefunden.«
»Das waren Clothildes Fachleute«, entgegnete Bruno lächelnd. »Ich habe nur geholfen, es zu identifizieren. Kommen wir lieber auf Ihre Arbeit zu sprechen. Ich bin sehr beeindruckt, wie Sie diese frühen Menschen wieder haben auferstehen lassen. Sie sind eine große Künstlerin, Madame.«
»Sehr freundlich, Monsieur Bruno«, erwiderte Elisabeth. Sie sprach mit einer weichen, wohlklingenden Stimme und einem leichten Akzent des Midi. »Es ist mir immer ein Vergnügen, Freunde von Clothilde kennenzulernen. Woran haben Sie eigentlich erkannt, dass die Knochen, die Sie gefunden haben, nicht aus prähistorischer Zeit stammen?«
»Ganz einfach, am Handgelenk befand sich eine Swatch. Und von Clothilde weiß ich, dass es solche Uhren erst seit 1983 gibt. Apropos, haben Sie schon einmal der Polizei geholfen, das Gesicht eines nicht identifizierten Skeletts zu rekonstruieren?«
»Ja, ein wenig, aber nur informell. Eine solche Arbeit kostet viel Zeit und Mühe, und weil sie vor Gericht kaum Bestand hat und meist als Fantasieprodukt abgetan wird, zögert die Polizei verständlicherweise, solche Projekte zu finanzieren.«
»Wenn ich Ihre Werke hier sehe, Madame, kann ich kaum nachvollziehen, warum Gerichte eine solche Arbeit nicht zu würdigen wissen«, erwiderte Bruno.
»Für Sie einfach Elisabeth«, sagte sie, als Clothilde sie zur Rezeption führte, wo sie ihnen mit Wein gefüllte Gläser reichte und sich dann entschuldigte, weil sie andere Gäste begrüßen musste. »Ich verstehe die Vorbehalte der Gerichte. Wenn Zeugen andere Personen beschreiben, nennen sie für gewöhnlich Haarfarbe, Frisur, Augenfarbe und Gesichtsform. Aber all das kann man von einem Schädel nicht ablesen. Wir können nur den Konturen eines Schädels folgen – die übrigens deutlich individueller sind, als man gemeinhin annimmt –, um jeden der dreiundvierzig menschlichen Gesichtsmuskeln nachzubilden. Vielleicht gelingt uns eine Rekonstruktion der Umrisse eines Gesichts, aber daraus auf das Haar, die Augen oder die Züge zu schließen, ist kaum möglich.«
»Variiert die muskuläre Struktur eines Gesichts mit den kleinen Unterschieden in der Form jedes Schädels?«
»Genauso ist es«, antwortete sie und nickte entschieden. »Wir nutzen Lasermesstechnik und können damit einen Schädel mikromillimetergenau abtasten und die Daten in einen Computer eingeben, der ein dreidimensionales Modell erstellt. Ein 3D-Drucker liefert uns dann einen entsprechenden Kopf. Den vergleichen wir danach, wiederum mit Lasertechnik, mit einem originalen Abguss des Schädels, um zu prüfen, ob beides wirklich absolut identisch ist. Dieses Verfahren zu entwickeln hat ein ganzes Jahr gedauert. Jetzt funktioniert es fast von selbst.«
»Wozu die vom Computer ausgedruckte Version, wenn Sie doch schon einen Abguss des Schädels haben?«
»Weil wir die Möglichkeiten des Computers genutzt haben, an der Muskulatur zu arbeiten«, antwortete Elisabeth. »Übrigens können wir auch dank der Computer die von uns erzeugten Bilder mit Kollegen in der ganzen Welt teilen. Als wir das Gesicht von Tutanchamun rekonstruieren wollten, setzten wir uns mit den Kollegen von National Geographic in Washington und dem Museum in Kairo in Verbindung.«
»Wenn Sie die Haarfarbe eines jungen Mannes kennen und wüssten, dass er in seinen Zwanzigern war und eine sportliche Figur hatte – könnten Sie ihn dann ziemlich genau abbilden?«
»Gewiss, Bruno. Ich schätze, Sie haben ein bestimmtes Skelett im Sinn und hoffen auf meine Hilfe. Leider muss ich Ihnen sagen, dass ich ungemein viel zu tun habe. Vielleicht wissen Sie bereits von Clothilde, dass wir vorhaben, die gesamte Familie der Hominiden aus frühester Zeit nachzubilden: den Australopithecus, Homo habilis, Homo ergaster, Homo floresiensis und natürlich den Neandertaler und Homo sapiens. Das wird jede Menge Zeit in Anspruch nehmen.«
»Verstehe. Aber vielleicht könnten Sie mir jemand anderen, einen Kollegen oder Schüler, empfehlen, der sich auf so etwas versteht.«
»Ich selbst habe am meisten von Jean-Noël Vignal gelernt, der am Forensischen Institut in Paris arbeitet. Der könnte Ihnen vielleicht helfen. Aber erzählen Sie mir doch Näheres von Ihrem Leichenfund.«
Bruno begann, die Geschichte von Jean-Jacques und Oscar kurz zusammenzufassen, wurde aber nach wenigen Sätzen von ihr unterbrochen.
»Sie sagen zwischen 1988 und 1989? Zu der Zeit war ich hier im Périgord«, erzählte sie aufgeregt. »Ich hatte in Le Thot zu tun, im Park, der der Höhle von Lascaux angeschlossen ist. Es ging um die Rekonstruktion eines Mammuts und einer Gruppe von urzeitlichen Jägern. Das waren meine ersten Arbeiten dieser Art. Eigentlich war ich Kostüm- und Maskenbildnerin am Schauspielhaus von Lille. Später bin ich dann nach Tautavel in den Pyrenäen gegangen, wo ich für das dortige prähistorische Museum steinzeitliche Modelle erstellen konnte. Seitdem habe ich eine persönliche Beziehung zu dieser Region. Zu der Zeit muss dieser junge Mann gestorben sein. Geben Sie mir Ihre Karte. Ich werde mit Kollegen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Jetzt muss ich aber wieder an die Arbeit. Danke für Ihr Interesse und Ihre freundlichen Worte.«
Sie tauschten Visitenkarten aus, nachdem sie ihre Mobilfunknummer auf ihre geschrieben hatte.
»Au revoir, Elisabeth, vielen Dank für diese Ausstellung und Ihre Hilfe.«
2
Bruno dachte nicht mehr an den Fall, bis er von Elisabeth hörte, dass sie eine mögliche Kandidatin für die Rekonstruktion aufgetrieben hatte, eine junge Design-Studentin aus Paris, die nach einem Projekt suchte, das sich für ihre Abschlussarbeit eignete. Ihr Name war Virginie. Ihre Mutter war Spanierin, ihr Vater Franzose. Sie war in Madrid und Toulon aufgewachsen und hatte in der vorlesungsfreien Zeit im letzten Sommer ein Praktikum in Elisabeths Atelier absolviert.
»Virginie ist gut. Sie hat sich meine Techniken angeeignet und arbeitet sehr genau«, erklärte Elisabeth. »Wenn sie weitere Fortschritte macht, werde ich ihr nach ihrem Abschluss eine Anstellung anbieten. Sie erhält noch ein Stipendium, bräuchte aber einen Zuschuss zur Miete, es sei denn, Sie können ihr eine günstige Unterkunft vermitteln. Außerdem braucht sie eine Werkstatt. Und nebenbei bemerkt, lassen Sie sich nicht von ihren Tattoos und Piercings irritieren. Sie ist wirklich gut.«
»Ach. Von ein paar Piercings lässt man sich hier in Saint-Denis nicht schocken. Was Sie sagen, klingt großartig, danke, Elisabeth. Ich werde mit Jean-Jacques reden und mich wieder bei Ihnen melden.«
Gleich nach dem Telefonat rief er Jean-Jacques an, um ihn zum Abendessen einzuladen. Vorher, sagte er, würde er mit ihm gern das Museum in Les Eyzies besuchen.
»Übrigens, hast du immer noch Zugriff auf Oscars Schädel?«, fragte Bruno, dem Jean-Jacques vor einiger Zeit endlich das Du angeboten hatte.
»Er hat einen Ehrenplatz in unserer Asservatenkammer. Warum?«
»Das erkläre ich dir später. Noch eine Frage: Verfügst du immer noch über ein Budget für ungelöste Altfälle?«
»Natürlich. Es ist Teil der Ausbildungsmittel. Wir betrauen Auszubildende mit ungelösten Fällen und schauen, wie sie damit zurechtkommen. Worauf willst du hinaus, Bruno?«
»Das erfährst du, wenn wir am Tisch sitzen. Ich glaube, es wird dir gefallen.«
Ehe er loszog, um sich mit Jean-Jacques vor dem Museum zu treffen, bereitete Bruno eine einfache Mahlzeit vor. Er würde den gebeizten Lachs aufschneiden, den er vor drei Tagen eingelegt hatte, und zwar in einer Marinade aus Salz, Dill, Pfefferkörnern, gestoßenen Wacholderbeeren und Zitronenzesten und einem Gläschen eau de vie. Als Soße rührte er Dijon-Senf, Apfelessig, Honig und Sonnenblumenöl an. Das Wildragout als Hauptgericht war schon fertig und brauchte nur noch aufgewärmt zu werden. Zum Nachtisch sollte es Apfelkuchen mit Eiscreme geben.
Von Fabiola, der Klinikärztin, wusste er, dass sie am Abend Bereitschaftsdienst hatte, also lud er nur ihren Partner Gilles ein, einen Journalisten, der bestimmt interessiert aufhorchen würde, wenn er hörte, dass die Ermittlungen im Fall Oscar wiederaufgenommen würden. Außerdem bat er den Bürgermeister von Saint-Denis dazu, dessen politische Expertise nützlich sein könnte, falls Jean-Jacques in seinem fast obsessiven Ehrgeiz bei der Klärung dieses Falles behördlicherseits auf Widerstand träfe. Die kleine Gruppe versammelte sich vor dem Museum, kurz bevor es geschlossen wurde, und alle waren erleichtert, der brutalen Julihitze, die dem Südwesten Frankreichs seit einer Woche zusetzte, in klimatisierte Räume zu entkommen. Clothilde führte sie durch Elisabeth Daynès’ Ausstellung, während Bruno nacherzählte, was er aus seinem Gespräch mit ihr gelernt hatte.
»Normalerweise würde ein solches Vorhaben ein Vermögen kosten, aber Elisabeth kennt eine junge Studentin, die darauf brennt, Oscars Gesicht im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zu rekonstruieren«, erklärte er. »Sie ist bestimmt sehr tüchtig.«
»Glaubst du ernsthaft, dass es möglich ist, ein Abbild von Oscars Kopf zu schaffen, das ihm ähnlich genug ist, um ihn endlich identifizieren zu können?«, fragte Jean-Jacques. »Angenommen, du hast recht, wie können wir erreichen, dass es viele Leute sehen?«
»Über die Medien natürlich«, antwortete Gilles. »Die Story ist gut und liefert Bilder, wie geschaffen für Fernsehen und Social Media. Wir haben einen Schädel, das rekonstruierte Gesicht und einen lange zurückliegenden Mordfall. Ich bin sicher, mein alter Chef bei Paris Match würde zwei volle Seiten dafür frei machen, die Sud Ouest ebenfalls, und ich kann mir sehr gut entsprechende Beiträge in Fernsehmagazinen vorstellen. Schräg – ein wunderbarer Schlussbeitrag für eine Nachrichtensendung.« Gilles richtete sich auf, machte ein gespielt ernstes Gesicht und nahm den halb sonoren, halb leutseligen Tonfall eines Nachrichtensprechers an. »Und nun noch ein Blick ins Périgord, wo Archäologen in einem Ermittlungsverfahren helfen, das ein über dreißig Jahre zurückliegendes Tötungsdelikt aufzuklären versucht, was bislang nicht gelungen ist.«
»Alles schön und gut, aber wie soll ich das denjenigen schmackhaft machen, die das Ganze zu bezahlen haben?«, wandte Jean-Jacques ein, der immer wieder seinen Blick auf die rekonstruierten Frauengesichter in der Schauvitrine richtete und erkennen ließ, wie sehr er davon beeindruckt war. »Wie dem auch sei, ich würde es einfach gern ausprobieren. Niemand wird bestreiten, dass diese Gesichter hier verblüffend lebensecht wirken.«
»Die Sache kostet euch nichts«, sagte der Bürgermeister. »Wenn ich richtig verstanden habe, will die Künstlerin kein Geld für ihre Arbeit, allenfalls einen kleinen Mietkostenbeitrag. Ich werde mit meinem Amtskollegen in Périgueux reden und bin mir sicher, dass wir für sie ein Bett im Studentenwohnheim finden. Und in eurem Polizeilabor wird doch bestimmt genug Platz für sie zum Arbeiten sein, oder? Da die Mordtat in Saint-Denis stattgefunden hat, werden wir aus unserem bescheidenen Fonds für Fremdenverkehrswerbung eine kleine Summe abzweigen und in die Rekonstruktion des Kopfes stecken können, für den sich nicht zuletzt auch unsere Touristen interessieren werden. Gilles hat recht, dieser Fall wird Aufmerksamkeit erregen.«
Sie hatten die Ausstellungsrunde abgeschlossen und blieben ein letztes Mal vor der Vitrine stehen, in der der lebensgroße Neandertaler mit dem Kind zu sehen war, daneben ein junger Cro-Magnon-Mensch, der mit erhobenem Speer zum Wurf ausholte.
»Interessant«, bemerkte Jean-Jacques, »diese Männer mit ihren zotteligen Bärten sehen irgendwie sehr viel weniger modern aus als die Frauen.«
»Ja, ich weiß, was du meinst, aber stell dir vor, du müsstest dich mit einem Feuerstein rasieren«, erwiderte Bruno.
»Ihr überseht was«, sagte Gilles merklich angeregt. »Schaut euch den Neandertaler an, der dieses Fell lose über die Schulter geworfen hat. Und dann richtet euren Blick auf den Cro-Magnon-Kollegen mit dem Speer aus einer viele tausend Jahre jüngeren Zeit. Er trägt geschneiderte Kleider aus Tierhäuten. Daran habe ich noch nie gedacht, aber diese Cro-Magnons müssen die Nähnadel erfunden haben, das heißt, sie konnten Kleidungsstücke herstellen, die sehr viel besser geeignet waren, das Überleben in Kälteperioden und Eiszeiten zu sichern. Vielleicht haben sie deshalb die Neandertaler abgelöst.«
Später, in Brunos Wohnzimmer, in dem dank der dicken Außenmauern erträgliche Temperaturen herrschten, startete man mit einem Aperitif in den Abend. Der Bürgermeister wandte sich an Jean-Jacques und fragte, ob er damals nicht daran gedacht habe, Oscar mithilfe einer DNA-Analyse zu identifizieren.
Jean-Jacques schüttelte den Kopf. »Das Verfahren war damals noch zu neu und unausgereift, viel zu teuer und unzuverlässig. Erst 1984 konnte der britische Forscher Alec Jeffreys nachweisen, dass jeder Mensch eine einzigartige DNA-Struktur in sich trägt«, erklärte er. »Er entdeckte damit den genetischen Fingerabdruck.« Die Polizei habe sich erst auf den neuesten Stand der Wissenschaft bringen müssen, aber es habe sich schnell ein Strafverteidiger gefunden, der das Potenzial dieser neuen Entwicklung erkannt und in einem Wiederaufnahmeverfahren vor Gericht genutzt habe. Er konnte nachweisen, dass seinen Mandanten, der wegen sexuellen Missbrauchs und des Mordes an zwei Mädchen verurteilt worden war, in Wirklichkeit keine Schuld traf. Wenig später wurde der wirkliche Täter überführt, und zwar anhand einer DNA-Analyse. Der Fall machte Schlagzeilen, und schon ein Jahr später wurde das Verfahren erstmals auch in Florida angewendet, wo es ebenfalls um einen Vergewaltigungsfall ging. Frankreich ließ sich mit der neuen Methode Zeit, nahm sich aber vor, bis spätestens 1996 eine nationale DNA-Datenbank anzulegen. Anfangs wurde das Verfahren nur bei mutmaßlichen Sexualstraftätern angewandt, erst nach den Terroranschlägen vom 11. September ging man dazu über, auch andere schwere Verbrechen damit aufzuklären.
»Heute umfasst unsere nationale Datenbank nicht mehr als fünf Millionen Personen«, berichtete Jean-Jacques. »In Großbritannien und den USA sind es jeweils über zwanzig Millionen. Immerhin waren es Wissenschaftler der französischen Polizei, die die Grenzen dieser Methode aufzeigten. Es gab da einen Fall, in dem eine DNA-Spur mit mehreren Tötungsdelikten in Österreich, Deutschland und Frankreich in Verbindung gebracht wurde. Die französischen Ermittler stellten fest, dass die DNA einer Frau zuzuordnen war, die in einer Fabrik arbeitete, die Wattestäbchen für DNA-Abstriche im Mundraum herstellte. Der Täter wurde schließlich gefasst, es war ein Mann. Es kann aber trotz einer solchen Panne wohl kaum ein Zweifel daran bestehen, dass die Entdeckung des genetischen Fingerabdrucks die Arbeit der Polizei revolutioniert hat.«
Für Bruno war das kurze Schweigen, das sich einstellte, eine günstige Gelegenheit, die Gäste an den Tisch zu bitten. Er servierte den selbst gebeizten Lachs und fragte, inwiefern Oscars DNA heute von Nutzen sein könne.
»Ich habe darüber nachgedacht«, antwortete Jean-Jacques, »und werde sie erst einmal mit der nationalen Datenbank abgleichen lassen. Die ist zwar noch weit davon entfernt, wirklich umfangreich zu sein, aber immerhin. Außerdem werde ich gleich über Interpol eine europaweite Suche einleiten. Auch unser eigenes Labor sollte sich eine Probe des Schädels vornehmen und die DNA sequenzieren.«
»Wird Jacqueline nicht bald zurück sein?«, fragte Gilles den Bürgermeister. Die halb französische, halb amerikanische Historikerin lehrte ein Semester an der Sorbonne, das andere an der Columbia University in New York. Den Rest des Jahres verbrachte sie in Saint-Denis. Sie hatte einen renovierten Bauernhof gemietet und lebte dort mit Mangin, mit dem sie eine wechselseitig so wohltuende Beziehung pflegte, dass beide um Jahre verjüngt wirkten.
»Ich erwarte sie am Freitag«, antwortete der Bürgermeister. »Zurzeit nimmt sie noch an einem Symposium am Cold War History Research Project in Washington teil. Es geht um ein Thema, mit dem sie sich in ihrem nächsten Buch beschäftigt, um irgendwelche Stasi-Dokumente aus der früheren DDR. Sie hat mir eine Mail geschickt und gesagt, dass auch Jack Crimson an diesem Symposium teilnimmt. Offenbar sitzt er in einem britischen Komitee, das mit darüber entscheidet, welche amtlichen Dokumente für die Öffentlichkeit freigegeben werden und welche nicht.«
»Dann wird Jack auch bald zurück sein?«, fragte Bruno. Er schätzte den ehemaligen britischen Diplomaten und Geheimdienstoffizier, dessen Tochter Miranda zusammen mit Brunos verflossener Liebe, aber immer noch engen Freundin Pamela einen in der Nähe gelegenen Reiterhof managte. Seit Neuestem boten sie auch Kochkurse an, damit Pamelas gîtes auch in den Wintermonaten belegt werden konnten, wenn es nur wenige Touristen gab. Bruno und andere Freunde hatten sich als Sous-Chefs der regionalen Küche einspannen lassen.
»Nein, Jacqueline sagt, dass Jack nach London zurückfliegt und dort an der Sitzung eines weiteren Komitees teilnehmen will. Wahrscheinlich geht es um Themen, die mit dem Symposium in Washington zusammenhängen«, antwortete der Bürgermeister. »Er wird aber nächste Woche wieder hier sein.« Man kam kurz auf Sport, dann auf Politik und nicht zuletzt auf das servierte Wildragout zu sprechen, bis sich Brunos Telefon meldete. Er kannte die Nummer im Display nicht, nahm den Anruf aber trotzdem an. Er wunderte sich, die Stimme Alains zu hören, der als sein Cousin sein nächster Angehöriger war und bei der Armée de l’Air diente.
»Schlechte Nachrichten, Bruno«, sagte er. »Es geht um maman. Sie hatte einen Schlaganfall und liegt jetzt im Krankenhaus in Bergerac, dem an der Avenue Calmette. Es muss vergangene Nacht passiert sein. Ich weiß es von meiner großen Schwester. Ich werde ein paar Tage Urlaub beantragen und sie besuchen. Es heißt, sie ist geistig klar, kann aber nicht sprechen.«
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte Bruno. »Wann kannst du im Krankenhaus sein?«
»Ich gehe davon aus, dass mein Antrag bewilligt wird und ich schon morgen früh losfahren kann. Gegen vier werde ich dann wohl in Bergerac sein. Ich kann ein, zwei Tage bei Annette unterkommen. Sehen wir uns?«
»Ich versuche mich hier loszumachen und kurz nach vier im Krankenhaus zu sein«, antwortete Bruno. »Vielleicht können wir anschließend noch ein Glas Wein miteinander trinken und uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Wir haben lange nichts voneinander gehört.«
»Stimmt. Dann bis morgen.«
Brunos Stimmung kippte. Er dachte an seine Tante und die übervolle Wohnung in einem düsteren Sozialbau, wo er seine Kindheit verbracht und mit fünf weiteren Kindern ein Schlafzimmer geteilt hatte, darunter auch Annette, die Älteste. Sie und die anderen sah er inzwischen nur noch, wenn er seiner Tante an ihrem Geburtstag und zu Weihnachten einen Pflichtbesuch abstattete, immer mit einer Flasche seines selbst gemachten vin de noix als Mitbringsel. Annette und ihr Bruder Bernard lebten in Bergerac, auch sie in einer Sozialwohnung. Die anderen drei Geschwister waren weggezogen und hatten bis auf Alain den Kontakt zu Bruno verloren. Annette arbeitete in der Küche des Seniorenheims, in dem ihre Mutter untergebracht war. Bernard war seit Jahren arbeitslos. Er behauptete, wegen einer Rückengeschichte erwerbsunfähig zu sein, was ihn aber nicht hinderte, gelegentlich schwarz als Maler und Dekorateur zu arbeiten.
Alain war Unteroffizier auf dem Luftwaffenstützpunkt Mont-de-Marsan südlich von Bordeaux, bekannt für die beiden dort stationierten Geschwader von Abfangjägern des Typs Dassault Rafale, des modernsten französischen Kampfflugzeugs. Als jüngstes der fünf Geschwister war Alain nur etwas über ein Jahr älter als Bruno, der im Alter von sechs Jahren von seiner Tante aus dem kirchlichen Waisenhaus zu sich geholt worden war. Es war kein glückliches Zuhause gewesen, und Bruno hatte lange Zeit den Verdacht gehegt, dass der Grund für seine Aufnahme das durchaus gut bemessene Pflegegeld war, das seine Tante für ihre famille nombreuse zu einer Zeit bezog, als der französische Staat an einem Zuwachs seiner Bevölkerungszahl interessiert war. Im Waisenhaus hatte er, wie er sich erinnerte, sehr viel besser gegessen.
»Sie sehen aus, als hätten Sie schlechte Nachrichten erhalten«, bemerkte Bürgermeister Mangin, als Bruno an den Tisch zurückkehrte und den Apfelkuchen samt Eiscreme servierte. Er berichtete, was er gerade erfahren hatte, was mitfühlend mit Kopfnicken quittiert wurde.
»Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals jemand aus Ihrer Familie nach Saint-Denis zu Besuch gekommen wäre«, sagte Mangin.
»In der Anfangszeit war meine Tante mal für ein Wochenende bei mir. Sie hat allerdings deutlich gemacht, dass es ihr nicht gefiel. Es störte sie zum Beispiel, vom Hahn geweckt zu werden. Andererseits war es ihr zu still, ihr fehlte der Straßenlärm der Stadt«, erwiderte Bruno mit einem kleinen Lächeln und dem gemischten Gefühl aus Zuneigung und Bedauern. »Sie hat nie ein Buch zur Hand genommen und fand es schrecklich, dass ich keinen Fernseher hatte«, fuhr er fort. »Immerhin gefielen ihr das Dordogne-Tal und die Burgen, aber eine Höhle wollte sie nicht besuchen, wegen ihrer Klaustrophobie.«
»Und Ihre Cousins und Cousinen?«
»Wir haben kaum Kontakt miteinander. Alain, der Jüngste, ist ungefähr in meinem Alter. Wir haben uns immer gut verstanden. Er hat mich mal besucht, als ich in einem Seniorenteam gegen eine Auswahl von Jugendlichen Rugby gespielt habe. Es hat ihm gefallen, und er spielt mit dem Gedanken, in ein paar Jahren, wenn er aus dem Militärdienst entlassen wird, hierherzuziehen.«
»Ich habe, als ich Senator war, an einem Programm mitgearbeitet. Es sieht vor, dass lang gediente Veteranen für das Lehramt umgeschult werden«, sagte der Bürgermeister. »Vielleicht wäre es was für ihn. Wir sind hier auf dem Land immer knapp an Lehrkräften, insbesondere an männlichen.«
»Ich werde ihn darauf ansprechen, wenn ich ihn im Krankenhaus sehe«, versprach Bruno. »Allerdings weiß ich, dass er sich gern als Unternehmer engagieren würde. Er ist als Radartechniker und Elektriker ausgebildet worden und schult jetzt andere an Luftabwehrsystemen, weiß also mit Computern umzugehen.«
»Ist er verheiratet?«, fragte Gilles.
»Noch nicht. Ihm geht’s wie mir, er findet nicht die passende Frau.«
»Finden tust du sie schon, Bruno«, grinste Gilles. »Aber du schaffst es nicht, sie vor den Traualtar zu schleifen. Liegt offenbar in der Familie.«
3
Bruno stellte sich auf ein deprimierendes Zusammentreffen ein, als er am nächsten Tag vor dem Krankenhaus ankam. Sein alter Land Rover war ohne Klimaanlage, und so hatte er sich während der vierzig Minuten von Saint-Denis hierher trotz heruntergekurbelter Fenster wie in einer Sauna gefühlt. Im Radio waren Waldbrände in der Provence gemeldet worden. Auf dem asphaltierten Parkplatz schlug ihm eine fast unerträgliche Hitze entgegen, und sein Hemd war völlig durchgeschwitzt, als er den Eingang zum Krankenhaus erreichte.
Obwohl er sich freute, Alain wiederzusehen, bedrückten ihn die Erinnerungen an seine Kindheit. Er war im vielköpfigen Haushalt seiner Tante das am wenigsten beachtete Mitglied gewesen, von dem man dennoch Dankbarkeit erwartete. Aber es hatte durchaus auch glückliche Momente gegeben, zum Beispiel, wenn er mit anderen Kindern auf der Straße Fußball spielte oder es zu Geburtstagen Kuchen gab. Gut tat ihm auch die wachsende Freundschaft mit Alain. In der Erinnerung überwogen jedoch die schlimmen Zeiten. Bernard, der sieben Jahre älter und ein echter Mistkerl gewesen war, wurde in aller Regelmäßigkeit handgreiflich und beleidigte Brunos tote Mutter als Hure.
Im Krankenhaus lag seine Tante auf einer kleinen Station mit acht Patienten, alle in fortgeschrittenem Alter. Es roch nach Desinfektions- und Putzmitteln und einer Spur von Urin. Sie war die Einzige, die Besuch hatte. Alain saß an ihrem Bett. Bruno gab ihr einen Kuss auf beide Wangen und reichte ihr die mitgebrachten Blumen, wofür sie sich mit schwachem, unverständlichem Gemurmel bedankte. Er umarmte Alain, setzte sich auf den freien Stuhl auf der anderen Seite des Betts und sagte, dass er sich freue, seine Tante in einem besseren Zustand anzutreffen als befürchtet. Sie stammelte wieder etwas und bewegte die Finger einer Hand, was Bruno als Geste der Frustration deutete, nämlich darüber, nicht sprechen zu können. Ihr Gesicht war wie zweigeteilt, die eine Seite, wie er sie kannte, die andere wirkte wie aus geschmolzenem Kerzenwachs. Der linke Rand des Mundes und das linke Auge waren abgesackt und mit ihnen, wie es schien, die ganze Haut.
Bruno fragte sich, wie ihm eigentlich zumute war. Seine Zuneigung hielt sich in Grenzen. In seiner Erinnerung war die Tante entweder müde oder wütend und immer bereit, mit dem Kochlöffel, einer Haarbürste oder was immer ihr in die Hände fallen mochte zuzuschlagen. Bruno konnte sich nicht erinnern, dass sie ihn je in den Arm genommen hätte. Dennoch glaubte er weiterhin, ihr dankbar sein zu müssen. Schließlich hatte sie ihn aus dem Waisenhaus zu sich genommen.
Bruno versuchte, die unschönen Gedanken abzustreifen und mit Alain ein paar Worte zu wechseln, in die er sie anfangs miteinbezog. Er ließ sich von seinem Cousin Neues aus der Familie berichten, kam auf die Pflege im Krankenhaus zu sprechen und pries die Freundlichkeit der Schwestern. Dass sie sich an dem Gespräch nicht beteiligen konnte, verstimmte die Kranke aber merklich so sehr, dass sie schwiegen. Bruno hielt ihre linke Hand. Sie war kalt und wirkte fast leblos. Es dauerte nicht lange, und sie schlief ein. Sie schnarchte leise.
»Schön, dich zu sehen, Bruno, trotz der traurigen Umstände. Wir haben viel zu lange nichts voneinander gehört«, sagte Alain. »Danke, dass du gekommen bist.«
»Auch ich freue mich, dich wiederzusehen«, erwiderte Bruno. »Für dein fortgeschrittenes Alter siehst du wirklich nicht übel aus.«
»Ich bin nur achtzehn Monate älter und entsprechend weiser, Bruno.«
Bruno lachte. Die Begegnung freute ihn tatsächlich. Auch wenn Alain ein Fußballfan war und er selbst auf Rugby flog, war ihm doch klar, dass sie viel miteinander gemein hatten. Sie sahen in etwa gleichaltrig aus, hatten noch volles Kopfhaar und wirkten beide gepflegt und fit. Bruno war der dunklere Typ und vier oder fünf Zentimeter größer. Alain war schwerer, fast ein bisschen gedrungen, doch fand Bruno, dass es durchaus eine Familienähnlichkeit zwischen ihnen gab.
»Hast du immer noch vor, ins Zivilleben zurückzukehren, in – wie lang ist’s noch hin? – zwei, drei Jahren?«
»Weniger als zwei. Ja, das ist mein Plan, obwohl ich mich dann völlig neu einkleiden muss«, antwortete Alain. »Abgesehen davon wird sich jede Menge für mich ändern, zumal ich nicht allein Abschied nehme.«
»Du hast jemanden kennengelernt?«, fragte Bruno neugierig.
»Ja, auf dem Stützpunkt, eine maréchal des logis namens Rosalie Lamartine«, antwortete Alain, und seine Augen leuchteten auf. »Sie wird zwanzig Jahre auf dem Buckel haben, nur fünf weniger als ich, wenn ich ausscheide, und hat damit Anspruch auf eine ordentliche Pension. Wir hatten es anfangs nicht ganz leicht. Vielleicht weißt du, dass eine Liaison zwischen verschiedenen Rängen bei uns nicht gern gesehen wird. Trotzdem sind wir an den Wochenenden zusammen, und wir hatten vor Weihnachten einen wunderschönen zweiwöchigen Urlaub im Senegal. Da ist uns klar geworden, dass wir gut zusammenpassen.«
»Freut mich für dich, Alain. Das sind wirklich gute Nachrichten. Vielleicht sollte ich schon mal für ein Hochzeitsgeschenk sparen.« Bruno gab seinem Cousin einen kleinen Knuff auf den Oberarm, und beide lachten. »Werdet ihr gleich nach eurer Ausmusterung heiraten?«
Alain nickte. »Vielleicht schon vorher, sofern Rosalie die erhoffte Beförderung erhält. Dann hätten wir denselben Rang und Anspruch auf Unterbringung im Quartier für Verheiratete. Sie ist noch jung genug, um Kinder zu bekommen, was wir uns beide wünschen. Sie ist eine tolle Frau, gutmütig und humorvoll. Ich glaube, sie wird dir gefallen.«
Er zog sein Handy aus der Tasche, öffnete die Galerie und zeigte Bruno stolz eines seiner Lieblingsfotos von ihr. Sonnengebräunt in einem etwas rötlicheren als bronzenen Ton, trug sie auf dem Foto einen hellblauen Bikini, der nur einen Bruchteil ihrer Kurven verbarg. Sie lächelte in die Kamera und hielt ein Stück Wassermelone in die Höhe. Bruno betrachtete das dunkle Haar, die lachenden braunen Augen, die ausgeprägten Wangenknochen und vollen Lippen und nickte anerkennend. Sie war eine attraktive Frau.
»Hast du ein Glück«, sagte er. »Sie ist ausgesprochen hübsch. Le bon Dieu hat dir ein großes Geschenk gemacht.«
»Ja, sie ist wundervoll und kommt, wie du dir denken kannst, gut an bei der Truppe.« Alains Augen leuchteten regelrecht, als er ein weiteres Foto aufs Display wischte. »Hier ist sie in Uniform. Steht ihr gut, nicht wahr?«
Er rief noch ein Foto auf. Es zeigte Rosalie in einer Tarnausrüstung, den Blick auf das Sturmgewehr gerichtet, das sie von der Schulter nahm. Ihre Haare waren unter einem Barett zusammengefasst und nur im Nacken zu sehen. Auf einem weiteren Foto plauderte sie, wiederum in Uniform, mit einigen Soldaten. Ihre Miene wirkte streng, aber nicht unfreundlich.
»Bring sie doch für ein Wochenende mit nach Saint-Denis, damit ich sie kennenlerne«, sagte Bruno. »Ich überlasse euch die Honeymoon-Suite, das heißt das ganze obere Stockwerk, und halte meinen Basset davon ab, dass er morgens hochkommt und euch weckt. Dass der Hahn womöglich kräht, müsstet ihr euch gefallen lassen. Dafür kann ich nichts.«
Alain lachte. »Das wird nicht schlimmer sein als der Weckruf eines Signalhorns. Es würde mich freuen zu sehen, wie du lebst, und ich bin gespannt auf deine Kochkünste. Ich habe ihr viel von dir erzählt. Wir haben ein paar Artikel der Sud Ouest über einige der Fälle gelesen, die du gelöst hast. Rosalie war beeindruckt und findet es toll, einen so hübschen Cousin zu bekommen.«
Bruno grinste. »Hast du immer noch vor, nach deiner Entlassung als Elektriker Geld zu verdienen?«
»Vielleicht, ich weiß noch nicht. Rosalie interessiert sich für ein neues Programm, das ihr die Möglichkeit verschafft, sich im letzten Dienstjahr für den Lehrberuf zu qualifizieren, bei voller Soldfortzahlung.« Bruno erinnerte sich, dass der Bürgermeister genau das erwähnt hatte. »Wir könnten dann in etwas über einem Jahr ins Zivilleben zurückkehren. Am liebsten würde sie an einer Berufsschule arbeiten. Das käme auch für mich in Betracht. Wir hätten zwei volle Gehälter und die Aussicht auf zwei Renten. Wir dachten daran, uns in der Nähe von Bergerac niederzulassen, wenn möglich im Weinanbaugebiet rund um Pomport.«
»Klingt, als hättet ihr schon alles in trockenen Tüchern«, sagte Bruno und verspürte einen Anflug von Neid. Andererseits mochte Alains Glück ja auch Hoffnung für ihn bedeuten.
»Was ist mit dir?«, fragte Alain. »Gibt’s eine Frau in deinem Leben oder hängst du immer noch der Polizistin aus Paris nach? Wie war noch ihr Name? Isabelle, nicht wahr?«
»Wir sehen uns von Zeit zu Zeit, und jedes Mal, wenn wir zusammen sind, komme ich mir vor wie ein verliebter Teenager. Uns beiden ist aber klar, dass daraus nichts Festes werden kann. Sie liebt ihre Arbeit über alles.«
»Vielleicht verguckt sich auf unserer Hochzeit eine der Brautjungfern in dich. Ich hoffe sehr, du wirst unser Trauzeuge sein und eine Rede halten.«
Bruno suchte noch nach einer passenden Antwort, als eine Lernschwester auf sie zukam und sagte, dass die behandelnde Ärztin jetzt Zeit für sie habe. Sie führte die beiden in ein Büro am Ende des Flurs.
»Sind Sie die nächsten Angehörigen?«, fragte eine mittelalte Frau mit Stethoskop um den Hals, als sie eingetreten waren. Sie hatte Ringe unter den Augen und sah erschöpft aus, stand aber schwungvoll von ihrem Schreibtischsessel auf und lächelte.
»Ich bin ihr Sohn, und das ist mein Cousin, ihr Neffe«, antwortete Alain. »Wir stehen aber eher wie Brüder zueinander.«
Bruno war von Alains Worten auf sonderbare Weise bewegt. Er hatte sich nie als sein Bruder empfunden, dabei hätten sie durchaus Brüder sein können: Er und Alain waren vom selben Schlag, Alain bei den Luftstreitkräften und er, Bruno, als ehemaliger Soldat nun bei der Polizei. Beide hatten sie eine chaotische Kindheit verlebt, aus der sie mit militärischer Strenge und Routine herausgewachsen waren. Bruno betrachtete Alain von der Seite, während der sich anhörte, was ihm die Ärztin zu sagen hatte.
»Mein Name ist Dumourriez. Ich behandle Ihre Mutter, die gestern Morgen bei uns eingeliefert wurde. Leider habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Ihre Mutter wurde heute Morgen einer MRT unterzogen, und die Ergebnisse sind nicht ermutigend. Sie hatte zwei schwere Schlaganfälle, und wir haben Hinweise auf ernste Gehirnschädigungen. Ich fürchte, Ihre Mutter wird nicht mehr richtig sprechen können. Auch ihr Herz ist in keinem guten Zustand, sie war schon vor den Schlaganfällen alles andere als gesund. Es bleibt uns wohl nicht viel mehr übrig, als ihr die Zeit, die sie noch hat, erträglich zu machen.«
Sie legte eine Pause ein, nahm einen Ordner zur Hand, der auf dem Schreibtisch lag, und öffnete ihn auf einer Seite, die Bruno als den Ausdruck des MRT-Resultats erkannte.
»Ihre Mutter wird mit Sicherheit nicht ins Seniorenheim zurückkehren können. Dort fehlen geeignete Gerätschaften, um sie am Leben zu halten. Wir können sie aber auch nicht länger hierbehalten. Das heißt, sie müsste auf eine geriatrische Station verlegt werden oder, wenn sich ihr Zustand verschlechtert, in ein Hospiz.«
»Wird sie sterben?«, fragte Alain, doch seinem Tonfall nach war es keine Frage. Er schien sich mit der Antwort schon abgefunden zu haben.
»Wir werden alle sterben«, antwortete die Ärztin schulterzuckend und räusperte sich, was als unterdrücktes Lachen hätte gedeutet werden können, wäre sie nicht so sichtlich müde gewesen.
»Ich bin mir sicher, sie hat einen röchelnden Laut von sich gegeben, weil sie mich erkannte, und auch meine Hand gedrückt, als ich mich neben sie ans Bett gesetzt habe«, sagte Bruno.
»Das war wahrscheinlich eine automatische Reaktion. Hängen Sie nicht Ihre Hoffnungen daran. Sie ist fast achtzig Jahre alt, ein ganz gutes Alter, und sie hat es bestimmt nicht leicht im Leben gehabt. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten für Sie.«
Die Ärztin stand auf und deutete an, dass das Gespräch für sie beendet war. Sie fuhr sich mit einer Hand durch ihr grau werdendes Haar und strich es aus der Stirn. Bruno fragte sich, wie viele solcher Gespräche sie an diesem Tag, in dieser Woche wohl schon geführt hatte. Sie reichte Alain ein Blatt Papier.
»Hier sind die Adressen der Hospize in unserer Gegend«, erklärte sie. »Ich habe zwei angekreuzt, in denen es noch freie Betten gibt. Beide sind zu empfehlen. Gemäß den neuen Richtlinien haben wir das Seniorenheim bereits darüber informiert, dass Ihre Mutter nicht zurückkehrt. Sie müssten also ihre Sachen aus dem Zimmer holen.«
»Von welchen Richtlinien sprechen Sie?«, fragte Bruno. Er versuchte dabei einen neutralen Ton anzuschlagen, traf aber offenbar eine Note, die die Ärztin veranlasste, ihm zum ersten Mal wirklich in die Augen zu schauen. Unter der roten Sportjacke, die er immer trug, wenn er als Zivilist erscheinen wollte, erkannte die Ärztin den Kragen seines Uniformhemds und bemerkte dann auch an seinem Gürtel das Halfterset seiner taktischen Ausrüstung als Polizist.
»Gendarmerie?«
»Polizei von Saint-Denis«, antwortete Bruno und öffnete die Jacke, um sein Abzeichen zu zeigen, das am Hemd steckte.
»Der Conseil Général unseres Departements hat diese Richtlinien im vergangenen Jahr eingeführt«, erklärte die Ärztin. »Hier in der Dordogne leben im Landesvergleich besonders viele ältere Menschen. Einer von sieben ist fünfundsiebzig Jahre alt und älter. Seniorenheime, geriatrische Stationen und Hospize stehen deshalb unter besonders hohem Druck, nicht zuletzt auch Fachärzte wie ich. Für Sie, Monsieur, bedeutet dieser Altersüberhang weniger Arbeit, weil weniger Verbrechen verübt werden. Die meisten Straftäter sind jünger.«
»Das trifft nicht auf Wirtschaftskriminalität zu, Madame«, entgegnete Bruno. »Aber natürlich haben wir Verständnis für den außerordentlichen Druck, der auf Ihnen lastet. Vielen Dank, dass Sie sich meiner Tante angenommen haben«, fuhr er fort. »Wann müsste sie spätestens in ein Hospiz verlegt werden?«
»Am besten schon morgen, spätestens übermorgen. So lange steht sie bei uns unter Beobachtung. Vielleicht ergibt sich doch ein Grund zur Hoffnung, aber daran zweifle ich, um ehrlich zu sein.« Sie warf einen Blick in die Krankenakte auf ihrem Schreibtisch und wandte sich dann wieder an Alain. »Wir haben hier die Kontaktdaten Ihrer Schwester Annette. Wenn auch Sie mir Ihre Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse geben würden … In dieses Feld bitte.« Sie schob ihm die Akte zu.
4
Brunos Tante kam nicht mehr zu vollem Bewusstsein und starb wenige Tage nachdem sie ins Hospiz gebracht worden war. An der Trauerfeier nahmen nur er, Alain, Bernard, Annette und ein halbes Dutzend Freunde und ehemalige Nachbarn teil. Zum Kaffeetrinken im Anschluss an die Einäscherung erschienen noch ein paar Bewohner des Seniorenheims. Die beiden anderen Kinder der Verstorbenen hatten Kränze geschickt und sich damit entschuldigt, dass sie bei ihrer Arbeit unabkömmlich seien. Niemand außer Bruno schien davon überrascht zu sein.
»Ich hatte noch nicht die Zeit, ihre Sachen durchzugehen«, sagte Annette, als nur noch die Familie zurückgeblieben war. »Nicht dass ihr viel geblieben wäre. Da sind ein Fotoalbum, ein paar Kleider, die ich der Action Catholique geben könnte, zwei von ihr bestickte Kissen und ein paar gerahmte Fotos, eins von ihrer Hochzeit, eins von meiner, dann noch zwei von dir und Alain in Uniform. Das ist wahrhaftig nicht viel nach fast achtzig Lebensjahren.«
Bruno lächelte traurig. Er hatte im Stillen gehofft, dass in der Hinterlassenschaft seiner Tante etwas von seiner Mutter zu finden wäre. Bei seinen Besuchen hatte er immer wieder das Fotoalbum durchgeblättert auf der Suche nach einem Bild der jungen Frau, die ihn zur Welt gebracht, als Neugeborenen vor eine Kirchenpforte gelegt hatte und dann verschwunden war. Seine Tante hatte sich über ihre Schwester nicht weiter auslassen wollen und nur gesagt, dass sie längst tot sei. Er, Bruno, müsse sich damit abfinden, keine Mutter zu haben. Manchmal klang ein bisschen Wehmut mit, wenn seine Tante so mit ihm sprach, und Bruno dachte dann immer, dass sie auf ihre Weise ihre kleine Schwester auch ein wenig vermisste.
Der Abbruch dieser letzten Verbindung zu seiner Mutter machte Bruno sehr nachdenklich, als er nach Saint-Denis zurückfuhr. Dem Wunsch, sie ausfindig zu machen, hatte er immer widerstanden. Manchmal war er in flüchtigen Gedanken auf sie und seinen unbekannten Vater zurückgekommen. Er hätte gern gewusst, wie sie ausgesehen und was sie bewogen hatte, ihn kaum eine Woche nach seiner Geburt auszusetzen. Gleichzeitig ahnte er, dass ihn eine Suche nach ihr nur noch mehr frustrieren würde.
Als er langsam durch Sainte-Alvère fuhr, vibrierte sein Handy am Gürtel und holte ihn in die Gegenwart zurück. Auf dem Display sah er den Namen von Jean-Jacques, und so hielt er am Straßenrand an, um den Anruf anzunehmen.
»Du wirst es nicht glauben, Bruno, aber wir haben eine neue Spur zu Oscar«, meldete er aufgeregt und berichtete, dass Frankreich in Mali Spezialkräfte im Einsatz habe, die das dortige Militär im Kampf gegen Dschihadisten unterstützten. Allen Mitgliedern dieser Einheit seien, wie auch allen Polizisten, DNA-Proben abgenommen worden, die aber aus Sicherheitsgründen unter Verschluss gehalten würden. Einer der Soldaten sei jüngst im Kampf getötet und seine DNA mit der Datenbank abgeglichen worden.
»Sag jetzt nicht, dass dieser Soldat Oscars Sohn oder Neffe gewesen ist. Oder irgendetwas in der Art.«
»Ersteres trifft zu. Es handelt sich um sergent-chef