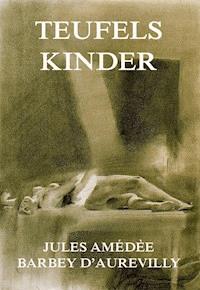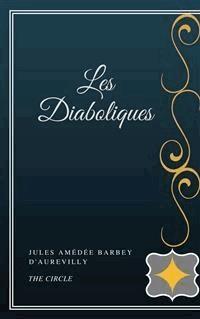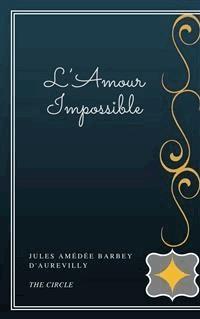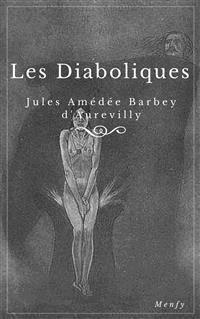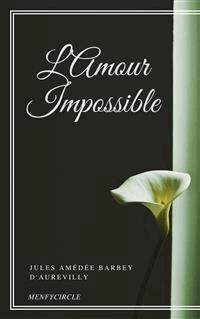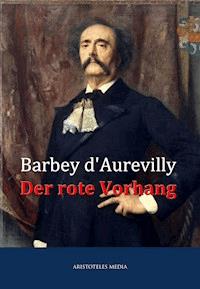Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Teufelskinder" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Es war ein Sonntag. Die Vesper war bereits zwei Stunden vorüber, und die blaue Weihrauchwolke, die wie ein Baldachin lange am Deckengewölbe gehangen hatte, war schon fast verflogen. Die Rippen und Sterne krochen in die Falten des breiten Schattenmantels, der von den Spitzbogen herabwallte. Nur die Flammen zweier Kerzen an zwei ziemlich weit voneinander entfernten Pfeilern des Mittelschiffes und das Laternenlicht am Hochaltar, das wie ein winziger Stern aus dem Dunkel des Chores hervorstarrte, warfen durch die Nacht, die sich im Mittelschiff und in den beiden Seitenschiffen breitmachte, einen gespenstischen Schimmer."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teufelskinder
Inhaltsverzeichnis
An den Leser
Wie schon der Titel dieses Buches »Teufelskinder« besagt, erhebt es nicht den Anspruch, ein Andachtsbuch, eine Nachfolge Christi, zu sein. Gleichwohl ist es von einem christlichen Sittenprediger geschrieben, allerdings von einem, der seine Ehre dareinsetzt, ein ehrlicher, wenn auch sehr kühner Beobachter des Lebens zu sein. Es ist sein Glaube, daß kräftige Künstler alles darstellen dürfen und daß ihre Werke genug sittlich sind, wenn sie die Gemüter erschüttern. Unsittlich sind nur die Unempfänglichen und die ungläubigen Spötter. Der Verfasser dieser Geschichten, der an den Teufel und seine Macht in der Welt glaubt, meint es durchaus ernst. Er erzählt den reinen Seelen, um sie mit Schrecken und Abscheu zu erfüllen. Wer diese Teufelskinder gelesen hat – des bin ich überzeugt –, der wird keine Lust verspüren, es ihnen nachzutun. Und darin liegt ja der sittliche Einfluß eines Buches.
Nachdem dies zur Ehre der Sache gesagt ist, eine andere Frage. Warum hat der Verfasser diesen kleinen Tragödien, die sich im Leben alle Tage abspielen, den vielleicht allzu vollklingenden Namen »Teufelskinder« gegeben? Gilt er den Geschichten oder den Frauengestalten darin?
Die Geschichten sind leider wahr. Es ist nichts daran erfunden. Nur tragen die dargestellten Menschen nicht ihre wirklichen Namen. Sie haben Masken bekommen. Man hat ihnen sozusagen die Namenszeichen aus der Wäsche getrennt. Das Alphabet gehört mir! war Casanovas Rechtfertigung, als man ihm den Vorwurf machte, er führe nicht seinen richtigen Namen. Das Alphabet eines Romandichters ist das Dasein aller derer, die Leidenschaften und Erlebnisse haben, und es handelt sich für ihn lediglich darum, die Buchstaben dieses Alphabets mit Kunst und persönlicher Rücksicht zu ordnen.
Übrigens wird es Hitzköpfe geben, die, vom Titel des Buches in Spannung gebracht, meine Teufelskinder gar nicht so teuflisch finden werden, wie sie sich den Anschein geben. Diese Geschichten sind schlichte Abbilder des wirklichen Lebens. Es gibt aber Leute, die Erfindungen, Verwicklungen, Klügeleien und Übertriebenheiten, kurzum den ganzen Zauber der modernen Opernmusik sogar in der erzählenden Kunst erheischen. Diese lieben Leute werden arg enttäuscht. Die Teufelskinder sind kein Teufelsmachwerk. Es sind eben Teufelskinder: Spiegelbilder des leibhaften Lebens aus unserer Zeit des Fortschrittes und der Kultur, die so erhaben und köstlich ist, daß ihr Konterfei, wenn man es wahrhaftig malt, immer aussieht, als habe uns der Teufel den Pinsel geführt.
Der Teufel ist ein Ebenbild Gottes. Die Lehre der Manichäer, jene Quelle der großen Ketzereien des Mittelalters, ist gar nicht dumm. Malebranche behauptet, Gott sei daran zu erkennen, daß er sich der einfachsten Mittel bediene. Ebenso macht es der Teufel.
Was nun die Frauengestalten in diesen Geschichten anbelangt: warum sollen sie keine Teufelskinder sein? Lebt und webt in ihnen nicht genug Teuflisches? Verdienen sie den holden Namen nicht?
Teufelskinder! Es ist keine einzige unter ihnen, die nicht irgendwie teuflisch wäre. Es ist keine darunter, zu der man mit Fug und Recht »Mein Engel« sagen könnte. Aber wie der Teufel, der doch auch ein Engel ist, wenngleich ein gefallener, so sind auch sie im Grunde Engel nach seinem Muster. Keine ist rein, tugendhaft,und unschuldig. Selbst abgesehen vom Ungeheuerlichen an ihnen, sind sie wirklich arm an Sittsamkeit und braven Gefühlen. Man kann also kaum den Vorwurf machen, sie trügen ihren Namen mit Unrecht.
Es ist vorläufig eine Auslese von solchen Damen. Ich hoffe, es treten mir im Leben nun auch Gegenstücke entgegen. Denn jedes Ding in der Welt hat zwei Seiten. Die Natur gleicht jenen Frauen, die ein blaues und ein schwarzes Auge besitzen. Hier ist das schwarze, abgemalt mit schwarzen Farben. Vielleicht kommt das blaue später einmal: nach den Teufelskindern die Himmelskinder! Ob sich die dazu nötigen himmelblauen Farben finden? Und gibt es denn Himmelskinder?
Paris, am 1. Mai 1874
Jules Amadée Barbey d'Aurevilly
Das Fenster mit den roten Vorhängen
Es ist schrecklich lange her, als ich mich eines Tages zur Jagd auf Wasserwild nach den Sümpfen des Westens aufmachte. In der Gegend, nach der ich wollte, gab es damals noch keine Eisenbahn. Ich setzte mich also in die Post, die am Wegkreuz bei dem Schloß Rueil vorbeifuhr.
Ein einziger Reisender saß im Abteil erster Klasse, und zwar ein in jeder Hinsicht ganz besonderer Mensch. Ich kannte ihn, wie man sich so kennt. Er war mir in der Gesellschaft öfters begegnet. Sagen wir, er hieß Graf von Brassard.
Es war nachmittags gegen fünf Uhr. Die Sonne warf nur noch matte Strahlen auf den Staub der Landstraße, hinter deren Pappelreihen sich die weiten Wiesen dehnten. Unsere vier starkkruppigen Gäule trabten flott vorwärts, vom Peitschenknall des Postillions getrieben.
Brassard, der, nebenbei bemerkt, in England erzogen war, stand damals längst auf der Höhe des Lebens, aber er gehörte zu jener Sorte von Menschen, die, schon dem Tode verfallen, sich dies nicht anmerken lassen und bis zum letzten Augenblick behaupten, sie dächten nicht an das Sterben. Im gewöhnlichen Leben und auch in der Literatur spottet man über Leute, die jung zu sein vermeinen, obgleich sie über die glückliche Zeit der Torheiten beträchtlich hinaus sind. Der Spott ist am Platze, wenn solches Jung-bleiben-Wollen in lächerlicher Form zutage tritt. Zuweilen jedoch wirkt dieses Nichtlassen von der Jugend geradezu großartig. Stolze Naturen lassen sich nicht werfen. Im Grunde freilich ist auch das sinnlos, denn es ist vergebliches Bemühen. Aber es ist schön, wie so vieles Sinnlose. Wer so dem Alter trotzt, in dem lebt der nämliche Heldengeist wie in der Alten Garde bei Waterloo, die eher starb, als daß sie sich ergab. Und für ein Soldatenherz ist das Nie-und-nimmer-sich-Ergeben doch die Losung in allen Dingen des Lebens.
Der sich nie ergebende Brassard – er lebt übrigens noch; wie er lebt, das geht aus dem Folgenden hervor – war damals, als ich zu ihm in die Postkutsche stieg, im Lästermunde der Welt ein sogenannter »alter Schwerenöter«. Wem hingegen Zahlen und Urkunden über das Alter eines Menschen nicht viel bedeuten, weil jedermann just so alt ist, wie er aussieht, dem war und blieb der Graf einfach »ein Schwerenöter«, oder besser ausgedrückt – denn diese Bezeichnung klingt zu kleinbürgerlich – ein Prachtmensch. Entschieden war er das zum Beispiel in den Augen der Marquise von V***, einer Kennerin in punkto Mannestugend, einer echten Dalila, die so manchen Simson unter ihrer Schere gehabt hatte. Alte Schwerenöter sind zumeist lüsterne, magere, dürftige, gezierte Erscheinungen. So darf man sich aber den Grafen von Brassard ja nicht vorstellen. Da bekäme man ein grundfalsches Bild. Leib, Geist, Haltung, Bewegung, alles an ihm war stattlich, verschwenderisch, vornehm, herrenhaft-gelassen. Mit einem Wort, er war ein echter Dandy wie Georg Brummell in seiner besten Zeit. Wäre er weniger ein Dandy gewesen, so hätte er es zweifellos bis zum Marschall von Frankreich gebracht. Er war einer der glänzendsten Offiziere des ersten Kaiserreichs. Regimentskameraden von ihm haben mir des öfteren seine Tapferkeit gerühmt. Sie sei so groß gewesen, wie die von Murat und Marmont zusammengenommen. Dazu hatte er viel Witz und viel Kaltblütigkeit. Somit hätte er als Soldat rasch sehr hoch kommen können, wenn er nicht eben so sehr Dandy gewesen wäre. Einem Offizier müssen Gehorsam, Pünktlichkeit und allerlei andere Diensttugenden in Fleisch und Blut übergegangen sein. Das ist aber mit dem Dandytum unvereinbar. Man kann nicht Berufssoldat und zugleich Dandy sein. Offiziere wie Brassard sind in einem fort nahe daran, um die Ecke zu gehen. Und Brassard wäre während seiner Soldatenzeit zwanzigmal um die Ecke gegangen, wenn er nicht wie alle Lebenskünstler Glück gehabt hätte. Mazarin hätte ihn brauchen können; seine Nichten auch, freilich aus anderen Gründen. Brassard war wirklich ein Prachtmensch.
Er war mit jener Schönheit begnadet, die ein Soldat nötiger hat denn jeder andere. Ohne Schönheit hat man auch keine Jugend. Eine Armee muß sich jung fühlen; dann ist das ganze Land jung und schön. Übrigens war Brassards Schönheit, mit der er sich nicht nur die Frauen, sondern auch die guten Gelegenheiten – diese alten Vetteln – zu eigen machte, nicht sein einziger Schutzengel. Soviel ich weiß, war er normannischer Abkunft, ein Nachkomme Wilhelms des Eroberers. Auch er war ein Eroberer. Nach dem Sturz Napoleons hielt er es natürlicherweise mit den Bourbonen, und während der hundert Tage bewahrte er ihnen schier übernatürliche Treue. Als die Bourbonen dann abermals auf den Thron kamen, machte ihn Karl der Zehnte eigenhändig zum Ritter des Ludwig-Ordens. Während der ganzen Zeit der Restauration zog »der schöne Brassard« kein einziges Mal auf Wache in den Tuilerien, ohne im Vorbeimarsch ein paar huldvolle Worte von der Herzogin von Angoule'me einzuheimsen. Für ihn fand sie die Liebenswürdigkeit wieder, die ihr das Unglück geraubt hatte. Dem Kriegsminister waren diese Beweise allerhöchster Gnade nicht unbekannt. Er hätte wer weiß was für die Beförderung eines Offiziers getan, den Madame derart auszeichnete, aber es ging beim besten Willen nicht. Der Tollkopf warf bei einer Besichtigung vor der Front seines Regiments dem Kommandierenden General, der ihm eine dienstliche Ausstellung machte, den Degen vor die Füße, und der Minister vermochte den Grafen gerade noch mit knapper Not vor dem Kriegsgericht zu bewahren. Derlei Achtungslosigkeit machte Brassard im Heer unmöglich. Nur im Felde, wo er mit Leib und Seele Offizier war, fügte er sich höherem Befehl. Im Frieden kümmerte er sich den Teufel um Dienstvorschriften. Unzählige Male entfernte er sich unversehens aus seinem Standort und vergnügte sich wer weiß wo, ungeachtet der Gefahr, sich endlosen Stubenarrest zuzuziehen. War Parade oder besonderer Dienst, so tauchte er wieder in der Kaserne auf, von seinem ihm treuergebenen Feldwebel benachrichtigt. Brassards Vorgesetzte hatten natürlich verdammt wenig für einen so zuchtlosen Offizier übrig, dessen Natur nun einmal keinerlei Zwang und Regel vertrug. Seine Grenadiere aber gingen für ihn allesamt durch das Feuer. Er war ihr Abgott. Von ihnen verlangte er nichts weiter, als daß sie durch und durch schneidig, ehrliebend und fesch waren. Mit einem Wort, er wollte Soldaten vom alten Schlag unter sich haben, Soldaten, wie man sie so meisterlich in gewissen alten Soldaten- und Volksliedern gezeichnet findet. Vielleicht verleitete er seine Untergebenen zur Rauferei untereinander, indem er behauptete, dies sei das beste Mittel, echte Soldaten zu erziehen. Tapferes Verhalten dabei belohnte er mit neuen Handschuhen, gutem Lederzeug und ähnlichen kleinen Geschenken, die er aus eigener Tasche bestritt. Er war ja steinreich. Hierzu pflegte er zu sagen: »Orden vermag ich den Kerlen nicht zu verleihen. Ich bin kein Fürst. Also kann ich sie nur damit dekorieren!« Die Kompanie, die er führte, stach infolgedessen durch ihr schmuckes Aussehen alle anderen Kompanien des an und für sich schon glänzenden Garderegiments aus. Er züchtete die Eitelkeit in seinen Leuten geradezu planmäßig. Bekanntlich neigt der französische Soldat sowieso zu Selbstgefälligkeit und Stutzertum, zwei Eigenschaften, die immer etwas Herausforderndes an sich haben: die eine durch den Ton, in dem sie zutage tritt; die andere durch den Neid, den sie erweckt. Und so war es nicht zu verwundern, daß alle anderen Kompanien im Regiment eifersüchtig auf die Brassardsche waren. Man schlug sich, um in sie hineinzukommen, und man schlug sich immer wieder, um nicht hinauszumüssen.
Derart war Brassards sonderbarer Stand zur Zeit der Restauration. Daß er über kurz oder lang erledigt sein mußte, war jedermann klar. Man lebte ja nicht mehr unter dem Kaiserreich, wo jeder Tag Gelegenheit zu neuen Heldentaten bot, die alles andere vergeben und vergessen ließen. Seine Kameraden fanden kaum noch Worte über sein Benehmen. Er spielte geradezu mit seinen Vorgesetzten, so wie er ehedem im Felde mit seinem Leben gespielt hatte. Da kam das Jahr 1830 und mit ihm der Umsturz des Staates. Er enthob den Regimentskommandeur des Einschreitens und den tollen Hauptmann der Schande eines schlichten Abschiedes, der mit jedem Tage bedrohlicher über seinem Haupt geschwebt hatte. Als die Julirevolution die Orleans zu Herren des Landes machte, hütete der Hauptmann Brassard gerade das Bett. Er hatte sich auf dem letzten Ball der Herzogin von Berry beim Tanzen den Fuß verstaucht. Aber das hinderte ihn nicht, beim ersten Trommelwirbel zu seiner Kompanie zu eilen. Da er noch keine hohen Stiefel anziehen konnte, erschien er im Hofballanzug, in seidenen Strümpfen und Lackschuhen, an der Spitze seiner Grenadiere, auf dem Bastilleplatz. Er bekam den Befehl, die Boulevards in ihrer ganzen Länge zu säubern. Barrikaden waren dort keine. Paris sah düster und drohend aus. Es war verödet. Die Sonne brannte wie Feuer. Bald sollte ein anderes Feuer blitzen; denn hinter all den geschlossenen Fensterläden harrten Tod und Verderben auf ihr Losungswort.
Der Hauptmann von Brassard teilte seine Leute in zwei Rotten, die zu beiden Seiten der Straße dicht an den Häusern entlang gingen, so daß sie nur den Schüssen von gegenüber ausgesetzt waren. Er selbst, mehr Dandy denn je, lief mitten auf dem Boulevard dahin. Tausend Flinten, Pistolen und Revolver richteten sich gegen ihn. Er kam bis zur Richelieustraße, ohne getroffen zu werden. Da, vor Frascati, an der Ecke der Richelieustraße, versperrte ihm die erste Barrikade den Weg. Er gab den Befehl, seine Leute sollten sich um ihn sammeln. Er wollte die Barrikade stürmen. Im selben Augenblick traf ihn eine Kugel in die Brust, die den Feind doppelt herausgefordert hatte, einmal durch ihre Breite und dann durch den Schmuck der Orden und Gardeabzeichen. Und ein Steinwurf zerschmetterte ihm den einen Arm. Gleichwohl nahm er die Barrikade und stürmte an der Spitze seiner begeisterten Leute bis zur Madeleine, die damals noch im Bau war. Auf einem Steinhaufen brach er blutend zusammen. Zwei Damen, die in einem Wagen aus dem Aufruhr der Stadt flüchten wollten, sahen ihn liegen und nahmen ihn mit. Er ließ sich von ihnen zum Gros-Caillou bringen, wo sich der Marschall von Ragusa aufhielt. Ihm meldete er im Dienstton: »Herr Marschall, ich habe vielleicht noch zwei Stunden zu leben. So lange bitte ich mich irgendwo zu verwenden!« Es kam anders. Er blieb am Leben. Fünfzehn Jahre später hat er mir erzählt: »Was verstehen die Ärzte von ihrer Kunst? Damals hat mir der Stabsarzt auf das strengste verboten, während des Wundfiebers Wein zu trinken. Ich habe mir trotzdem täglich eine Flasche Bordeaux genehmigt. Und nur der hat mich vor dem sicheren Tode gerettet!«
Er trank wie ein Landsknecht. Aber auch im Trinken war er Dandy. Er besaß einen prachtvollen Pokal aus böhmischem Kristall, in den eine ganze Flasche Wein hineinging. Den konnte er mit einem Zug leeren, so wahr ich hier stehe! Er hat mir übrigens gestanden, daß er alles in diesem Unmaße tat. Ich glaube es ihm. Er war ein zweiter Marschall Bassompierre und ein Zecher wie er. Auch nach dem tollsten Gelage habe ich ihn kaum mehr denn angeheitert gesehen. In seiner leichtfertigen Soldatenart nannte er das: ein bißchen angeschossen sein. Und noch eines. Wozu sollte ich es verheimlichen? Meine Geschichte will ja nichts als ein Bildnis des Hauptmanns von Brassard in möglichster Treue geben. Also Brassard, dieser Ritter Blaubart des neunzehnten Jahrhunderts, hatte einstmals zu gleicher Zeit sieben Herzensdamen. Er nannte sie romantisch: die sieben Saiten seiner Leier. Ich billige diese leichtfertige musikalische Art, von seinen Sünden zu sprechen, durchaus nicht. Aber was soll man sagen? Wäre der Hauptmann nicht in allem so gewesen, wie ich Ihnen erzählt habe, dann wäre meine Geschichte eben auch weniger merkwürdig. Oder vielmehr, Sie bekämen dann gar keine zu hören.
Selbstverständlich dachte ich an alles andere denn daran, den Grafen in der Postkutsche vorzufinden, als ich damals in Rueil einstieg. Wir hatten einander seit langem nicht gesehen, und ich war sehr vergnügt über unser Zusammentreffen, wurden mir doch ein paar Plauderstunden mit einem Menschen geschenkt, der zwar ein Zeitgenosse von mir war, aber doch im Grunde einer vergangenen Welt angehörte. Wenn er die Rüstung Franz des Ersten angelegt hätte, wären seine Bewegungen darin ebenso ungezwungen gewesen wie in seinem flotten blauen Waffenrock. Er war in Haltung und Gestalt elegant wie keiner unserer Kavaliere von heute. Neben ihm verloren die neumodischen kleinen Helden ihr bißchen Glanz wie blasse kleine Sterne, die sich am Abendhimmel hervorwagen, während die flammende Sonne eines strahlenden Tages noch nicht untergegangen ist. Sein Gesicht war nicht klassisch geschnitten, aber von ganz eigenartiger Schönheit. Sein Haar war immer schwarz. Natur oder Kunst? Ich weiß es nicht. In jedem Falle war es ein Geheimnis. Den ebenso schwarzen Bart trug er kurzgeschnitten. Seine Gesichtsfarbe war männlich und frisch; seine Stirn hoch, edel, glatt und weiß wie ein Frauenarm. Durch die schwere Grenadiermütze war ihm das Haar über der Stirn reichlich dünn geworden, wodurch sie noch breiter und vornehmer aussah. Unter geschwungenen Brauen leuchteten ein Paar tiefdunkelblaue Augen hervor, wie funkelnde Saphire. Diese Augen fragten nicht viel; sie durchdrangen.
Wir begrüßten einander und gaben uns die Hand. Dann begannen wir uns zu erzählen. Der Hauptmann redete langsam mit kräftiger Stimme, der man es anhörte, daß sie gewohnt war, über dem Exerzierplatz zu ertönen. Seine Gemessenheit war durchaus kein Zeichen von Unbeholfenheit, aber sie verlieh allem, was er sagte, ein eigentümliches Gepräge, selbst seinen Scherzworten. Und solche liebte er sehr, sogar recht gewagte. Er hatte sozusagen eine lose Zunge. Die schöne Gräfin F***, die sich seit dem Tode ihres Mannes nur noch in Schwarz, Veilchenblau und Weiß kleidet, behauptet, der Hauptmann von Brassard wäre immer zu weit gegangen. Seine Art hätte man manchmal für unerhört erklären können, wenn sie nicht dabei so unsagbar weltmännisch gewesen wäre. Und wie das so ist: einem Grafen und Gardeoffizier verzeiht man schließlich manches.
Ein Vorteil der Plauderei auf Reisen ist es, daß man aufhören darf, wenn man nichts mehr zu sagen weiß. Niemand fühlt sich gekränkt. Brassard und ich, wir tauschten zunächst ein paar Bemerkungen aus über Vorgänge während der Fahrt, etliche Beobachtungen über die Landschaft um uns und einige Erinnerungen an gemeinsame frühere Erlebnisse, alles im Flusse des Geratewohls. Der Tag ging zur Neige. Die Dämmerung brach an. Alles ringsum versank in tiefe Stille. Im Herbst vollzieht sich der Wandel vom Tag zur Nacht so rasch, daß es einem vorkommt, als falle die Dunkelheit geradezu vom Himmel auf die Erde. Die Nacht war frisch. Wir krochen in unsere Mäntel und sanken in unsere Ecken zurück. Ich weiß nicht, ob mein Reisekamerad in seinem Winkel einschlummerte. Ich blieb wach. Da ich die nämliche Fahrt schon oft gemacht hatte, war mir die allzu bekannte Gegend völlig gleichgültig. Ich kümmerte mich nicht um die Dinge draußen, die in der Dunkelheit an uns vorüberhuschten, als kämen sie aus entgegengesetzter Richtung an uns vorbei. Wir fuhren durch ein paar kleine Landstädte, wie sie hier und da an jeder Heeresstraße liegen. Die Nacht war schwarz wie ein ausgebrannter Herd. In dieser Finsternis hatten die unbekannten kleinen Orte seltsame Gesichter. In den meisten Städtchen, durch die wir kamen, waren die Laternen rar. So konnte man weniger erkennen als vorher auf der Landstraße. Dort erzeugten der Himmel und der weite Raum ein gewisses Helldunkel. In den Städten indes drängten sich die Häuser, und ihre schwarzen Schatten füllten die Straßen. Man sah kaum den Himmel und nur ein paar Sterne zwischen den langen Dächerreihen. Sie hatten etwas Geheimnisvolles, diese schlafenden kleinen Städte. Der einzige wachende Mensch war immer der Stallknecht mit seiner Laterne, der die frischen Pferde herbeiführte und sie anschirrte, wobei er pfiff oder über die störrischen oder ihm zu unruhigen Gäule fluchte. Abgesehen davon und außer der immer gleichen Frage eines schlaftrunkenen Reisenden, der das Fenster herunterließ und in das tiefe nächtliche Schweigen hinausrief: »Wo sind wir denn, Kutscher?«, war nichts Lebendes zu hören oder zu sehen, weder draußen noch drinnen in unserem Postwagen, in dem vielleicht noch ein anderer Grübler, gleichwie ich, durch die Glasscheibe nach den Häusern starrte, die uns die Nacht kaum erkennen ließ.
Das einsame Wachen eines menschlichen Wesens, und sei es eines Wachtpostens, während alle anderen in den todähnlichen Zustand versunken sind, der das Ausruhen der erschöpften Natur ist, hat immer etwas Sonderbares an sich. Irgendwo ist Licht hinter einem verhängten Fenster, aber wir wissen nicht, was dahinter vorgeht. Wir grübeln darüber nach und machen uns Vorstellungen. Mir wenigstens geht es so. Wenn ich nächtlicherweile durch ein stilles Städtchen fuhr und ein Fenster erleuchtet sah, da habe ich den hellen Raum dahinter mit einer Welt von Geschehnissen erfüllt, wenn ich auch gerade keine Tragödien darin vermutete. Noch heute, nach so vielen Jahren, trage ich in meinem Gedächtnis eine Reihe von geheimnisvoll schimmernden Fenstern. Eines aber ist mir ganz besonders deutlich in der Erinnerung verblieben.
Es war in einer kleinen Stadt, durch die wir – Brassard und ich – in jener Nacht fuhren, das Fenster eines Hauses, drei Häuser über den Gasthof hinaus, vor dem wir die Pferde wechseln sollten. Meine Erinnerung an alle Nebenumstände ist geradezu handgreiflich. Ich konnte die Fenster in aller Muße betrachten. Ein Rad an unserer Postkutsche hatte unterwegs einen Schaden bekommen. Man holte den Stellmacher. Der schlief. Es ist nun keine Kleinigkeit, in einer schlafenden Kleinstadt einen Stellmacher zu wecken und zu nächtlicher Arbeit heranzuholen. In der Tat währte es sehr lange, ehe er kam. Von unserem Sonderabteil hörte ich durch die Wand hindurch die Reisenden im Wagen schnarchen. Vom Verdeck war keiner herabgestiegen. Bekanntlich haben doch die Inhaber der Oberplätze geradezu eine Leidenschaft, jedesmal, wenn die Post hält, herunterzukommen. Offenbar wollen sie ihre Gewandtheit im Auf- und Abklettern zeigen. Die liebe Eitelkeit der Franzosen betätigt sich selbst in derlei Dingen. Der Gasthof, vor dem wir haltgemacht hatten, war geschlossen. Wir hatten in der Haltestelle vorher zu Abend gegessen. Das Haus lag im Schlaf. Nirgends Leben. Kein Geräusch in all der Stille. Nur im großen Hof, dessen Tor wohl nachts offenzubleiben pflegte, machte sich das einförmige Hin und Her eines Besens hörbar. Ob ein Mann oder eine Frau diese Arbeit betrieb, war in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Die Hauptseite des Gasthofes war so dunkel wie die ganze Straße. Nur hinter einem einzigen Fenster war Licht, eben jenem Fenster, das mir unvergeßlich geblieben ist. Noch jetzt schimmert es in meinem Gedächtnis. Es war nicht hell. Es schimmerte nur. Denn das Licht drinnen ward gedämpft durch ein paar rote Vorhänge. Geheimnisvoll sickerte es durch den dichten Stoff. Das Haus war groß, hatte aber nur ein einziges, allerdings hohes Stockwerk. »Das ist doch sonderbar!« sagte der Graf von Brassard, als rede er mit sich selbst. »Man sollte meinen, es sei noch immer derselbe Vorhang!«
Ich wandte mich ihm zu; aber ich konnte ihn in der Dunkelheit nicht recht sehen, denn im nämlichen Augenblick erlosch die Laterne unter dem Kutscherbock, die den Weg und die Pferde beleuchten sollte. Ich hatte geglaubt, Brassard schliefe. Das war also nicht so gewesen. Und das seltsame Fenster beschäftigte ihn genauso stark wie mich. Eines jedoch hatte er vor mir voraus: er wußte, warum ihn das Fenster anzog. Die paar Worte, so nichtssagend sie an und für sich waren, hatte er in einem Tone gesagt, der mir an ihm dermaßen ungewohnt war, daß mich die lebhafteste Neugier befiel. Ich mußte sein Gesicht sehen! Rasch entzündete ich ein Streichholz, als wollte ich mir eine Zigarre in Brand setzen. Der bläuliche Lichtschein durchzuckte die Finsternis. Der Graf sah totenbleich aus. Was machte ihn so blaß, ihn, den Vollblüter, der sich sonst nie entfärbte, dem im Gegenteil jedwede Erregung einen roten Kopf verursachte? Hinter jenem Fenster, hinter jener Bemerkung, in dem Erbleichen dieses Mannes und in der Erregung, die seinen Körper durchflutete, was ich in der Enge des dunklen Wagens verspürte, in all dem war ein Geheimnis verborgen. Vielleicht gelang es mir altem Geschichtenjäger, dahinterzukommen, wenn ich es geschickt anfing.
»Verehrter Hauptmann«, begann ich mit erheuchelter Gleichgültigkeit, »Sie betrachten das Fenster da! Und es ist Ihnen gut bekannt!«
»Gut bekannt! Beim Teufel ja!« gab er zur Antwort mit seiner gewohnten kräftigen und jede Silbe betonenden Stimme.
Die Ruhe herrschte bereits wieder in diesem seiner selbst sicheren, überlegenen Weltmann, der, wie alle Herrenmenschen, jedwede Erregung für unter seiner Würde hielt, ganz im Gegensatz zu Goethe, dem ewigen Toren, der vom Nil admirari! nichts wissen wollte.
»Ich komme selten durch diesen Ort«, fuhr Brassard gelassen fort. »Ich vermeide es sogar nach Möglichkeit. Wissen Sie: Es gibt Dinge, die man nie vergißt. Wenige. Aber es gibt welche. Ich kenne ihrer drei: den ersteh Waffenrock, das erste Gefecht, die erste Frau! Und das Fenster, das Sie dort sehen, das ist für mich das vierte, was mir nicht aus dem Sinn will.« Er schwieg und ließ die Glasscheibe vor sich herunter. Wollte er das geheimnisvolle Fenster drüben besser sehen? Der Postkutscher war nach der Schmiede gegangen. Die neuen Pferde ließen noch immer auf sich warten. Die uns bisher gezogen, standen müde da, noch nicht ausgespannt, mit hängenden Köpfen. Keines scharrte auf dem stillen Pflaster. Geduldig träumten sie von ihrem Stall. Unser verschlafener Postwagen sah aus wie verwunschen, als habe ihn eine Fee an einem Kreuzweg in Dornröschens Nähe mit ihrem Zauberstab berührt.
»In der Tat«, meinte ich, »für einen Phantasiemenschen hat das Fenster da etwas ganz Merkwürdiges ...«
»Ich weiß nicht, was es in Ihnen erweckt«, unterbrach mich der Graf. »Ich weiß nur, an was es mich erinnert. Es ist das Fenster meiner ersten Leutnantswohnung. Donnerwetter, das ist jetzt fünfunddreißig Jahre her! Dort hinter den Vorhängen... Die Dinger sehen aus, als wären sie noch die gleichen! Genau so schimmerte damals das Licht durch, damals, als...« – »Sie Ihre kriegswissenschaftlichen Studien beim Lampenlicht dort oben betrieben, als eifriger junger Offizier«, fiel ich ein, weil es mir vorkam, als wolle er Erinnerungen niederdrücken, auf die ich nun einmal erpicht war. »Da überschätzen Sie mich sehr!« entgegnete er mir. »Ein junger Offizier war ich, und die Lampe brannte in die Nacht hinein, bis zu ganz ungebührlicher Zeit, wie der Spießbürger so sagt. Gewiß. Aber im ›Marschall von Sachsen‹ las ich nicht.« »Na, na!« scherzte ich. »Aber nachgeeifert haben Sie ihm doch!« Wie eine Leuchtkugel zischte meine Bemerkung zu ihm hinüber. Solch Spiel gefiel ihm. Er ging darauf ein.
»Nein, nein! Damals war ich durchaus nicht ein Schüler des Marschalls, so wie Sie dies meinen. Das ist erst viel, viel später gekommen. Zu jener Zeit war ich ein kindlicher Leutnant, bildsauber in seinem bunten Rock, aber im Umgang mit den Frauen linkisch und schüchtern, obgleich das keine wahrhaben wollte, wegen meiner Teufelsaugen. Man kann mit Schüchternheit viel erreichen. Ich hab' es nie versucht. Übrigens war ich damals siebzehn Jahr alt, eben aus der Kriegsschule heraus. Heutzutage ist man älter, wenn man hineinkommt. Aber der Kaiser, der unersättliche Menschenverbraucher, hätte am Ende Zwölfjährige ins Feuer geführt, wenn er weiter der Herr geblieben wäre, wie die Fürsten des Morgenlandes Neunjährige in ihrem Harem haben.«
Du lieber Gott, dachte ich bei mir. Wenn Brassard vom Kaiser und den Weibern des Morgenlandes zu erzählen beginnt, dann kommen wir weitab von dem, was ich hören wollte. Rasch lenkte ich auf den alten Gegenstand zurück: »Bei alledem, Graf, möchte ich doch wetten, daß hinter den roten Vorhängen in Ihrer nur darum so getreuen Erinnerung ein Frauenbild lebt.«
»Sie gewännen Ihre Wette«, erwiderte er ernst.
»Also doch!« rief ich aus. »Und weiter! Einem Mann wie Ihnen kann ein im Dunkeln herschimmerndes Fenster in einem Spießernest, durch das Sie alle Jubeljahre wieder einmal durchfahren wie heute, doch nur dann von Bedeutung bleiben, wenn es Sie an eine langwierige Belagerung oder an die Eroberung einer Frau im Sturm erinnert.«
»Von einer Belagerung kann nicht die Rede sein, wenigstens nicht im militärischen Sinn«, fuhr er ernst fort. Sein Ernst war indes oft die Maske, hinter der er seinen Scherz trieb. »Und erst recht nicht von einem Sturm. Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß ich dazumal kein Eroberer war. Überhaupt, es war keine Frau, die hier genommen ward, sondern ich war es!«
Ich verbeugte mich. Gewahrte er es in der Dunkelheit? »Auch Berg-op-Zoom ist gefallen«, sagte ich.
»Und ein siebzehnjähriger Leutnant ist für gewöhnlich kein Berg-op-Zoom an Standhaftigkeit und Uneinnehmbarkeit«, fügte er hinzu.
»Also eine Frau Potiphar!« bemerkte ich lachend.
»Vielmehr ein Fräulein Potiphar«, verbesserte er in drolliger Einfalt. »Das Nonplusultra, verehrter Hauptmann. Andrerseits: ein Josef im bunten Rock, mithin einer, der nicht ausreißen darf.«
»Im Gegenteil, einer der auskniff, als wäre der Teufel hinter ihm her!« belehrte er mich, kalt wie ein Frosch. »Allerdings zu spät. Großer Gott,wie trieb mich die Angst! Ich kann das Wort des Marschalls Ney verstehen,das ich selbst von ihm gehört habe und mich einigermaßen tröstet: Ein Erzschwindler, wer von sich sagt, er habe sein Lebtag keine Angst gehabt!«
»Alle Wetter, Graf, eine Geschichte, in der Sie diese Empfindung verspürt haben, die muß verflucht kitzlig sein!«
»Bei Gott ja!« bekräftigte er wortkarg. Dann aber fuhr er fort: »Übrigens kann ich Ihnen die Sache erzählen, wenn Sie es wollen. Wie Säure den blanken Stahl, so hat dies Erlebnis alle meine späteren Liebschaften angefressen. Man ist nicht immer ungestraft ein Sünder.«
Die Wehmut, die seine letzten Worte durchklang, überraschte mich an diesem Lebenskünstler, den ich gegen derlei für gefeit gehalten hatte. Er zog das Wagenfenster wieder hoch. Befürchtete er, draußen gehört zu werden, wo sich doch kein Mensch um unser einsames und unbewegliches Gefährt kümmerte? Oder störte ihn das gleichförmige Geräusch des Besens, der übers Pflaster des Hofes hin und her strich, in seiner Erzählung? Es war mir in der Dunkelheit unmöglich, Brassards Gesicht zu sehen. Um so aufmerksamer lauschte ich auf jeden leisen Wandel in seiner Stimme, während meine Augen unverwandt hinüber nach dem seltsamen Lichtschimmer hinter den roten Vorhängen starrten, von denen er jetzt zu erzählen begann.
»Ich war also siebzehn Jahre alt. Unlängst von der Kriegsschule gekommen, eben zum Leutnant unter Versetzung in ein einfaches Infanterieregiment befördert, harrte ich mit der üblichen Ungeduld des Marschbefehls nach Deutschland, wo der Kaiser den Feldzug von 1813, wie die Geschichte ihn nennt, führte. Von meinem alten Herrn im Hinterland hatte ich bereits Abschied genommen. Das Bataillon, zu dem ich gehörte, hatte seinen Standort in dieser kleinen Stadt. Der Ort hatte keine dreitausend Einwohner, und so lagen hier nur die beiden ersten Bataillone meines Regiments. Die zwei anderen waren in ein paar Nachbarorten untergebracht. Wenn man wie Sie nur hin und wieder durchkommt, so kann man sich keinen Begriff machen, was es heißt oder vielmehr hieß, vor dreißig Jahren, in diesem Saunest dauernd leben zu sollen. Es war die übelste Garnison, in die einen der Zufall beordern konnte, der Zufall, der zumeist der Teufel, hier einmal aber der Kriegsminister war. Und das zu Beginn meiner militärischen Laufbahn! Ich fluchte nicht schlecht, als ich herkam. Mehr Stumpfsinn, Rückständigkeit und Langeweile als hier konnte es nirgends beieinander geben. Zu meinem Glück litt ich damals noch an einer Krankheit, die Sie nicht kennen, die aber alle einmal durchmachen, die je einen Leutnantsrock tragen: an der Verliebtheit in die Uniform. Diesem Umstand hatte ich es zu verdanken, daß mir die öde Welt dieser kleinen Spießerstadt, die ich ein paar Jahre später keine volle Woche ertragen hätte, eigentlich gar nicht zum Bewußtsein kam. Ich wohnte weniger in ihr als vielmehr in meinem Waffenkleid, das mich jungen Dachs namenlos glücklich machte. Vernarrt in meinen Beruf, der mir die ganze Welt verwandelte und vergoldete, was ging mich da diese traurige Garnison an? Wenn mich die Langeweile dieses geistlosen und gottvergessenen Ortes plagte, zog ich meine Paradeuniform an, gefertigt von den besten Pariser Uniformschneidern, Thomassin & Pied – und weg war aller Stumpfsinn! Es ging mir wie manchen Frauen, die ihren schönsten Schmuck anlegen, obgleich sie einsam und allein sind und sie niemanden erwarten. So warf ich mich in Gala nur für mich. Ich berauschte mich an meinen Epauletts, an meiner Paradeschärpe, an meinem Galadegen, der im Sonnenlicht gleißte und glänzte. Und wenn ich dann einer wie alle Tage am Nachmittag gegen vier Uhr auf der öden Hauptstraße hinschlenderte, war ich bei aller Verlassenheit doch seelenvergnügt. Ein ähnliches Gefühl hob mir das Herz wie in späteren Tagen, wenn ich, einer schönen Frau zur Seite, auf dem Korso irgendwelcher Weltstadt promenierte und hinter mir uns bewundernde Worte hörte.
Die Einwohnerschaft war arm. Verkehr und Geselligkeit gab es nicht. Die vorhandenen alteingesessenen, nicht wieder in die Höhe gekommenen Familien grollten dem Kaiser, weil er, wie sie vermeinten, den Revolutionsmännern allen Raub gelassen habe. Infolgedessen ließ man auch seine Offiziere links liegen. Einladungen, Empfangstage, Gesellschaften, Bälle, Maskeraden, alles das waren Dinge, die man hier nicht kannte. Allerhöchstens gab es sonntags, wenn schönes Wetter war, ein armseliges bißchen Korso, nach der Zwölf-Uhr-Messe, wo die Mütter mit ihren Töchtern auftauchten und sie ausführten, bis sie um zwei Uhr beim ersten Vespergebimmel röckeraschelnd wieder in der Kirchtür verschwanden. Dann war auch das wieder vorbei. Damals gingen wir Offiziere in keine Messe. Das begann erst nach der Restauration. Von da an war es großer Regimentsdienst. Das ganze Offizierskorps mußte erscheinen. In kleinen Garnisonen war das übrigens die einzigste Abwechslung eines gleichförmigen Daseins. Aber unter dem Kaiser gab es das noch nicht, damit auch nicht die geringste Aussicht, sich an die besseren Mädchen der Stadt heranzupirschen. Traumgestalten gleich schwebten sie an uns vorüber. Verbotene Früchte, sorgsam eingezäunt! Wenn es wenigstens eine Entschädigung dafür gegeben hätte! Aber die Paradiese, von denen man in der guten Gesellschaft nicht spricht, waren ungenießbar, und die Kaffeehäuser so armselig, daß wir unsere schöne Uniform geschändet hätten, wenn wir in eines davon gegangen wären. Damals gab es in diesem Städtchen, in das heute wie überall ein gewisser Prunk eingezogen ist, nicht einmal einen halbwegs anständigen Gasthof, in dem wir eine Offizierstafel hätten gründen können. Die vorhandenen Kneipwirte beutelten uns nur aus, so daß wir auf eine gemeinsame Mahlzeit verzichteten und uns bei minderbemittelten Bürgerfamilien Wohnung und Verpflegung suchten. Das kostete immer noch genug, denn die lieben Leutchen nutzten diese Gelegenheit aus, ihren kärglichen Mittagstisch oder ihre mäßigen Einkünfte durch uns möglichst zu verbessern. Ich machte es wie die anderen. Ein Kamerad von mir wohnte in dieser Gasse hier, in der Post. Sehen Sie, dort, ein paar Häuser weiter, da war sie früher. Bei Tage sieht man die altertümliche vergoldete Sonne über der Einfahrt. Mein Freund mietete mir eine Stube in dem Hause da drüben, mit dem Fenster dort, das mir vorkommt, als wäre es noch immer das Fenster meiner Wohnung. Ich ließ mich von meinem Kameraden dorthin einquartieren. Er war älter als ich, schon länger im Regiment, und er gefiel sich darin, mich in meiner Unerfahrenheit, die mehr Gleichgültigkeit war, zu bemuttern. Ich habe bereits erwähnt, daß mir alles einerlei war. Ich lebte in der einzigen Hoffnung, recht bald die Kanonen donnern zu hören und im ersten Gefecht meine militärische Jungfernschaft zu verlieren. Verzeihen Sie mir diesen Landsknechtsausdruck! Sie in unserer schlappen Zeit der Friedenskongresse und Humanitätsduselei, Sie können dergleichen kaum noch verstehen. Ich indes stand ganz im Bann jener kriegerischen Tage. Ich lebte in meinen Träumen. Lebt doch der Mensch überhaupt mehr in seinem eingebildeten denn im wirklichen Dasein. Dabei lebte ich wie eine fromme Seele für ein Jenseits wie ein Mönch. Der Soldat hat ja manches gemein mit dem Mönch. So war ich beides. Außer den Mahlzeiten, die ich mit meinen Wirtsleuten einnahm, und den Stunden, die der Dienst beanspruchte, lag ich die meiste Zeit in meiner Stube auf einem riesigen blauen Ledersofa, das mich besonders, wenn ich vom Exerzieren heimkam, wie ein kaltes Bad berührte. Zuweilen ging ich zu meinem Kameraden in die Post, um mit ihm zu fechten oder Ecarté zu spielen. Ludwig von Meung – so hieß er – war nicht solch ein Träumer wie ich. Er hatte unter den Grisetten der Stadt eine nette kleine Maus aufgegabelt, die ihm die Zeit totschlagen half. Was ich bis dahin mit Weibern erlebt hatte, in den paar freien Stunden auf der Kriegsschule, das war zu wenig verlockend, als daß ich mir ein Beispiel an ihm hätte nehmen wollen. Zudem gibt es Naturen, deren wahre Sinnlichkeit erst spät erwacht.
Nun aber zu meinen Wirtsleuten! Ein biederes Spießbürgerpaar. Mann wie Frau schon bejahrt. Beide nicht ohne Lebensart. Besonders mir gegenüber waren sie von einer Artigkeit, wie man sie heutzutage unter solchen Leuten vergebens sucht und die einen wie altmodischer Lavendelduft anmutet. Übrigens war ich damals noch nicht in den Jahren, wo man Menschenbeobachter ist. Die beiden Alten waren mir viel zu gleichgültig, als daß es mir eingefallen wäre, in ihre Vergangenheit eindringen zu wollen. In der oberflächlichsten Weise verbrachte ich täglich zwei Stunden mit ihnen, mittags und abends bei Tisch. Unsere Unterhaltung bildete gewöhnlich der Stadtklatsch, den sie mir beibrachten, wobei der Mann sein Vergnügen daran hatte, alle Welt ein bißchen zu verlästern, während seine überaus fromme Ehehälfte mehr Zurückhaltung, aber doch das gleiche Behagen am Gerede bewies. Von sich selbst sprachen sie nicht. Indes vermeinte ich aus allerlei herausgehört zu haben, daß der Mann in jungen Jahren, ich weiß nicht in welchem Auftrag und zu welchem Zweck, in die weite Welt gegangen und nach langen Jahren zurückgekommen war, um die Frau zu heiraten, die auf ihn gewartet hatte. Wie gesagt, es waren zwei anständige höfliche alte Leute, die ein geruhsames Dasein führten. Die Frau strickte den lieben langen Tag Strümpfe für ihren Mann; und er, ein Musiknarr, fiedelte in einem Dachstübchen, grade über meinem Zimmer, auf seiner Geige altmodische Stücke. Vermutlich hatten sie bessere Zeiten gesehen, und um irgendeinen Geldverlust wettzumachen, waren sie Vermieter geworden. Aber abgesehen davon, machte sich dies in keiner Weise bemerkbar. Denn alles im Hause deutete auf altmodischen Wohlstand, der Überfluß an duftender Wäsche, das schwere Silberzeug und die großen Möbelstücke. Ich fühlte mich wie zu Haus. Auch die Küche war gut. Bei Tisch bediente uns eine alte Dienerin namens Olivia. Ich nahm mir die Freiheit, sofort nach der Mahlzeit aufzustehen.
Ich wohnte ungefähr ein halbes Jahr in dieser Einsiedelei, als ich eines Mittags beim Eintritt in das Eßzimmer ein hochgewachsenes junges Mädchen erblickte. Obgleich mir meine Wirtsleute nie ein Wort von dem Vorhandensein dieses Wesens berichtet hatten, sah ich doch sofort an ihrem Benehmen, daß sie in das Haus gehörte. Offenbar war sie eben von einem Spaziergang heimgekommen. Sie stand auf den Fußspitzen und hing ihren Bänderhut an einen Haken in der Ecke auf. Der Haken war in beträchtlicher Höhe eingeschlagen, und so mußte sie sich sehr recken. Dabei verriet sich ihr ganzer herrlicher Wuchs. Sie stand da wie die Mänade des Skopas. Ein grünseidenes Mieder umschloß ihre Taille; seine Fransen hingen über ihren weißen Rock, der nach der damaligen Mode um die Hüften eng zusammengezogen war. Man scheute sich damals nicht zu zeigen, was man hatte. Als sie mich wahrnahm, wandte sie den Kopf halb um, so daß ich ihr Gesicht sehen konnte. Die Arme aber behielt sie weiterhin hoch. Ohne sich im geringsten durch mich stören zu lassen, ordnete sie die Bänder, damit sie nicht gedrückt würden. Das tat sie langsam, bedächtig, beinahe, als ob sie mich ärgern wollte. Denn ich stand doch wartend da, um mich ihr vorzustellen. Endlich tat sie mir die Ehre an, mich richtig anzusehen, mit einem Paar schwarzen kühlen Augen, unter den Locken ihres über die Stirn fallenden kurz geschnittenen Titushaares. Wer ist dies junge Mädchen? fragte ich mich erstaunt. Noch niemals hatten wir einen Tischgast gehabt. Und sie war doch gewiß zum Essen gekommen, denn der Tisch war für vier gedeckt.
Da kamen die beiden Alten herein und stellten sie mir als ihre Tochter vor, die aus dem Internat zurückgekehrt sei, um fortan unser Stillleben zu teilen. Ich war sprachlos. Ihre Tochter! Diese Leute hatten solch eine Tochter! Selbstverständlich meine ich das nicht im physiologischen Sinn. Denn ich weiß und Sie gewiß auch, daß die hübschesten Mädels der Welt von wer weiß was für Eltern stammen können. Es kommt vor, daß der grundhäßlichste Mensch das bildschönste Geschöpf in die Welt setzt. Aber hier! Das war ein Rassenunterschied, der die Junge von den Alten sonderte. Physiologisch betrachtet – um mich nochmals dieses stolzierenden Schulmeisterausdruckes zu bedienen, den Ihre Zeit geprägt hat, nicht die meine! –, also physiologisch betrachtet, erkannte man den Unterschied schon in ihrer Haltung. Über ihrem ganzen Wesen lag eine bei solcher Jugend äußerst seltene Gemessenheit, um diese schwer in Worte zu fassende eigene Art so zu nennen. Unter die sogenannten schönen Weiber, die man gern sieht und gleich wieder vergißt, gehörte sie nicht. Es war etwas so Besonderes an ihr, daß sie auf den ersten Blick nicht bloß völlig anders erschien als ihre Eltern, sondern überhaupt völlig anders als alle Menschen. Sie mußte anders sein in ihren Gefühlen und Empfindungen, in ihrem Leben und ihren Leidenschaften. Man stand vor ihr wie vom Mond gefallen. Kennen Sie von Velasquez die Infantin mit dem Wachtelhund? Ungefähr so sah sie aus. Nicht hochmütig, nicht verächtlich öder geringschätzig. Nein, nur gründlich gleichgültig. Menschen, die sich hochmütig oder geringschätzig benehmen, geben sich doch immer noch die Mühe, sich mit uns in Vergleich zu setzen. Aber solche Gleichgültigkeit leugnet einfach unsere Gegenwart. Das war der Ausdruck ihres ganzen Wesens. Noch heutigentags stehe ich vor der unbeantwortbaren Frage, die sich mir von der ersten Stunde an aufdrängte: Wie ist dieses feine schlanke Geschöpf zu diesem Vater gekommen, zu diesem behäbigen, redseligen, geschmacklos gekleideten Spießbürger mit Doppelkinn, Speckbuckel und Fettwanst? Und wenn man vom Mann absah – denn auf den Ehegatten kommt es ja in solchen Fragen schließlich nicht an –, so sah die Frau ebensowenig aus, als könne sie die Erzeugerin Albertinens gewesen sein. Albertine, so hieß die rassige Herzogin, die wie zu Spott und Hohn vom Himmel herabgefallen sein mußte, in die Mitte dieses ehrsamen, blöden, ihr wesensfremden Philisterehepaares.
Alberte, wie sie der Kürze halber genannt wurde, erschien mir von Anfang an als eine wohlerzogene, für gewöhnlich schweigsame junge Dame. Wenn sie zuweilen etwas zu sagen hatte, sprach sie dies in gut gewählten, aber sehr knappen Worten aus. Dann schwieg sie wieder. Überdies hätte sie noch so geistvoll sein können – ich weiß nicht, wes Geistes Kind sie war –, es wäre bei unseren Tischgesprächen verborgen geblieben, denn wir redeten lediglich über das Wetter. Mit dem Stadtklatsch war es seit ihrer Ankunft aus.
Allmählich verlor die junge Dame, die mich zuerst so sehr in Verwunderung gesetzt hatte, ihre Anziehungskraft mir gegenüber, da sie aus ihrer Teilnahmslosigkeit nicht herausging. Wäre sie mir in meinem Gesellschaftskreise begegnet, so hätte mich ihre Gleichgültigkeit unbedingt aus dem Gleichgewicht gebracht. So aber war sie mir ein Wesen, das man nicht begehrt, weder im Ernst noch im Spiel. Ich war Mietsgast im Hause ihrer Angehörigen und demgemäß ihr gegenüber in einer heiklen Lage, die durch eine Geringfügigkeit unmöglich werden konnte. Sie stand mir weder nah noch fern genug, um mir etwas sein zu können. Und so kam es ganz ungezwungen und unwillkürlich, daß ich ihrer Unpersönlichkeit mit vollkommenem Gleichmut begegnete.