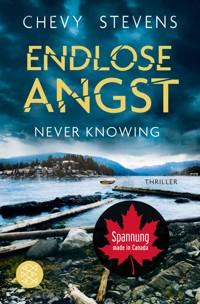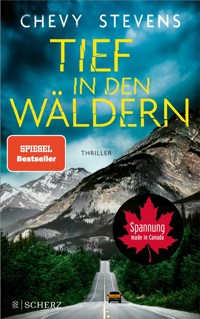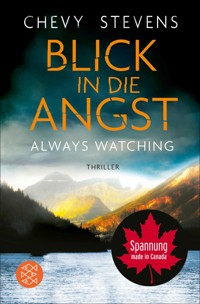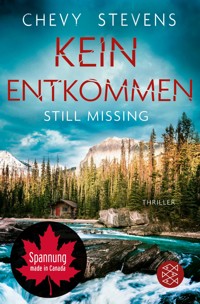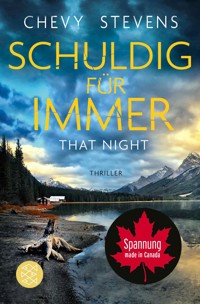
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kanada-Thriller
- Sprache: Deutsch
Wenn du sie nicht getötet hast, wer dann? Sie haben dich verurteilt. Wegen Mordes an deiner Schwester. Du weißt nicht, was in jener Nacht geschehen ist. Aber du weißt, dass der wahre Mörder irgendwo dort draußen sein muss. Und jetzt kommst du frei. Als die rebellische Toni achtzehn Jahre alt ist, wird ihre jüngere Schwester Nicole unten am See ermordet. Man verurteilt Toni und ihren Freund Ryan dafür. Jahre später wird Toni auf Bewährung entlassen. Sie will nur eines: ein neues Leben beginnen. Doch was damals geschehen ist, ist noch lange nicht vorbei. »Vorsicht, dieser Thriller wird Sie in den Bann schlagen!« Karin Slaughter »Mitreißend von der ersten Seite an.« Harlan Coben »Intensiv und verstörend – ein großartiger psychologischer Thriller.« Lee Child
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Chevy Stevens
That Night - Schuldig für immer
Thriller
Über dieses Buch
Als die rebellische Toni achtzehn Jahre alt ist, wird ihre jüngere Schwester Nicole am See ermordet. Man verurteilt Toni und ihren Freund Ryan dafür. Fünfzehn Jahre später wird Toni auf Bewährung entlassen. Sie will nur eines: ein neues Leben beginnen. Doch was damals geschehen ist, ist noch lange nicht vorbei …
»Chevy Stevens in Hochform mit einer adrenalingeladenen Story, die zwei Zeitebenen verwebt – eine fesselnde emotionale Achterbahnfahrt.« Jennifer McMahon, New York Times-Bestsellerautorin
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Chevy Stevens ist die einzige Kanadierin unter den internationalen Top-Thrillerautor:innen. Sie lebt in Nanaimo auf Vancouver Island mit seiner beeindruckenden Natur. Ihre eindrücklichen Thriller um Frauen, die ums Überleben kämpfen, stehen weltweit auf den Bestsellerlisten. Chevy Stevens ist auf einer Ranch aufgewachsen und liebt Wandern, Paddeln und Zelten mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren Hunden.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel ›That Night‹ im Verlag St. Martin's Press, New York.
© Chevy Stevens / René Unischewski 2014
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main 2015
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Arcangel / Evelina Kremsdorf
ISBN 978-3-10-400680-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
1. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver März 2012
2. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Januar 1996
3. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver März 1998
4. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Januar 1996
5. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver März 1998
6. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Januar 1996
7. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver Juni 1998
8. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Februar 1996
9. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver März 2010
10. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Mai 1996
11. Kapitel
Echo Beach Freigängerhaus, Victoria März 2012
12. Kapitel
Campbell River Juli 1996
13. Kapitel
Echo Beach Freigängerhaus, Victoria Januar 2013
14. Kapitel
Campbell River August 1996
15. Kapitel
Campbell River Mai 2013
16. Kapitel
Campbell River August 1996
17. Kapitel
Campbell River Mai 2013
18. Kapitel
Campbell River September 1996
19. Kapitel
Campbell River Juni 2013
20. Kapitel
Campbell River Juni 2013
21. Kapitel
Campbell River Juni 2013
22. Kapitel
Campbell River Juni 2013
23. Kapitel
Campbell River Juni 2013
24. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver Juli 2013
25. Kapitel
Campbell River Juli 2013
26. Kapitel
Campbell River Juli 2013
27. Kapitel
Campbell River Juli 2013
28. Kapitel
Campbell River Juli 2013
29. Kapitel
Campbell River Juli 2013
30. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver Juli 2013
31. Kapitel
Campbell River Oktober 2013
Dank
Für alle Menschen auf der Welt, die Tieren helfen – in Tierheimen, Tierschutzgruppen oder indem sie bedürftige Tiere aufnehmen. Danke.
1. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver März 2012
Ich folgte dem begleitenden Beamten zum Aufnahme- und Entlassungsbereich, den Pappkarton mit meinen Habseligkeiten unterm Arm – eine Jeans, ein paar abgetragene T-Shirts, die wenigen Dinge, die ich über die Jahre angesammelt hatte, heißgeliebte Bücher, meinen CD-Player. Der Rest, alles, was für mich aufbewahrt worden war, wartete auf mich. Ein Beamter ging die Formulare durch. Meine Hand zitterte, als ich die Entlassungspapiere unterschrieb, und die Worte verschwammen. Aber ich wusste, was sie bedeuteten.
»Okay, Murphy, dann sehen wir uns doch mal Ihren persönlichen Besitz an.« Die Wachen drinnen riefen einen immer beim Nachnamen, nie beim Vornamen. Immer nur beim Nachnamen oder einem Spitznamen.
Er leerte einen Karton mit den Gegenständen aus, mit denen ich ins Gefängnis gekommen war. Mit leiernder Stimme listete er sie auf und machte sich dazu auf seinem Klemmbrett Notizen. Ich starrte die Anzughose, die weiße Bluse und den Blazer an. Ich hatte sie so sorgfältig für den Prozess ausgesucht, weil ich dachte, ich würde mich darin stark fühlen. Jetzt konnte ich ihren Anblick nicht ertragen.
Die Hand des Beamten ruhte einen Moment auf meiner Unterwäsche.
»Eine weiße Unterhose, Größe S.«
Er schaute auf die Unterhose herunter, überprüfte das Etikett, befummelte den Stoff. Ich wurde rot. Er warf mir einen kurzen Blick zu, um meine Reaktion abzuschätzen. Er wartete darauf, dass ich austickte, damit er mich wieder zurückschicken konnte, doch ich ließ mir nichts anmerken.
Er öffnete einen Briefumschlag, spähte hinein, warf noch einmal einen prüfenden Blick auf sein Klemmbrett, ehe er den Inhalt des Umschlags in meine ausgestreckte Hand fallen ließ. Die versilberte Uhr, die meine Eltern mir zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hatten. Sie glänzte immer noch, doch die Batterie war leer. Die Halskette, die ich von Ryan bekommen hatte. Der schwarze Onyx fühlte sich kühl an, und das Lederband war ganz weich geworden, weil ich es jeden Tag getragen hatte. Ich starrte den Anhänger an, spürte sein Gewicht in meiner Hand, dachte an damals. Dann schloss ich die Finger darum und stopfte die Kette sicher zurück in den Umschlag. Sie war das Einzige, das mir von ihm geblieben war.
»Sieht so aus, als wär’s das.« Der Beamte hielt mir einen Stift hin. »Unterschreiben Sie hier.«
Ich unterschrieb das letzte Formular und verstaute meine Besitztümer wieder im Karton.
»Haben Sie irgendetwas zum Anziehen?«, fragte er.
»Nur das hier.«
Sein Blick huschte über meine Jeans und das T-Shirt. Manche Insassen bekamen von ihren Familien Klamotten zugeschickt, die sie an ihrem Entlassungstag anziehen konnten. Mir hatte niemand etwas geschickt.
»Sie können in der Anmeldung warten, bis Sie abgeholt werden. Da ist auch ein Telefon, falls Sie jemanden anrufen müssen.«
Ich setzte mich auf eine der Bänke, die Kartons zu meinen Füßen, und wartete auf die ehrenamtliche Betreuerin, Linda. Sie würde mich abholen und mit mir zur Fähre und rüber nach Vancouver Island fahren. Um siebzehn Uhr musste ich im Freigängerhaus in Victoria sein. Linda war eine nette Lady in den Vierzigern, die in einer der Unterstützergruppen mitarbeitete. Ich hatte sie schon vorher kennengelernt, als sie mich für meine Hafturlaube auf die Insel gebracht hatte.
Ich hatte Hunger – heute Morgen war ich zu aufgeregt gewesen, um viel zu essen. Margaret, eine meiner Freundinnen drinnen, hatte mich dazu genötigt, etwas herunterzubringen, und jetzt lag mir der Haferbrei wie ein Klumpen im Magen. Ob Linda wohl irgendwo unterwegs anhalten konnte? Ich malte mir einen Big Mac und Pommes aus, vielleicht einen Milchshake dazu, und ich dachte wieder an Ryan und daran, wie wir unsere Burger immer zum Strand mitgenommen hatten. Um mich von der Erinnerung abzulenken, beobachtete ich, wie ein Beamter eine neue Insassin brachte. Eine junge Frau. Sie wirkte verängstigt und blass, ihr langes, braunes Haar war zerzaust, als sei sie die ganze Nacht wach gewesen. Sie sah kurz zu mir, ihr Blick wanderte von meinem Haar auf das Tattoo an meinem Oberarm. Ich hatte es mir nach und nach stechen lassen – schmale Tribals für jedes Jahr hinter Gittern, die zusammen ein dickeres, durchgehendes Band um meinen Bizeps bildeten und ihn umschlangen.
Der Beamte zerrte die Frau am Arm zur Aufnahme.
Ich rubbelte mir mit den Händen über den Kopf. Mein Haar war jetzt kurz, in der Mitte Iro-mäßig aufgerichtet, aber es war immer noch schwarz. Ich schloss die Augen und dachte daran, wie es auf der Highschool gewesen war. In langen Wellen war es mir bis auf den Rücken gefallen. Ryan hatte es geliebt, seine Hände darin zu vergraben. Im Gefängnis hatte ich es abgeschnitten, nachdem ich eines Tages in den Spiegel geschaut und Nicoles Haar darin gesehen hatte, klebrig von Blut, und mich daran erinnerte, wie ich ihren zerschlagenen Körper in den Armen gehalten hatte, als wir sie in jener Nacht fanden.
»Na, bereit, diesen Ort zu verlassen, Toni?«, fragte eine freundliche Frauenstimme.
Ich öffnete die Augen und blickte zu Linda auf. »Ich kann’s kaum erwarten.«
Sie bückte sich und hob einen meiner Kartons auf, wobei sie leise stöhnte. Linda war eine kleine Frau, nicht sehr viel größer als ich, und ich war mit einem Meter zweiundfünfzig ziemlich kurz geraten. Margaret sagte immer, ein Mäusefurz könne mich umpusten. Aber Linda war fast so breit wie hoch. Sie hatte Dreadlocks, trug lange, fließende Kleider und Birkenstocks und schimpfte ständig über das Gefängnissystem. Ich folgte ihr hinaus zu ihrem Auto, meinen Karton in den Armen, während sie irgendwas vom Fährverkehr plapperte.
»Bis raus zur Horseshoe Bay war der Highway frei, wir werden also gut vorankommen. Wir sollten gegen Mittag da sein.«
Als wir davonfuhren, beobachtete ich, wie das Gefängnis in der Ferne immer kleiner wurde. Ich drehte mich wieder um. Linda kurbelte das Fenster herunter.
»Puh, echt heiß heute. Ehe man es sich versieht, ist der Sommer da.«
Ich zeichnete die Linien meines Tattoos nach, zählte die Jahre und dachte zurück an jenen Sommer. Jetzt war ich vierunddreißig, und ich hatte seit meinem achtzehnten Lebensjahr in Gewahrsam verbracht, seit man Ryan und mich für den Mord an meiner Schwester verhaftet hatte. In jener Nacht waren wir mit ihr allein gewesen, aber wir hatten Nicole nicht schreien gehört. Wir hatten gar nichts gehört.
Ich umklammerte meinen Arm mit der Hand und drückte kräftig. Fast mein halbes Leben hatte ich hinter Gittern verbracht, für ein Verbrechen, das ich nicht begangen hatte.
Die Wut vergeht niemals.
2. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Januar 1996
Ich schwänzte die letzte Stunde und traf mich mit Ryan auf dem Parkplatz hinter der Schule, wo das coole Partyvolk herumhing. Neben dem Café in der Arena war es der einzige Ort auf dem Schulhofgelände, an dem wir rauchen konnten. Den nächsten Anwohnern gefiel es nicht, aber sie machten uns selten Ärger, solange niemand seinen Motor aufheulen ließ oder den Ghettoblaster voll aufdrehte. Dann kämen die Cops vorbei, um zu überprüfen, ob wir tranken oder kifften – was irgendwer eigentlich immer machte, aber ich nicht, jedenfalls nicht in der Schule.
Die Woodbridge High war alt und hätte eine gründliche Renovierung dringend nötig gehabt. Die Mauern waren von einem verwaschenen Blau, zumindest dort, wo sie nicht von Graffiti bedeckt waren, die der Hausmeister ständig wegzumachen versuchte. Mehr als fünfhundert Jugendliche besuchten die Schule von der achten bis zur zwölften Klasse. In meinem Abschlussjahrgang waren über hundertzwanzig Schüler, von denen mir neunundneunzig Prozent schnurzegal waren.
Heute waren wir nur wenige, grüppchenweise standen wir um unsere Autos herum. Die Mädchen mit ihren langen Haaren und hochtoupierten Ponys trugen zu viel dunkles Make-up und die Lederjacken ihrer Freunde. Die Jungs mit ihren Kurt-Cobain-Frisuren und ihren Kapuzen hockten auf ihren Trucks und redeten über Vergaser und Hemi-Motoren. Die meisten von uns waren grungemäßig gekleidet mit Flanellhemden, zerrissenen Jeans, zerlumpten Pullovern, und alle trugen dunkle Farben.
Ryan lehnte an seinem Truck und unterhielt sich mit ein paar Freunden. Als er mich sah, lächelte er und gab mir seine Kippe. »Hey, Babe.«
Ich lächelte zurück und nahm einen Zug. »Hey.«
Seit letztem Juli war ich mit Ryan Walker zusammen, seit es in der Kiesgrube zwischen uns gefunkt hatte, dort, wo die Jungs am Wochenende immer mit ihren Geländewagen rumgurkten und Lagerfeuer machten. Er fuhr einen coolen Chevy-Truck, an dem er die ganze Zeit herumbastelte – das Einzige, worüber wir uns je stritten. Ich kannte ihn schon eine ganze Weile und hatte ihn schon immer süß gefunden mit dem braunen, zerzausten Haar und den dicken Brauen, den fast schwarzen Augen mit den langen Wimpern und einem umwerfenden Lächeln, bei dem sich nur die eine Hälfte vom Mund hob. Und dieser Blick, mit dem er einen unter dem Rand seiner Baseballkappe hervor ansah, war einfach supersexy. Ein paar Monate lang hatte er eine Freundin gehabt, eine blonde Tussi. Nachdem sie sich getrennt hatten, schien er sich für niemand anders zu interessieren, als würde er lieber sein eigenes Ding machen oder mit den Jungs abhängen. Er hatte den Ruf, ziemlich hart drauf zu sein, und das fand ich cool. Er prügelte sich nicht grundlos, aber wenn jemand den großen Macker raushängen ließ oder Mist über seinen Dad erzählte, der, seit Ryan klein war, immer wieder mal im Knast saß, machte er denjenigen fertig. Wenn er nicht mit mir zusammen war, verbrachte er seine Zeit meistens mit seinen Freunden, schraubte mit ihnen zusammen an den Trucks herum, angelte oder raste mit dem Geländemotorrad oder Quad durch die Gegend.
Sehr viel mehr gab es auch nicht zu tun. Campbell River ist ein kleiner Küstenort am Nordende der Insel, keine Ahnung mit wie vielen Einwohnern. Ich war dort aufgewachsen, aber Ryans Familie war erst vor zwei Jahren aus dem Norden von British Columbia hierhergezogen. In Campbell River arbeitete man entweder als Holzfäller, in der Papiermühle, den Minen oder auf einem Fischerboot. Ryan jobbte stundenweise in einem der Läden für Outdoorbedarf. Früher war ich dort manchmal hingegangen und hatte getan, als sähe ich mich um, wobei ich vor allem versuchte, seinen Blick einzufangen. Doch er war immer damit beschäftigt, Kunden zu bedienen, so dass ich es schließlich aufgab.
Eines Abends im letzten Sommer war ich mit Freunden zusammen in der Kiesgrube gewesen, wir hatten abgehangen und einen Joint geraucht, als Ryan zu uns kam und anfing, sich mit mir zu unterhalten. Er fragte mich, wie mein Sommer so sei. Ich versuchte, cool zu bleiben, als wäre das gar nichts Besonderes, aber mein Herz pochte wie verrückt. Er sagte: »Hast du Lust, ’ne Runde mitzufahren?« Wir rasten die Kiesabhänge hoch, der Matsch spritzte hinter uns hoch, der Motor war genauso laut wie die Musik – AC/DC, Back in Black. Ich lachte, fühlte mich lebendig und erregt. Er sagte: »Du bist echt total cool.« Später am Lagerfeuer nippten wir zusammen am Southern Comfort, sein Arm ruhte warm an meinem Rücken, während wir über unsere Familien sprachen, über meine ständigen Streitereien mit meiner Mutter und seine Probleme mit seinem Dad. Seit dem Abend waren wir zusammen.
Ich inhalierte den Rauch. Ryan lehnte an seinem Truck, beobachtete mich und lächelte sein träges Lächeln. Ein Auge war halb geschlossen, das Haar lugte unter der Baseballkappe hervor. Seine Freunde hatten sich verzogen. Es war die erste Januarwoche und kalt, aber er trug keine Jacke, nur einen dicken braunen Pullover, der seine Augen aussehen ließ wie dunkle Schokolade. Er schob die Finger in die vorderen Taschen meiner Jeans und zog mich näher heran, bis ich an ihm lehnte. Er trieb nicht oft Sport, aber er leistete viel körperliche Arbeit – sein Körper war fest, die Bauchmuskeln hart. Er war einen Meter achtzig groß, so dass ich mich strecken musste, um ihn zu küssen. Wir knutschten eine Weile, der rauchige, bittere Geschmack des Tabaks auf unseren Zungen vermischte sich, sein unrasiertes Kinn kratzte an meinem. Wir hörten auf, uns zu küssen, und ich legte mein Gesicht in seine warme Halsbeuge, roch seinen Körpergeruch, spürte einen Schmerz in meinem ganzen Körper und wünschte, es gäbe für immer nur uns beide, so wie jetzt.
»Kannst du heute Abend kommen?«, flüsterte er mir ins Ohr.
Ich lächelte an seiner Haut. »Vielleicht.«
Obwohl ich Ende Dezember achtzehn geworden war, musste ich unter der Woche abends pünktlich zu Hause sein. Am Wochenende waren meine Eltern nicht ganz so streng – ich musste nur anrufen, wo ich hinwollte, damit sie wussten, dass mit mir alles in Ordnung war, aber ich durfte nicht die ganze Nacht wegbleiben, es sei denn, ich schlief bei einer Freundin. Meine Mutter war echt ein harter Brocken und machte einen Riesenstress, wenn ich nur eine Minute zu spät kam. Ich versuchte, so viel Zeit wie möglich mit Ryan zu verbringen, wir fuhren durch die Gegend, trieben es in seinem Truck, seinem Keller und wo wir sonst noch allein sein konnten. Nachdem wir zwei Monate zusammen waren, hatten wir das volle Programm durchgezogen – er war der erste Junge, mit dem ich je geschlafen hatte. Sein Dad saß in der Kneipe, seine Mutter, eine Krankenschwester, arbeitete in der Spätschicht im Krankenhaus. Wir rauchten einen Joint, dann machten wir auf seinem Bett herum. Im Hintergrund lief leise Nirvana, süßer Kerzenduft vermischte sich mit dem des Marihuanas. Ich war aufgeregt, in meinem Kopf drehte sich alles vom Kiffen. Ich rieb meinen Körper an seinem, meine nackte Brust lag warm auf seiner. Die restliche Kleidung zogen wir ganz schüchtern unter der Decke aus. »Möchtest du, dass ich aufhöre?«, flüsterte er.
»Nein«, sagte ich und starrte bewundernd in sein Gesicht. Wie konnte ein Junge nur so schön und seine Art zu sprechen, seine Stimme, die weichen Lippen, dunklen Augen, einfach alles, nur so verdammt sexy sein? Und ich fühlte mich ebenfalls schön, als richtige Frau, so wie er mich ansah, als könnte er nicht glauben, dass ich da war, in seinem Bett. Ich war nervös und verlegen, doch dann übernahm einfach mein Körper das Kommando, drängte und zog und packte ihn. Er stöhnte mir in den Mund, und ich hielt den Atem an, um nicht vor Schmerz aufzuschreien. Unsere Blicke ließen einander nicht los. Ich spürte, wie er sich in mir bewegte, und wusste, dass er der einzige Junge war, mit dem ich zusammen sein wollte, mit dem ich das hier tun wollte.
Hinterher war er total lieb, fragte, ob es mir gutgehe, brachte mir ein Handtuch und ein Glas Wasser. Wir kuschelten uns aneinander, ich legte den Kopf auf seine Brust und zeichnete seine Rippen mit den Fingern nach. Der feine Schweißfilm glänzte im Kerzenlicht, ich küsste die Narbe an seiner Seite, die geblieben war, nachdem sein Dad ihn aus dem Truck gestoßen hatte. Schüchtern sagte er: »Ich liebe dich, Toni.«
Ich hörte Gelächter und schaute nach links. Shauna McKinney und ihre Mädels hockten auf der Heckklappe des Trucks von einem der Typen. Ich hasste es, wenn sie hier herumhingen. Kim, Rachel und Cathy waren nicht ganz so schlimm wie Shauna, aber zusammen waren sie ein Haufen fiese Zicken; die Sorte »Geht-mir-alles-wo-vorbei-und-du-vor-allem«-Zicken. Shauna mit ihrem langen, kastanienbraunen Haar und den großen blauen Augen war hübsch und beliebt, trieb viel Sport und hatte einen superathletischen Körper.
Sie schien immer das aktuellste technische Spielzeug und ständig neue Klamotten zu haben, und sie war die Erste in unserer Klasse, die ein anständiges Auto hatte, einen weißen Chevrolet-Sprint, den ihr Dad ihr gekauft hatte. Sie strotzte vor Selbstbewusstsein und hatte etwas an sich, als würde sie sich von niemandem einschüchtern lassen. Klug war sie auch noch und hatte richtig gute Noten, aber hinter dem Rücken der Lehrer zog sie über diese her, so dass die anderen Jugendlichen sie trotzdem total cool fanden.
Die meisten Mädchen in unserem Jahrgang hatten entweder Angst vor ihr oder wollten unbedingt ihre Freundin sein, was meiner Meinung nach auf dasselbe hinauslief. Rachel Banks war ihre treuste Anhängerin. Früher als kleines Kind war sie ziemlich pummelig gewesen und hatte eine Menge einstecken müssen, selbst nachdem sie in der Highschool abgenommen hatte, doch dann fing sie an, mit Shauna abzuhängen, und die Leute hörten auf, sie zu ärgern. Sie war immer noch rundlich, hatte dichtes, glattes braunes Haar und trug ständig Minikleider mit Strumpfhosen oder kurze Karo-Röcke und Kniestrümpfe.
Kim Gunderson war eine zierliche Balletttänzerin und etwa so groß wie ich. Sie trug oft schwarze Kleidung, Leggins mit übergroßen Pullovern und coolen Stiefeln, und sie redete unglaublich schnell. Ich hatte Gerüchte gehört, sie sei lesbisch, aber keiner wusste das mit Sicherheit. Cathy Schaeffer war fast so hübsch wie Shauna, hatte langes, weißblondes Haar, blassgrüne Augen und eine gewaltige Oberweite. Cathy war verrückt und witzig und trieb es auf Partys ziemlich wild. Sie rauchte ebenfalls, weshalb die Mädchen überhaupt hierherkamen.
Ich kannte sie alle, so lange ich denken konnte, ich war sogar einmal mit Shauna befreundet gewesen. Als wir zwölf oder dreizehn gewesen waren, hatte sie sich einen Spaß daraus gemacht, ein Mädchen anzurufen und sie zu uns einzuladen, um sie dann zwei Stunden vorher erneut anzurufen und zu sagen, wir wollten doch nicht mehr, dass sie käme. Manchmal waren wir einfach auch weggegangen, kurz bevor das Mädchen kam. Shauna war ziemlich gut darin, andere Leute nachzumachen – einmal hat sie mit der Stimme eines anderen Mädchens einen Jungen angerufen und gesagt, sie sei total in ihn verknallt.
Als ich Shauna sagte, ich wolle diese Spielchen nicht länger mitspielen, sprach sie eine ganze Woche nicht mehr mit mir. Ich war am Boden zerstört, vor allem, wenn sie und ihre Freundinnen im Korridor an mir vorbeigingen, als würde ich gar nicht existieren, und dabei flüsterten und die Augen verdrehten. Jeden Tag kam ich weinend nach Hause. Schließlich kam Shauna nach der Schule zu mir und sagte, ich würde ihr fehlen. Ich war so erleichtert, dass ich vergaß, wie der Streit überhaupt angefangen hatte, vergaß, dass es mir nicht gefiel, wie sie die Leute behandelte.
Shauna war die Tochter eines Cops, Frank McKinney. Jeder kannte ihn. Er trainierte Baseball- und Hockeyteams und solche Sachen. Als wir noch jünger waren, war McKinney, wie die meisten Leute ihn nannten, nicht oft zu Hause, normalerweise war er auf dem Polizeirevier. Shaunas Mutter war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Shauna fünf war, und ihre Großmutter passte auf sie auf, aber sie war nicht sonderlich bei der Sache. Zum Geburtstag setzte sie uns Unmengen von Pommes und Hot Dogs vor, legte einen Film ein und verschwand für die nächsten Stunden in einem anderen Zimmer. Als Shauna zur Welt kam, waren Frank McKinney und seine Frau gerade achtzehn oder so. Er war ziemlich groß und breit, aber nicht fett, nur muskulös und hochgewachsen und stolzierte ziemlich selbstbewusst durch die Gegend. Er hatte einen Schnauzer wie Tom Selleck, eine tiefe Stimme, trug Sonnenbrillen und kaute Kaugummi, den er zwischen den Zähnen zerplatzen ließ. Selbst wenn er in Zivil war, merkte man ihm wegen seiner abgehackten Sprechweise den Cop an – er benutzte viele kurze Wörter und Abkürzungen und so was. Und man merkte, dass ihm sein Job echt wichtig war – er gab seine Uniform in die Reinigung, die Schuhe waren immer blankpoliert und der Streifenwagen immer sauber.
Manchmal hatte ich den Eindruck, er sei irgendwie einsam – er verbrachte viel Zeit allein, saß in der Küche und las ein Buch oder sah sich die Nachrichten an. Ich glaube nicht, dass er oft ausging, und mit den wenigen Frauen, die er kennenlernte, schien es nie lange gutzugehen. Uns allen tat es leid, dass Shauna keine Mutter hatte, und wir wussten, dass es sie ebenfalls bedrückte. Wir merkten es daran, wie sie mit unseren Müttern redete, wenn sie bei uns zu Hause war. Sie war höflich und liebenswürdig und half nach dem Abendessen beim Aufräumen, als wollte sie unbedingt, dass sie sie mochten.
Die meisten Jugendlichen hatten Angst vor McKinney, aber ich nicht. Mir tat er einfach nur leid, obwohl ich mir nie sicher war, warum. Wann immer ich über ihn nachdachte, kam mir stets dieses eine Bild in den Sinn, wie er stundenlang in der Küche saß, die Zeitung oder ein Buch vor sich, daneben eine Tasse Kaffee. Ab und zu blickte er auf und schaute aus dem Fenster, als wünschte er, er wäre da draußen in seinem Wagen, unterwegs auf Streife. Als wünschte er, er wäre überall, nur nicht in diesem Haus.
Als wir in die Highschool kamen, wurde ich es allmählich leid, dass Shauna ständig versuchte, den Rest von uns gegeneinander auszuspielen, indem sie behauptete, eine von uns hätte schlecht über die andere geredet, jemanden bei einer Einladung überging oder gemeine Bemerkungen über unsere Klamotten und Haare machte, um dann nachzuschieben: »War doch nur ein Witz!« Am nächsten Tag erzählte sie dir, du wärst ihre beste Freundin und schenkte dir eines ihrer Lieblingskleidungsstücke, Schmuck oder eine CD, die sie nur für dich gebrannt hatte, woraufhin die anderen eifersüchtig wurden. Gefühlt jede Woche gab es einen Wutanfall, und irgendjemand war wieder traurig. Außerdem hatte ich es satt, nicht anziehen zu können, was ich wollte – Jeans und T-Shirt anstatt Rock und Bluse, die Shauna zu unserer Uniform auserkoren hatte.
In der neunten Klasse bemerkte ich eines Tages Shauna gegenüber, dass mir ein Junge namens Jason Leroy gefiel. Sie sagte, sie würde mir helfen. Sie gab eine Party bei sich zu Hause und lud ein paar Jungs ein. Ihr Dad arbeitete, und ihre Großmutter sollte eigentlich aufpassen, aber sie verschwand mit einem Glas irgendwas und einem vagen »Viel Spaß, Kinder« im Fernsehzimmer. Vor der Party hatte Shauna mir erzählt, sie habe gehört, Jason würde mich mögen, aber er stünde eher auf »echte Frauen«. Sie sagte, ich müsste ihm unbedingt einen blasen, sonst wäre ich ein Feigling – sie hätten es alle schon getan. Auf der Party war ich ziemlich nervös, aber Jason lächelte mich ständig an und fragte mich, ob ich mit ihm in eines der Schlafzimmer gehen wollte. Nachdem wir ein wenig herumgealbert hatten, ließ er beiläufig fallen, dass ich ihm einen blasen solle. Als ich mich zierte, sagte er, Shauna habe ihm versprochen, dass ich es machen würde und dass er nur deswegen mit seinen Freunden gekommen sei. Wenn ich es nicht machte, würde er jedem erzählen, er habe es zu dritt mit Shauna und mir getrieben.
Nach der Party erzählte ich Shauna, was er gesagt und zu was er mich gezwungen hatte. Sie wurde wütend. Sie rief Jason an und sagte, wenn er irgendjemandem erzählte, was passiert war, würde sie jedem an der Schule erzählen, er hätte einen winzigen Schwanz. Wir hörten nie wieder etwas von ihm, aber später am selben Abend fing Shauna an zu kichern und gestand, dass keines der anderen Mädchen schon einmal einem Jungen einen geblasen hatte – ich war die Erste.
Ich war echt sauer, weil ich in die Falle aus Shaunas Lügen getappt war, aber ich versuchte, es zu vergessen, weil sie sich ja auch für mich eingesetzt hatte. Zum Teil genoss ich sogar meine neue Rolle als das sexuell erfahrenste Mädchen der Gruppe. Doch einen Monat später verknallte Shauna sich in Brody, einen Jungen aus meinem Werkkurs. Wir blieben oft noch länger, um an einem Projekt zu arbeiten, und eines Tages kam sie vorbei, als wir gerade über irgendetwas lachten. Ich stand nicht auf Brody und wollte nichts von ihm, aber das zählte nicht. Nach der Schule taten alle Mädchen, als würde ich nicht existieren. Also fragte ich Shauna, was los sei.
»Du hast mit Brody geflirtet.«
»Hab ich nicht! Ich finde ihn nicht mal besonders süß.«
»Er ist total süß, und du bist schon seit Wochen in ihn verknallt.«
Alle Mädchen standen da und starrten mich an.
Ich wusste, was sie wollte. Ich sollte mich entschuldigen, dann würde sie mich eine Weile ignorieren, bis sie beschloss, mir zu vergeben. Aber ich hatte die Schnauze voll von Shauna, von ihren Machtspielchen und Intrigen. Ich hatte genug.
»Du kannst mich mal, Shauna. Glaub doch, was du willst, aber es nicht meine Schuld, das Brody dich nicht mag. Nicht jeder fährt total auf dich ab, weißt du.« Ich ging davon. Hinter mir hörte ich die anderen nach Luft schnappen, dann folgte wütendes Geflüster.
Ich wusste, dass sie sich rächen würde, aber ich wusste nicht, wie schlimm es werden würde, bis ich am nächsten Tag zur Schule kam. Wie sich herausstellte, hatte Shauna den ganzen Abend damit zugebracht, das Gerücht zu verbreiten, ich sei mit einem Penis geboren worden und hätte versucht, mich an sie heranzumachen. Außerdem erzählte sie jedem Einzelnen, was ich jemals Schlechtes über sie oder ihn gesagt hatte – obwohl ich das meiste davon gar nicht selbst gesagt hatte, sondern einfach nur Shauna zugestimmt hatte. Nachdem sie damit fertig war, hatte ich mehrere Monate lang keine Freunde mehr und musste ständiges Gewisper und Angestarrtwerden ertragen. Ich schämte mich so sehr über meinen Loser-Status, dass ich meiner Familie nichts davon erzählte, obwohl meine Mutter mich ständig fragte, warum die Mädchen nicht mehr anriefen. Nicole, die jünger als ich war, aber auf dieselbe Schule ging, wusste, dass irgendetwas passiert war, und fragte mich danach, aber selbst ihr erzählte ich nichts. Meine Schwester war die einzige Person, die in der Schule mit mir sprach, ohne sie wäre ich noch einsamer gewesen.
Schließlich ließ ich einmal nach dem Sportunterricht in der Mädchenumkleide meine Hose runter und forderte die anderen auf, genau hinzuschauen. Eines der Mädchen, Amy, fand das lustig. Sie war ziemlich cool und zog sich wie ich gerne jungenhaft an – seit Shauna mich fallengelassen hatte, trug ich, was ich wollte, Militaryhosen und enge, schwarze T-Shirts oder klobige Armeestiefel zu ausgeblichenen Jeans und dazu ein Arbeitshemd meines Vaters. Am nächsten Tag stellte Amy beim Mittagessen ihr Tablett neben meins und sagte: »Mädchen mit Schwänzen fand ich immer schon gut.« Seitdem waren wir beste Freundinnen, aber es fiel mir schwer, anderen Mädchen zu vertrauen, nach dem, wie Shauna mich behandelt hatte – mit Jungs fühlte ich mich wohler.
Nach dieser Geschichte suchte Shauna sich andere Zielscheiben, freundete sich mit Cathy, Kim und Rachel an – die umgehend auf der sozialen Leiter aufstiegen – und beachtete mich jahrelang gar nicht. Manchmal war sie sogar halbwegs freundlich, sagte hallo oder lächelte, wenn sie vorbeiging. Doch dann fing das mit Ryan und mir an. Erst später fand ich heraus, dass Shauna jedes Wochenende in die Kiesgrube gegangen war, in der Hoffnung, sich ihn angeln zu können. Er hatte sie einmal nach Hause gefahren, als sie megabetrunken gewesen war, aber da war nichts passiert, obwohl sie es versucht hatte. Am nächsten Wochenende kamen Ryan und ich zusammen. Seitdem hasste sie mich, noch mehr als damals, als ich ihr wegen Brody blöd gekommen war.
Seit ich nicht mehr mit Shauna befreundet war, war ich Frank McKinney nur ein paarmal über den Weg gelaufen. Als er Ryan und mich eines Abends am See erwischte, hielt er uns eine gewaltige Predigt, aber schließlich beschlagnahmte er nur unseren Alkohol und befahl uns, nach Hause zu fahren. Im selben Sommer wurde Ryan dabei erwischt, wie er Benzin aus einem Holzlaster absaugte. McKinney nahm keine Anzeige auf, sondern ging nur mit ihm ins Gefängnis und führte ihn dort herum. Dann sagte er ihm, er solle zur Vernunft kommen und dass er ihn von nun an im Auge behalten würde. Und wir wussten, dass er das ernst meinte.
Ich war mir ziemlich sicher, dass McKinney nicht wusste, was Shauna nach dem Tod ihrer Großmutter in ihrer Freizeit trieb, wahrscheinlich glaubte er, sie würde zu Hause sitzen und lernen. Sie schien genug zu tun, um ihren Notendurchschnitt zu halten, obwohl sie sich zu meinem Ärger keine große Mühe zu geben brauchte, aber meistens hing sie mit ihren Freundinnen herum oder feierte.
Jetzt beobachteten mich die Mädchen von ihrem Platz auf dem anderen Truck, flüsterten miteinander und kicherten.
Ich schmiegte mich enger an Ryan und zog seinen Kopf für einen weiteren langen Kuss nach unten. Ich fuhr total darauf ab und schlang meine Arme fest um ihn. Ich liebte es, seine Hände an meinem Hintern zu spüren und lächelte unter seinen Lippen, als ich daran dachte, dass Shauna zuschaute.
Als ich wieder aufblickte, waren Shauna und die Mädchen verschwunden.
Am nächsten Tag stand ich nach der Schule auf dem Parkplatz und wartete rauchend neben seinem Truck auf Ryan, als ein Wagen so dicht neben mich fuhr, dass er mich beinahe streifte. Shauna in ihrem weißen Sprint.
»Hey, du Schlampe«, rief sie und stieg aus. Cathy und Kim kletterten vom Rücksitz, Rachel vom Beifahrersitz. Sie kreisten mich ein.
»Was hast du für ein Problem?«, fragte ich.
»Du bist mein Problem«, sagte Shauna.
Die Mädchen lachten. Ich musterte sie rasch. Rachel hatte einen fiesen, finsteren Blick aufgesetzt, und Cathy zeigte ihr breites, dümmliches Lächeln. Na klasse. Es gibt doch nichts Schöneres, als den Spielball für ein paar gehässige Zicken zu geben.
»Ich hab dir nichts getan«, sagte ich. »Ich kann nichts dafür, wenn Ryan keine billigen Tussen mag.«
Sie baute sich direkt vor mir auf, so nah, dass ich ihr Parfüm riechen konnte, irgendetwas Fruchtiges, wie Mandarine.
»Pass auf, was du sagst.«
»Sonst was?«
Sie hob die Arme und schubste mich. Ich stolperte gegen den Truck.
Ich ließ meine Zigarette fallen und schubste sie kräftig zurück. Und dann waren wir auch schon mittendrin, die Fäuste flogen, und wir zogen uns an den Haaren. Ich hörte andere Schüler schreien, als sie herbeirannten und uns anfeuerten. Die Mädchen schrien: »Mach sie fertig, Shauna!« Shauna war größer als ich und gewann rasch die Oberhand, aber ich schaffte es, mich zu befreien, und wollte sie gerade ins Gesicht schlagen, als sich ein Arm um meine Hüfte legte und mich hochhob.
»Hör auf damit«, hörte ich Ryans Stimme an meinem Ohr.
Ich war immer noch fuchsteufelswild und wischte mir die Haare aus dem Gesicht, als er mich wieder auf die Beine stellte. Ein anderer Typ zog Shauna fort. Ihre Freundinnen schrien mir Beleidigungen entgegen. Ryan schob mich in seinen Truck und warf meinen Rucksack auf den Rücksitz.
Er startete den Motor und versuchte zurückzusetzen. Shauna stand immer noch neben ihrem Auto.
»Was hängst du dich in Tonis Kämpfe rein?«, brüllte sie.
Er brüllte zurück: »Halt die Schnauze, Shauna.«
Sie zeigte ihm den Finger.
Wir fuhren zu Ryan nach Hause. Seine Mom arbeitete mal wieder Spätschicht, und sein Dad, Gary, wie ich ihn nennen sollte, saß übernächtigt vor dem Fernseher.
Als wir eintraten, blickte er auf. »Bring mir noch ein Bier, Ry.«
Ryan brachte es ihm. »Wir sind in meinem Zimmer.«
Sein Dad zwinkerte ihm zu. »Viel Spaß.«
Ich zuckte zusammen, aber es war nett, nicht schikaniert zu werden, was nicht heißen sollte, dass Ryans Dad seinem Sohn nicht oft genug das Leben schwermachte. Wenn Gary im Knast saß, dann meistens wegen Kneipenschlägereien oder weil er im Suff irgendetwas hatte mitgehen lassen. Ryan sagte, sein Vater habe keine langen Finger, sondern Whiskeyfinger. Wenn er richtig betrunken war, ging er ziemlich grob mit Ryan um. Im letzten Jahr hatten sie sich ein paarmal geprügelt – jetzt, wo Ryan größer und kräftiger war, schien sein Dad ihn noch häufiger fertigmachen zu wollen, als wolle er beweisen, dass er immer noch der Stärkere war. Gary arbeitete als Holzfäller, eine Saisonarbeit, doch Ryan erledigte alle Arbeiten rund ums Haus und half seiner Mom. Ich weiß nicht, warum sie Ryans Dad nicht schon längst verlassen hatte. Sie hieß Beth und schien eine nette Frau zu sein. Sie arbeitete viel, aber kümmerte sich immer noch um Ryan, strich ihm das Haar zurück und fragte ihn, ob er genug zu Abend gegessen habe oder mehr Geld für die Schule brauche. An der Art, wie sie über seine Witze lachte und ihn voll Stolz ansah, merkte man, dass sie ihren Sohn aufrichtig liebte.
Wir gingen in Ryans Zimmer, und ich warf mich aufs Bett, während er seinen Ghettoblaster einschaltete.
»Du darfst dich nicht von Shauna provozieren lassen«, sagte er.
»Sie hat angefangen.« Auf dem Heimweg hatte ich Ryan den Grund für den Kampf erklärt.
»Na und? Ignorier sie.«
»Klar, so wie du jemanden ignorierst, der dir das Leben schwermacht?«
»Bei Jungs ist das was anderes. Wenn bei uns jemand wen verprügelt, gibt der Verlierer danach Ruhe, aber Shauna fährt darauf ab, dich zur Weißglut zu reizen, und du gibst ihr genau das, was sie will. Wenn du sie ignorierst, machst du sie wütend.«
Ich starrte an die Decke und dachte über das nach, was er gesagt hatte. Es stimmte, je heftiger ich reagierte, desto mehr schien Shauna es zu genießen.
»Vielleicht hast du recht. Vielleicht verliert sie irgendwann die Lust.«
Er ließ sich neben mich fallen, drehte mit einem frechen Grinsen seine Baseballkappe zurück und begann, an meinem Hals zu schnuppern. Er schob sich auf mich und griff unter mein T-Shirt. Die rauen Hände fühlten sich kratzig auf der Haut an und schickten mir Schauder über den Rücken, so dass ich mich am liebsten ganz klein zusammengerollt hätte. Ich ließ mich vom harten Rhythmus der Heavy-Metal-Musik, seinen Berührungen, seinem warmen Mund davontragen. Ich würde nicht weiter an Shauna denken, würde sie nicht gewinnen lassen. Aber eine leise, zweifelnde Stimme konnte ich nicht zum Verstummen bringen. Würde sie mich jemals in Ruhe lassen?
3. Kapitel
Rockland Strafanstalt, Vancouver März 1998
Der Transporter hielt vor dem Gefängnis an. Ich saß hinten drin, mit Handschellen und Fußfesseln, wie ein Tier in einem Metallkäfig gefangen. Die Türen des Vans wurden geöffnet, und die Wachen packten mit festen Griffen meine Oberarme und führten mich hinaus. Ich schlurfte vorwärts und starrte entsetzt auf das imposante Gebäude. Es bestand ganz und gar aus grauem Beton, und die Mauern waren mit breiten, schmutzigen Streifen bedeckt, als wären riesenhafte Tränen an den Blöcken heruntergelaufen. Nato-Draht sicherte den dreieinhalb Meter hohen Metallzaun, der das gesamte Gebäude umgab, und auf den Türmen standen Wachen in Uniformen und mit Maschinenpistolen.
Fünfzehn Jahre. Die Worte hallten in meinem Kopf nach, aber ich konnte sie nicht wirklich begreifen, konnte mir nicht vorstellen, was diese Zeitspanne wirklich bedeutete. Sobald ich die Worte des Richters gehört und gewusst hatte, dass alle Hoffnung verloren war, war irgendetwas in mir zerbrochen und tief in mir verschwunden. Ich hatte das Gefühl, neben dem Geschehen zu stehen, als sähe ich einen surrealen Film. Mit einem Flugzeug brachte man mich nach Vancouver, und ich dachte daran, wie Ryan und ich geplant hatten, durch die Welt zu reisen. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, dass wir in seinem Truck gesessen und von unserer Zukunft geträumt hatten, von unserer großen Flucht. Wir wollten so dringend aus Campbell River weg, und jetzt hätte ich alles dafür gegeben, wieder dort zu sein, selbst wenn es bedeutet hätte, für immer dort zu bleiben.
Ich sah, wie die Münder der Beamten sich bewegten, aber ich konnte mich nicht auf das konzentrieren, was sie sagten, und sie mussten es wiederholen. Ich starrte auf meine Fußknöchel, als sie mich hineinführten. Schlurf, schlurf. Ich war mir bewusst, dass meine Hand- und Fußgelenke schmerzten, aber es war mir egal. Alles, was ich hören konnte, war das Rauschen meines Bluts und die Worte fünfzehn Jahre.
Man machte ein Foto von mir und gab mir eine Identitätsmarke. Anschließend stellte man mir ein Haufen Fragen, während einer der Beamten Formulare ausfüllte. »Denken Sie manchmal daran, sich selbst etwas anzutun?« »Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?« Ich verneinte jede Frage, aber ich hörte nur halb zu und war nur halb anwesend. In einem weiteren Raum befahlen zwei Beamtinnen mir, mich auszuziehen. Ich starrte sie nur an. Die mit dem gemeinen Gesichtsausdruck und dem schlechten Haarschnitt sagte: »Ziehen Sie sich aus!«
Ich hatte das alles schon zuvor durchgemacht, im Untersuchungsgefängnis, in dem ich auf die Anhörung zur Festsetzung der Kaution gewartet hatte. Ich hatte die ganze Zeit geweint wie ein Baby und vor Scham geschluchzt, als sie mir ihre Befehle entgegenbellten: »Heben Sie die Haare hoch, strecken Sie die Zunge heraus, heben Sie die Brüste, beugen Sie sich vor und husten Sie.« Als ich jetzt die Schikane und die Abneigung im Gesicht der Beamtin sah, löste ich mich allmählich aus meiner Schockstarre und begriff endlich, dass das die Realität war. Meine Schwester würde nie wieder nach Hause kommen, und ich war im Gefängnis. Doch dann fand ich etwas, an das ich mich klammern konnte, etwas, das ich aus vollem Herzen spürte. Ich empfand Wut. Sie rauschte in meinem Blut, heiß, schwer und dick.
Ich zog mich aus. Ich spreizte die Beine. Ich hustete. Und ich hasste sie. Ich hasste jede Person an diesem Ort, die es als gegeben hinnahm, dass ich schuldig war, jede Person, die im Gerichtssaal gesessen und sich unseren Prozess angeschaut hatte, als sei er eine Show, und ich hasste jede Person, die im Zeugenstand gelogen hatte. Doch am meisten von allen hasste ich denjenigen, der meine Schwester getötet hatte, der sie unserer Familie weggenommen, ihr die Möglichkeit geraubt hatte, erwachsen zu werden und eine Zukunft zu haben. Ich klammerte mich an diesen Hass und hüllte mich darin ein wie in eine glühende Decke. Niemand würde mir meine Wut nehmen können. Niemand würde mich je wieder verletzen.
Nach einer Entlausungsdusche reichte man mir ein paar frische Klamotten: vier Jogginghosen, vier Sport-BHs, viermal Unterwäsche, vier graue T-Shirts, zwei Sweatshirts und ein Paar Turnschuhe. Außerdem bekam ich einen Sack mit Bettzeug und ein kleines Paket mit Hygieneartikeln. Es war spät am Abend, und die anderen Frauen waren bereits in ihren Zellen. Wir gingen einen kalten, zugigen Korridor entlang, der Boden war metallisch-grau gestrichen, die Luft roch staubig und abgestanden wie der Tod. Ich war angespannt wie eine Sprungfeder, hielt jedoch den Kopf gesenkt und blickte in keine der Zellen, an denen wir vorüberkamen. Ich hörte das neugierige Tuscheln der Frauen und spürte, wie sie mich anstarrten.
Meine Gedanken huschten zu Ryan, und ich empfand einen scharfen Stich, einen Schmerz im Brustkorb, als ich mir vorstellte, welcher Horror ihm bevorstand. Er war ebenfalls in Rockland, aber im Männergefängnis auf der anderen Straßenseite. Wir durften einander nicht sehen, nicht einmal, sobald wir unter Auflagen draußen wären – was bedeutete, für den Rest unseres Lebens. Ich konnte die Vorstellung eines Lebens ohne Ryan kaum ertragen, konnte mir nicht ausmalen, wie ich das überleben sollte. Unsere einzige Hoffnung lag darin, unsere Unschuld zu beweisen. Der Anwalt hatte gesagt, er würde Berufung einlegen. Es konnte drei bis sechs Monate dauern, bis er auch nur einen Termin für eine Anhörung bekam, aber es gab vielleicht eine Chance. Ich hielt kurz den Atem an und pendelte von Hass zu Hoffnung.
Der Wachmann blieb vor einer Zelle stehen, steckte den Schlüssel ins Schloss und schob die Tür mit einem lauten Scheppern auf.
»Da sind wir, Murphy. Sie haben das obere Bett.« Ich trat ein, und er verschloss die Tür hinter mir mit einem weiteren lauten Scheppern.
Ich musterte meine Zelle. Sie war etwa drei mal vier Meter groß, mit einer Edelstahltoilette und einem Spiegel über einem kleinen Metallwaschbecken, alles völlig offen. Eine Wand war mit angeklebten Fotos bedeckt. Im unteren Bett lag eine spindeldürre Frau mit langen, glatten schwarzen Haaren und einem Buch in den Händen. Ihre Arme waren mit Narben und Tattoos bedeckt. Nie zuvor hatte ich so viele Tätowierungen bei einer Frau gesehen. Sie starrte mich an.
»Ich heiße Pinky«, sagte sie.
»Ich bin Toni.«
»Bist du dieses Mädchen aus dem Fernsehen? Die, die ihre Schwester umgebracht hat?«
Ich wurde rot und dachte an die Übertragungswagen der Nachrichtensender, die das Gericht belagert hatten, an die Kameras und Mikrophone, die man mir vor die Nase gehalten hatte.
Die Worte kamen ungewollt aus meinem Mund. »Ich bin unschuldig.«
Sie lachte, ein tiefes, rasselndes, verschleimtes Raucherlachen. »Hat dir noch niemand gesagt, dass wir hier drinnen alle unschuldig sind?«
Ich ignorierte Pinky, die immer noch lachte, als ich meine Bettwäsche aufzog. Dann kletterte ich hoch, rollte mich zu einer Kugel zusammen, die Tüte mit den Toilettenartikeln fest an den Bauch gepresst, für den Fall, dass sie versuchte, irgendetwas davon zu stehlen. Ich hätte mir gern das Gesicht gewaschen und die Zähne geputzt, aber ich war zu müde und hatte zu große Angst. Ich schloss die Augen und begann einzudämmern.
Pinkys Kopf tauchte auf, und sie packte mich am Arm. Ich versuchte, ihn zurückzureißen, doch sie hielt fest, mit Händen wie weiße Krallen mit langen Nägeln. Ihr mageres Gesicht sah im Dämmerlicht aus wie ein Schädel. Beinahe hätte ich laut aufgeschrien.
»Ich würde nicht herumlaufen und jedem erzählen, dass du unschuldig bist«, zischte sie. »Sie werden dich windelweich prügeln.«
Sie ließ mich los und verschwand wieder in der unteren Koje. Ich starrte zur Decke hinauf, mein Herz pochte, und ich spürte immer noch ihre Finger, die sich in mein Fleisch gebohrt hatten. Kurz darauf hörte ich sie schnarchen. Ich zog mir die dünne Decke über den Kopf, versuchte, das Geräusch auszublenden, versuchte, alles auszublenden.
In den ersten Tagen blieb ich für mich und versuchte, diese furchterregende neue Welt, in die man mich gestoßen hatte, zu durchschauen. Meine Stimmung schwankte zwischen hilflosem Zorn, bei dem ich am liebsten auf irgendetwas oder irgendwen eingetreten und eingeschlagen hätte, und Depression. Doch meistens empfand ich Angst, wann immer eine andere Insassin mich ansah, wann immer ich daran dachte, wie lange ich an diesem Ort würde bleiben müssen.
Das Gefängnis war alt und laut und beherbergte mehr als hundertachtzig Frauen in verschiedenen Sicherheitsstufen. Die Luft war miserabel, die Korridore und Treppen düster und eng. Alles, was man anfasste, fühlte sich kalt an, die Wände, die Gitterstäbe unserer Zellen, der Fußboden. Das Gefängnis war in vier Bereiche unterteilt. In einem Flügel herrschten nur minimale Sicherheitsvorkehrungen, für Frauen, die das geringste Risiko darstellten. Auf meiner Gebäudeseite gab es zwei Bereiche. Ich war dem A-Bereich zugeteilt worden, was einer mittleren Sicherheitsstufe entsprach. Beide Bereiche bestanden aus langen Doppelreihen mit etwa sechzig Zellen, wobei der B-Bereich nur etwa halb so groß wie der A-Bereich war, denn dort galt die höchste Sicherheitsstufe. In der anderen Hälfte von B lagen die Zellen für den Schutzgewahrsam und die Isolationszellen.
Wie betäubt saß ich da und versuchte, mir alles zu merken, was man mir in einem Einführungskurs zur allgemeinen Orientierung erzählte. Ich bekam ein Handbuch mit Informationen über Dinge wie Besuch, Telefonanrufe und Insassenkonten. Während der nächsten neunzig Tage würde man mich begutachten, mein Bewährungshelfer würde einschätzen, wie gefährlich ich war und was ich brauchte. Anschließend würde man einen Resozialisierungsplan für mich entwerfen. Alle waren höflich, geschäftsmäßig und verbindlich, und ich versuchte, auf das zu achten, was sie sagten, aber ein Teil von mir schrie ständig in meinem Kopf: Nein, ich bin nicht gemeint. Ich gehöre hier nicht her. Ich habe nichts falsch gemacht. Nicoles Mörder läuft immer noch draußen herum!
Es gab keine festgelegten Besuchstage, aber ich musste Formulare an jeden schicken, den ich auf meiner Besucherliste haben wollte. Außerdem musste ich ein Formular ausfüllen, damit mir eine Liste mit Telefonnummern genehmigt wurde. Die Kosten eines Anrufs würde entweder der Empfänger tragen, wenn ich ein R-Gespräch anmeldete, oder ich müsste eine Telefonkarte benutzen. Man sagte mir, es könne Wochen dauern, bis meine Telefonnummern- und Besucherliste genehmigt seien. Ich durfte so vielen Leuten schreiben, wie ich wollte, auch Ryan, was eine große Erleichterung war, aber die gesamte Post wurde kontrolliert. Ich durfte auch Bücher haben, aber nur eine begrenzte Menge Papier, und in jeder Zelle gab es große Stauboxen, in denen die Gefangenen ihre Habseligkeiten aufbewahren konnten. Jede Woche bekam man eine gewisse Anzahl Gesundheits- und Hygieneartikel ausgehändigt – alles andere musste man in der Kantine kaufen. Ich durfte mir auch einen Fünfzehn-Zoll-Fernseher zulegen, einen CD-Player und ein paar Kleidungsstücke wie Unterwäsche, Socken oder Jeans. Insgesamt durften die persönlichen Besitztümer in meiner Zelle den Wert von fünfzehnhundert Dollar jedoch nicht übersteigen. Wenn ich irgendeine Regel brach, würde ich bestraft werden, entweder mit einer Geldstrafe oder dem Entzug von Privilegien. Und wenn ich etwas richtig Schlimmes anstellte, käme ich in Einzelhaft. Die Zellen anderer Gefangener durfte ich nicht betreten, und ich durfte auch keinen körperlichen Kontakt zu anderen Gefangenen haben. Zu diesem Zeitpunkt war mir das völlig egal – es gab ohnehin niemanden, den ich hätte anfassen wollen. Es sollte Jahre dauern, bis ich feststellte, dass das Fehlen von Körperkontakt zu den Dingen gehörte, mit denen ich am schwersten fertigwurde.
Fürs Erste hatte ich Mühe, mich an die tägliche Routine und die ganzen Regeln zu gewöhnen. Die Wächter leuchteten mit ihren Taschenlampen spätabends und frühmorgens in die Zellen und weckten mich jedes Mal unsanft auf, nachdem ich endlich, unter der dünnen Decke zitternd, in einen unruhigen Schlaf gefallen war. Stündlich machten sie ihre Runden und förmliche Zählungen, die erste um fünf Uhr morgens. Dann wurden diejenigen, die in der Küche arbeiteten, nach unten geschickt, während der Rest von uns zu den Duschen hetzte. Nach dem Frühstück gingen die Frauen zur Arbeit und zu ihren Therapiegruppen oder lungerten in ihren Zellen und dem Gemeinschaftsbereich herum. Man bekam etwas Lohn für die Arbeit, fünf oder sieben Dollar am Tag. Solange sie nicht arbeiteten, blieben die Gefangenen mit der höchsten Sicherheitsstufe in ihren Zellen eingeschlossen, durften aber stündlich in den Gemeinschaftsbereich gehen. Wenn das Wetter es zuließ, durften wir nach dem Abendessen hinaus auf den Hof.
Es wurde von einem erwartet, dass man arbeitete oder an dem Therapieprogramm teilnahm, doch ich verbrachte den Großteil meiner Zeit damit, in meiner Zelle auf und ab zu laufen, zu schlafen, zu weinen oder Briefe an Ryan zu schreiben – man hatte mir ein paar Blatt Papier und einen winzigen Bleistiftstummel gegeben. Über ein Jahr lang hatten wir gar keinen Kontakt gehabt und dann nur beim Prozess, so dass ich unbedingt wissen musste, ob mit ihm alles in Ordnung war. Ich hatte noch keine Briefmarken und wartete darauf, dass die Kantine in ein paar Tagen wieder öffnete – ich hoffte, mein Dad hatte es geschafft, Geld zu schicken. Im Gefängnis schien alles immer eine Ewigkeit zu dauern.
Nach meiner Verhaftung hatte ich meinen Eltern geschworen, dass ich unschuldig war, und ich war ziemlich sicher, dass mein Dad mir immer noch glaubte, aber bei meiner Mutter war das spätestens seit dem Prozess anders. Mein Dad durfte mir ein paar persönliche Dinge schicken wie CDs und einige Fotos, aber man hatte mich gewarnt, dass es eine Weile dauern würde, bis das Gefängnis sie genehmigte. Ich bat um Bilder von Ryan und unserer Familie, vor allem von Nicole. Am Telefon schwieg er, als ich ihn darum bat, dann stimmte er mit leiser Stimme zu. Nach dem Mord hatte Mom Stunden damit zugebracht, weinend unsere gesamten Fotoalben durchzublättern, doch ich hatte es vermieden, auch nur in die Nähe von Nicoles Fotos in unserem Haus zu kommen. Und ich hasste es, ihr Bild aus dem Jahrbuch in jeder Nachrichtensendung und jeder Zeitung zu sehen. Aber jetzt, anderthalb Jahre später, musste ich Bilder von ihr haben, musste mich in allen Einzelheiten an sie erinnern, wie sie lächelte, was sie mochte, was sie nicht mochte. Ich hatte Angst, sie könnte sonst meiner Erinnerung entgleiten, und musste sie irgendwie lebendig erhalten.
Mein Bewährungshelfer entschied, mich in das Antidrogenprogramm zu stecken, weil ich in der Nacht, in der Nicole ermordet wurde, stoned gewesen war. Aber ich bestand darauf, dass ich kein Drogenproblem hatte, und weigerte mich, daran teilzunehmen. Der Bewährungshelfer war ein kleiner Mann, nur ein paar Zentimeter größer als ich, und hatte zierliche Hände. Ich fragte mich, ob ihm wohl gefiel, dass er im Gefängnis Macht über Frauen hatte, während sie in der Welt draußen womöglich über ihn lachten.
»Das fließt mit in Ihre Beurteilung ein«, sagte er. »Wenn Sie nicht an Ihrem Resozialisierungsplan mitarbeiten, werden Sie nie eine niedrigere Einstufung bekommen. Es könnte zudem einen Einfluss auf Ihre zukünftige Berechtigung zum Hafturlaub haben.«
»Ich bin unschuldig«, sagte ich. »Mein Anwalt hat Berufung eingelegt – ich bin hier bald wieder draußen.«
Mit undurchdringlicher Miene machte er sich eine Notiz.
Ich begann, abends endlos die Hofrunde zu gehen. Ich kam an anderen Frauen in ihren Gruppen vorbei oder an der seltsamen Frau, die immer für sich allein joggte. Eines Tages begann ich, ebenfalls zu laufen. Ich konzentrierte meine Aufmerksamkeit ganz auf das Gefühl, wenn meine Füße den Boden trafen, und mit jedem Bumm, Bumm, Bumm erstickte ich die ständigen Grübeleien, die endlose Verzweiflung in meinem Inneren. Ich versuchte, nicht daran zu denken, wie sehr ich Ryan und Nicole vermisste, versuchte, nicht an das leere Zimmer meiner Schwester zu denken, an ihre Sachen, die niemand mehr angerührt hatte. Nie zuvor hatte ich jemanden verloren, den ich liebte, nicht einmal ein Haustier, und es fiel mir schwer, den Tod zu begreifen, die Endgültigkeit, den niederschmetternden Gedanken, dass ich meine Schwester nie wieder sehen, nie wieder ihre Stimme hören würde. Dass sie nicht länger existierte. Ich hatte Mühe, an einen Himmel oder ein Leben nach dem Tod zu glauben, und konnte mir nicht vorstellen, wo sie jetzt vielleicht sein mochte. Ich konnte nicht begreifen, dass ein Mensch einfach fort sein konnte. Ich hatte auch noch nie zuvor echte Gewalt erlebt und verstand nicht, wie jemand meiner Schwester all diese furchtbaren Dinge hatte antun können. Unablässig stellte ich mir vor, wie groß ihre Angst gewesen sein musste, wie sehr es weh getan haben musste.
Jede Erinnerung war wie ein glühender Schlag, und die Trauer umhüllte mich so fest, dass ich kaum atmen konnte. Also rannte ich, immer und immer weiter.
Meine Zellengenossin und ich redeten nicht viel. Am Morgen, nachdem Pinky mich nachts am Arm gepackt hatte, klärte sie mich kurz über die Routine hier drinnen auf. Dann wurde ihre Miene verschlagen, die Augen wurden schmal.
»Hast du Eltern, die dir Geld schicken? Ich bräuchte ein paar Sachen aus der Kantine, nur bis mein Alter mir in zwei Wochen Geld schickt.«
»Ich kann dir nichts kaufen. Tut mir leid.«
Wir maßen einander mit Blicken, und ich merkte, dass sie versuchte, mich einzuschüchtern, aber sie war ziemlich nervös, ihr Blick huschte umher, ob irgendjemand uns gehört hatte. Niemand war im Gang, und die Frauen in der Zelle neben uns stritten sich lautstark. Ich hatte den Eindruck, dass sie bewusst diesen Zeitpunkt gewählt hatte, damit sie ihr Gesicht wahren konnte, falls ich ihr eine Abfuhr erteilte.
»Mir doch schnurz, wenn du unbedingt meinst.« Sie wandte sich wieder ihrem Bett zu und murmelte: »Aber räum gefälligst deinen Mist hier auf.«
Ich sprach mit keiner der anderen Insassinnen, sondern blieb für mich. Zu den Mahlzeiten saß ich in der Ecke und konzentrierte mich in der Schlange auf mein Tablett, doch mit verstohlenen Blicken musterte ich die anderen Frauen. Es waren größtenteils Weiße, dazu ein paar indianisch- und ein paar asiatischstämmige Frauen. Es gab welche, die sahen aus wie Männer, mit Kurzhaarfrisuren, breiten Schultern und einem ziemlich mackerhaften Auftreten. Manchmal fassten sie sich in den Schritt, was mich total irritierte. Und dann gab es noch ein paar Frauen, die richtig hart aussahen und Bikerinnen oder Junkies sein konnten – die machten mir am meisten Angst. Doch die größte Überraschung für mich war, wie normal viele der Frauen wirkten. Ein paar sahen sogar ziemlich hausbacken aus. Viele hatten Übergewicht, bleiche Haut und fleckige Zähne. Ich sah Unmengen von Tattoos, manche waren richtig exotisch und cool, andere dagegen grob und verblasst. Ich sah nicht viele Junge, nur ein paar Frauen waren vielleicht in den Zwanzigern.
Keine von ihnen beachtete mich, bis eines Tages eine große Frau mit grauen Haaren, die sie zu einem langen Zopf geflochten hatte, zu mir kam. Sie hielt den Kopf hoch, hatte breite Schultern und lief, als hoffe sie, irgendjemand würde ihr Ärger machen, doch alle Frauen gingen ihr aus dem Weg. Sie setzte sich neben mich.
»Du sitzt wegen Mord, Kleine?«
Am ganzen Körper angespannt, betrachtete ich ihre Hände. Jeder Knöchel trug das Tattoo eines Auges. Gehörte sie zu irgendeiner Gang? Ich warf ihr einen kurzen Blick zu, schaute wieder fort. Ich dachte an Pinkys Warnung, aber ich konnte mich einfach nicht bremsen und murmelte: »Ich war’s nicht.«
Sie knuffte mich in die Rippen, ein harter Stoß mit dem Finger. Blut stieg mir ins Gesicht. Ich hielt nach den Wachleuten Ausschau, aber die sprachen gerade mit anderen Gefangenen.
»Hör zu, Kleine, ich werde dir sagen, wie es hier drin läuft.« Ich fing ihren wütenden Blick auf und stellte fest, dass an ihrer Unterlippe ein eingetrockneter Speicheltropfen hing. »Niemand hier gibt einen Scheiß drauf, was du draußen getan hast. Du bist jetzt im Knast. Halt deine Zelle sauber und halt dich selber sauber. Wenn du was zu besprechen hast, kommst du zu mir, nicht zu den Schließern. Ich schmeiß den Laden hier.«
Sie stand auf und ging davon. Ich starrte ihren breiten Rücken an und sah weg, als sie über die Schulter zurückschaute. Ich schob mein Tablett zur Seite, das bisschen Appetit, das ich noch hatte, war mir vergangen. Draußen hatte sich niemand darum geschert, dass ich unschuldig war, und hier drinnen scherte sich auch niemand darum.
Die Frau neben mir sagte: »Isst du das noch?«
Ich hatte gerade noch Zeit, den Kopf zu schütteln, als sie sich auch schon den Saftbecher von meinem Tablett schnappte und meinen Hamburger aufspießte. Ich spürte, dass mich jemand ansah, und blickte auf.
Die grauhaarige Frau beobachtete mich.
4. Kapitel
Woodbridge Highschool, Campbell River Januar 1996
Als Ryan mich zu Hause absetzte, war es schon spät, und ich hatte das Abendessen verpasst. Ich kam durch den Seiteneingang und traf auf meinen Vater, der ein paar Angelschnüre in der Garage zusammenknüpfte. Früher waren wir oft zum Angeln gefahren, wir machten uns ein Lunchpaket fertig und verbrachten den ganzen Tag in unserem Kanu. Jetzt, wo ich den Großteil meiner Zeit mit Ryan verbrachte, zog ich nicht mehr so oft mit ihm los, obwohl ich immer noch gerne angelte. Ryan und ich hatten ein paar Lieblingsplätze am Fluss, doch die Hälfte der Zeit endete es damit, dass wir rumknutschten. Früher hatte Dad mich auch manchmal zur Arbeit mitgenommen, und ich hatte gern neben ihm gearbeitet. Als ich fünf war, kaufte er mir einen eigenen Werkzeuggürtel, und ich folgte ihm überallhin und hämmerte herum.
Den ganzen letzten Sommer hatte ich für ihn gearbeitet, um einen Teil des Autos abzubezahlen, das ich von meinen Eltern bekommen hatte – einen Honda, den meine Mom geerbt hatte, als meine Großeltern starben. Er war ziemlich ramponiert, doch sobald wir ein paar Sachen repariert und einen Satz neue Reifen besorgt hätten, würde er mir noch ein paar Jahre gute Dienste leisten. Ich hoffte, dass wir ihn bis zum Frühjahr fertig haben würden, damit ich ihn anmelden und einen richtigen Job annehmen konnte. Mit Dad zu arbeiten machte Spaß und war anstrengend – ich hatte kräftige Armmuskeln und einen flachen, harten Bauch davon bekommen, den Ryan liebte. Aber ich wollte etwas anderes ausprobieren, nicht immer nur im Familienbetrieb arbeiten.
Als ich durch die Seitentür hereinkam, blickte Dad auf.
»Hi, Spatz. Wo warst du?«
»Bei Ryan.«
Mein Dad sah müde aus, das Gesicht war blass, und unter den Augen hatte er Tränensäcke. Er hatte einen neuen Auftrag für eine Neubausiedlung und ging im Moment früh aus dem Haus und kam spät zurück. Er hatte wie Nicole und ich dunkle Haare – meine Mutter war als Einzige blond – und olivfarbene Haut, die bronzefarben wurde, sobald wir länger als fünf Minuten in der Sonne waren. Zumindest im Gesicht sahen wir ihm ähnlicher. Unsere Figur hatten wir von unserer Mom, sie war zierlich, hatte kleine Hände und Füße, schmale Hüften und Schultern. Sie war zwar klein, hatte aber muskulöse Arme, und ich war stolz, so eine scharfe, taffe Mom zu haben. Wenn sie ein Tanktop trug, konnte man ihre kräftigen Arme sehen, und die Männer drehten sich ständig nach ihr um. Dad erzählte den Leuten gerne, »Pam ist klein und drahtig wie ein Terrier«, und sie tat dann immer so, als würde sie ihm eine langen.
Dad war auch nicht besonders groß, vielleicht einen Meter fünfundsiebzig, aber er war muskulös und hatte von der schweren Arbeit eine gute Figur. Nacken und Arme waren immer dunkel gebräunt und die Hände rau, und seine Haut roch immer nach Holz, Zeder oder Fichte, saubere Gerüche von draußen. Mit seinem freundlichen Gesicht und der Brille sah Dad jedoch eher aus wie ein Lehrer als wie ein Mann, der eine Baufirma leitete.
»Deine Mom regt sich auf, weil du nicht angerufen hast.« Mahnend musterte er mich über den Rand seiner Brille hinweg.
»Ich habe ihr gestern gesagt, dass ich nach der Schule wahrscheinlich noch mit zu Ryan gehe.«
»Ich glaube, sie würde sich über eine Entschuldigung freuen.«