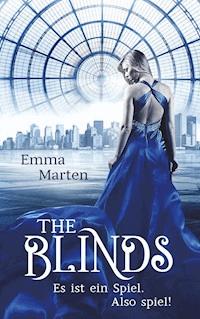
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: The Blinds
- Sprache: Deutsch
Ich hatte keine Chance Aber ich tat es Ich war hier Geheimnisse sind kein Fremdwort für Riley. Ihre Kindheitsträume hat sie längst begraben. Doch dann bietet sich ihr die Chance, an der bekanntesten Fernsehshow des Landes teilzunehmen - den Blinds. Und plötzlich rücken all diese Träume in greifbare Nähe ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für meine Familie
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
1
»Riley?«
»Hat noch jemand ein Schlüssel?«, rief ich gereizt zurück und schloss die Wohnungstür hinter mir. Ich fühlte mich wie erschlagen, wollte mich nur noch unter der Bettdecke verkriechen und die Augen schließen. Aber das durfte ich nicht.
»Riley?«
»Ja!« Ich musste mich zurücknehmen, dass meine Stimme nicht allzu schlecht gelaunt klang.
Ich stellte die Einkäufe ab und hängte meine abgetragene Jacke an den Garderobenständer. Für einige Augenblicke stand ich nur da, atmete tief durch und hoffte, die Einkäufe würden sich von selbst in den Schrank räumen und das Abendessen würde wie von Zauberhand auf dem Esstisch erscheinen. Aber das passierte natürlich nicht.
Kurz ließ ich meinen suchenden Blick durch die kleine Wohnung schweifen, um abzuschätzen, wann ich endlich ins Bett kommen würde: Auf der winzigen Küchenzeile stapelte sich das dreckige Geschirr, auf dem altersschwachen Fernseher sammelte sich der Staub zu einem Berg an und der Mülleimer quoll fast über. Seufzend öffnete ich die Tür zum Schlafzimmer und fand ihn auf dem Bett vor.
»Bist du heute überhaupt aufgestanden?«, fragte ich angespannt.
Die Frage rutschte mir heraus, ich wollte sie nicht stellen, wollte die Antwort nicht hören.
Ein Nicken folgte, genauso wie das Gefühl von Erleichterung, das sich in mir breitmachte. Ich setzte mich neben ihn und strich durch seine blonden Haare. »Abendessen?«
Er lächelte nur, was er in der letzten Zeit immer seltener getan hatte. Ungelenk zog er einen Briefumschlag hinter seinem Rücken hervor. Ich nahm ihn mit einem lautlosen Seufzen entgegen, ahnend, was ich vorfinden würde. Als ich ihn das erste Mal in der Hand gehalten hatte, hatte ich es nicht glauben können. Das war vor ein paar Tagen gewesen. Damals hatte ich noch nicht gewusst, was sich darin befand.
Jetzt wusste ich es.
Er beobachtete mich mit einem kindlichen Funkeln in den Augen, obwohl ich bereits schon einmal Nein gesagt hatte.
Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Müdigkeit und Hunger machten das nicht gerade leichter, aber ich wollte ihm jetzt nicht wütend an den Kopf werfen, dass niemals eintreten würde, was er sich wünschte.
Ständig fragte ich mich, was ich mir eigentlich dabei gedacht hatte, was ich erwartet hatte. Ich wusste, wie sehr er sich das für mich wünschte. Früher war ich das Mädchen gewesen, dessen Kopf in den Wolken gesteckt hatte, mit dem Älterwerden kehrte sich das offenbar um.
Ich wusste nicht, wie ich die Bestätigung bekommen hatte. Vermutlich musste ein bestimmter Prozentsatz aus den Slums erfüllt werden. Vielleicht luden sie auch einfach jeden aus den Slums ein, um für die Fahrkarte noch extra Geld einzunehmen. Bei den Menschen im Zentrum konnte man nie wissen.
»Ich dachte, wir hätten das geklärt.« Ich konnte nicht verhindern, dass meine Stimme leicht ungehalten klang.
Trotzdem öffnete ich den Umschlag und fischte eine Fahrkarte ins Zentrum heraus, dazu die Einladung, die ich schon vor einigen Tagen bekommen hatte. Ich hätte sie ihm gar nicht zeigen und gleich verbrennen sollen. Immer wieder fragte ich mich, wieso ich es nicht getan hatte. Er hätte nie davon erfahren, schließlich konnte er mich nicht nach etwas fragen, von dem ich keine Ahnung haben sollte. Ich war so schockiert gewesen, dass ich ihn gefragt hatte, ob er das gewesen war, ob er mich angemeldet hatte.
Ich hätte nicht so schnell reagieren dürfen.
Ich hätte überlegter handeln sollen.
Ich hätte es mir denken können.
Doch ich war nie ein Mensch gewesen, der lange über etwas nachdachte und die Konsequenzen gegeneinander abwog. Ganz im Gegenteil. Das brachte mich auch in solche Situationen.
Ich lächelte traurig. »Ich werde dort nicht hingehen.« Wieso lächelte ich? Ich wollte doch ernst sein, musste ernst sein.
»Du hast es mir versprochen«, flüsterte er.
Hatte ich nicht. Das kleine Mädchen von damals hatte es. Das Mädchen war ich nicht mehr.
»Ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Geld verdienen. Das kann ich da nicht.«
»Tu es für mich.«
»Angenommen ich gehe dorthin, was machst du dann? Gehst du arbeiten? Wirst du Geld verdienen?«, fragte ich geradeheraus.
Meine eigenen Worte überraschten mich. Er hatte das alles getan - davor. Ich wusste, dass er mich nur beschützen wollte. Wieso konnte er nicht verstehen, dass ich ihn auch beschützen wollte, dass ich mich um ihn sorgte, dass ich ihn brauchte?
In seinen Augen konnte ich den Vorwurf erkennen, den er sich selbst machte. »Bitte.«
Bevor ich ihm erneut widersprechen konnte, biss ich mir auf die Lippen. Wie oft sprachen wir darüber, dass er sich für mich eine bessere Zukunft wünschte? Eigentlich gar nicht, außer der wenigen Male, seitdem ich die Einladung bekommen hatte. Ich konnte es immer nur in seinen Augen sehen. In diesen Augen, die bis auf den Grund meiner Seele blicken konnten, die mich besser kannten als ich mich selbst.
Natürlich wollte er, dass es mir besser ging, ich wollte das auch. Doch im Gegensatz zu ihm war ich in diesem einen Punkt realistisch.
»Ich werde mit Mrs. Winston reden.« So viel zum Thema realistisch.
Wenn ich nicht ginge, würde er sich ewig Vorwürfe machen, dass ich meine Chance nicht genutzt hatte - seinetwegen. Eine Chance, die er mir irgendwie ermöglicht hatte.
Aber was für eine Chance bitte? Wieso sollte sich ein Coach für mich entscheiden?
»Hab ich schon.«
Ich drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. »Ich hab dich lieb.« Ich hatte ihm noch nie lange böse sein können.
»Versprich mir, dass du hingehst!« Er kannte mich zu gut.
Ich grummelte genervt, erhob mich und ging zur Küchenzeile, die Tür ließ ich offenstehen. Ich versprach es ihm nicht, zumindest nicht laut. Die Entscheidung würde ich morgen von meiner Laune abhängig machen, jedenfalls redete ich mir das ein. Klar, als Kind hatte man Träume, Träume von einer Märchenwelt, einem Märchenprinzen und einem Schloss in rosafarbenen Wolken.
Doch ich war kein kleines Mädchen mehr, schon lange nicht mehr. Ich lebte nicht in einem Traum, ich lebte in der gnadenlosen, harten Wirklichkeit und im Gegensatz zu dem kleinen Mädchen von früher hatte ich begriffen, dass Träume einen nicht weiterbrachten. Dass sie einen nur verwirrten und glauben ließen, man könne die Sterne vom Himmel holen. Sie waren Erwartungen, die irgendwann enttäuscht werden würden.
Ich holte die Einkäufe, stellte zwei Töpfe auf den Herd und begann zu kochen, nebenbei räumte ich die Tüten aus. Schon bald strömte Essensgeruch durch das ganze Zimmer. Seit dem Frühstück hatte ich nichts außer einer matschigen Banane gegessen, weshalb mein Magen zu knurren begann. Wie so oft aßen wir im Bett. Ich schob mir den Reis mit der wässrigen Soße mit einem Löffel in den Mund und versuchte dabei, ihn nicht zu genau zu beobachten. Als wir fertig gegessen hatten, spülte und trocknete ich ab, räumte die Wohnung auf und legte mir meine beste Kleidung für morgen zurecht. Zwar hatte ich mich immer noch nicht entschieden, doch es zeigte ihm zumindest meinen guten Willen.
»Weck mich morgen, wenn du aufbrichst.«
»Okay«, log ich und schloss die Augen.
Natürlich tat ich es nicht.
Ich zog mich im Dunklen an, ging ins Bad, schminkte mich ausnahmsweise und kämmte meine blonden Haare, sodass sie glatt auf meine Schultern fielen. Dann packte ich meinen Rucksack, legte Mrs. Winston einen Zettel hin und ging. So leise wie möglich schlich ich die knarrende Treppe hinunter, trat durch die Tür nach draußen.
Wieso ich es tat? Ich hatte nicht den blassesten Schimmer.
Es war später Herbst. Der kalte Wind wirbelte Müll wie Blätter durch die Luft. Mit eiligen Schritten ging ich zur Straßenbahn und fuhr zum naheliegenden Bahnhof für die Schnellzüge. Während die Bahn sich wackelnd und rumpelnd zu ihrem Ziel bewegte, beobachtete ich draußen, wie zwischen den Plattenbauten die Sonne aufging. Einige Obdachlose kauerten in Hauseingängen oder in Haltestellen, die längst nicht mehr vom Bus angefahren wurden. Es war ein Wunder, dass die Straßenbahn zu den Hauptverkehrszeiten fuhr.
Durch ein zerschlagenes Fenster pfiff der Wind, blähte Jacken und Mäntel der Passagiere auf, die sich auf ramponierten Sitzen niedergelassen hatten, sich gegen die Wände lehnten oder einfach auf dem Boden saßen. Ich war freilich nicht die Jüngste. Ein vielleicht zwölfjähriges Mädchen mit dunklen Augenringen und blasser Haut saß schräg gegenüber auf dem Boden, das ihren kleinen Bruder auf dem Schoß festhielt, der mit einem zerfetzten Stofftier spielte. Ich schenkte ihr ein schiefes Lächeln, sie sah einfach durch mich hindurch, als würde ich nicht existieren.
Im Bahnhof angekommen fischte ich nervös die Fahrkarte aus meinem Rucksack und ging zu dem Gleis hinüber, von dem der Schnellzug abfuhr. Der strahlend weiße Zug wirkte wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Anstatt der Räder wie bei der Straßenbahn schwebte er über den Schienen. Als Kind hatte ich mir vorgestellt, dass er direkt in den Himmel fliegen würde, was er natürlich nicht tat. Unruhig passierte ich den Fahrkartenscanner, der in der Tür des Schnellzuges installiert war. Jeder, der keine Fahrkarte besaß, prallte an dem bläulichen Kraftfeld ab. So gelangten nur diejenigen, die sich eine Karte leisten konnten, ins Zentrum.
Für die Fahrt hatte ich mir keine Beschäftigung mitgenommen, für Bücher oder andere Luxusgegenstände fehlte das Geld. Nur die Panflöte, die er mir geschnitzt hatte, trug ich bei mir.
Ich blickte aus dem Fenster und beobachtete, wie die schmucklosen, hässlichen Plattenbauten an mir vorüberzogen und der Ziegelbau des Bahnhofs immer kleiner wurde und dann ganz verschwand. Ich war nicht alleine im Abteil, trotzdem sprach niemand, es waren nur die Geräusche des Zuges zu hören. Ich beobachtete die anderen Passagiere, um einzuschätzen, weshalb sie zum Zentrum unterwegs waren. Die meisten vermutlich aus demselben Grund wie ich, sonst wären hier nicht so viele Kinder. Andere waren so glücklich und hatten im Zentrum Arbeit gefunden, wobei man das nicht wirklich als Glück bezeichnen konnte. Man schwebte zwar nicht in Lebensgefahr wie bei der Arbeit in den Kraftwerken und Fabriken, dafür wurde man wie der letzte Abschaum behandelt.
Ich presste mein Gesicht gegen die kühle Scheibe und versuchte, meine Aufregung zu mindern. Ich schob sie darauf, dass ich das Zentrum wiedersehen würde. Denn wieso sollte ich mich vor einem Auftritt fürchten, der mir sowieso nichts bedeutete?
Nach ungefähr einer Stunde wichen die eintönigen Plattenbauten, riesigen, vereinzelt stehenden Villen in langen Hügelketten mit eigenen Pools. Einige mit endlosen Fensterfronten, andere sandfarben mit ausladenden Balkonen. Die Gegend war mir fremd, zwar wirkten die Häuser imposant, doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass wirklich Menschen dort leben sollten. Was machten sie mit all dem Platz? Ich konnte geradeso die Miete für unsere Wohnung aufbringen, was musste erst so ein Grundstück kosten, ganz zu schweigen von Elektrizitäts- und Wasserkosten?
Das letzte Mal, als ich im Zentrum gewesen war, war ich wohl fünf oder sechs Jahre alt gewesen. Damals, vor so langer Zeit, hatte ich noch nicht geglaubt, unter der Last zusammenzubrechen, unter den Gefühlen zu ersticken. Damals hatte ich mir noch vorgestellt, wie es wäre im Zentrum zu leben. Die besten Lebensmittel einkaufen zu können, sich keine Sorgen wegen Straßengangs oder Verbrechern zu machen, die beste medizinische Versorgung, die das Land zu bieten hatte, keine Ausgangssperre, keine Abfälle auf den Straßen, Bäume und Blumen im Vorgarten, vor allem keine hungrigen Kinder und keine Obdachlosen.
In meiner perfekten Welt gab es weder Armut noch Krankheiten, dort hatten die Menschen alle das gleiche Recht und die gleiche Versorgung, es gab keinen Unterschied zwischen ihnen.
Nicht wie in der realen Welt.
Bald sah ich den riesigen Bahnhof näherkommen, meine Erinnerungen daran waren verschwommen, aber ich erkannte ihn zumindest als die Endstation dieses Zuges. Daneben ragte eine monströse Halle auf, deren schwarzes Kuppeldach von einem ovalen Rundbau getragen wurde, aus dem gleichen Material wie das Dach.
Das Forum.
Dort fanden die Blinds statt.
Es war einzig für diese gebaut worden.
Oft genug hatte ich es auf unserem Fernseher bewundern können. Der Architekt hatte in diesem Bau ein Meisterwerk geschaffen. Die Außenverkleidung bestand aus mehreren Bildschirmen, dazwischen untergebrachte Minigeneratoren projizierten Hologramme in die Luft, die auf die Besucher herabstießen und in tausend Sternen explodierten. Früher hatte ich dem Schauspiel stundenlang zusehen können, jetzt erinnerte es mich nur noch an die grenzenlose Macht, die das Zentrum besaß und bei jeder Gelegenheit zur Schau stellte.
Die Blinds. Die berühmteste Fernsehshow von Free America. Aufwendig. Dramatisch. Spektakulär. Von einer Größenordnung und Intensität, die alles Vorangegangene in den Schatten stellte. Allein in der ersten Runde entschied sich je einer von fünfhundert Coaches für einen der über tausend Kandidaten. Von da an begleitete und beriet er diesen bis zu dessen Ausscheiden oder dem unwahrscheinlichen Sieg. Den Sieger erwartete endloser Ruhm und Reichtum.
Die Zentrumsbürger meldeten sich an, weil es Tradition geworden war, um die Ehre zu verteidigen und sich an anderen zu messen. Für sie waren der Gewinn nur Kleckerbeträge auf ihrem ohnehin gut gefüllten Konto.
Die Armen meldeten sich an, weil sie die irrationale Hoffnung hatten, gewinnen oder sich zumindest ein Leben im Zentrum ermöglichen zu können. Man musste kein Genie sein, um zu wissen, dass ihre Chance gegen Null ging.
Meine Chance.
In den letzten Jahren waren die Aufgaben teilweise so gefährlich gewesen, dass es zu Todesfällen gekommen war. Die Show hieß deswegen Blinds, weil der ursprüngliche Sinn bei der ersten Ausstrahlung darin bestanden hatte, Geheimnisse zu offenbaren, die die Zuschauer und die Jury überraschten und begeisterten. Je besser das Geheimnis, desto mehr Punkte.
Doch schon in der ersten Staffel hatte man feststellen müssen, dass diese Art von Unterhaltung auf die Dauer langweilig wurde. Die Menschen im Zentrum wollten für ihr Geld etwas geboten bekommen. Es war viel aufregender die Talente irgendwelche aberwitzigen Sachen machen zu lassen, als nur ihre Geheimnisse zu hören. Es gab schon so viele verschiedene Aufgaben, die sich die Organisatoren ausgedacht hatten, dass ich mich unmöglich an alle erinnern konnte.
Ich hatte mich nicht beworben.
Das hätte ich nie im Leben getan.
Das hatte er für mich getan.
Ich wollte dort nicht hingehen, aus tiefstem Herzen hasste ich diese Show, denn genau das war sie.
Eine Show. Sie zeigte nichts vom richtigen Leben. Sie zeigte nur Luxus, Macht und Gnadenlosigkeit.
Aus den Slums hatte es bisher keiner geschafft, zu gewinnen. Dafür fehlte uns die Ausbildung, die andere Kandidaten genossen hatten, und die finanziellen und sozialen Mittel der besten Coaches.
Ich hatte also gar keine Chance.
Aber ich tat es.
Ich war hier.
2
Nachdem der Zug gehalten hatte, stieg ich langsam aus. Mit jedem Schritt, überlegte ich mir, ob ich nicht umkehren und mir die Blamage ersparen sollte.
Doch er würde dann enttäuscht sein. Und er hatte Geld für die Fahrkarte ausgegeben, zumindest die sollte nicht umsonst gewesen sein.
Ich könnte lügen.
Doch gleichzeitig wusste ich, dass er die Show verfolgen würde. Und dass ich ihn nicht belügen konnte. Das hatte ich nie gekonnt.
Die Menschen, die an mir vorbei strömten, sahen fast aus wie ich. Sie waren meistens größer, fast alles Männer in schicken Anzügen. Mit Haaren auf dem Kopf, einer Nase, Augen und Mund, zwei Ohren. Menschen wie ich und doch könnten wir nicht unterschiedlicher sein.
Sie sprachen oder tippten irgendetwas auf ihren KITs - wofür auch immer die Abkürzung stand - jedenfalls konnte man laut den Strahlemännern in der Werbung alles damit anstellen.
Ihre Mienen waren emotionslos, zeigten weder Entbehrung noch Angst, wie sie ihre nächste Mahlzeit bezahlen sollten. Die Menschen im Zentrum hatten alles im Überfluss, sie scherten sich nicht um die Anderen, die sie wie Ameisen unter ihren Schuhen zerquetschten.
Ich fädelte mich in den geordneten, chaotischen Strom von Menschen ein, die aus dem Bahnhof quollen. Hier war alles sauber. Roboter wischten den blitzblanken Boden, bedienten Informationsstände oder Fahrkartenschalter. Draußen sah es genauso aus. Roboter machten all die Arbeit, die die Menschen hier nicht machen wollten. Von selbstfahrenden Müllautos bis zu mechanischen Gärtnern. Es könnte so viel mehr Arbeit geben.
So einen Roboter bekam man nicht zu sehen, dort wo ich herkam. Da war nur ein alter, kaputter, der schon seit ich mich zurückerinnern konnte, immer die gleiche Stelle fegte und unaufhörlich vor sich hin plapperte. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn abzuholen. Er war einfach vergessen worden, so wie ich mich oft vergessen gefühlt hatte.
Ich überquerte die Straße und reihte mich in die Schlange vor dem Forum ein. Aus meinem Rucksack holte ich meine Einladung hervor, damit ich sie griffbereit hatte. Während ich vorrückte, stieg meine Nervosität. Hier waren Menschen in allen Altersklassen vertreten, von zwölfjährigen Kindern bis zu Rentnern. Die meisten trugen ihre beste Kleidung, hatten sich hübsch gemacht, als ginge es gleich ins Finale. Viele wirkten überfordert von dem Stress des Zentrums. Sie kamen alle aus den Slums.
Menschen aus dem Zentrum sah ich keine, sicherlich durften die Privilegierten einen anderen Eingang benutzen, damit sie sich nicht mit dem niederen Volk abgeben mussten.
Meine Nervosität ließ mich unruhig zappeln, immer wieder sah ich mich um. Sicherheitsroboter mit blitzweißen Körpern und gelben Augen suchten die Menge ab und scannten die Gesichter nach Auffälligkeiten. Aus Erfahrung wusste ich, dass ihre Waffen in ihre Panzerung integriert waren, sodass kein Zivilist sie an sich reißen konnte. Wenn sie in den Slums auftauchten, hieß das nichts Gutes, hier sollten sie die Menge beschützen. Vor was auch immer. Gangs stifteten hier sicher keine Unruhe.
Aber sie waren nicht in Alarmbereitschaft, sonst würden ihre Augen in einem tödlichen Rot leuchten.
»Name?«, fragte mich ein Roboter, als ich an der Reihe war. Sein Mund leuchtete beim Sprechen auf, wenn man überhaupt von einem Mund sprechen konnte. Seine Augen schienen mich genervt anzusehen. Auch wenn ich mir das nur einbildete, kam ich mir sofort noch unerwünschter vor.
»Riley McAvish.«
»Deine Einladung?«
Ich reichte sie ihm. Der Roboter scannte sie mit den Augen, dann gab er sie mir zurück. »Einen fröhlichen Aufenthalt.«
Als würde ich einen Freizeitpark besuchen, oder so. Nicht, dass ich jemals in einem gewesen war. Aber so hatte ich es mir immer vorgestellt.
Drinnen war alles technisiert. Es gab Sitzgelegenheiten und Stehtische in sanften Farben: Cremeweiß und karamellfarben. Die Decke und die Wände waren mit holographischen Bildschirmen versehen, die Szenen und Kandidaten aus den vorangegangenen Shows zeigten. Immer wieder entdeckte ich das markante Gesicht des ersten Siegers. Obwohl er damals gerade erst vierzehn war, war er muskulös, sodass das weiße T-Shirt um die Schultern spannte.
Die letzte Aufgabe, das Finale, war damals ein Schwertkampf gewesen, den er für sich entschieden hatte. Publikumsliebling, erster jüngster Gewinner der Blinds, erfolgreich, charismatisch, überirdisch reich und keine negative Presse. Zu Duke Donovan konnte man alles sagen. Er wusste, wie man in dieser Welt spielte. Er hatte das größte Spiel gewonnen.
Überall standen Menschen, unterhielten sich, trotzdem war die Lautstärke angenehm, so als würden alle nur flüstern. Kameras flogen umher, wobei ihr matter Körper nur auffiel, weil ich nicht an den Anblick gewöhnt war. Die meisten nahmen sie nur zur Kenntnis, um Kusshände hineinzuwerfen. Es wirkte, als wollten sie in dieser Welt unbedingt aufgehen, aber ihre Kleidung verriet sie.
Ich ließ mich am Rand des Geschehens gegen die Wand gelehnt nieder und umklammerte die Holzflöte, als würde sie mir Halt geben. Das Herz sank mir in die Hose und ich wünschte mir, ich hätte mich anders entschieden und wäre zurückgefahren.
Was sollte ich hier?
Eine Frau mit roten Locken schmetterte ohne Musik eine Oper, wobei ihre Stimme mehrere Oktavensprünge machte, ein anderer muskelbepackter Mann stemmte Gewichte. Eine Frau im abgetragenen Glitzerkostüm tanzte, drehte sich sooft, dass mir allein vom Zusehen schwindelig wurde, ein vierter spielte Gitarre und rockte mit einer rauchigen Stimme ab, sodass um ihn herum Beifall ausbrach.
Was sollte ich hier?
Hatte ich echt vor, mit einer Holzflöte auf die Bühne zu gehen und zu spielen?
Ich musste verrückt sein.
Ich würde mich total blamieren.
Der Tag verging, die Stunden zerrannen. Ich fühlte mich sekündlich unwohler und rief mir immer wieder ins Gedächtnis, dass unsere Fähigkeiten nur bedingt zählten. Es war vielmehr unsere Ausstrahlung, unser Wirken auf die Coaches, unsere Überzeugungskraft. Es kam nicht darauf an, dass ich nur Flöte spielte. Zumindest redete ich mir das ein, um meine Nerven zu beruhigen.
Es klappte keine Sekunde.
Ich war schon immer schüchtern und zurückhaltend gewesen, wenn es um andere Menschen ging. Mein Vertrauen verschenkte ich nicht leichtfertig und weihte andere Menschen schon gar nicht in meine Geheimnisse ein. In den letzten Jahren hatte ich mich zu einer guten Lügnerin entwickelt, in den letzten Jahren hatte ich gelernt, was es bedeutete, aus den Randbezirken zu kommen. Egal wie gut du warst, egal wie sehr du dich angestrengt hast, du wirst niemals gut genug sein.
Ich versuchte die Geheimnisse von den anderen zu erraten, um mir die Zeit und meine Nervosität zu vertreiben.
Wenn die Darbietung überzeugte und ein Coach einen auswählte, war man sofort weiter. Manchmal kam es aber vor, dass sich ein Coach zwar für einen interessierte, aber dann noch ein Geheimnis hören wollte, um sich entscheiden zu können. Man konnte sich auch gleich für ein Geheimnis entscheiden, was nicht unbedingt Pluspunkte brachte. Wozu brauchte man schon ein Geheimnis, wenn man den Menschen dahinter nicht kannte? Es interessierte keinen, weil dich niemand kannte.
Ein paar Mädchen, die ich von früher aus der Schule kannte, hatten gemeint, dass sowieso alles vorher abgesprochen war.
Die Blinds dienten nicht dazu, jemanden berühmt zu machen, sie dienten nur dazu, die Massen zu unterhalten und Geld in die Kassen fluten zu lassen.
Ich fühlte mich von Geheimnissen nicht gerade angezogen, dafür trug ich zu viele mit mir herum.
»Du bist Riley McAvish. Ich bin Eddy Latham.« Eine Frau streckte mir die Hand entgegen und ich ergriff sie zaghaft. »Bist du alleine hier?«
Wo war die gerade hergekommen? War ich so tief in meinen Gedanken versunken gewesen, dass ich sie glatt übersehen hatte?
»Ja.« Meine Stimme zitterte ein wenig.
Die Moderatorin, die die letzten beiden Shows begleitet hatte und mir deswegen bekannt war, setzte sich zu mir auf den Boden. Eine völlig ungewöhnliche Aktion, die mich irritierte.
Sie hatte hellbraune Haare mit dunklen Highlights, braungrüne Augen und trug ein enges violettes Kleid. Zwar war ihre Statur durchschnittlich, doch ihr Gesicht wirkte warm und freundlich, sodass man versucht war, ihr sofort sein Herz auszuschütten. Natürlich war sie mit Absicht ausgewählt worden, um den Kandidaten vor den Shows so manch unbewusste Offenbarung zu entlocken.
»Sonst werden die anderen Kandidaten immer von einem Haufen Fans begleitet.« Sie schien der Umstand, dass ich niemand dabei hatte, nicht zu stören, oder sie war einfach professionell. »Wo kommst du her?«
»Vielleicht ist genau das mein Geheimnis.« Ich sah sie mit einem Glitzern in den Augen an, versuchte, geheimnisvoll zu wirken. Natürlich war es für jeden offensichtlich, dass ich aus den Randbezirken kam.
Wenn ich auf die Bühne gehen würde, würde genau dieses Interview kurz vorher den Zuschauern gezeigt werden, oft genug hatte ich das gesehen. Selbst wenn ich ausscheiden sollte, konnte ich mir zumindest einreden, dass ich alles versucht hatte.
Sie grinste. »Gut gekontert. Du bist gleich dran. Willst du irgendwen vorher grüßen?«
»Sicher.« Ich zauberte ein Lächeln auf meine Lippen, schaffte es nur, weil ich an ihn dachte.
Die Moderatorin wartete, doch ich sagte nichts.
Eins hatte ich in den Randbezirken gelernt, Schweigen war Gold, in diesem Fall Überleben.
Als Eddy begriff, dass ich nichts sagen würde, lächelte sie in die Kamera und nannte noch einmal meinen Namen: »Riley McAvish, die Zuhause einen geheimnisvollen Fremden grüßt.«
Sie lächelte und eskortierte mich dann durch den Raum zu einem unscheinbaren Eingang, der von einem Türsteher geöffnet wurde. Ich ging ohne ein weiteres Wort hindurch.
Es waren genau dreihundertsiebenundfünfzig Schritte bis zur Bühne, wo ich stehenbleiben musste. Auf dem ganzen Weg war es mir vorgekommen, als wäre ich mehr Menschen begegnet als den ganzen Tag über, was übertrieben war. Aber die Crew hinter der Bühne war riesig, so viele Gesichter, so viele Menschen, die vollständig aufeinander abgestimmt waren. Eine Frau, die mir Makeup auftrug, eine andere, die meine Haare überprüfte, ein Mann, der mich fragte, ob ich irgendetwas auf der Bühne brauchte und was ich zeigen würde. Andere, die an meiner Kleidung zupften, mir sagten, wie lange ich Zeit hatte, wie viele Coaches sich noch nicht entschieden hatten. Ich bekam von dem Wortschwall weniger als die Hälfte mit.
Meinen Rucksack hatte ich einer Frau in einem engen, weißen Kleid anvertraut, die die Interviews danach führen würde, nur die Flöte hatte mich bis auf die Bühne begleitet. Sie war das Einzige, worum ich meine verschwitzten Hände legen konnte.
Der Zuschauerraum war dunkel. Dort saßen nur die Coaches, das Publikum wurde erst in der nächsten Liveübertragung zugelassen. Ein Scheinwerfer flammte auf, blendete mich. Ich zitterte, strich mir eine Strähne meiner blonden Haare hinters Ohr, dann setzte ich die Flöte an die Lippen, schloss die Augen und blies den ersten Ton.
Die leise Melodie trug mich fort. Ich spürte die weichen, sanften Töne tief in meinem Körper, tief in meinem Herzen. Sie ließ mich fort schweben, auf Engelschwingen in eine schöne, bessere Vergangenheit. Ich vernahm sein Lachen, hörte mein eigenes getragen vom Wind, der mir die Haare aus dem Gesicht strich. Spürte seine warmen Arme um meinen Körper. Ich vernahm ihre Stimmen, ohne Wut zu empfinden, spürte ihre Küsse sanft und wohltuend auf meiner Haut. Sonnenlicht wärmte unsere Körper, eng verschlungen, Gras unter den nackten Füßen. Schnelle Schritte, aufgefangen, bevor ich fiel. Sicherheit. Geborgenheit. Blaue Augen, von denen ich wusste, dass ich sie nie wieder gehen lassen würde, dass ich sie festhalten würde, dass wir zusammen gehörten. Leise Worte, dass wir gehen mussten. Proteste, Widerworte, bittend, flehend. Dieser Tag durfte noch nicht zu Ende gehen. Arme, die mich hochhoben und forttrugen. Ein glänzender Blick zurück auf ein Leben, das nie wieder so sein würde, auf einen Traum, der vom Regen fortgewaschen wurde wie ein Kreidebild auf der Straße. Unvergessen, verborgen, aber für immer fort.
Tränen rannen meine Wangen hinunter. Zu schnell verklang das Lied, zu schnell musste ich wieder aufhören und die Augen öffnen. Ich blinzelte wegen der Helligkeit, dann entdeckte ich ihn vor mir sitzen, die Beine unterschlagen, zu mir aufblickend. Ich starrte in grünblaue Teiche, die voller Rührung waren.
Ich lächelte zaghaft und wischte mir verlegen die Tränen fort. Ich träumte noch immer. Ich musste einfach träumen. Das konnte doch nicht wirklich wahr sein?
»Wie heißt du?«
»Riley«, antwortete ich zitternd, konnte kaum glauben, dass mich ein Coach ausgewählt hatte. Das war alles noch so fern, alles so weit weg, als wäre mein Gehirn von meinem Körper getrennt.
»Das war wunderschön, Riley. Hast du Lust mit mir zu arbeiten?«
»Ja…Ja! Danke!«, stammelte ich.
In diesem Moment dachte ich nicht mehr daran, wer ich war und woher ich kam. Ich dachte nicht daran, wie ich im Fernsehen aussah und wie ich auf die reichen Zuschauer wirken musste.
In diesem Moment sah ich nur ihn und fragte mich, wie ich hatte zweifeln können, dass ich hier womöglich nichts verloren hatte.
Verdammt, ich kannte ihn, er war sogar noch attraktiver als im Fernsehen. Wie jeder hatte ich die erste Show von den Blinds verfolgt. Er hatte damals gewonnen.
Duke Donovan…
3
Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Wie ein Mantra hörte ich seine Worte immer wieder in meinem Kopf, im Schnellzug, in der holprigen Straßenbahn, auf dem Weg die dunkle Straße entlang, die knarrenden Stufen zu unserer Wohnung hinauf. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was ich im Interview danach gesagt hatte, vor drei Stunden schwebte ich noch im siebten Himmel.
Vor der Wohnungstür blieb ich einige Sekunden stehen, sammelte mich und verbannte die freundliche Stimme aus meinen Gedanken. Jetzt war ich wieder in der Realität, hier gehörte ich hin. Es war ein wunderbarer Ausflug gewesen, mehr nicht. Ein Abenteuer, das an dieser Tür sein Ende fand.
Ich schloss die Tür auf und trat ein.
»Riley«, rief er von der Couch.
Ich sah ihn nicht an, stellte meinen Rucksack ab und schlüpfte aus der Jacke.
»Riley?« Die Euphorie war aus seiner Stimme gewichen, er schien besorgt.
Jetzt hatte ich keine Ausrede mehr, ihn nicht anzusehen. Ich hob den Kopf und meine Augen blickten in seine. Ich versuchte, keine Gefühle zu zeigen, nur Freude, dass ich wieder Zuhause war. Es misslang.
Natürlich merkte er es sofort.
»Riley, was ist los?«, fragte er.
Ich wollte nichts sehnlicher, als mich in seine Arme zu flüchten, den Kopf an seiner Schulter zu verbergen und die Wärme seines Körpers durch den Stoff zu spüren. Doch ich hielt mich zurück, ich wollte es ihm nicht noch schwerer machen, als es schon war. Für mich selbst war es beinahe schon zu viel.
»Hast du schon gegessen?«, fragte ich deshalb in neutralem Ton, der mir kaum gelang.
Perplex starrte er mich an, der Fernseher plärrte mit ungewohnter Lautstärke, durchschnitt die Stille mit der Schärfe einer Rasierklinge. Seine Stimmung wandelte sich, Wut überlagerte die vertrauten Züge und seine Augen blitzten zornig.
Ich floh ins Badezimmer, stützte mich auf dem Waschbecken ab und betrachtete mein erschöpftes Gesicht im Spiegel. Tränen standen in meinen Augen und ließen sie seltsam verschwommen wirken, die Lippen hatte ich zusammengepresst, um die Schluchzer zu unterdrücken, die unbedingt aus meiner Kehle wollten. Wütend wischte ich mir über die Augen, drängte die Trauer zurück. Sie gehörte hier nicht hin.
Hatte ich mir heute Morgen nicht noch eingeredet, dass die Blinds keine Bedeutung für mich hatten?
Dass die Blinds nur eine irrationale Hoffnung heraufbeschworen, einen aus der Realität rissen und blutend zurückließen.
»Es geht nicht«, hörte ich mich selbst laut sagen. Meine Stimme zitterte nicht.
»Meinetwegen?« Seine triefte bei diesem Wort vor Selbsthass.
»Nein.« Die erste Träne löste sich von meinen Wimpern. »Es ist meinetwegen.«
Natürlich war es meinetwegen.
Weil ich bei ihm bleiben wollte, weil ich ihn nicht verlassen wollte. Was war ich denn ohne ihn? Ich hatte ihm so viel zu verdanken und konnte ihn jetzt nicht einfach im Stich lassen, auch wenn er es wollte. Er wünschte sich etwas für mich, was unmöglich war.
Natürlich war es seinetwegen.
Weil er meine Hilfe brauchte, weil er ohne mich kein Geld auftreiben konnte, um die Miete und sein Essen zu bezahlen. Ich trug die Verantwortung für ihn, ich hatte mir diese Verantwortung zwar nicht ausgesucht, aber ich würde alles für ihn tun.
Ich suchte nach den richtigen Worten, um ihm meinen Konflikt zu erklären, doch ich fand sie nicht. Der vernünftige Teil von mir wollte sprechen, ihn besänftigen, damit er verstand. Doch ich war mir nicht einmal sicher, was ich ihm erklären wollte. Mein Herz fühlte sich an, als würde es von zwei Kräften zerrissen werden. Ich wollte bei ihm bleiben und ich wollte Duke Donovan wiedersehen. Das Kind in mir, das noch Träume von Zuckerschlössern und Prinzen auf weißen Pferden hatte, stritt mit meinem sechzehnjährigen Ich, das schon genug Enttäuschungen hatte hinnehmen müssen, um eine weitere ohne Schaden zu verkraften.
Er schwieg eine ganze Weile. Ich wurde nervös, meine Finger krallten sich um das Waschbecken. Wenn ich nicht weiter wusste, hatte ich mich an seiner Schulter vergraben, während Tränen seine Kleidung durchnässt hatten. Er hatte meinem Schluchzen still zugehört und mir dann geraten, das zu tun, was mein Herz mir sagte. Wie sollte ich in diesem Moment seinem Ratschlag folgen, wenn mein Herz nicht wusste, was es wollte?
Eigentlich hätte er mich jetzt besänftigen, ermutigen und mir recht geben müssen, doch er schwieg weiterhin. Angst krampfte sich in meinem Magen zu einer harten Kugel zusammen. Er würde nicht schweigen, wenn er wüsste, wie zerrissen ich mich fühlte.
Ich rief nach ihm, keine Antwort.
Schnell eilte ich die zwei Schritte aus dem Badezimmer, sah die Couch, seinen Hinterkopf, das ungekämmte, zerzauste, hellblonde Haar. Ruhe überkam mich so plötzlich, als hätte ich geglaubt, er könne sich einfach so in Luft auflösen und mich alleine lassen. Er war mein Fels in der Brandung, er hatte schon so viele Kämpfe für mich geführt, mich beschützt und behütet.
Wieder sagte ich seinen Namen, diesmal leiser, versuchte, die Stimmung zu besänftigen. Ich wollte nicht, dass er sich die Schuld gab. Denn es war allein meine Entscheidung, ich war alt genug, um selbst zu wissen, was das Beste für mich war. Und im Moment konnte ich mir kein Leben ohne ihn vorstellen. Ich würde es mir nie vorstellen können.
»Ich bin müde«, sagte er nur.
Ich hatte ihn verletzt. Aber seine Worte trafen mich ebenfalls. Ich konnte verstehen, dass er enttäuscht war, ich war nicht die Einzige, die sich in Fantasien und Seifenblasen flüchtete. Doch Seifenblasen hatten es an sich, ohne Vorwarnung zu platzen. Die echten Seifenblasen hinterließen keine Scherben, aber geplatzte Träume hinterließen blutige Spuren der Verwüstung.
Ich trat neben ihn, die Schuldgefühle lagen mir schwer im Magen und verursachten Übelkeit. Mit vertrauten Bewegungen legte ich mir seinen rechten Arm über die Schulter, stützte ihn an der Hüfte und zog ihn so auf die Beine. Mit dem freien Arm stützte er sich an der Wand ab, während seine Füße über den Boden schlurften. Nach nur wenigen Schritten sank er völlig erschöpft aufs Bett. Er konnte seinen Oberkörper ohne meine Hilfe nicht aufrecht halten. Mein Magen verkrampfte sich nur noch mehr. Ich zog seinen Oberkörper zum Kissen und bettete seinen Kopf darauf, dann hob ich beide Beine hoch und legte sie unter die Decke.
Er wollte mich immer noch nicht ansehen, blickte nur zur Zimmerdecke. Schweiß glänzte im schummrigen Licht auf seinem Gesicht. Es kostete mich enorme Kraft, nicht darüber nachzudenken, wie es früher gewesen war ... und wie es jetzt war.
Ich ging hinaus, lehnte die Tür an, sodass kaum noch Licht ins Schlafzimmer fiel. Ich brauchte einige Sekunden, um meine Fassung zurückzugewinnen. Ich hatte mir abgewöhnt, ihn nach seinem Befinden zu fragen. Nur allzu deutlich hatte er mir klar gemacht, dass es seine Sache war, dass er mich nicht mehr als nötig belasten wollte.
Doch natürlich war das alles Wunschdenken.
Ich drehte den Fernseher leiser und setzte mich davor. Ich brauchte einige Minuten, um mich zu sammeln, damit ich weitermachen konnte. Der Fernseher hatte nur zwei Programme und in beiden wurden die Auftritte von heute übertragen. Noch immer waren nicht alle durch, es waren jedoch nur noch zwei oder drei neue Coaches, die sich noch nicht entschieden hatten. Vermutlich würden sie dann irgendeinen nehmen, nur damit sie zugelassen wurden. Nach dem nächsten Auftritt eines Kindes aus den Slums, das gar nicht mal so schlecht zu einer Musik getanzt hatte, zeigten sie einen Zusammenschnitt ausgewählter Talente. Einige von ihnen waren mir schon in der Vorhalle aufgefallen, die Coaches kannte ich auch von ihren Gesichtern her. Ich hatte ein grauenvolles Namensgedächtnis.
Dann drangen Flötentöne aus dem Lautsprecher und ich versteifte mich unwillkürlich. Die Scheinwerfer waren auf eine junge Frau gerichtet, deren Augen geschlossen waren und mit solchem Gefühl spielte, dass mir erneut die Tränen kamen. Ich sah weder schäbig noch unsicher aus. Es war, als umgebe mich ein weißer, mysteriöser Schein, der sicher von dem Licht herrührte. Doch mir kam es vor wie Magie. Die bekannte Melodie, die ich immer nur selbst gespielt und niemals wirklich gehört hatte, ohne mich auf die Griffe zu konzentrieren, ließ mir Tränen über die Wangen strömen und meine Hände zittern.
Dann sah ich zum ersten Mal, wie das Licht an Duke Donovans Stuhl hell und weiß aufflammte und eine dunkler Schemen, der genau seine Gestalt hatte, durch die Ränge ging und sich vor mich auf die Stufen der Bühne setzte. Und ich hatte nicht bemerkt, dass er meinem Lied fast zwanzig Sekunden gelauscht hatte, mir so nah. Die Rührung auf seinem Gesicht ließ mich schmelzen. Ich hatte nicht geglaubt, dass jemand die Gefühle hinter der Melodie begreifen konnte.
Doch er konnte es, er hatte sich nicht nur von meinen Tränen überzeugen lassen, sondern von der Melodie, von den Noten, die ich vor einer Ewigkeit auf ein Stück Papier gekritzelt hatte.
Was hatte Duke in mir gesehen, was er in anderen nicht gesehen hatte, die vor mir und weit besser waren als ich? Meine Musik hatte ihn bezaubert, ja, aber das reichte kaum aus, um seine Entscheidung, mich als sein Talent anzunehmen, zu rechtfertigen oder auch nur im Entferntesten zu erklären.
Ich verstand nur, was er gesehen hatte.
Eine Chance.
Er musste es als Wink des Schicksals gesehen haben, dass ausgerechnet Duke Donovan mich als seine Kandidatin ausgewählt hatte. Eine unter Tausenden.
Einige Sekunden saß ich noch regungslos auf der Couch, dann schaltete ich den Fernseher aus, blieb einen Augenblick stehen, während die Gedanken wie zäher Gummi durch meinen Kopf trieben. Ich konnte nicht begreifen, wieso er sich mit einem sechzehnjährigen Mädchen aus den Randbezirken zufriedengeben sollte, wenn er doch jede haben konnte. Duke Donovan war der Gewinner der Blinds, niemand anderes war so berühmt geworden wie er, niemand anderes hatte diese Fernsehshow so geprägt. Wieso hatte er mich ausgewählt? Wieso hatte er seine Chance auf einen Sieg so leichtfertig weggeworfen?
Von draußen fiel nur schwach Licht herein, die Deckenlampe flackerte und erlosch. Es musste also ungefähr 21:30 Uhr sein. Die Abschaltung des Stroms in den Haushalten war nicht nur eine Maßnahme, Strom zu sparen, sie läutete gleichzeitig die Ausgangssperre ein. Manchmal wurden von Sicherheitsrobotern noch Kontrollen vorgenommen und Patrouillen auf den Straßen vertrieben Obdachlose oder jeden, der sich in der Nacht noch draußen herumtrieb, doch manchmal war zu selten geworden und selten zu so gut wie nie.
Ich versicherte mich, dass das Notaggregat des Kühlschranks funktionierte und die Haustür abgeschlossen war, dann betrat ich leise das Schlafzimmer. An seinen unregelmäßigen Atemzügen erkannte ich, dass er noch nicht eingeschlafen war. Im Dunklen zog ich mich aus und schlüpfte in ein weißes T-Shirt, das mir um einiges zu groß war. Ich kroch neben ihm ins Bett, zog die Decke über meinen schmalen Körper und die Knie an die Brust, weil es kalt war.
»Es tut mir leid«, flüsterte ich.
Die Worte waren keine leere Entschuldigung, wie ich sie schon oft genug zu hören bekommen hatte. Nie von ihm.
»Ich komm schon klar, Riley.« Er klang erschöpft.
Ich wusste sofort, dass er log. Es versetzte mir einen Stich, er belog mich nicht oft, er sagte einfach nichts, schwieg und zeigte mir so, dass ich nicht weiter darüber reden sollte. Aber die Sache mit den Blinds schien ihm so wichtig zu sein, dass er mich dafür anlog. Eigentlich sollte ich es ihm übel nehmen, aber konnte ich es ihm verdenken?
»Mrs. Winston und Mr. Harrison werden mir helfen«, setzte er an.
»Ich weiß.« Meine Kehle hatte sich bei seinen Worten zusammengeschnürt.
Ich rutschte neben ihn, legte meinen Kopf auf seine Schulter und lauschte seinem Herzschlag. »Ich will nur nicht ...«
Ein Schluchzer löste sich aus meiner Kehle und ich spürte Tränen meine Wangen hinunter rinnen. Ich wollte nicht weinen, nicht jetzt, nicht vor ihm. Seine Lippen streiften meine Haare und sein Arm legte sich schwerfällig über mich. Ich packte seine Hand und umklammerte seine schmalen Finger.
»Riley.«
Mein Name klang so sehnsuchtsvoll, er wollte mir allen Kummer nehmen. Er wünschte sich, dass es niemals so weit gekommen wäre. Ich wünschte mir, dass ich niemals älter geworden wäre, dass der Tag ewig währen würde, über den ich das Lied geschrieben hatte.
»Es ist dein Leben.« Seine Stimme klang erstickt und leise, so als kämpfe auch er gegen die Tränen.
Ja, es war mein Leben und ich wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, dass mein und sein Leben nicht mehr lange zusammen weiterlaufen würde, dass ich irgendwann in die Wohnung kommen und er nicht auf mich warten würde.
Wir wussten beide, dass es eine Deadline gab.
Für sein Alter ging es ihm noch richtig gut, ich kannte weit schlimmere Fälle. Doch ich sah es in jeder Bewegung, hörte es in seinen keuchenden Atemzügen, erkannte es in seinen erschöpften Augen, in der fehlenden Wärme, in den Momenten der Stille, wenn seine Gedanken dunkle Wege einschlugen, hörte es in seinen Albträumen.
Wie viel Zeit wir noch zusammen hatten, konnte uns kein Arzt sagen. Manchmal ging es schnell, manchmal dauerte es eine Ewigkeit voller Qualen.
Qualen für uns beide.
»Es ist deine Chance.« Er klang erschöpft, seine Stimme war benebelt vom Schlaf.
Es war heute zu anstrengend gewesen, vermutlich spielte auch die Aufregung eine große Rolle. Schon nach einigen Augenblicken beruhigten sich seine Atemzüge, wurden gleichmäßiger und tiefer.
Der Tag, an dem er einfach nicht mehr da sein würde, würde für mich der schrecklichste und einsamste Tag auf dieser furchtbaren, beschissenen Welt sein.
Das Leben war nicht toll. Das Leben war nicht gut.
Das Leben war scheiße und ungerecht.
Und ich konnte rein gar nichts tun, um daran etwas zu ändern.
Die Blinds waren eine Chance zu versagen und bloßgestellt zu werden. Aber ich hatte ihm noch nie einen Wunsch abschlagen können. Und es war vielleicht eine kleine Möglichkeit, eine klitzekleine Chance, für einen leichten Abschied.
4
Als ich am Morgen aufwachte, wusste ich immer noch nicht, was ich tun sollte. Es hatte sich nichts geändert. Weder an unserer Situation noch an meiner gespaltenen Gefühlswelt. Könnte ich mich entzweireißen, würde ich es ohne nachzudenken tun.
Das Geld für die Fahrkarte hatte ich nicht und selbst wenn, war ich mir nicht sicher, ob ich es dafür aufs Spiel setzen würde. Wer nicht kam, wurde nicht genommen und der Coach flog aus dem Rennen.
Pech gehabt.
Fahrkarte ins Paradies verspielt.
Obwohl man sich darüber streiten konnte.
Ich blieb noch einige Augenblicke liegen und beobachtete ihn im dämmrigen Licht, das durch die geöffnete Tür ins Zimmer fiel. Seine Haut war schon immer blass, doch es tat ihm nicht gut, dass er die Sonne nur durch das Fenster genießen konnte. Obwohl er gut aß, hatte er abgenommen, sodass ich seine Knochen nur allzu genau unter seiner Haut spüren konnte. Sein Brustkorb hob sich beim Atmen regelmäßig, doch seine Atemzüge waren flach.
Lautlos stand ich auf und zog mich an. Sonnenlicht fiel durch das einzige Fenster in unsere Wohnung. Ich machte mir die Haare mit einem Gummi zusammen, schlüpfte in meine Schuhe und öffnete die Wohnungstür. Das Treppenhaus war mehr als schäbig, die Tapete hatte sich an einigen Stellen von der Wand gelöst, der Teppich war abgetreten und zerfiel bald in seine Einzelteile. Ich klopfte an die Tür, die unserer gegenüber lag. Obwohl es früh war, hatte ich keine Bedenken, dass unsere Nachbarin noch schlafen und ich sie wecken würde.
Kurz darauf wurde die Tür geöffnet und eine zierliche Frau mit grauen Haaren lächelte mich schüchtern an. Falten zogen sich wie ein Spinnennetz über ihre Haut, doch ich wusste, dass sie nicht viel älter als fünfundfünfzig sein konnte. Trauer und Schmerz hinterließen oft sichtbare Narben.
»Riley«, begrüßte sie mich freudig. »Du warst wunderbar.«
Sie schlang ihre schmalen Arme um mich. Ich erwiderte die Umarmung nur halbherzig. Zwar mochte ich Mrs. Winston, doch ich war nie froh, wenn ich sie darum bitten musste, sich um ihn zu kümmern, auf ihn aufzupassen, wenn ich arbeiten war. Oder wenn sie mir Geld zusteckte, das sie im Krankenhaus verdient hatte.
»Er ist so stolz auf dich. Wir haben gemeinsam mit Mr. Harrison und seiner Nichte Taylah deinen Auftritt gesehen. Du erinnerst dich an sie, oder?« Dann runzelte sie die Stirn. »Wieso bist du noch nicht unterwegs? Der Zug fährt doch in vierzig Minuten.«
»Darüber wollte ich mit Ihnen reden.« Ich zuckte beschämt mit den Schultern. »Ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht weggehen.«
»Ach, Liebes.« Sie tätschelte mir liebevoll die Schulter. »Tee?«
Ich nickte dankbar, nur mühsam konnte ich die Tränen zurückhalten. Wir gingen hinein und ich setzte mich auf einen alten Küchenstuhl. Sie kannte meine Situation genau und hatte mir, ohne zu fragen, immer geholfen, auch wenn ich es ihr nie vergelten konnte. Ich bewunderte sie für ihre Tapferkeit, trotz ihres schmächtigen Körpers war sie die stärkste Person, die ich kannte.
Während sie den Tee aufsetzte, zog ich an dem grauen Pullover herum, er war an den Ärmeln ein wenig kurz geworden. Zwar kaufte ich meine Kleidung immer zwei Nummern größer, falls ich noch wachsen würde, doch meine letzte Shopping Tour war auch wieder einige Jahre her. Aus den meisten Sachen wuchs ich raus, doch Geld für neue Klamotten hatte ich nicht. Ich konnte froh sein, wenn es für das Essen und die Medikamente reichte.
»Wie ging es ihm gestern?«, fragte ich und spielte mit der Zuckerdose, eine Maus, die auf zwei Pfoten stand und die Nase so hielt, als hätte sie gerade einen überaus leckeren Duft wahrgenommen.
»Er möchte nichts mehr, als das du glücklich bist.« Es war keine Antwort auf meine Frage. Aber die würde sie mir auch nicht geben. Hatte sie nie getan, auch wenn ich sie angefleht hatte. Trotzdem gab ich es nicht auf, die Frage gehörte zur Begrüßung.
»Ich bin glücklich ... hier«, erwiderte ich. »Diese Shows, der Glamour, die Stars und die Partys … das ist nicht meine Welt.« Obwohl ich es ehrlich meinte, schwang Kummer in meiner Stimme mit. Es war eine Chance, eine verhältnismäßig kleine Chance, aber immer noch eine Chance auf ein besseres Leben. Ich wusste nicht, was Duke Donovan in mir gesehen hatte, ich wusste nicht, was er an mir fand. Aber er hatte mich ausgewählt, aus Tausenden von Bewerbern. Ein Mädchen mit einer selbstgeschnitzten Flöte. War es Mitleid gewesen?
Doch das konnte ich mir nicht vorstellen, wieso auch? Er war der Gewinnertyp. Wieso sollte er auf gute Gewinnchancen verzichten, wenn er jemanden wie mich aussuchte? Vielleicht wollte er sein Image aufpolieren und seinem Ruf auch noch Großherzigkeit hinzufügen?
Ich war nicht hässlich, aber mit den Mädchen aus dem Zentrum konnte ich mich nicht messen.
In dieser Nacht hatte ich mir tausend Antworten ausgedacht, die er zu mir sagen könnte, doch keine hatte mich wirklich überzeugt. Noch dazu konnte ich unmöglich wissen, was er dachte.
Mrs. Winston stellte eine Tasse vor mich, die dunkle Flüssigkeit darin dampfte. Sie setzte sich auf einen zweiten Küchenstuhl, legte die gerunzelten Hände um ihre eigene Tasse und sah mich mit einem mütterlichen Lächeln an. »Du solltest es nicht einfach wegwerfen.«
Es war ein gut gemeinter Rat, dahinter steckte jedoch auch die Andeutung, dass sie sich in meiner Abwesenheit um ihn kümmern würde, dass ich erneut in ihrer Schuld stehen würde. Einer Schuld, die ich nie würde begleichen können.
Meiner Meinung nach hatte ich schon zu viele Gefallen erbeten. Ohne diese Menschen, die einfach halfen, ohne zu fragen, wäre ich schon längst nicht mehr hier.
Ich biss mir auf die Unterlippe, sah sie nicht an, als ich überlegt antwortete: »Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben.« Tränen drängten sich in meine Augen.
»Du weißt, wie es ausgeht, Riley.« Sie lächelte traurig und Kummer färbte ihre Augen dunkel. »Wenn er wüsste, dass es dir gut gehen würde, wenn…« Sie stockte, sprach die verhängnisvollen Worte nicht aus. »Es würde leichter sein.«
»Leichter, als wenn ich bei ihm wäre?«
»Er will nur das Beste für dich, seit deiner Geburt hat er das gewollt.« Sie zuckte die mageren Schultern. »Aber es ist deine Entscheidung, nicht meine und auch nicht seine.«
Ich seufzte, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, und weil ich doch irgendwie tief in meinem Herzen wusste, was ich wollte. Nur würden diese beiden Dinge schwer vereinbar sein. Schwer, aber nicht unmöglich.
Ich trank einen Schluck von dem Tee, der mich sofort von innen wärmte. Ich wusste nicht, wann ich das letzte Mal guten Tee getrunken hatte.
»Würden Sie ihm helfen?« Ich musste diese Frage stellen. Ich wollte es nicht, ich musste es. Eine andere Möglichkeit hatten wir nicht, er kam nicht alleine zurecht.
»Natürlich, Riley.«
»Danke.« Das Wort kam gepresst aus meiner Kehle.
Ich stand auf, schenkte ihr noch ein dankbares Lächeln und ging zurück in meine Wohnung. Ich schaltete das elektrische Licht ein, da die Sonne nur spärlich das Zimmer erhellte. Ich nahm den Rucksack und ging ins Schlafzimmer. Schnell hatte ich meine besten Kleidungsstücke zusammengepackt und in den Rucksack gestopft. Die Flöte schob ich in eine Seitentasche, damit sie nicht kaputt ging.
Ich musste jetzt schnell sein, sonst würde ich mich wieder umentscheiden. Wenn ich genau darüber nachdachte, konnte ich nicht genau sagen, was mich zu dieser radikalen Kehrtwende bewogen hatte.
Er rührte sich auf dem Bett, sah mich verschlafen mit zusammengekniffenen, blauen Augen an. Ich setzte mich neben ihn und griff seine Hand, die auf seinem Bauch über der Decke lag.
»Es wird hart.« Meine Stimme klang rau und voller Kummer und Angst. »Für uns beide.«
Ich sah ihm an, dass er irgendetwas sagen wollte, doch das würde ich nicht ertragen. Wenn er jetzt sagte, dass er stolz auf mich war, würde ich mir nur noch schlechter vorkommen.
Denn irgendwie fühlte es sich wie eine Flucht an. Eine Flucht vor dem Unvermeidlichen, vor der Last und vor dem Verlust, der mich auseinanderreißen würde.
Ich hatte ihm geschworen, bei ihm zu bleiben, ihn nicht alleine zu lassen, aber ich konnte nicht mehr, ich war nie so stark gewesen wie er.
Und tief in mir drin, irgendwo versteckt, ein Gedanke von der Größe eines Atoms, dort wollte ich daran glauben, dass meine Seifenblase nicht platzte.
»Mrs. Winston wird sich um dich kümmern und ich komme sooft vorbei, wie ich kann.« Ich drückte meine Lippen auf seine Stirn. »Ich liebe dich.«
5
Ich zog die Wohnungstür nicht hinter mir zu. Mrs. Winston lehnte an ihrer Tür auf der anderen Seite des Treppenhauses, gerade mal vier Meter entfernt, und nickte mir aufmunternd und Mut machend zu. Ich lächelte verängstigt zurück. Sie würde sich um ihn kümmern, er würde nicht alleine sein, sie würde ihn nicht im Stich lassen.
Wie immer schlich ich flink die Treppe hinunter, mein Rucksack hing schwer über einer Schulter. Ich erreichte die Eingangstür, stemmte sie auf und trat hinaus. Sofort blies der Wind mir die Haarsträhnen aus dem Gesicht. Im Vergleich zu gestern hatte er an Stärke zugenommen. Ich zog mir auch den anderen Träger über die Schulter und ging los. Den Weg zur Straßenbahnhaltestelle kannte ich auswendig und hätte ihn sogar bei Dunkelheit gefunden. An den heruntergekommenen Plattenbauten vorbei, an dem Roboter, der immer den gleichen Fleck fegte und vor sich hin brabbelte. Ich musste rennen, um die Straßenbahn noch zu bekommen, kurz bevor sich die Türen schlossen, zwängte ich mich hinein. Die Leute von der Nachtschicht kauerten müde auf ihren Sitzen, einige hatten die Augen geschlossen. Ich blieb stehen, umklammerte eine Haltestange und wippte unruhig auf und ab.
Wieso war ich doch gegangen?
Wieso war ich ruckartig aufgebrochen?
Wieso hatte ich meine Meinung geändert?
Ich wusste keine Antwort auf die Fragen, die wie ein Waldbrand mein Inneres verzehrten. Wusste nur, dass ein Teil von mir noch Hoffnung hatte, dass ein Teil von mir noch an Wunder glaubte. Ich war nie länger als elf Stunden von ihm getrennt gewesen. Wie sollte ich jetzt Tage aushalten?
Ich hatte mich verabschiedet, er hatte darauf bestanden, dass ich ging, aber es fühlte sich wie damals an, als wir im Stich gelassen wurden, als sie uns verließ.
Im Bahnhof angekommen eilte ich aus der Straßenbahn und hinüber zu dem Bereich, wo der Schnellzug ins Zentrum abfuhr. Ich sah den Zug, blendend weiß, auf jedem Waggon der Aufdruck ZENTRUM.
Dann blieb ich stehen.
Mitten in der Masse der Arbeiter, die sich auf den Weg machten, wohin auch ich musste. Sie rempelten gegen mich, weil ich einfach stehen geblieben war, einige murrten, doch keiner forderte mich auf, weiterzugehen.
Ich stand wie eingefroren da.
Starrte den Zug an.
Während die Frage, wieso ich eigentlich hier war, sich hinter meine Stirn, hinter meine Augen brannte. Ich hatte keine Fahrkarte, ich konnte unmöglich in diesen Zug steigen.
Es fuhr nur ein Zug von jedem der fünf Bahnhöfe der Randbezirke ins Zentrum. Kein Stopp, kein Halt, bis er im Bahnhof im Zentrum hielt. Keine Möglichkeit, sich an den Grenzen vorbei zu schmuggeln und in einen besseren Stadtteil von Central America zu gelangen. Keine Sicherheitsroboter, niemand rechnete mit einer gewaltsamen Übernahme des Zuges. Im Zentrum wäre sowieso Endstation, im wahrsten Sinne des Wortes.
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












