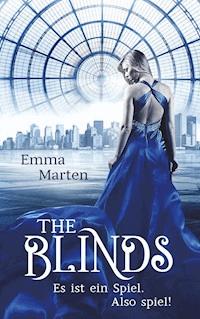Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Dazwischen
- Sprache: Deutsch
Geboren in Dunkelheit, um das Licht zu retten. Selena fürchtet sich vor der Dunkelheit, doch in ihrer Heimat Schwarz ist diese allgegenwärtig. Ihr Vater, der Anführer der Seelendiebe, setzt sie unter Druck, endlich ihre düsteren Fähigkeiten einzusetzen. Als er gegen Tods oberstes Gesetz verstößt, stellt Selena sich gegen ihn. Ein Fremder verhilft ihr zur Flucht. Raedan hat sie aus einem bestimmten Grund auserwählt: Er braucht ihre Kraft, um Tod eine Seele zu stehlen. Selena will sich weigern, denn sie hasst ihre Macht. Aber was, wenn das Leben aller auf dem Spiel steht? Wenn sie über Leben und Tod entscheidet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle, die die Dunkelheit kennen.
Und das Licht suchen.
Inhaltsverzeichnis
Selena
Tod
Selena
Tod
Selena
Tod
Selena
Tod
Selena
Tod
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Raedan
Raedan
Raedan
Selena
Tod
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
Raedan
Selena
SELENA
KRIEG IST EIN KIND. EIN EGOISTISCHES, IMPULSIVES, GRAUSAMES KIND.
Der Gestank von Blut ist so intensiv, dass ich nur schwer ein Würgen unterdrücken kann. Das Klirren der Schwerter, das Sirren der Bogensehnen und das Krachen, wenn Schilde aufeinanderprallen, stellen die Häarchen an meinen Unterarmen auf.
Obwohl alles in meinem Inneren nach Flucht schreit, stehe ich still. Mein Herz hämmert gegen meine Rippen, kalter Schweiß rinnt meinen Rücken hinunter. Ich wage kaum zu atmen. Meine Augen sind auf meine schwarzen Stiefel gerichtet, das Leder glänzt frisch poliert. Verschwendung, denn sobald das Klirren der Waffen erstirbt und der Kampf ein Ende gefunden hat, werden sie sich mit Blut vollsaugen.
Ich spüre die Unruhe meines jüngeren Bruders Killian. Erst vor wenigen Tagen haben wir mit einem großen, berauschenden Fest seine Volljährigkeit gefeiert, heute findet seine erste Diebestour statt. Ich presse die Lippen zu einem harten Strich zusammen und balle die Hände zu Fäusten. Das verängstigte Murmeln der Angehörigen lässt mich nun doch aufblicken. Sie drücken sich an die dunklen Hausfassaden, die den Platz begrenzen. Einige Mutigere wagen sich langsam vorwärts, suchen mit den Augen nach ihren Verwandten. Am Rand warten vier Ärzte mit klobigen Taschen, in denen sie ihre Kräuter und Pulver aufbewahren. Ihre Kleidung ist unserer nicht unähnlich, nur von aschgrauer Farbe. Ihre Fähigkeit ist selten, aber machtvoll.
Der Kampf ist fast vorüber. Das Kopfsteinpflaster mit Blut, Schweiß und Tränen getränkt. Körper liegen mitten auf dem Platz, manche bäumen sich in Agonie auf, als wollten sie weiterkämpfen. Andere sind reglos.
Ein paar wenige Krieger ringen noch miteinander. Ich erkenne Demetrius unter ihnen. Schweiß glänzt auf seinem muskulösen Oberkörper. Blutspritzer, frische und vernarbte Wunden erschaffen ein Kunstwerk des Kriegs auf seiner Haut. Seine zwei gebogenen Schwerter führt er mit einer Grazie, die ihresgleichen sucht. Nicht nur deswegen ist er einer der gefürchtetsten Krieger von Schwarz. Er holt aus und versenkt ein Schwert in der Brust seines Gegners, der ohne einen Laut nach hinten kippt. Der Kampf ist vorüber.
Noch bevor wir uns in Bewegung setzen - eine lautlose Prozession aus schwarzer Kleidung, ausdruckslosen Gesichtern und offenen Geldbeuteln -, stürmen die Angehörigen auf den Platz. Huschen zwischen den Körpern hindurch auf der Suche nach ihren Familienangehörigen. Ihre Angst und Trauer schwappt wie eine Flutwelle über mich.
Mein Vater verlässt als Erster unsere Reihe und schreitet, einem König gleich, auf Demetrius zu. Dieser hat seine Schwerter in die Scheiden an seiner Hüfte geschoben und wartet, bis mein Vater ihn erreicht hat, um ihn, wie jedes Mal, respektvoll fortzuschicken. Der Krieger hat noch nie eine tödliche Verletzung erlitten, die unserer Hilfe bedurft hätte.
Mein Bruder kann es kaum abwarten, bis die Ersten uns heftig zu sich winken. Sie schwenken Goldbeutel in der Luft und rufen immer dasselbe:
»Helft uns!«
»Ich bezahle Euch das Doppelte!«
»Kommt schnell!«
»Hier, nehmt!«
Ich höre nicht hin, versuche, den Worten keinen Sinn abzugewinnen. Mechanisch setze ich mich mit meiner Familie in Bewegung. Zwischen all den Verwundeten und Toten suche ich mir ein Mädchen heraus. Kaum älter als ich. Die dunklen Haare sind auf einer Seite abrasiert, die kahle Stelle mit einer blutroten Tätowierung verziert. Ein Pfeil hat sie in den Brustkorb getroffen. Eine Spur Blut läuft über ihr Kinn. Ihre Mutter, dem Aussehen nach, kniet neben ihr, hält mir einen Geldbeutel hin.
»Beschützt sie«, bettelt die Frau. Ihre Hände zittern, die Augen sind voller Angst.
Alles in mir ist taub. Ich fächere meinen Mantel auf und knie mich neben das Mädchen. Der Goldsaum meines Umhangs blitzt bei der Bewegung kurz auf. Die Kriegerin hat hübsche Augen, dunkel mit Goldsprenkeln. In ihnen entdecke ich keine Angst, es ist nicht ihr erster Seelenraub. Gestorben ist sie noch nicht, dafür kann ich zu viel Leben in ihren Augen sehen. Aber da ist die Leere, nicht mehr als ein Funken, doch vorhanden.
Ich winke einen Arzt zu mir. Er schiebt die besorgte Mutter rücksichtslos zur Seite und macht sich daran, die Wunde zu versorgen. Der Schaft bricht mit einem Knacken und der Arzt zieht ihn aus dem Brustkorb. Die Geräusche sind mir inzwischen so vertraut, dass sich nicht mal ein leiser Anflug von Übelkeit meldet. Da der Arzt die Kriegerin heilt, wird er das meiste Gold einstecken. Das ist mir gleich, solange ich nicht einen Seelenfetzen des Mädchens an meine heften muss und die Leere in ihr vergrößere.
In meinem Augenwinkel erscheinen und verblassen die Weißen Frauen. Dienerinnen des Todes, mit Gesichtern ohne Augen, Nase und Mund, weiten Gewändern und langen Haaren, die sich bewegen, als streiche der Wind durch sie. Sie kommen nicht zu mir. Das Mädchen steht nicht so nah am Tode wie andere.
Ich beobachte, wie meine Tante aufsteht und einer Weißen Frau die Hände gegen die Brust stößt, sodass diese davon geschleudert wird und sich auflöst. Die Lippen fest zusammengepresst, wende ich mich ab.
Die Wunde der Kriegerin schließt sich. Noch bevor der Arzt aufstehen kann, setzt sie sich auf, wischt sich das Blut vom Kinn und greift nach ihrer Klinge. Ich weiche einen Schritt zurück, halte stumm meinen Beutel hin und warte auf meine Entlohnung. Die Mutter ist großzügig und legt zehn Goldstücke hinein.
Ich nehme den Zorn in den Augen der Kriegerin wahr. Würde es das Gesetz nicht verbieten, würde sie sich erneut auf ihre Kontrahenten stürzen und sich rächen. So stürmt sie nur vom Platz, gefolgt von ihrer besorgten Mutter.
Ich drehe mich um, hoffe, dass niemand mehr meine Hilfe braucht. Mein Bruder kniet neben einem älteren Krieger, dessen Arm abgeschlagen wurde. Ein Arzt lässt die Gliedmaße gerade nachwachsen. Das wird den Krieger ein Vermögen kosten.
Die Habichtaugen meines Vaters treffen meine. Keine einzige Haarsträhne hat sich aus seinem strengen Zopf gelöst. Das Missfallen in seinem aristokratischen Gesicht ist nicht zu übersehen. Schuldbewusst senke ich den Blick und suche mir einen neuen Verwundeten, der meine Hilfe nicht unbedingt nötig hat. Zum Glück haben die meisten Angehörigen zu viel Angst vor Tod, dass ich selbst bei unbedeutenden Verletzungen gerufen werde.
Nach einer Stunde habe ich vierzig Goldmünzen in meinem Beutel, nicht annähernd genug, um meine Familie zufriedenzustellen. Aber wann konnte ich das jemals?
Killian grinst über beide Ohren, weil er unserem Onkel helfen durfte, die Weißen Frauen abzuwehren, um einen Krieger von den Toten zu erwecken. In unserer Villa wird er damit angeben. Ich stelle mich neben ihn. Fremde würden uns niemals für Geschwister halten. Obwohl wir beide die typische dunkle Haar- und Augenfarbe haben, sind unsere Staturen, unsere Gesichter sehr gegensätzlich. Wo meines weich und rund ist, ist seines hart und kantig. Neben ihm wirke ich wie ein Kind.
Ich blende sein Grinsen und seinen bluttriefenden Umhang so gut wie möglich aus. Mein eigener Umhang wiegt schwer, ist nicht minder blutgetränkt.
In einem Pulk, meinen Vater an der Spitze, verlassen wir den Platz. Unsere Arbeit ist für heute hoffentlich getan. Ich habe nicht die Kraft oder den Willen, noch einmal zu einem Kampf zu müssen. Aber Krieg ist unberechenbar. Manchmal geschieht tagelang gar nichts und dann schlagen die Krieger sich stundenlang die Köpfe ein, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen.
Der Himmel hängt grau und bleischwer über uns. Die engstehenden Häuser sehen alle wie kleine Türme aus. Fahnen wehen auf den Zinnen, viele mit Kriegs Zeichen, den gekreuzten Schwertern auf blutrotem Grund. Andere sind Eigenkreationen von Kämpfern, die in Kriegs Gunst stehen. Wir kommen an Demetrius Haus vorbei, der brüllende Löwe sticht mir sofort ins Auge. Er ist überall präsent: Als steinerne Statuen an der Treppe, die zur wuchtigen, eisenbeschlagenen Tür mit dem Griff in Form eines Löwen führt, auf dem goldenen Wappen darüber und auf den Bannern, die an zwei Fenstern im zweiten Stock hängen.
Die Schenken, manche kaum mehr als vier Säulen, ein Dach und eine Theke, sind brechend voll, was mir Hoffnung macht, dass Krieg für heute genug gespielt hat.
Schon bald erreichen wir die Villenstadt, wie ich sie nenne, mit Gärten, in denen kaum ein Farbtupfer zu finden ist. Hier hat Krieg die Ärzte und anderen Begabten untergebracht, die ihm nützlich sind. Die blattlosen Bäume strecken ihre kalkweißen Äste wie gierige Finger über Steinmauern hinweg und scheinen nach jedem zu greifen, der ihnen zu nahe kommt. Wenn uns Leute begegnen, machen sie uns sofort Platz und senken ehrerbietig die Köpfe. Manche verbeugen sich sogar, als wären wir die Unsterblichen, denen sie dienen. Nur einer steht über uns im Rang.
Ich laufe in der Mitte meiner Angehörigen. Ich sollte mich machtvoll und stark fühlen, aber das tue ich nicht.
Als unser schmiedeeisernes Tor in Sichtweite kommt, muss ich mich zwingen, nicht aufzuatmen. Wie immer schwingt es, wie von Geisterhand bewegt, zur Seite, um uns einzulassen. Der Weg führt durch eine Allee weißknorriger, blattloser Bäume zu einer hohen, spitz zulaufenden Flügeltür aus dunklem Holz, die mit schweren Eisenriegeln beschlagen ist. Aus den wenigen nicht verhangenen Fenstern dringt kaum Helligkeit. Mein Blick wandert die schwarzgraue Fassade hinauf zu meinem Fenster unter dem hohen Dach. Es ist ebenfalls dunkel.
Die Eingangstür gewährt uns lautlos Eintritt. Noch bevor ich sie sehe, verrät mir das aufgeregte Stimmengewirr, dass die Seelendiebe, die zu jung sind, um mit auf Diebestour zu gehen, uns erwarten. Killian wird sofort von den Kindern in Beschlag genommen und ausgefragt. Der Pulk um mich löst sich auf. Vor der Truhe, in der wir das Gold aufbewahren, bildet sich eine Schlange, also schaue ich mich um. Diener stehen bereit und sammeln hastig alles auf, was die Seelendiebe fallen lassen, um unsere Ausrüstung dann in den riesigen Truhen am Rand der Halle zu verstauen. Mein Vater steht auf der riesigen Treppe, die in die höheren Stockwerke führt und blickt auf uns herunter. Schnell wende ich mich ab. Immerbrennende Kerzen in Glasgefäßen, ähnlich den Diamantgefäßen, in denen wir die Seelen einsperren, erleuchten die Halle. Die Kerzen hängen unter der gewölbten Decke, so viele, dass ich sie nicht zählen kann.
Killians tiefes Lachen dringt zu mir herüber. Er hat Sienna seinen Goldbeutel gegeben, der so schwer ist, dass das kleine Mädchen ihn mit einem Klirren fallengelassen hat.
Ich trete zur Truhe. Achtlos schütte ich mein Gold hinein, schlüpfe ein paar Meter weiter aus den blutverschmierten Schuhen und verschwinde durch eine unscheinbare Tür in die Dienstbotenflure, bevor mich jemand aufhalten kann. Ich muss mir nicht die Glückwünsche und maßlos übertriebenen Beschreibungen anhören. Jedes Mal ist es das Gleiche, wenn wir von einer Diebestour zurückkommen, als würden wir nicht fast täglich unsere Fähigkeit einsetzen. Wenigstens habe ich jetzt eine Zeit lang vor ihnen Ruhe, während sie die Seelenfetzen in die Gefäße übersetzen. Ich habe mir abgewöhnt, sie zu zählen. Die Zeremonie der Seelen hat nichts Ehrfurchtsvolles, es ist die pure Darstellung von Macht. Und mein Vater genießt sie mit jedem Atemzug.
Es geht ihm nicht um die gestohlenen Seelen, nicht um die Menschen, die ihre Menschlichkeit verlieren. Wenn er wenigstens begreifen würde, was er den Menschen antut, wäre es nicht so eine Qual, ihm zuzuschauen.
Die Gänge sind teilweise so schmal, dass zwei Personen nicht aneinandervorbeigehen können. Die Mauern sind kahl, nur vereinzelt erhellt eine immerbrennende Kerze den Weg. Doch ich könnte mich blind zurechtfinden. Ich betrete mein Zimmer durch die Dienstbotentür, die unscheinbar in die Wand integriert ist, öffne sofort die Manschette meines Umhangs und lasse ihn zu Boden gleiten. Dann reiße ich mir die Kleidung vom Leib, die nach Blut und Tod stinkt. Meine Dienerin wird sich darum kümmern.
Ich fröstle auf dem kalten Holzboden. Schnell laufe ich über den weichen Teppich ins Badezimmer, in dem Monica bereits ein heißes Bad eingelassen und auf einem Schemel frische Kleidung bereitgelegt hat. Kerzenschein spiegelt sich an den dunklen Fliesen. Das Wasser rötet meine blasse Haut sofort, aber ich spüre die Hitze kaum. Ich lasse mich in die Stille unter Wasser gleiten, beobachte wie Luftblasen aus meiner Nase an die Oberfläche steigen. Als meine Lungen nach Luft verlangen, setze ich mich wieder auf und streiche mir Tropfen aus den Augen. Obwohl ich keuche, habe ich das Gefühl, ein wenig leichter atmen zu können. Dann fällt mein Blick auf das schwarze Mal auf meinem Unterarm. Ich widerstehe dem Drang, darüber zu reiben, als könnte ich es mit genügend Druck abwaschen.
Ich habe einen weiteren Diebeszug hinter mich gebracht, ohne mich den Weißen Frauen entgegenzustellen und Tods Zorn auf mich zu ziehen. Trotzdem fühle ich mich nicht besser.
Als ich aus dem Badezimmer trete, wartet Onkel Sage auf mich. Er steht mit dem Rücken zu mir und blickt gedankenverlorenen nach draußen. Er hat meine Bücher neben der Fensternische aufgestapelt, die Wolldecke liegt achtlos zerknüllt auf den Kissen, die meinen Lieblingsleseplatz bilden.
Als er sich umdreht, trägt Sage für einen Moment noch die ausdruckslose Maske, dann schleicht sich ein warmer Glanz in seine dunklen Augen. Ein hauchfeines Lächeln erscheint um seine Mundwinkel und vertieft die Falten.
»Selena.«
Nur mein Name, aber es reicht aus, um das Eis in meinem Innern ein wenig zum Schmelzen zu bringen. Erschöpft lasse ich mich auf das Bett sinken. Sage setzt sich neben mich, aber ich blicke nicht auf. Wie meist, trägt er die schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Er hat die gleiche Hakennase und die Habichtaugen wie mein Vater, aber sie sind niemals so eisig.
»Killian sagt, es wäre unglaublich gewesen.«
Ich hole tief Luft. »Es war nicht so schlimm.«
Sage zeigt nicht, ob er mir glaubt. Er ist zwei Jahre älter als mein Vater. Seine Haut sieht wächsern aus, Falten haben sich tief in seine bleiche Haut um Augen und Mund gegraben. Ich wäre gerne wie er, gleichzeitig empfinde ich Mitleid für ihn. Dass er lebt, verdankt er alleine meiner Großmutter, die ich leider nie kennengelernt habe. Durch seine Erzählungen fühle ich mich dieser Frau nahe, die sich gegen ihren Ehemann gewehrt und einen Gabenlosen aufgezogen hat, anstatt ihn zu töten oder zu verstoßen.
Ich wäre getötet worden.
Als mein Vater geboren wurde, war die Familienehre wiederhergestellt und ein würdiger Erbe gefunden. Damals hatte sicher nicht einmal mein Großvater damit gerechnet, dass sein Zweitältester seine Gier und Macht noch übertreffen würde. Mein Vater ist besessen davon, so viele Seelendiebe wie möglich unter sich zu vereinen. Schon jetzt ist er der mächtigste Seelendieb in Schwarz und hat Tod fast aus dem Leben der Menschen verbannt.
Auch wenn Sage in diesem Haus lebt, ist er ein Ausgestoßener. Er ist kein Seelendieb.
Für meinen Vater bin ich die gleiche Schande. Ich bin eine Seelendiebin, aber ich will keine sein.
»Worüber grübelst du?«, reißt Sage mich zurück in die Wirklichkeit.
»Nichts«, weiche ich aus. Ich verspüre nicht den Elan, diese Diskussion erneut mit ihm zu führen. Er versteht als Einziger, wieso ich meine Fähigkeit nicht einsetzen möchte. Aber nicht, wieso ich sie hasse. Er hat Angst vor Tod. Dass ein halbes Leben schlimmer ist, versteht er nicht. Dabei müsste er sich nur meine Mutter ansehen.
Sage bohrt nicht nach. »Wie hat Killian sich wirklich geschlagen?«
»Er ist stark. Die Weißen Frauen sind ihm nicht gewachsen.«
Sages Muskeln entspannen sich etwas.
»Trotzdem kann er sich überschätzen. Er ist übereifrig, fast schon besessen.«
»Er ist jung«, wendet Sage ein. »Sie benehmen sich alle so.«
Bis auf mich, füge ich stumm hinzu.
»Nur du bist klug.« Er lächelt mich an. »Aber gib Acht, Selena, dein Vater hat äußerst schlechte Laune.«
»Hat er die nicht immer.« Ich verdrehe die Augen und lasse mich aufs Bett zurücksinken. »Wir sollten mal raus. Zum schwarzen Strand. Da können wir …« Ich kann es nicht aussprechen, selbst an diesem Ort des Friedens, der Abgeschiedenheit, kann ich nicht frei sein.
»Sele-.«
»Früher sind wir oft dort gewesen«, falle ich ihm ins Wort. »Du hast mir deinen Lieblingsplatz gezeigt.« Für einen langen Moment könnte ich vergessen, was ich bin.
»Es tut mir leid, Selena. Wie sehr ich mir wünsche, du wärst noch das kleine Mädchen. Aber du bist eine Erwachsene. Du hast deine Pflichten zu erfüllen. Wenn du es nicht tust, …«
»Er bestraft mich ohnehin.«
Sage lächelt, obwohl seine Augen dunkel vor Sorgen sind. »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Es ist kein Ja. Aber mehr, als er mir die letzten Male zugestanden hat.
TOD
SCHWARZ IST RUHIG. KRIEG HAT FÜR HEUTE GENUG GESPIELT.
Unruhe treibt mich durch die Straßen von Schwarz. Ich habe die Sterbenden gespürt, aber die wenigsten wurden von meinen Dienerinnen in meinen Palast gebracht. Sie sind frustriert, schreien in ihrem Turm nach Seelen und kämpfen untereinander um jeden, der von mir gerufen wird. Nur die Seelen, die sie aus Weiß zu mir bringen, halten meine Dienerinnen gerade so im Zaum. Dort haben die Seelendiebe keine derartige Macht über die Bewohner.
Je weiter ich mich von den zumeist verlassenen oder nur von Tollkühnen oder Verehrern bewohnten Gebäuden um meinen Palast entferne, desto belebter wird Schwarz. Menschen tummeln sich auf Bänken vor Wirtshäusern, gut besuchte Geschäfte reihen sich aneinander, alle auf den Bedarf von Kriegern ausgerichtet: von den unterschiedlichsten Waffen und Rüstungen zu Schneidern, Schustern und Kerzenmachern und exquisiten Läden wie Edelstein- und Schmuckverkäufern.
Gold wechselt den Besitzer. Ich beobachte Krieger und Kriegerinnen, die ihre Wut im Alkohol ertränken und Strategien für die nächste Schlacht schmieden. Eifersüchtige Liebhaber und Liebhaberinnen, die ihren Geliebten nachspionieren.
Zwischen diesen bewegen sich die Gabenlosen mal mehr, mal weniger unsichtbar. Ein Krieger stößt einen älteren Mann zu Boden, weil dieser nicht schnell genug ausgewichen ist. Seine vielleicht fünfjährige Enkelin versucht, die Tränen zurückzuhalten. Dafür huscht eine junge Frau ungesehen in das Geschäft eines Gemischtwarenhändlers und kauft ein karges Abendbrot. Manchmal sinniere ich darüber, wieso die Gabenlosen sich keinem Unsterblichen anschließen, um ihren Status zu erhöhen. Nicht alle Unsterblichen sind schlecht. Unter Angst könnten sie ein gutes Leben führen. Früher hätte ich sie zu gerne darüber ausgefragt, heute nehme ich ihre Anwesenheit hin.
Mein Weg führt mich zu einer abgelegenen Villa, die von einem großen, brachliegenden Grundstück umgeben ist. Genau wie das Gebäude, stehen die Bäume schon Jahrhunderte hier. Das hohe, schmiedeeiserne Tor bleibt für mich verschlossen. Es ist einer der wenigen Orte in Schwarz, die ich nicht betreten kann. Licht leuchtet hinter den wenigen Fenstern, die nicht durch dicke, schwere Vorhänge den Blick ins Innere verwehren.
Die Seelendiebe sind zwar nicht so alt wie ich, doch ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann Schwarz den Ersten hervorgebracht hat. Seither ist ihre Zahl beständig gewachsen. Sie bewahren sich selbst vor mir. So können sie fast unsterblich werden, bis ihre Körper versagen und keine Spur einer Seele mehr in ihnen vorhanden ist. Bis sie nur noch eine leere Hülle sind. Erst dann werden sie mir als Opfer dargebracht, als würde mich das besänftigen, nachdem sie mir all die Leben gestohlen haben, die mir zustehen. Sterbliche Hüllen sind uninteressant für mich. Die Seelen verwahren die Diebe weiterhin, halten sie auf ewig gefangen und verweigern damit den Verstorbenen ihre letzte Ruhe. Wenn die Seelendiebe sie freiließen, hätte ich zwar keine Kontrolle mehr darüber, wann jemand stirbt, aber zumindest wäre die natürliche Ordnung wiederhergestellt.
Nach und nach erlöschen die Lichter, bis nur noch ein schwaches brennt. Ich weiß, dass es die ganze Nacht leuchten wird. Schon viele Male habe ich das Licht beobachtet, als könne es mir etwas über den Bewohner des Zimmers verraten, der Angst vor der Dunkelheit hat, die er nicht haben sollte.
Schwarz ist Dunkelheit.
Schwarz ist Finsternis.
Schwarz ist mein Reich.
Die Sonne ist am magischen Himmel nie zu sehen, gleichgültig, in welcher der drei Ebenen man sich bewegt. Weder Sterne noch Mond zeigen sich in der Nacht. Alles ist bestimmt von dunklen Farben, von Leblosigkeit und Düsternis. Ganz anders Weiß. Aber außer mir hat noch nie ein Bewohner von Schwarz die Gegenseite gesehen. Zu groß ist die Angst vor dem Dazwischen.
Ich seufze. Weiß. Ein Ort des Lichts und der Liebe. Meine Schwester leitet die Bewohner mit sanfter Hand. Sie ist wie eine fürsorgliche Mutter. Niemand braucht sich vor ihr zu fürchten. Sie bietet mir immer eine Zuflucht an, auch wenn ich ihre Untertanen genauso hole wie alle anderen.
Schwarzes Feuer rast durch meine Adern und erinnert mich an die Bürde meiner Bestimmung. Ein Schrei hallt in meinem Inneren wider. Im nächsten Moment materialisiere ich mich in einem Haus. Glasscherben liegen auf dem Boden, Möbel sind umgeworfen, eine riesige Standuhr ist zu Bruch gegangen. Dunkles Blut glänzt auf dem Boden. Meine Dienerin wiegt einen kahlgeschorenen Krieger in ihren Armen und singt ein für Menschen unhörbares Wiegenlied. Vier andere Weiße Frauen umringen eine junge Kämpferin, die auf dem Boden kniet, die Hände wie zum Gebet gefaltet, und mich anfleht. Sie hat mich gerufen, genauso wie ihr Verstoß.
Zuerst trete ich zu dem Toten, ergreife seine noch warme Hand. »Willkommen in meinem Schoß«, spreche ich die rituellen Worte. »Du wirst es gut haben.« Seine Zeit war noch nicht abgelaufen. Er hätte gelebt, noch viele Jahre lang. Zwei Kinder werden nicht geboren werden, weil die Kriegerin ihm aus Rache das Leben genommen hat.
Meine Dienerin löst sich auf und nimmt die Seele des Toten mit sich. Langsam wende ich mich um. Die Kriegerin spürt meine Anwesenheit, als breite sich eine dunkle Decke aus Metalldornen über sie aus. Sie wirft sich auf die Knie.
»Gnade«, bettelt sie.
Doch ich zeige keine Gnade mit Mördern und Gesetzesbrechern. Ich spüre, dass sie erst heute eine schlimme Verletzung erlitten hat, die sie das Leben gekostet hätte. Ich kann mir denken, dass der getötete Krieger dafür verantwortlich war. Vielleicht wollte sie ihn nicht einmal töten, sondern hat nur das Gold verlangt, das sie durch ihre Verwundung verloren hat. Aber Gesetz ist Gesetz.
Meine Dienerinnen weichen zurück. Die Kriegerin zittert, flieht aber nicht. Es wäre sowieso sinnlos. Vor mir kann sie nicht davonlaufen.
»Ich habe nicht viele Regeln«, sage ich.
Meine körperlose Stimme erschrickt sie.
Ich sehe in sie hinein und finde keine Reue. »Aber diese Regeln werden befolgt und ihr Bruch wird bestraft.«
»Bitte«, fleht sie.
Gedanklich schicke ich meinen Dienerinnen eine Anweisung. Sie schießen gierig vor, packen die Kriegerin an den Armen und zerren sie auf die Beine. Sie schreit, panisch und zornig, versucht, sich loszureißen. Hektisch sucht sie nach mir, aber ich bleibe unsichtbar für sie.
»Die Strafe für Mord ist Tod.« Ich greife in ihre Brust und umschließe ihr Herz.
Während sie stirbt, erkenne ich den immer gleichen Ausdruck in ihren Augen: Begreifen und Angst. Dann werden sie leer.
»Bringt sie fort«, weise ich meine Dienerinnen an. »Hundert Jahre in den Feuergruben sollten genügen, um sie Reue zu lehren.«
Ich lasse die Seele von meiner Handfläche zu ihnen schweben. Diese von Zorn und Rachsucht zerfressene Seele - ein rotgoldenes, loderndes Feuer.
Ich folge meinen Dienerinnen zurück in meinen Palast. Er liegt am tiefsten Punkt von Schwarz und wurde bisher von keiner lebenden Seele betreten. Fackellicht spiegelt sich auf den schwarzen Fliesen. Schwere Türen aus Ebenholz säumen die schmalen und breiten Gänge, sie führen mal in große, mal in kleinere Räume. Manche haben einfach angefangen zu existieren, andere entstehen, wenn meine Dienerinnen neue Seelen bringen. In ihrer Einrichtung spiegelt sich der Bewohner wider, sein Leben, seine Wünsche und Träume. Wer meinen Palast von außen betrachtet, würde ein Labyrinth dieses Ausmaßes nicht erwarten.
Die Verliese und die Feuergruben kann keine Seele betreten, außer, ich habe sie ausdrücklich dort eingesperrt. Sie sind all jenen vorbehalten, die gegen meine Gesetze verstoßen. Die Feuergruben löschen alle Erinnerungen, die Verliese lassen einen nachdenken.
In den Gängen wandeln die wartenden Seelen, geisterhafte Abbilder ihrer Körper. Heute husche ich wie ein Schatten vorbei, weil ich keine Lust auf eine belanglose Unterhaltung habe.
Als ich meine Gemächer erreiche, wird der Drang größer, eine Gestalt anzunehmen, aber ich kann widerstehen. Die damit einhergehenden starken, menschlichen Emotionen würden mich vollends schwach werden lassen. Das Himmelbett ist von schwarzen Vorhängen eingefasst, die Bettpfosten allerdings sind aus dunkelbraunem, glänzendem Holz aus dem Garten meiner Schwester Liv. Künstler haben Figuren, Gesichter, Tiere, Bäume und Blumen hineingeschnitzt. Ich verspüre das drängende Bedürfnis, mich ins Bett zu legen und nie wieder aufzustehen. Schnell wende ich den Blick ab, lasse ihn über die farbenfrohen Bilder an den Wänden gleiten. Eines zeigt Livs Palast im Sonnenlicht, ein anderes eine Sonnenblume, ein weiteres einen blütentragenden Baum. Es sind die einzigen Bilder in Schwarz, die nicht mit dunklen Farben gemalt wurden. Dieses Mal verspüre ich nicht den Elan, sie zu verhängen. Ich gehe zu dem, das meine Schwester zeigt. Sie lächelt und ihre großen, grünen Augen leuchten, als wären sie lebendig. Ihre Umarmung würde die Schatten für einen kurzen Moment in Schach halten.
Als ich mich abwende, fällt mein Blick durch die offene Tür in den ansonsten leeren Nebenraum, auf das Modell unserer beiden Welten, das in der Mitte schwebt. Die drei Ebenen von Schwarz. Meines Reiches. Düster wie sein Name. Die unterste besteht aus meinem Palast, einigen Häusern um das Gelände mit der hohen Mauer, wo vor Jahrhunderten Dienstboten gewohnt haben, jetzt aber nur noch Tollkühne und Todessehnsüchtige, die entweder verrückt oder zerbrochen sind. Ich erinnere mich kaum an die Zeit, in der ich nicht gänzlich alleine war. In der Menschen mich als alten Vertrauten willkommen geheißen haben, wenn es für sie an der Zeit war, zu gehen, in der sie mich nicht gefürchtet haben.
Die zweite Ebene ist deutlich größer und bewohnter: Kriegs Burg liegt neben einer der größten Treppen, die direkt auf den Platz vor meinem Palast führt. Raches Reich ist frei zugänglich, ohne Mauer, auch ein Abbild besserer Zeiten. Die Häuser werden in alle Richtungen von Feldern und an einer Seite von einem schwarzen Strand begrenzt. Und schließlich die dritte Ebene, zerfallen und von einem in der Realität endlosem Friedhof umgeben. Der Schandfleck meiner Welt, das personifizierte Elend.
Das Dazwischen ist als leuchtend blaue Wasserblase dargestellt. Es bewegt sich träge, pulsiert. Niemand wird wohl je seine Mysterien entdecken. Selbst mir ist dieses Zwischenreich nur unter größter Kraftanstrengung zugänglich.
Darüber strahlt Weiß mit seinen Feldern, der riesigen Hafenanlage, den Prachtstraßen und bunten Villen und dem Palast der Herrscherin, aus Glas, Kristall und weißem Marmor, umgeben von einem Garten.
Ein Lichtfleck am Rand meines Sehbereichs nimmt meine Aufmerksamkeit gefangen. Ich drehe den Kopf weg vom Modell und schaue zu dem Spiegel, den ich in die hinterste Ecke des Zimmers verbannt habe. Der schwarze Vorhang, der die Fläche normalerweise bedeckt, ist verrutscht und lässt warmes, reines Licht hindurch. Meine Magie reißt ihn vollends herunter.
Sonnenlicht fällt heraus und hüllt das düstere Zimmer in Helligkeit. Ich trete vor. Der Spiegel überragt mich um gut einen Kopf.
»Du siehst schrecklich aus«, begrüßt Liv mich.
Heute hat sie die Gestalt eines Kindes angenommen, sitzt lächelnd neben einem Puppenhaus. Goldene Locken umfließen ihr herzförmiges Gesicht, ihr schmaler Körper steckt in einem türkisfarbenen Kleid. Sie steht auf und stellt sich von ihrer Seite an das Fenster.
Niemand ist bei ihr, woraus ich schließe, dass sie darauf gewartet hat, dass ich komme. Sie muss meine Unruhe gespürt haben.
Weil Liv mich auch so sehen kann, nehme ich keine Gestalt an. Sie berührt das Glas, als wolle sie mir die Sorgenfalten aus dem Gesicht streichen. »Was ist geschehen?«
»Ein Regelbruch«, antworte ich. Obwohl ich mir immer wieder schwöre, sie nicht mit meinen Sorgen zu belasten, schaffe ich es nicht, mich daran zu halten. Sie ist einfach zu überzeugend, ohne mich wirklich zu drängen.
Meine Dunkelheit kann ihre Helligkeit nicht eine Spur verblassen lassen.
»Komm zu mir, nur ein paar Tage«, schlägt meine Schwester vor, wie jedes Mal.
Einmal habe ich es getan. Einmal habe ich ihr Angebot angenommen. Wenn die Verzweiflung mich wieder übermannt, erinnere ich mich daran, dass auch die Menschen von Weiß mich fürchten. Außer in meinem Palast bin ich nirgends willkommen.
Nur bei Liv. Sie empfindet keine Angst.
SELENA
EHRGEIZ MACHT BLIND. BLIND FÜR MENSCHEN, DIE EINEM ETWAS BEDEUTEN SOLLTEN.
Ich schlage die Augen auf und betrachte das Licht auf meinem Nachttisch. Ich habe es als Kind gebastelt. Es ist ein Glas mit Sand und dunklen Muscheln vom schwarzen Strand, darin eine rote, immerbrennende Kerze. Ich setze mich auf und fahre mir durch die Locken. An meinen Albtraum kann ich mich nicht erinnern, nur, dass ich mehrmals in der Nacht aufgeschreckt bin. Langsam steige ich aus dem Bett und trete zum Fenster. Ein typisch grauer Himmel begrüßt mich.
Ich ziehe mich an und schminke mir die Müdigkeit aus dem Gesicht, damit meine Familie nicht merkt, dass ich die halbe Nacht wach liege. Dass mich Gedanken und Gesichter wach halten.
Ein zaghaftes Klopfen. Monica steht in der Dienstbotentür. Ihr schwarzes Haar trägt sie in einem streng geflochtenen Zopf, obwohl ich weiß, dass sie es am liebsten offen lässt. Ich lächle sie an. Sie wünscht mir einen guten Morgen und betritt mein Zimmer, schüttelt mein Bett auf und öffnet das Fenster, um frische Luft hereinzulassen.
»Seelendieb Dominikus möchte dich sehen«, informiert sie mich.
Ich nicke. Meine Angst ist mir sicher anzusehen, also straffe ich die Schultern und zwinge eine emotionslose Maske auf mein Gesicht. Ich muss nicht fragen, was mein Vater von mir will. Sein Missfallen gestern war nicht zu übersehen. Er wird mich zurechtweisen, vielleicht bestrafen.
Ich verlasse mein Zimmer und gehe mit energischen Schritten die mit roten Teppichen ausgelegten Gänge und Treppen hinunter. Kronleuchter erhellen die Düsternis, Behaglichkeit erzeugen sie keine. Von den Wänden starren mir meine Ahnen arrogant hinterher. Ich hätte die Bilder am liebsten verbrannt.
Leise klopfe ich an die Flügeltür des Arbeitszimmers.
Sein »Herein« klingt fordernd wie stets.
Ich drücke die Klinke hinunter. Nachdem mein Großvater gestorben war, hat mein Vater sein Arbeitszimmer bezogen und verlässt es kaum noch. Er hat es zu seinem persönlichen Thronsaal erklärt.
Der Raum ist von vielfarbigem Leuchten erhellt. In mir zieht sich alles zusammen, als mein Blick über die vielen Seelenfetzen wandert, die unruhig in ihren Diamantgefäßen flackern, als wollten sie zu ihren Besitzern zurück. Jedes einzelne Glas ist fein säuberlich beschriftet. Die Schränke und Regale sind so vollgestellt, dass kaum noch eine Lücke vorhanden ist. Und das sind nur die Seelen, mit denen mein Vater seine Macht demonstrieren will.
Er thront hinter seinem wuchtigen Schreibtisch, sein stoischer Gesichtsausdruck verrät mir, dass er nicht allzu schlecht gelaunt ist.
»Setz dich.«
Ich gehorche sofort, muss mich aber zwingen, die gesamte Stuhlfläche auszunutzen, um einen möglichst entspannten Eindruck zu vermitteln. Momentan widmet er einem Dokument mehr Aufmerksamkeit als mir, ich bin erleichtert über jeden einzelnen Herzschlag Ruhe. Gleichzeitig weiß ich, dass er nur seine Macht ausspielt. Ich bin nicht wichtig genug. Die unscheinbare Tür zum Nebenraum, in welchem er seine Papiere aufbewahrt, ist wie immer geschlossen. Nur einmal habe ich einen kurzen Blick auf riesige Schränke mit Mappen und Blätterstapeln geworfen, bevor er sie vor meiner Nase zugeknallt hat.
Mein Vater platziert das Blatt auf einem Stapel, erhebt sich und starrt auf mich herunter. Ich kann nicht atmen. Ein riesiger Kloß sitzt in meiner Kehle und lässt Tränen in meinen Augen brennen, die ich auf keinen Fall vergießen darf.
»Was genau, glaubst du, gestern getan zu haben, Selena?«, fragt er mit eiskalter Stimme.
»Wieso?«, frage ich, Unwissen heuchelnd. Das Zittern in meiner Stimme kann ich jedoch nicht verbergen. Hastig senke ich den Blick auf meine Schuhspitzen und spüre, wie sich eine Träne aus meinem Wimpernkranz löst.
»Zwei Jahre«, betont er. »Seit zwei Jahren bist du eine vollwertige Seelendiebin und trotzdem nimmst du deinem Bruder die Aufgaben, die ihm angemessen sind. Was sollen wir von dir denken, Selena?« Er spricht meinen Namen wie einen Fluch aus.
»Er ist stärker als ich.« Ich mache mich noch kleiner, um in den Augen meines Vaters noch schwächer zu erscheinen. Ich habe ihm so oft klar zu machen versucht, dass ich nicht so stark wie mein Bruder bin. Deswegen schämt er sich für mich. Ich bin die Ältere, ich soll seine Nachfolge antreten. »Ich fühle mich dem nicht gewachsen, den Tod zu bestehlen. Wenn ich verliere …« Ich beende meinen Satz absichtlich nicht. Im Gegensatz zu ihm weiß ich, dass ich nicht verlieren werde. Ich weiß, dass ich stark genug bin, den Tod zu bestehlen. Ich will einfach nicht eine fremde Seele mit meiner vereinigen, ich will einem Menschen nicht einen Teil seiner Seele nehmen. Nie wieder. Ich will nicht für die Leere in seinen Augen, in seinem Herzen, in seinem Leben verantwortlich sein.
Mein Vater knallt die Handfläche auf den Tisch. Ich zucke zusammen. »Woher willst du es wissen, wenn du es nicht probierst?«, schreit er, dass es draußen auf dem Flur noch zu hören sein dürfte.
Ich habe es probiert, will ich ihm am liebsten entgegenschreien. Ich war dumm und naiv.
Wir handeln mit Seelen, die nicht selbst entscheiden können, die immer und immer wieder ins Leben zurückgezwungen werden und dabei sich selbst verlieren. Ein Teil von ihnen wird immer Tod gehören.
»Hörst du mir überhaupt zu?«
Ich schrecke hoch und für einen Moment verrutscht meine Maske. Seine letzten Worte habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen. Schuldbewusst senke ich wieder den Kopf. Ich warte nur darauf, dass er in seine unterste Schreibtischschublade greift, trotzdem bringe ich die Worte hervor, die noch nie etwas geändert haben. »Tut mir leid.«
»Was soll ich nur mit dir machen?«, fragt mein Vater missmutig. Die Schublade bleibt verschlossen, seine Laune ist noch nicht auf dem Tiefpunkt angekommen. Trotzdem wage ich nicht, aufzuatmen.
Verstoßen kann er mich nicht, da ich die Gabe besitze. Verheiraten wäre eine Alternative, die Schmach kann er sich gegenüber anderen Familien aber auch nicht erlauben. Meine Familie ist die mächtigste der Seelendiebe. Und in seinen Augen bin ich eine Schande, die seine Ehre und seinen Ruhm trübt. Die seinen Namen beschmutzt.
Lass mich einfach so weitermachen, will ich ihm vorschlagen. Aber das kann ich nicht, denn das würde er nicht akzeptieren. Er würde mich für meine Schwäche schlagen, wenn nicht sogar zwingen, Tod zu bestehlen.
»Du wirst als meine Nachfolgerin zurücktreten«, sagt er, ohne mich anzusehen. »Ich werde Killian als meinen Erben bestimmen.«
Ich muss mich verhört haben. Ein Gewicht hebt sich von meinen Schultern, gleichzeitig will ich ungläubig den Kopf schütteln, kann es aber gerade noch verhindern. Ich brauche mehrere Augenblicke, bis sich die Erleichterung wie die Wärme eines heißen Bades in meinem Körper ausgebreitet hat. Mein Vater erkennt nicht, was er mir Gutes tut.
»Und du wirst dich nicht mehr mit Sage treffen. Er hat einen schlechten Einfluss auf dich.«
Fassungslos starre ich meinen Vater an. Eiswasser schießt durch meine Adern, vertreibt die Wärme so plötzlich, als hätte jemand eine Kerze ausgepustet. Ich presse die Lippen zusammen und bohre die Fingernägel in die Handfläche, damit der Schmerz mich daran erinnert, nicht vor ihm zu weinen. Sage nicht mehr sehen zu dürfen, gleicht einem Todesurteil. Für ihn und für mich. Meine Familie, unsere Familie redet nur das Nötigste mit ihm. Außer mir hat er niemanden. Außer ihm habe ich niemanden!
»Nein«, platze ich heraus. »Er gehört zur Familie. Du kannst mir nicht verbieten, mit ihm zu sprechen.«
Ich muss dem Drang widerstehen, meine Hand vor den Mund zu schlagen, als könne ich die Widerworte wieder hineinzwingen. Diese Bewegung würde mein Vater noch mehr als Schwäche auslegen und mich noch heftiger bestrafen. Unwillkürlich straffe ich meine Schultern und bereite mich darauf vor, dass das kaum hörbare Kratzen meine Nackenhaare aufstellt.
Seine Faust kracht auf den Tisch. »Mein Vater hat ihn damals nicht verstoßen, obwohl unser Gesetz es verlangt«, fährt er mich an. »Sage lebt, weil ich es ihm erlaube!«
Ich weiß, dass er meinen Großvater für diese Entscheidung hasst. Er hält seinen älteren Bruder für einen Makel unserer Blutlinie. Obwohl ich ein kleines Mädchen war, als meine Großmutter dem Tod übergeben wurde, erinnere ich mich noch an ihre wirre Geschichte, wie erleichtert mein Vater war, als er die Kennzeichnung auf meiner Haut entdeckt hat. Die mich als das ausweist, was ich hasse.
Hatte er angenommen, dass ich ebenfalls gabenlos geboren werde? Hätte er mich getötet? Hätte meine Mutter es verhindern können?
Ich widerstehe dem Drang, mein Handgelenk zu drehen, um auf der Innenseite meines Unterarmes die schwarze Markierung zu sehen, die mich als eine Seelendiebin ausweist. Ich habe sie oft genug betrachtet, um sie mir detailgenau vor mein inneres Auge zu rufen. Eine schwarze Gestalt, bis zur Hüfte abgebildet, in einem schwarzen Mantel mit aufgesetzter Kapuze, die wie zu einer Dolchspitze zerläuft, das Gesicht undeutlich. Die blassen Hände vor der Brust geöffnet, als würden sie nicht Leere, sondern eine heilige Reliquie tragen.
»Du wirst nicht mehr mit Sage sprechen«, wiederholt mein Vater seinen Befehl.
Ich weiß, dass ich mit dem Feuer spiele, aber ich kann nicht anders. »Nein!«
Wir funkeln uns an. Er nimmt mir das Einzige, was mich mein Leben gerade so ertragen lässt, diesmal werde ich nicht nachgeben.
Ein energisches Klopfen reißt die Aufmerksamkeit meines Vaters an sich. »Herein!«
Ich hole Luft und bemerke erst jetzt, dass ich sie angehalten habe. Wut züngelt in mir und ich riskiere einen ganz kurzen Blick in mich, solange er abgelenkt ist. Meine silberne, fast durchscheinende Seele flackert, unruhig wie eine Kerzenflamme im Luftzug. Die zweite scheint geschrumpft und farblos.
»Dominikus.« Lubilianas hohe Stimme. Meine Tante klingt aufgeregt. »Du hast einen Auftrag.«
Ich richte meine Konzentration wieder nach außen. Mein Vater steht wohl hinter mir. Ich drehe mich nicht um. Was dieser Auftrag sein soll, macht mich zwar neugierig, aber das will ich auf keinen Fall zeigen.
Im nächsten Moment bin ich alleine im Arbeitszimmer, als hätte unser Streitgespräch niemals stattgefunden. Sobald es um seine Repräsentation und Zurschaustellung von Macht geht, bin ich unsichtbar.
Ich weiß, was die Menschen flüstern, wenn sie über meinen Vater sprechen. Ein Mann, der mächtiger ist als der Tod.
TOD
ES IST EIN FLÜSTERN. EIN RUF NACH HILFE.
Ich rase unsichtbar durch mein Reich, vorbei an Feiernden, Ahnungslosen, Betrunkenen, Sorgenlosen. Straße um Straße lasse ich hinter mir, steige hinauf, komme dem Dazwischen näher und näher. Nehme Abkürzungen durch dunkle Tunnel, die nie ein Mensch betreten hat, und husche durch magische Portale.
Als ich meinen Zielort erreiche, halte ich inne und lasse das Bild auf mich wirken. Obwohl ich jeden Ort in meinem Reich kenne, fühle ich jedes Mal abgrundtiefe Enttäuschung und Bitternis bei diesem Anblick: Die Gasse ist von halb zerfallenen Häusern begrenzt, Regen hat den Boden zu Schlamm aufgeweicht. Der Himmel ist rabenschwarz, manchmal flackert eine Spur Blau auf, ein Blitz, ein Wolkenband, das auftaucht und verschwindet. Das Dazwischen.
Man müsste nur auf eines der höheren Gebäude klettern, die Hand in den Himmel strecken und hineingreifen. Schon würde das Dazwischen einen einsaugen.
Unsterblichkeit ist ein Fluch. Dass die Menschen sich danach sehnen, ist mir bis heute unbegreiflich. Wir fristen ein endloses Dasein, nur die anderen Unsterblichen sind Gewissheit und unsere Aufgabe, die uns fesselt.
Die Ebene von Hunger verabscheue ich. Besäße ich die Fähigkeit, würde ich alles ändern und meine Untertanen zur Räson rufen. Aber sie tun nur das, wofür sie geschaffen wurden. Wider der Natur zu handeln, ist unmöglich. Ich habe es versucht.
In der dritten Ebene leben die Vergessenen von Schwarz. Trauer verkümmert die Seele, Hunger und Krankheit übernehmen den Körper. In den anderen Teilen von Schwarz gibt es kaum Chancen, aus der Routine des Alltags, des Kämpfens, des Sterbens, des Leidens, der Furcht auszubrechen, aber hier existiert nicht einmal ein Funke Hoffnung.
Ich nehme Gestalt an, sofort spüre ich das Gewicht meines menschlichen Körpers. Die Kälte dringt durch meine Kleidung und die Nässe des Matschs gräbt sich durch meine Stiefel bis zu meinen Zehen. Mein Mantel bauscht sich im eiskalten Wind, als ich die wenigen Schritte zu einer Gestalt gehe, die sich zwischen zwei Mauerstücke einer zerfallenen Ruine presst, um sich vor dem Wetter zu schützen. Dreck ist auf dem zerlumpten, mehrmals geflickten Mantel getrocknet. Schuhe, Hemd und Hose sind in keinem besseren Zustand.
Der Mann hört mich nicht. Selbst als ich neben ihm in die Knie gehe, bleibt er zusammengekauert. Seine Lider sind geschlossen, die eingefallenen Wangen und die Nase gerötet von Kälte.
Behutsam strecke ich die Hand aus und lege sie auf die magere Schulter des Mannes.
Er öffnet nur langsam die Augen. Einen Moment braucht er, um mich zu erkennen. »Du?«, flüstert er mit heiserer Stimme.
Ich lächle sanft, obwohl sich in meinem Inneren alles verkrampft. Die Schmach über mein Versagen, heute wie damals, bohrt sich wie ein Messer in meine Eingeweide.
»Nimm mich mit«, bittet er.
Ich schüttele den Kopf, lege den Mantel ab und ihm um die Schultern. Gegen die Kälte wird er kaum ausreichen, aber er beruhigt ansatzweise mein Gewissen. »Deine Zeit ist noch nicht gekommen«, raune ich.
Ich bin erleichtert darüber, auch wenn das Leben ihm übel mitspielt. Nähme ich ihn mit, würde sein körperliches Leiden enden. Doch obwohl er mich schon oft darum gebeten hat, kann ich ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. Er hat eine Vorstellung davon, was ihn erwartet. Aber er weiß nicht, wie es wirklich sein wird. Und das kann ich ihm nach all dem nicht antun, wenn noch die winzigste Chance besteht, dass sein Leid irgendwann endet, ohne dass es sein Ende bedeutet.
Er widerspricht nicht, schließt nur wieder die Augen.
Ich greife in meine Tasche, meine Finger umschließen die harte Goldmünze darin. Ich öffne seine Hand, lege ihm die Münze hinein und balle sie mit meiner zur Faust. Obwohl er die Lider geschlossen hat, weiß ich, dass er meinen Blick wahrnimmt.
»Kämpfe!«, fordere ich ihn auf.
Seine Lider flattern und er sieht mich mit diesen blaugrauen Augen an, die in Schwarz so untypisch sind.
»Wofür?«, fragt er.
»Für mich.«
Ein Lächeln teilt seine spröden Lippen und ein Laut, der nur entfernt einem Lachen ähnelt, dringt heraus.
»Komm«, sage ich und ziehe behutsam an seinem Arm.
Noch länger in der Kälte zu bleiben, wäre sein Ende. Niemand wird ihm hier helfen. Jeder ist sich selbst der Nächste.
Er schüttelt den Kopf. »Keine Extrabehandlung«, flüstert er mit rauer Stimme. Ein Husten erschüttert seinen mageren Körper.
Selbsthass lodert in meinem Innern, aber ich zeige ihn nicht, sonst würde er nie mit mir kommen, sonst würde er sich nie helfen lassen. Er ist meinetwegen hier.
»Du kennst mich«, erwidere ich also grinsend. »Außerdem hättest du mich ja nicht rufen müssen. Du weißt, dass ich dir nicht beim Sterben zusehen kann.«
Er sieht mich einen Moment länger an, als es mir gefällt, dann nickt er und lässt sich von mir aufhelfen. Schwer stützt er sich auf mich, zieht bei jedem Schritt sein steifes Bein hinter sich her wie einen Fremdkörper. Die menschliche Berührung fühlt sich gut an. Sein Gewicht zu spüren, ihm richtig helfen zu können. Zu lange habe ich es nicht gewagt, eine Form anzunehmen. Um genau das zu vermeiden, den Ansatz von Menschlichkeit zu spüren.
»Du bist zu waghalsig«, sagt er. Und erinnert mich damit wieder daran, wieso er hier ist.
Obwohl ich lieber etwas durch die Gegend werfen würde, lächle ich, weil er das jedes Mal sagt. Mit einer Gestalt sind die Emotionen viel stärker. Ich habe sie vermisst, aber gleichzeitig fühle ich mich auch schwächer, beeinflussbarer. Ich kann den Schmerz der Menschen besser nachvollziehen, ihr Leiden, ihren Kummer. Manchmal frage ich mich, wie sie all das ertragen. So viel Emotionen in so zerbrechlichen Geschöpfen. Sie haben keine Jahrhunderte Zeit, um zu lernen, ihre Wut in den Griff zu bekommen, mit ihrer Trauer umzugehen, vor überschüssiger Energie nicht alles kurz und klein zu schlagen und nicht bei jedem Anflug von Liebe den anderen in ein sicheres Versteck zu bringen und vor der Welt wegzuschließen.
Vielleicht sind sie deswegen so manipulierbar und empfänglich für uns.
Wir verlassen die Ruine und wanken die Gasse hinunter. Mit dem steifen Bein findet er kaum Halt im Schlamm. Mehrmals kann ich gerade so seinen Sturz verhindern. Vor einem heruntergekommenen Gasthaus bleibe ich stehen. Für das Gold wird er ein Zimmer für eine Nacht und drei warme Mahlzeiten erhalten. Ich erinnere mich nicht, wann Hunger zuletzt die Gasthäuser für alle öffnete, damit ihm die Anhänger nicht wegsterben. Ich sollte ihn mal wieder zur Räson rufen. Auch wenn er und Krankheit die widerlichsten Unsterblichen sind, müssen sie ihre Anhänger nicht wie Abfall behandeln.
»Ruh dich aus«, sage ich.
»Das könnte ich bei dir«, erwidert er, nimmt aber seinen Arm von meiner Schulter und stützt sich an der Tür ab.
»Lebe!«
Er sieht mich erschöpft an. Dann humpelt er in das Gasthaus und lässt mich draußen zurück. Ich trete einige Schritte von der Tür zurück, bleibe aber in meiner Gestalt. Einen Moment will ich noch das Gefühl von Menschlichkeit auskosten und vergessen, wer ich bin.
SELENA
VERSAGEN MACHT WÜTEND. VERSAGEN IST FÜR MEINEN VATER UNDENKBAR.
Ich sitze meinem Bruder gegenüber, der, obwohl er erst vor einer Stunde von einer weiteren Diebestour zurückgekommen ist, das Essen in sich reinschaufelt, als sei er am Verhungern. Allein vom Zusehen vergeht mir der Appetit, obwohl ich wirklich essen sollte, um meiner Familie vorzugaukeln, dass alles in Ordnung sei.
Ich habe in den letzten Wochen zu viel abgenommen. Die fast täglichen Diebestouren nagen an meiner Substanz.
Wir sitzen in der größten Halle, deren gewölbte Decke rund zwei Etagen über uns thront, bemalt mit jahrhundertealten Szenen von Diebestouren. Überall schimmern Seelenfetzen wie Flammen, von den Seelendieben sind nur die Hände nicht von schwarzen Umhängen verdeckt. Ich vermeide jeden Blick hinauf, denn genau so sehe ich aus, wenn ich auf die Straßen gehe. Eine unter vielen. Vermummt. Ehrerbietend. Zum Fürchten.
Nur mein Vater trägt nicht die Kapuze. Jeder soll wissen, wer er ist, wie mächtig er ist.
Der massive, dunkle Eichentisch beugt sich unter den Massen an Essen: saftiges Lammfleisch, frischgebackenes Brot, goldgelbe Kartoffeln, knusprige Hähnchenschenkel, Braten und Soße.
Nicht einmal die Hälfte davon wird von uns gegessen, aber statt es an die Armen zu verteilen, werfen wir es einfach weg.
Diener huschen unentwegt heran und wieder in die Schatten, um nachzufüllen, Wein einzuschenken oder verschmutztes Geschirr wegzuräumen und neues zu bringen. Niemand beachtet sie, als wären sie unsichtbar. Gabenlose.
Meine Cousine Cora beugt sich an mir vorbei und angelt nach einer Scheibe Brot. »Hast du es schon gehört?«, raunt sie mir zu.
Ich muss nicht nachfragen, muss ich nie. Cora ist ein Plappermaul. Nur Augenblicke später fährt sie fort: »Es gab einen Regelbruch. Onkel Dominikus wurde gerufen, um einen Seelenraub durchzuführen, obwohl Tod die Kriegerin eigenhändig zu sich geholt hatte.«
Wie stolz sie ihre Verwandtschaft betont. Allein bei seinem Namen läuft mir ein Schauder über den Rücken. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich ihn das letzte Mal ausgesprochen, geschweige denn ihn Vater genannt habe.
Mein Herz klopft heftig in meiner Brust. Niemand ist so waghalsig und bricht das oberste Gesetz des Todes, keine Seele zurückzuholen, die er als Bestrafung für einen Regelbruch zu sich geholt hat. Mein Vater muss endgültig den Verstand verloren haben.
»Er hat sich geweigert«, wispert Cora mir zu, »aber die Mutter wollte das nicht hinnehmen. Sie hat ihm Unsummen versprochen und gemeint, dass er es tun müsse, weil er der beste und stärkste Seelendieb ist.«
Mein Blick huscht zum Kopfende, an dem mein Vater sitzt und sein Essen kaum anrührt. Dunkle Ringe unter seinen Augen lassen die Haut noch bleicher erscheinen. In diesem Moment scheint er nicht der autoritäre Mann zu sein, der mich in meinen Albträumen heimsucht. Trotzdem kann ich kein Mitleid für ihn aufbringen.
Meine Tante, seine Stellvertreterin, sitzt neben ihm und wirft ihm immer wieder besorgte Blicke zu. Lubiliana ist ihm so treu ergeben, dass sie für ihn sterben würde. Sie sieht nicht, was für ein Monster er sein kann, obwohl auch sie die Narben seiner Strafen trägt. Während ich meine verstecke, zeigt sie ihre mit Stolz.
»Er hat es nicht getan, oder?«, höre ich mich flüstern, obwohl sein müdes Aussehen mir das Gegenteil beweist. Wut lodert in meinem Innern, genauso wie Angst. Was sind wir, wenn wir nicht einmal die heiligsten Gesetze des Todes respektieren? Wir bewegen uns sowieso auf Messers Schneide.
»Doch«, sagt Cora mit einem triumphalen Grinsen. »Die Kriegerin lebt.«
»Wie viel von ihrer Seele ist übrig?« Viel kann es nicht sein. Ich kann den Blick nicht von meinem Vater abwenden.
Cora zuckt die Schultern, als kümmere sie nur, dass es meinem Vater gelungen ist. Sie bewundert ihn, seit sie laufen kann. »Nicht viel«, sagt sie schließlich.
Ich stehe so ruckartig auf, dass die Gespräche am ganzen Tisch verstummen. Gesichter drehen sich in meine Richtung, dunkle Augen fixieren mich. Mein Bruder sieht mich grimmig an, Soße glänzt in seinem Mundwinkel. In diesem Moment verabscheue ich ihn genauso wie meinen Vater. Der funkelt mich an, hat aber offenbar weder die Kraft noch die Geduld, etwas zu sagen. Cora beobachtet mich mit großen Augen. Meine Tante verzieht die Lippen.
Sollen sie denken, was sie wollen. Mein Vater ist zu weit gegangen, und statt es ihm vorzuhalten, bewundern ihn alle.
Ich werde nicht mehr vor ihnen kriechen, mich nicht mehr im Schatten verstecken. Mein Vater hat eine Grenze überschritten, die ich nicht bereit bin, zu überschreiten. Wut feuert durch meine Glieder und setzt sie in Brand.