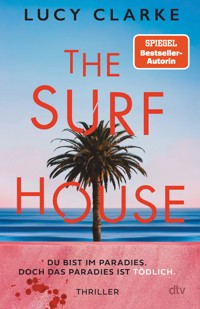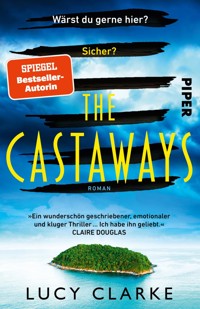
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Schwestern, eine Insel und ein tödliches Geheimnis Lori wacht auf einer wunderschönen, einsamen Insel auf. Glitzerndes blaues Meer, goldene Sonnenuntergänge, dunkelgrüner Urwald. Und dennoch ist es nicht der Urlaub, den sie und ihre Schwester Erin geplant haben. Denn neben einem Flugzeugwrack steht ein Fremder, ein zweiter Mann ritzt mit einem Messer die Anzahl der Toten in den Stamm einer Palme. Andere beobachten Lori über die Flammen eines Lagerfeuers hinweg – und jeder einzelne verschweigt eine Geschichte und hütet Geheimnisse. Während Erin zu Hause in London denkt, ihre Schwester für immer verloren zu haben, gerät diese auf der Insel in höchste Gefahr … Mehr Lesestoff der Erfolgsautorin von »One of the Girls«! » Zutiefst emotional und spannend ... Eine Geschichte mit genau dem richtigen Tempo und unglaublich authentischen Charakteren. Sie werden dieses Buch verschlingen. Es ist einfach perfekt!« Julie Clark »Wunderschön geschrieben.« Marie Claire »Voller Atmosphäre und Spannung sowie brillant gezeichneter Charaktere, die mir ans Herz gewachsen sind. Ich habe es geliebt!« Claire Douglas »Ein echter Pageturner, eine dichte, absolut fesselnde Geschichte.« T.M. Logan »Eine wahre Achterbahnfahrt! ›The Castaways‹ entführt Sie auf eine abgelegene Insel und lässt Sie nicht mehr los.« Bella Magazine »Dieser Roman hat uns von der ersten Seite an gefesselt.« Closer »Absolut süchtig machend, clever und atmosphärisch«. Erin Kelly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Castaways« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Aus dem Englischen von Karin Dufner
© Lucy Clarke 2021
Titel der englischen Originalausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München XXXX
»The Castaways«, HarperCollinsPublishers 2021
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2022
Die deutsche Erstausgabe erschien 2022 unter dem Titel
»Der Ozean unserer Erinnerung« im Piper Verlag.
Redaktion: Kerstin Kubitz
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München, nach einem Entwurf von Claire Ward © HarperCollinsPublishers Ltd 2021
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
Damals
Lori
2
Jetzt
Erin
3
Jetzt
Erin
4
Damals
Lori
5
Jetzt
Erin
6
Jetzt
Erin
7
Damals
Lori
8
Jetzt
Erin
9
Damals
Lori
10
Jetzt
Erin
11
Jetzt
Erin
12
Damals
Lori
13
Damals
Lori
14
Jetzt
Erin
15
Damals
Lori
16
Damals
Lori
17
Jetzt
Erin
18
Damals
Lori
19
Jetzt
Erin
20
Damals
Lori
21
Jetzt
Erin
22
Damals
Lori
23
Jetzt
Erin
24
Damals
Lori
25
Jetzt
Erin
26
Damals
Lori
27
Jetzt
Erin
28
Damals
Lori
29
Damals
Lori
30
Jetzt
Erin
31
Damals
Lori
32
Jetzt
Erin
33
Damals
Lori
34
Jetzt
Erin
35
Damals
Lori
36
Jetzt
Erin
37
Damals
Lori
38
Jetzt
Erin
39
Damals
Lori
40
Jetzt
Erin
41
Damals
Lori
42
Jetzt
Erin
43
Damals
Lori
44
Jetzt
Erin
45
Damals
Lori
46
Jetzt
Erin
47
Damals
Lori
48
Jetzt
Erin
49
Damals
Lori
50
Jetzt
Erin
51
Damals
Lori
52
Jetzt
Erin
53
Damals
Lori
54
Jetzt
Erin
55
Damals
Lori
56
Jetzt
Erin
57
Damals
Lori
58
Jetzt
Erin
59
Jetzt
Erin
60
Jetzt
Erin
61
Jetzt
Erin
62
Damals
Lori
63
Damals
Lori
64
Damals
Lori
65
Jetzt
Erin
66
Jetzt
Erin
Lori
Erin
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für James, Tommy und Darcy
1
Damals
Lori
Lori zog ihren Rollkoffer den schwülwarmen Korridor im Flughafen entlang. Lose Haarsträhnen klebten ihr im Nacken. Als sie die Nummer ihres Gates entdeckte, blieb sie stehen und sah sich um.
Von ihrer Schwester noch immer keine Spur.
Sie förderte ihr Telefon zutage, doch das Display glotzte sie nur mit leerem Blick an. Keine Nachrichten. Keine verpassten Anrufe. Das Herz hämmerte ihr im Brustkorb. Nur noch wenige Minuten bis zum Einsteigen.
Ein Satzfetzen aus ihrem Streit schoss ihr durch den Kopf. Ich erkenne dich gar nicht wieder …
Lori fuhr sich mit den Zähnen über die glatte Haut an der Innenseite der Wangen und biss zu, bis sie Blut schmeckte.
Sie versuchte sich auszumalen, wie sie ohne Erin startete. Wie sie allein den Flug bis zum weit entfernten südöstlichen Rand der Inselgruppe antrat. Dabei hielt sie sich vor Augen, dass sie die schwierigste Etappe der Reise bereits gestern hinter sich gebracht hatte, den Langstreckenflug von London nach Fidschi. Sogar ohne Diazepam. Doch da hatte sie Erin neben sich gehabt, die mit Knabbersachen, Musik-CDs und Büchern bewaffnet erschienen war und nur so übersprudelte von Vorschlägen, welche Drinks sie an Bord bestellen sollten, sodass Lori den Start kaum mitgekriegt hatte. Nach der Ankunft gestern Abend hatten sie in ein Hotel am Strand eingecheckt und eigentlich vorgehabt, rasch etwas zu essen und ein paar Stunden zu schlafen, bevor sie am Morgen weiter zu ihrem Resort flogen.
Nur, dass sie jetzt ohne Erin hier stand.
Sie schleppte ihren Koffer zu den Toiletten, wo sie sich über das Waschbecken hinweg zum Spiegel beugte, um sich zu betrachten. Mit den Fingerspitzen betastete sie ihre geschwollenen Lider und fuhr die dunklen Augenringe nach.
Letzte Nacht war sie wach geblieben, immer in der Hoffnung, vielleicht doch noch unsichere Schritte draußen auf dem Hotelflur zu hören. Ein Klopfen an der Tür und die Stimme ihrer Schwester, die in einem Bühnenflüstern um Einlass bat. Sie hatte sich Erin vorgestellt, wie sie sie, mit Gin abgefüllt, mit gelallten Entschuldigungen flutete. Vielleicht hätte sie ihr aufgemacht und wäre in dem breiten Hotelbett zur Seite gerutscht, damit sie Platz hatte. Hätte Erin aufgefordert, in die andere Richtung zu atmen, und sie ermahnt, sie solle bloß nicht schnarchen. Ja, vielleicht hätte sie das getan. Aber möglicherweise hätte sie die Tür auch nur einen Spalt geöffnet, gerade eben weit genug, um ihr zu sagen, sie solle sich zum Teufel scheren.
Allerdings konnte Lori sich die Frage, wie sie sich dabei gefühlt hätte, nicht beantworten. Denn Erin war nicht zurückgekehrt.
Sie kramte ihr Schminktäschchen heraus, weil ihre Hände eine Beschäftigung brauchten. Ihr Teint war von einer winterlichen Blässe, die auf zu viele Stunden in geschlossenen Räumen hinwies. Seit Monaten hatte sie schon keinen Sonnenstrahl mehr auf der Haut gespürt. Mein Gott, blauer Himmel. Schwimmen im warmen Meer. Frische Luft. Ein gutes Buch. Sie hatte sich diesen Urlaub verdient. Sie brauchte ihn.
Aber was, wenn das alles ein Fehler gewesen war? Sie hatte die Reise ganz spontan gebucht. Um drei Uhr morgens. Das Bett zerwühlt nach einer weiteren schlaflosen Nacht. Eigentlich hatte sie den Laptop herausgeholt, um sich einen Film anzuschauen – etwas, um sich gedanklich abzulenken –, doch dann war plötzlich die Werbung auf dem Bildschirm erschienen. Zehn Übernachtungen auf einer weit entfernten Fidschi-Insel, wo man barfuß herumlaufen konnte. Die Reisezeit schloss ihren achtundzwanzigsten Geburtstag ein. Also hatte sie ein neues Fenster geöffnet und den Stand ihres Ehegattenkontos gecheckt. Und, siehe da, es waren noch zweitausend Pfund drauf. Fick dich, Pete, dachte sie, als sie auf »Buchung bestätigen« klickte.
Beim ersten Morgengrauen hatte sie sich in Erins Zimmer geschlichen, ihr eine Tasse dampfenden Tee hingestellt und ihre langen Beine unter die Daunendecke geschoben.
»Ich schlafe noch«, nuschelte Erin.
»Ich habe Neuigkeiten«, verkündete Lori. »Es werde Licht!« Sie streckte die Hand aus, um die Nachttischlampe anzuknipsen. »Ich habe eine Reise für uns gebucht. Nach Fidschi. In der zweiten Januarwoche. Du hast doch gesagt, du müsstest noch deinen Resturlaub nehmen. Ich lade dich ein.«
Erin hob den Kopf ein winziges Stück und schlug ein Auge auf.
Lori konnte sich denken, was jetzt in ihrer Schwester vorging: Aber Lori hat doch Flugangst. Sie reist nie. Ein Urlaub ist, als würde man ein Pflaster auf eine tiefe Wunde kleben. Und so sprach Lori leise und im Brustton der Überzeugung weiter, bevor Erin Gelegenheit zu einer Antwort hatte. »Ich muss raus hier. Und du bist der einzige Mensch, mit dem ich mir das vorstellen kann.« Eine bedeutungsschwere Pause. »Du und ich.«
Du und ich. Schwer mit Vorgeschichte beladen, flirrten die Worte zwischen ihnen in der Luft.
Eine winzige Pause entstand, nur der Hauch eines Zögerns. »Also gut.«
Und trotzdem stand jetzt nur Lori auf dem Flughafen herum. Allein.
Sie schloss ihr Schminktäschchen, schnappte sich den Koffer und verließ die Toilette.
Der Korridor war noch immer menschenleer. Wieder griff sie nach ihrem Telefon und drehte es unschlüssig in den Händen hin und her. Eigentlich wäre es Erins Sache gewesen, sich zu melden … aber Lori musste einfach ihre Stimme hören und sich vergewissern, dass alles in Ordnung war.
Sie wählte.
Während sie dem Freizeichen lauschte, beobachtete sie, wie sich ein Pilot in weiß gestärktem Hemd auf dem Korridor näherte. Er trug eine marineblaue Schirmmütze und hatte dicke Tränensäcke und blutunterlaufene Augen. Etwa der Pilot meiner Maschine? Er ging in die Hocke und suchte etwas in seinem Bordgepäck. Verwirrung malte sich auf seinem Gesicht. Dann fuhr er sich mit der Hand über die Wangen und strich die schlaffe Haut hinunter bis zum Kiefer. Nach einer Weile gab er das Herumgekrame auf, holte tief Luft und setzte seinen Weg mit gesenktem Kopf fort.
Als mit einem Klicken die Mailbox ansprang, riss Lori sich von seinem Anblick los. »Erin hier. Fass dich kurz.« Der Signalton folgte so unmittelbar darauf, dass man richtiggehend zusammenschrak.
Lori zögerte. Die lastende Pause zog sich hin, ihr Schweigen wurde aufgezeichnet.
Ihre Gedanken wanderten gut zwei Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit. Sie lagen unter einer mit Sternen gemusterten Bettdecke, ihr Atem warm in der dunklen Baumwollhöhle. Ihre Mutter war erst seit einer Woche tot. Lori drückte die Hand ihrer Schwester. Du brauchst keine Angst zu haben, Erin. Ich bin deine große Schwester. Ab jetzt passe ich auf dich auf.
Doch was war, wenn Lori zur Abwechslung einmal sie brauchte? So wie jetzt zum Beispiel? Was dann?
»Ich bin am Flughafen«, zischte Lori, die Lippen dicht am Telefon. »Wo, zum Teufel, steckst du?«
2
Jetzt
Erin
Auf dem Treppenabsatz vor meiner Wohnung ist es stockdunkel. Letzten Monat ist die Glühbirne durchgebrannt, und ich habe es noch nicht geschafft, sie zu ersetzen.
Auf der Suche nach dem Schloss lasse ich die Hand tastend die Tür hinaufgleiten. Meine Lederjacke riecht feucht vom Regen. Hinter mir steht der Mann, den ich in der Kneipe abgeschleppt habe. Ein Rest von Rasierwasser, eine ordentliche Bierfahne. Mark? Matt?
»Mein Telefon hat eine Taschenlampenfunktion«, sagt er, als ich es gerade geschafft habe, den Schlüssel ins Schloss zu stecken und die Tür mit einem Schubs aufzustoßen.
Ich mache einen großen Schritt über die Post von heute, lege den Schlüssel weg und ziehe die Stiefel aus.
Er folgt mir ins Wohnzimmer, wo sein Blick die Wohnung erkundet. Plötzlich sehe ich sie mit seinen Augen: zusammengewürfelte Unterwäscheteile, steif getrocknet auf dem Heizkörper. Der Geruch nach verkochtem Essen, der sich hartnäckig im Teppichboden hält. Die abgebrannten Kerzenstummel in Nestern aus gehärtetem Wachs. Kaffeetasse und Müslischale auf dem Fensterbrett, wo ich jeden Morgen sitze, das Fenster einen Spalt weit geöffnet und mit gerecktem Hals, um einen Blick auf den Himmel über den Hausdächern zu erhaschen.
Ich schlüpfe aus der Jacke. Werfe sie über die Lehne eines Stuhls, auf dem sich Bücher türmen.
Der Alkoholnebel lichtet sich viel zu rasch. Ich hätte die Stehlampe einschalten sollen, nicht die helle Deckenbeleuchtung, die uns beide in einen grellweißen Schein taucht. Herrje. Ich frage mich, ob er es inzwischen genauso bereut wie ich. Eine neue Galerie wurde eröffnet, und da sie irgendeinen Schreiberling hinschicken mussten, habe ich das große Los gezogen. Zum Essen reichte die Zeit nicht mehr. Getränke waren gratis. Nach der Galerie sind wir in eine Kneipe und dann noch in eine andere weitergezogen. Meine Kollegen habe ich vor ein paar Stunden aus den Augen verloren, und irgendwann stand ich mit diesem Typen in der dunklen Ecke eines Clubs. Jetzt ist er irgendwie in meine Wohnung geraten und mustert mich, ein wölfisches Grinsen auf den Lippen. Mir wird bewusst, dass wir uns nicht mehr im Schutz einer Horde fröhlich feiernder Mittzwanziger befinden. Die Wohnungstür ist zu. Wir sind allein.
Ich habe die Stimme meiner Schwester im Ohr. Erin, benutz deinen Verstand.
Kurz schließe ich die Augen und lasse mich tiefer in ihren Klang fallen.
Wenn du ihn loswerden willst, bitte ihn einfach zu gehen.
»Willst du was trinken?«, frage ich, streiche mir mit der Hand über das kurze Haar im Nacken und spüre, wie es meinen Daumen streift. Er kommt mir nach in die Kochnische. Eine Schachtel Frühstücksflocken. Die Spur aus Cornflakes führt zu einer offenen Packung Schmerztabletten und einer Wodkaflasche. Hänsel und Gretel für Erwachsene.
Ich öffne einen Schrank und weise auf die Flaschen mit Wein, Spirituosen und angebrochenen Mixgetränken. »Such dir was aus.«
Er entscheidet sich für Rum und gießt ihn pur in zwei Gläser, die er auf dem Abtropfbrett findet. »Hast du Cola da? Limetten?«
»Keins von beidem.«
»Du bist mir eine Gastgeberin.«
Ich zucke die Achseln.
Er reicht mir mein Glas. Wir stoßen an und trinken auf ex.
Er schenkt nach. Wir gehen mit den Gläsern ins Wohnzimmer und nehmen die Flasche mit. Ich schiebe eine Decke weg und setze mich aufs Sofa. Er bleibt stehen. »Gehört dir die Wohnung?«
»Nur gemietet.«
»Mitbewohner?«
»Momentan nicht«, antworte ich. Mein Blick trifft auf das Bild über dem Sofa, das einzige, das meine ansonsten kahlen Wände ziert. Es ist mit Acrylfarben gemalt und stellt den Fluss dar, der am Rand des Gartens unserer Kindheit in Bath verlief. Lori ist die Künstlerin, und sie hat mit ihrer üblichen Farbpalette aus kräftigen Blautönen und lebhaftem, üppigem Grün gespielt. Sie hat es geliebt, die Farbe in breiten Schwüngen aufzutragen. Das Bild war ein Geschenk für mich, als ich meinen ersten Job in London antrat. Damit du auch in der Stadt ein Stück Heimat hast, hat sie auf die Rückseite geschrieben.
Mit den Augen folge ich den erhabenen Wirbeln in der Acrylfarbe, den dicken Schichten, die sie mit dem Spachtelmesser eingekerbt hat, um den Bäumen am Flussufer Struktur zu verleihen. Ich habe Lori vor mir, das blonde Haar zurückgebunden und in einem weiten Hemd voller Farbkleckse aus Petes Bestand. Sie war nie eine ausgeflippte Künstlerin, sondern stand für brave Jeans und ordentlich frisierte Haare, Organisation und Tüchtigkeit, lackierte Nägel und gezupfte Augenbrauen. Ihre Kreativität war für sie keine Qual. Sie sonnte sich in ihrem Licht.
Ich wende meine Aufmerksamkeit wieder dem Mann zu. Er ist älter, als ich gedacht habe, und hat einen Bart, der nach viel Arbeit aussieht. Zu gerade Linien und stumpf gestutzte Koteletten. Die Haut unter seinem Kinn ist so eigenartig glatt, als käme sie nie an die Luft. Er zieht mich überhaupt nicht an. Ich hätte ihn nicht abschleppen sollen.
Warum hast du es dann getan, Erin?, höre ich wieder die Stimme meiner Schwester.
Weil es Mittwoch Nacht ist? Weil ich was getrunken habe? Weil ich keine Lust hatte, allein diese Wohnung zu betreten? Sonst noch was?
Er schlendert durch das Wohnzimmer und begutachtet die Bücherregale. Am Kamin bleibt er stehen. Es ist einer der Kamine, wie man sie in London häufig antrifft – aus der edwardianischen Ära und zugemauert, sodass er nun eine Glasvase mit einer Lichterkette darin beherbergt. Loris Idee.
»Dein Geburtstag?«
Die Frage bringt mich aus dem Konzept. Ich folge seinem Blick zum Kaminsims, wo, zwischen zwei windschiefen Kerzen, eine einsame Geburtstagskarte steht. Die Zahl auf der Vorderseite glitzert.
»Ja«, erwidere ich nach einer Weile. Es ist einfacher zu lügen, als es ihm zu erklären.
»Ich hätte dich nicht auf dreißig geschätzt.«
Nein, weil ich erst siebenundzwanzig bin, verdammte Scheiße, denke ich, darf es aber nicht aussprechen.
Ich trinke meinen Rum aus und spüre, wie sich Wärme in meiner Brust ausbreitet. Dann wähle ich auf meinem Telefon Spotify aus und klicke eine Chill-Hop-Playlist an. Im nächsten Moment fällt mir die Mutter an, die unter mir wohnt, und ich stelle die Musik leiser. Gestern habe ich ihr geholfen, den Kinderwagen zwei Treppen hinunterzuschleppen, weil der Aufzug schon wieder kaputt ist. Das Baby beobachtete mich argwöhnisch und zerkrümelte dabei eine bröckelige Reiswaffel in der Faust. Als die Mutter sich bei mir bedankte, klang sie, als sei sie den Tränen nah. Kurz habe ich überlegt, ob ich sie hereinbitten und sie fragen sollte, ob alles in Ordnung ist. Aber dann war es mir zu viel.
Inzwischen mustert mich der Mann mit hochgezogenen Augenbrauen, als habe er etwas auf dem Herzen. »Erklär mir deine Frisur.«
»Meine Frisur?« Nun ziehe ich die Augenbrauen hoch. Echt jetzt? »Man nennt so was einen Undercut«, erwidere ich und weise auf den ausrasierten Bogen über meinem rechten Ohr. Die nicht vorhandene Symmetrie wirkt auf viele Menschen verwirrend. Mein Haar ist schwarz und kurz. »Pixie Cut« lautet die Bezeichnung, mit einem Touch von Undercut an der einen Seite. Es ist kein bewusstes modisches Statement. Ich war am Azubi-Abend beim Friseur, und die Azubine, ein Teenie mit einem frischen Tattoo am Handgelenk, die Haut noch gerötet und geschwollen, hat mir den Schnitt vorgeschlagen. »Warum nicht?«, lautete meine achselzuckende Antwort.
Scheint meine Reaktion auf die meisten Dinge zu sein.
Soll ich mit zu dir kommen?
Warum nicht?
Wahrscheinlich sollte ich mir die Augen mit Kajal umranden und irgendetwas Aufregendes mit meinen Brauen anstellen, aber ich kann mich nicht richtig dazu aufraffen.
»Mir gefällt es«, verkündet er. Er bewegt sich. Einen Moment lang glaube ich, dass er sich neben mich aufs Sofa setzen wird, und zucke zusammen. Doch stattdessen durchquert er das Wohnzimmer. »Ich muss mal austreten.«
Austreten. Das klingt, als hätte ich einen Opa abgeschleppt.
Zu spät bemerke ich, dass er auf die falsche Tür zusteuert. Ich springe auf und haste zu ihm, als er schon die Hand nach der Klinke ausstreckt.
»Nein …«, rufe ich, aber da geht die Tür zum Gästezimmer schon auf, und der Lichtschalter wird betätigt.
Er erstarrt.
Er kehrt mir zwar den Rücken zu, aber ich weiß genau, wie der Anblick auf ihn wirken muss. Sicher hat er die Augen weit aufgerissen und starrt entsetzt auf die Wände.
Obwohl ich das Zimmer schon seit Wochen nicht betreten habe, sehe ich es deutlich vor mir.
Seine Stimme steigt um eine Oktave. »Was, zum Teufel …?«
Eine Pause zwischen zwei Liedern sorgt dafür, dass plötzlich Stille herrscht. Der Moment zieht sich wie Gummi, seine Frage bohrt sich in die Luft.
»Das Bad ist nebenan«, sage ich schließlich.
»Was ist das für Kram?«
Die Wände des Gästezimmers sind mit Zeitungsausschnitten, Landkarten und Fotos gepflastert. Dazwischen verlaufen bunte Fäden, und das Ganze ist mit Post-it-Zetteln und handgeschriebenen Fragen garniert. Gesichter mit toten Augen sehen uns an, und Schlagzeilen brüllen: »Verschwunden!«, »Vom Flugzeug fehlt jede Spur«.
Ich weiß, welches Licht das auf mich wirft.
Ich weiß es einfach, okay?
In der Mitte befindet sich ein Zeitungsausschnitt, auf dem ein kleines weißes Flugzeug abgebildet ist. Ein roter Streifen verläuft mitten durch den Rumpf. Darunter sind die Fotos von zwei Besatzungsmitgliedern und sieben Passagieren angeordnet.
Als ich nicht antworte, dreht er sich zu mir um. »Es geht doch um dieses Flugzeug, oder? Das, das verschollen ist.«
Ich nicke widerstrebend.
»Ist… das… für deinen Job?« Ich erkenne einen Funken Hoffnung.
»Ja«, lüge ich.
Die Erleichterung steht ihm ins Gesicht geschrieben. »Du bist Journalistin, richtig? Ich habe etwas über diesen Flug gelesen. Er ging nach Fidschi, oder? Die Maschine war einfach weg. Vom Radar verschwunden. Spurlos. Niemand hat etwas gesehen. Keine Funksprüche. Kein Wrack. Echt schräg, wenn du mich fragst.«
Mein Mund verweigert den Dienst.
»Das ist schon eine Weile her, richtig? Letztes Jahr?«
»Zwei Jahre.« Zwei Jahre und sechs Tage.
»Es waren die verschiedensten Theorien in Umlauf. Ob vielleicht ein Terrorist an Bord war oder ob der Pilot Selbstmord begehen wollte. Recherchierst du in dieser Sache?«
»Hmmm«, murmle ich ausweichend.
Inzwischen ist sein Blick wieder argwöhnisch. »Nimmst du oft Arbeit mit nach Hause? Ist das hier dein Büro oder so?«
Wieder eine lange Pause. »Oder so.«
Seine Miene verändert sich. Offenbar ahnt er, dass da etwas faul ist. Er betrachtet die Wand, die Fotos, die Zeitungsausschnitte, manche davon bräunlich an den Rändern, und das vergilbte Klebeband. Dann sieht er mich an. Ich merke ihm an, dass er sich das Hirn zermartert und versucht, sein Unbehagen einzuordnen.
Vielleicht liegt es am Alkohol. Vielleicht fehlt es ihm auch nur an Durchhaltevermögen. Jedenfalls gibt er nahezu kampflos auf. »Klo«, sagt er, schlüpft in den Raum, und ich höre, wie er die Tür verriegelt.
Ich stehe im Flur und schaue durch die offene Tür ins Gästezimmer. Loris früheres Zimmer. Ich habe schon seit Monaten keinen Blick auf diese Wände geworfen. In London kann sich niemand ein leeres Zimmer leisten. Ich auch nicht. Aber ich darf diese Sachen nicht abhängen, denn das hieße, dass es vorbei ist. Dass ich mich geschlagen gebe. Dass ich mich mit ihrem Verschwinden abfinde.
Allerdings weiß ich, dass ich auf lange Sicht nicht darum herumkommen werde.
Ich hole Luft. Dieses Wochenende. Ich hänge alles ab. Wirklich alles. Es reicht.
Oder vielleicht könnte ich ja auch erst mal nur einen Teil davon wegräumen. Schrittweise sozusagen. Ich könnte damit anfangen, dass ich Loris Bett freilege, das unter einer Schicht aus Büchern, Artikeln und aufgeschlagenen Akten begraben ist. Ich hätte dieses Zimmer schon vor Monaten untervermieten sollen. Mein Bankkonto würde erleichtert aufatmen. Nur, dass mir beim Gedanken an eine Mitbewohnerin graut. Ein anderer Mensch, der mich hört, wenn ich um vier Uhr morgens durch die Wohnung geistere. Oder der meine skurrilen Essenszeiten mitbekommt. Oder den Freundeskreis beurteilt, den ich nicht habe.
Ich höre, wie die Toilettenspülung rauscht und der Spülkasten vollläuft. Also warte ich auf das Geräusch von fließendem Wasser, wenn es das Waschbecken hinuntergurgelt. Doch stattdessen öffnet sich die Tür. Ungewaschene Hände, tief in den Hosentaschen. Augen, die meinem Blick ausweichen. »Ich muss morgen früh aufstehen. Also …«
»Klar.«
Er schnappt sich seinen Mantel und nimmt sich nicht einmal die Zeit, ihn anzuziehen. »Tschüss«, nuschelt er, als er schon in der Tür steht.
Ich folge ihm, halte ihm die Tür auf und warte, bis er im Treppenhaus ist. Wenn ich jetzt die Tür zumache, schneide ich ihn von der einzigen Lichtquelle ab und lasse ihn im Stockfinstern stehen. Ich sollte wenigstens warten, bis er die Treppe hinunter und an der Haustür ist.
Ach, scheiß drauf.
Ich knalle die Tür zu. Verriegle sie.
Dann hole ich mir die Flasche aus dem Wohnzimmer. Am Flaschenhals klimpern silbrige Ringe vom Drehverschluss. Ich gehe in Loris Zimmer, schiebe ein Buch über die Geschichte des Flugzeugabsturzes beiseite und sinke auf die Bettkante. Die Luft riecht muffig und abgestanden, und es ist kühler als in der restlichen Wohnung.
»Alles Gute zum Dreißigsten«, sage ich und proste dem Foto meiner Schwester an der Wand mit der Flasche zu.
Nimm ein Glas, höre ich Loris Stimme und male mir aus, wie sie in gespielter Verzweiflung die Augen verdreht.
Ich trinke einen kräftigen Schluck direkt aus der Flasche. Und grinse.
Während der Rum mir brennend die Kehle hinunterrinnt, mustere ich das Foto von Lori, das zwischen denen der übrigen Passagiere an Bord von Flug FJ209 hängt. Passagierin drei, hat die Presse sie genannt. Das Foto haben sie von ihrem Instagram-Account, das letzte von ihr, ehe sie an Bord der Unglücksmaschine ging. Sie hatte sich kurz zuvor Strähnchen in warmen Honig- und Karamelltönen färben lassen, das Lächeln mit glänzend geschminkten Lippen erreicht ihre Augen nicht.
Als das Foto entstand, saß ich neben ihr. Natürlich haben sie mich rausgeschnitten. Nun sieht man nur noch meine Finger um ihre Taille. Es wurde am Abend vor dem Flug gemacht – vor all den Fehlern, die ich bald begehen würde. Doch es ist, als wäre in diesem Foto bereits alles enthalten. Lori mit leerem, starrem Blick und allein, und ich, wie ich die Hand nach ihr ausstrecke. Wie ich sie festhalten will.
3
Jetzt
Erin
Inzwischen ist es ein Uhr morgens, und ich sitze noch immer im Gästezimmer. In wenigen Stunden muss ich zur Arbeit. Deshalb sollte ich jetzt ein großes Glas Wasser trinken, mir zwei Aspirin neben dem Bett bereitlegen und endlich schlafen.
Als ich noch einen Schluck Rum nehme, stoßen meine Zähne gegen die Flasche. Ich mustere das Foto von der Maschine. Vor zwei Jahren hätte dieses Flugzeug vom Flughafen Nadi auf Fidschi nach Limaji fliegen sollen, eine kleine Insel am südöstlichen Rand des Archipels. Nur, dass es – ebenso wie die neun Menschen an Bord – niemals angekommen ist.
Spurlos verschwunden, hieß es in der Presse.
Ich betrachte die Auflistung der Fakten, stichpunktartig notiert auf Karteikarten an der Wand. Captain Mike Brass’ letzter Funkkontakt mit der Flugsicherung fand zweiundzwanzig Minuten nach dem Start statt. Da war alles noch in bester Ordnung. Und trotzdem verschwand die Maschine acht Minuten später von den Radarschirmen und erreichte nie ihr Ziel. Die groß angelegte Suchaktion unter Einbeziehung verschiedener Polizeibehörden deckte einen Radius von fünfhundert Kilometern ab. Ohne Ergebnis. Kein Wrack. Kein einziges Trümmerteil. Keine Leichen.
Absolut nichts.
Ich starre weiter hin und versuche angestrengt, den Leerstellen zwischen den Informationen noch etwas abzuringen.
Nach dem Verschwinden des Flugzeugs machte ich mich auf die Jagd nach Beweisen. Ich piesackte die Polizei, das britische Konsulat und die CAAF – die zivile Luftsicherungsbehörde auf Fidschi. Ich forderte Antworten auf die Frage, welche Suchgebiete bereits durchkämmt worden waren, und hakte sie auf meiner eigenen Karte der Inselgruppe ab, die hinter mir an der Wand hängt. Ich spürte einige Angehörige der Passagiere auf und bedrängte sie, weiter Druck auf die Behörden auszuüben. Ich las jedes Buch über Flugzeugabstürze und Menschen, die diese wider Erwarten überlebt hatten, das ich in die Finger bekam. Ich verfasste Presseerklärungen, damit das verschollene Flugzeug bei den Medien nicht in Vergessenheit geriet.
»Du verbeißt dich da in etwas«, meinte Sarah, eine meiner ältesten Freundinnen, die in Berlin wohnt, bei einem Skype-Telefonat.
»Weil du dir nicht verzeihen kannst«, fügte Ben aus dem Hintergrund hinzu, während er, an einer blitzblanken Theke stehend, zwei große Gläser mit Weißwein füllte. Die beiden zusammen zu sehen, war für mich noch immer wie ein Schlag in die Magengrube. In der Schule hatte Ben einmal gesagt, wir drei seien wie die Seiten eines gleichseitiges Dreiecks: jede Seite im identischen Winkel mit der anderen verbunden, sodass eine vollkommene Symmetrie entstand. Aha. Komisch, wie schnell dieses wundervolle Gebilde in die Knie ging, als die beiden verkündeten, sie hätten sich ineinander verliebt und würden nach Berlin ziehen.
Ich entdecke nichts Neues, wie ich da betrunken in Loris altem Zimmer sitze. Und trotzdem kann ich nicht zu suchen aufhören. Ich strecke mich auf dem Bett aus und greife nach einer Akte. Sie enthält meine gesamte Korrespondenz aus den Wochen und Monaten nach dem Verschwinden des Flugzeugs. Die Akte habe ich deshalb angelegt, weil ich etwas tun musste. Warten war ein gefährliches Terrain. Zu viel Spielraum für meinen Verstand, um zu kreischen, zu toben, mit dem Finger zu zeigen und Schuld zuzuweisen.
Ich schlage die Akte an einer zufälligen Stelle auf und lese eine E-Mail von einem Mitarbeiter der CAAF, die mir bestätigt, man suche zwar nicht mehr aktiv, werde die Ermittlungen jedoch in absehbarer Zeit nicht abschließen.
In absehbarer Zeit nicht abschließen. Wie soll man mit so einer Aussage leben?
Ich weiß, dass diese Geschichte kein Happy End hat. Ein Flugzeug verschwindet nicht einfach, weil es sich im Resort geirrt hat, wo die Passiere nun fröhlich ihre Cocktails schlürfen, Baströckchen tragen und die Hüften kreisen lassen. Wenn ein Flugzeug weg ist, weist das auf ein riesengroßes Scheißproblem hin. Und ich muss wissen, was das für ein Problem war. Ich muss wissen, was nach jenem letzten Funkkontakt mit dem Piloten passiert ist. Ich muss wissen, wem ich, verdammt noch mal, die Schuld geben kann. Denn im Moment ist mein einziger Sündenbock die Person, die nicht in diese Maschine gestiegen ist. Die noch lebt und hier in diesem Scheißzimmer sitzt, das eigentlich das ihrer Schwester sein sollte!
Ich schnappe mir die Akte und schleudere sie quer durchs Zimmer. Als der Ringordner gegen die Wand knallt, geht er auf, sodass Papiere und Fotos wie gebrochene Flügel zu Boden flattern.
Noch ein guter Grund, das Zimmer nicht unterzuvermieten: aggressive Tendenzen.
Als mein Blick über den Papierhaufen schweift, fällt er auf einen Artikel, in dem es um einen der Passagiere geht: Felix Tyler, zum Zeitpunkt des Fluges siebenundzwanzig Jahre alt. Auf dem Foto trägt er ein tief in die Stirn gezogenes Beanie, das dunkle Haar reicht ihm bis zum Kinn. Torfbraune Augen spähen unter dichten Wimpern hervor. Attraktiv, wenn man auf böse Buben steht. Ich habe alles über ihn gelesen, was ich auftreiben konnte – so wie über alle Passagiere –, denn ich wollte die Menschen in dieser Maschine genau kennenlernen. Ich wollte wissen, warum sie unterwegs waren und wie sie sich in einer Notsituation verhalten hätten. Mit wem meine Schwester im Moment des Absturzes zusammen war.
Und da hat dieser Felix mich ins Grübeln gebracht. Er hat das Ticket nach Fidschi achtundvierzig Stunden vor dem Start gebucht. Als ich mit dem Inhaber des Resorts auf der Insel sprach, das Felix als Ziel angegeben hatte, berichtete er mir, dieser habe für einige Woche den Tauchlehrer vertreten sollen. Es ist mir gelungen, seinen Lebenslauf und seinen Tauchschein in die Finger zu kriegen. Allerdings erwiesen sich seine Referenzen bei näherer Betrachtung samt und sonders als gefälscht. Felix Tyler war Freeclimber, nicht Taucher. Ein Kletterer, der achtzehn Monate vor dem Flug ohne Helm und Gurt fünfzehn Meter tief auf einen Granitfelsen gestürzt war und sich dabei vierzehn Knochen im Körper gebrochen hatte. Seitdem war er nicht mehr geklettert.
Ein solches Erlebnis steckt man nicht so einfach weg.
Ich versuchte mich mit seiner Familie in Verbindung zu setzen, aber sein Vater war drei Monate nach seinem Verschwinden gestorben, und seine Stiefmutter weigerte sich, mit mir zu reden. Felix’ Leistungen als Kletterer nachzuverfolgen war nicht möglich. Typen wie er waren Freaks, die entlegene Gipfel und Bergkämme stürmten. Ich mailte zwar alle meine Ergebnisse an den britischen Konsul und die Polizei, aber offenbar hielt man einen gefälschten Tauchschein bei der Suche nach einem verschollenen Flugzeug nicht für sachdienlich.
Dennoch kann ich nicht aufhören zu grübeln. Die Frage kreist nachts, wenn ich nicht schlafen kann, weiterhin in meinem Kopf herum: Warum? Warum hat er gelogen? Hat er auch sonst die Unwahrheit gesagt?
4
Damals
Lori
Lori stand im Abflugbereich am Fenster und drehte den Armreif an ihrem Handgelenk hin und her. Noch immer keine Spur von Erin.
Auf dem sonnenbeschienenen Rollfeld wartete das Flugzeug. Eine rote Linie verlief durch seinen Rumpf wie die Markierung für einen Einschnitt. Kleine Flugzeuge sind die schlimmsten, dachte sie, während ihr der Puls in den Ohren pochte. Zu leicht. Jedes Rütteln und Schütteln durch Turbulenzen, jeder Ansturm von Wind und Wetter – sie würde alles spüren. Sie zählte die Fenster auf der ihr zugewandten Seite. Acht. Dann malte sie sich aus, wie sie die Stufen hinaufstieg. Das Klappern von Metall, die Sonne in ihrem Nacken. Der Flug dauerte nur eine Stunde. Das würde sie schon schaffen.
Auf dem Rollfeld erschien ein Mann im blauen Overall und spähte unter die Maschine. Überprüfte er das Triebwerk? Den Treibstofftank? Sie hatte keine Ahnung, wo genau sich diese Bauteile befanden. Der Mann neigte den Kopf und schaute genauer hin. Ein zweiter Mann, diesmal in einer orangefarbenen Signalweste, gesellte sich zu ihm. Offenbar diskutierten die beiden etwas und wiesen mit rudernden Armen zwischen Flugzeug und Terminal hin und her. Kurz darauf marschierte der Mann mit der Signalweste davon, während der andere, immer noch stirnrunzelnd, in die Hocke ging. Schließlich richtete auch er sich auf, zuckte die Achseln und entfernte sich.
Was sollte das Achselzucken? Was hast du gesehen? Stimmt etwas mit dem Flugzeug nicht? Herrje, Flugangst konnte einem wirklich den letzten Nerv rauben.
Sie zwang sich, sich vom Fenster abzuwenden. Ein Stück weiter stand ein Mann. Er trug Chinos und ein Polohemd und hatte eine teure Reisetasche aus Leder bei sich. Geschäftsreisender, sagte sie sich. Ein Telefon am Ohr, schaute er immer wieder zum Gate. »Ich bin es, Daniel. Ich wollte mich nur vergewissern, dass alles… klar ist«, meinte er. Seine Stimme war leise und klang nach Oberschicht. Eine Pause entstand, in der er von einem Fuß auf den anderen trat. »Ich weiß«, erwiderte er mit einem heftigen Nicken. »Ich bin Ihnen was schuldig.« Er klimperte mit dem Kleingeld in der Hosentasche. »Irgendwelche Zweifel?« Seine Hand wanderte von der Hosentasche zum Nacken. Sein Blick streifte das Flugzeug. Auf seiner Stirn glänzte Schweiß. »Vielleicht.«
Ihr Buch. Am besten fing sie an zu lesen. Das würde sie ablenken. Also setzte sie sich, förderte brav ihr Buch zutage, schlug es auf und schaute auf die Seite. Sie las dreimal denselben Satz, ohne den Sinn der Geschichte zu verstehen. Ihre Beine fühlten sich unruhig und zappelig an.
Als sie aufblickte, bemerkte sie einen dunkelhaarigen Mann, der gerade den Wartebereich durchquerte. Er streifte einen großen Rucksack von den Schultern, stellte ihn auf den Boden und ließ sich am Ende einer Stuhlreihe auf einen Plastiksitz fallen. Dann setzte er einen Kopfhörer auf, senkte das Kinn auf die Brust, verschränkte die Arme und schloss die Augen. Sie beobachtete, wie seine Schultern sich sichtlich entspannten. Die Fingerspitzen klopften den nur für ihn hörbaren Rhythmus mit.
Ihr Blick wanderte zu seinem Gesicht. Ein Gewirr dunkler Haare hing nach vorne und traf sich mit den dichten Bartstoppeln, die seinen Kiefer bedeckten. Seine Kleidung – schmal geschnittene graue Jeans und ein T-Shirt – wirkte erschlafft, so als hätte er darin geschlafen, was zu seinen Augenringen passte.
Sie fragte sich, welche Art von Reisenden das Resort wohl ansprach. Umweltbewusst, aber dem Luxus nicht abgeneigt, hatte es auf der Webseite geheißen.
Der Mann riss die Augen auf, förderte unvermittelt sein Telefon zutage und las etwas auf dem Display. Sein gesamter Körper verspannte sich, und er blähte die Nüstern. Stocksteif saß er da, ohne zu blinzeln oder einen Muskel zu rühren. Seine Augen wurden glasig. Er presste Zeigefinger und Daumen gegen die Augenhöhlen. Die Fingerknöchel der rechten Hand waren aufgeschürft – frische Verletzungen.
Konzentrier dich auf dein Buch, sagte sie sich und schaute kurz auf die Seite – bevor sie wieder verstohlen zu dem Mann hinübersah.
Der hatte angefangen, etwas in sein Smartphone zu tippen, und stach mit dem Finger auf das Display ein. Kurz hielt er inne, las, was er geschrieben hatte, und berührte einmal kurz das Display. Erstaunt beobachtete Lori, wie er anschließend das Telefongehäuse öffnete, mit einer unwirschen Bewegung die Rückseite aufklappte und den Fingernagel unter die SIM-Karte schob, um sie herauszuhebeln. Er nahm eine Münze aus der Tasche und kratzte damit kräftig über die matte Metalloberfläche.
Nachdem das erledigt war, marschierte er durch den Raum und warf SIM-Karte und Telefon in den Papierkorb.
Als der Mann sich umdrehte, begegnete sein Blick dem von Lori. Er blieb stehen. Und starrte ihr direkt ins Gesicht.
Ihre Wangen röteten sich, als habe er sie beim Spionieren ertappt.
Der Ausdruck in seinen Augen war zornig und abwehrend. Ein wenig herausfordernd.
Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her.
Sein Blick bohrte sich in sie wie der eines Wolfs. Sprungbereit.
Lori überlegte, ob die Zeit noch reichte, auf die Toilette zu gehen. Durfte man die Wartezone verlassen, wenn man sein Ticket bereits vorgezeigt hatte? Verstohlen drückte sie sich kurz auf die Blase. Vielleicht konnte sie es ja einhalten. Das waren nur die Nerven.
Ein amerikanisches Paar zog identische Rollkoffer hinter sich her. »Wir feiern unseren vierzigsten Hochzeitstag«, teilte der Mann der jungen rotblonden Frau neben sich mit.
Die junge Frau nickte geistesabwesend. Ihre Miene hatte etwas Ängstliches oder Erschöpftes an sich. Sie hatte die Hand vor dem Leib gewölbt, wo ein Neugeborenes in einem Tragetuch an ihrer Brust ruhte. Lori konnte das runde Köpfchen des Babys und seinen hellen Haarflaum erkennen. Mit Kindern hatte sie in diesem Resort nicht gerechnet. Eigentlich machten die abgeschiedene Lage und die nicht gerade familientauglichen Bedingungen ja einen Teil seines Reizes aus.
Das Baby war ein Junge, stellte sie nun fest, als die Mutter sich umdrehte. Offenbar war er erst wenige Monate alt, etwa im gleichen Alter wie Petes Tochter. Bessy hatte er das kleine Mädchen genannt. Lori hatte den Namen scheußlich finden wollen, tat es aber nicht.
Pete.
Immer Pete.
Was hatte Erin am gestrigen Abend gesagt? Lori habe ihn immer auf ein Podest gestellt. »Er hat dich im Stich gelassen, Lori. Er hat dich betrogen und ist dann abgehauen.«
Abgehauen.
Daran brauchte sie niemand zu erinnern. Sie hatte es schließlich am eigenen Leibe erlebt.
Lori presste die Lippen zusammen und blickte hinauf zur getäfelten Decke.
Nicht jetzt. Keine Tränen. Wenn sie an Bord dieses Flugzeugs wollte, musste sie sich zusammenreißen.
»Miss? Verzeihung, Miss? Wir rufen jetzt die Passagiere zum Einsteigen auf.«
Erschrocken hob sie den Kopf. Die Stewardess wies in Richtung des langen Korridors, wo die übrigen Passagiere sich bereits in Bewegung setzten. Lori hielt Ausschau nach Erin. Nach ihren kurzen, schnellen Schritten, dem dunklen Haarschopf, dem Rucksack, der so groß war wie sie selbst.
Lori würde ihr verzeihen. Wirklich. Aber nur, wenn Erin jetzt endlich aufkreuzte und sich entschuldigte.
Vor Panik wurde ihr erst heiß und dann eiskalt. »Meine Schwester«, begann sie. »Eigentlich sollte sie mitfliegen. Ich warte auf sie. Sie ist bestimmt schon unterwegs.« Ihr war bewusst, wie dünn und zittrig ihre Stimme klang.
»Tut mir leid«, antwortete die Stewardess freundlich. »Aber das Gate ist schon geschlossen. Ich fürchte, sie kommt zu spät.«
5
Jetzt
Erin
Ich schiebe die Hände in die Taschen meines zu dünnen Mantels und ziehe die Schultern hoch bis an die Ohren. Das Gedränge der Pendler nimmt zu. Alle wollen unbedingt nach Hause. Ich stemme mich breitbeinig in den Boden und verteidige meinen Platz.
Mein Kater – vorhin eine lodernde Flamme in meinem Schädel – hat sich zu einer dumpfen Basslinie im Hinterkopf abgeflacht. Ich erschaudere unwillkürlich, als ich an den Typen denke, den ich letzte Nacht abgeschleppt habe. An die verdatterte Miene, mit der er die Zeitungsausschnitte im Gästezimmer angestarrt hat. Wenigstens habe ich nicht mit ihm geschlafen. Ich werte das als Fortschritt.
Die Luft in der U-Bahn-Station ist stickig. Die körperwarme Brise weht einen leichten Hauch von Uringeruch und Küchendunst heran. Wäre ich doch mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Ich wusste, dass ich es bereuen würde, aber ich habe heute Morgen den Wecker überhört und bin zu spät in einer meiner seltsamen nach innen gerichteten Katerstimmungen aufgewacht. Deshalb konnte ich einfach keine Begeisterung für nassen Asphalt und feuchte, kneifende Regenkleidung aufbringen.
Immer wenn eine U-Bahn sich nähert, scheint der Tunnel einzuatmen. Die Menschenmenge wird an die Bahnsteigkante gesaugt. In der an meinem Handgelenk baumelnden Tüte befinden sich eine nicht übermäßig verlockende Fertiglasagne und eine Flasche Wein. Trotzdem kann ich es kaum erwarten, zu Hause zu sein, mich unter die heiße Dusche zu stellen und mir den Tag von der Haut zu spülen. Den Nachmittag habe ich damit verbracht, mich quer durch London zu schleppen, um drei Karaoke-Sängerinnen zu interviewen, die eine Band gegründet und einen Top-Forty-Hit gelandet haben.
Dir hätten sie bestimmt super gefallen, Lori. Ich lächle in meinen Schal hinein, während ich mich an die Schlachten ums Autoradio erinnere, die wir uns als Jugendliche geliefert haben. Ich beugte mich vom Rücksitz aus nach vorne, um ihre Kassette mit Popmusik auszuwerfen, und jammerte, ich würde davon Ohrenbluten kriegen. Lori schob den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten, um mich daran zu hindern. Dad drohte, Klassik auf Radio 4 einzuschalten, wenn wir nicht damit aufhörten.
Als die U-Bahn einfährt, ist sie bereits voll. Ich quetsche mich hinein und muss einige Haltestellen lang stehen. Zum Glück trage ich Turnschuhe und keine hochhackigen Lacklederpumps wie die Frau neben mir, die sich mit den Fingerknöcheln den unteren Teil des Rückens massiert. Endlich lichtet sich die Menge, und in Kennington ergattere ich einen Sitzplatz. Ich nehme die Strickmütze ab, stopfe sie in die Tasche und kratze mich kräftig am Kopf.
Dann drehe ich an dem schwarzen Ohrstecker herum und lasse den Blick geistesabwesend durch den Waggon schweifen. Mir gegenüber sitzt eine Frau und liest eine Abendzeitung. Ihre rosige Stirn glänzt, und sie hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Wird ihr beim Nachhausekommen der Geruch von selbst gekochtem Essen entgegenwehen? Oder wird sie, wie ich, den Stromzähler mit Münzgeld füttern, unter der Bettdecke eingekuschelt das Programm auf Netflix sondieren und auf das Signal der Mikrowelle warten?
Die Frau blättert die Zeitung um, sodass die Titelseite in Sicht kommt.
Meine Haut ist mir plötzlich zu eng. Mir stockt der Atem.
Das ist er!
Ich starre auf das Foto eines Mannes im mittleren Alter, der eine weiße Pilotenuniform mit drei Streifen auf der linken Schulter trägt. Sein Haar ist kurz, pechschwarz und hie und da grau meliert. Es ist das gleiche Foto, das in meinem Gästezimmer an der Wand hängt.
Mike Brass. Kapitän von Flug FJ209.
Vor zwei Jahren, als eine neue Theorie die Nation erschütterte, war sein Foto tagelang in der Zeitung. Doch als die Tage zu Wochen wurden und es keine weiteren Erkenntnisse gab, wanderte die Story langsam von der ersten Seite in den Mittelteil, bis sie zu einer Randnotiz geworden war. Eine verblassende Erinnerung in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich hingegen habe mir dieses Gesicht genau eingeprägt, sodass ich es strahlend hell vor mir sehe. Wie oft habe ich dieses Foto betrachtet und in den Fältchen rings um die eisblauen Augen und den zum Anflug eines Lächelns verzogenen Lippen eine Erklärung gesucht. Und da ist er wieder. Auf der Titelseite.
Warum jetzt?, frage ich mich, und der Puls pocht mir in der Kehle. Heute ist kein Jahrestag. Seit Monaten gab es nichts Neues mehr. Die Story ist mausetot.
Ich muss die Schlagzeile lesen. Und schon springe ich auf und mache einen Satz durch den Waggon zum Platz der Frau. »Ich brauche …«, sage ich, während meine Finger schon zupacken.
Die Frau schnappt nach Luft und drückt sich die Zeitung an die Brust. Und da – in diesem Moment – kann ich die ganze Schlagzeile entziffern, die in schwarzen Blockbuchstaben über die Seite verläuft.
»TOTER« PILOT LEBENDIG AUF FIDSCHI AUFGETAUCHT.
Der Waggon verschwimmt, mein Gesichtsfeld verengt sich.
Ich fange am ganzen Körper an zu zittern: Finger und Beine. Zähneklappern.
Als die U-Bahn ruckelnd stoppt, stolpere ich in die Frau hinein, die die Zeitung weiter umklammert. Sie stößt einen Schrei aus, woraufhin alle sich nach uns umdrehen. Während ich eine Entschuldigung nuschle, rappelt sie sich auf und klopft sich die Kleider ab. Dann wirft sie die Zeitung hinter sich auf den Sitz und steuert kopfschüttelnd auf die Tür zu.
Ich greife nach der Zeitung. Das Blut braust mir in den Ohren, und der tintige Geruch feuchter Druckerschwärze steigt mir in die Nase. Die Türen der U-Bahn schließen sich, und wir rumpeln surrend weiter durch den Untergrund.
In meinen verschwitzten Handflächen fühlt sich die Zeitung klebrig an. Ich blinzle zu schnell und atme zu heftig. Ich fange an zu lesen.
Captain Mike Brass, Pilot von Flug FJ209, der vor etwa zwei Jahren irgendwo über dem Südpazifik verschwunden ist, wurde lebendig aufgefunden. In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages wurde er von seinem Arbeitgeber nach einem Zusammenbruch in ein Krankenhaus auf Fidschi eingeliefert. Eine Pflegerin erkannte ihn und setzte sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung.
Offenbar hat Brass seit dem Verschwinden von Flug FJ209 unter falschem Namen auf Fidschis Hauptinsel Viti Levu gelebt. Unter dem Alias Charlie Floyd war er als Hausmeister in einem Resort im Landesinnern der Insel beschäftigt.
Als die Polizei seine Frau Anne Brass, wohnhaft in Perth, befragte, gab sie an, sie habe keine Ahnung gehabt, dass ihr Mann noch lebte. »Er hat sich nicht bei mir gemeldet.« Anne und Mike Brass haben einen Sohn, Nathan Brass, der ebenfalls in Perth wohnt.
Meine Gedanken schreien wild durcheinander.
Der Pilot hat überlebt.
Atme. Atme.
Rasch lese ich den restlichen Artikel, der die bereits bekannten Informationen zusammenfasst. Im letzten Absatz heißt es: Eine Sprecherin der Regierung von Fidschi gab folgende Stellungnahme ab: »Captain Mike Brass befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Wir hoffen, dass sich sein Zustand bald stabilisiert, damit er uns bei der Untersuchung des Verschwindens von Flug FJ209 unterstützen kann.«
Der Pilot war die ganze Zeit am Leben.
Als ich aufblicke, bemerke ich mein Spiegelbild im dunklen Fenster des U-Bahn-Waggons. Mein Gesicht ist kreidebleich. Ich ziehe die Brauen hoch und presse die Lippen fest zusammen. Speichel sammelt sich in meiner Kehle, gefolgt von dem Geschmack nach Galle.
Das ist doch nicht möglich, oder?
Ich habe es mir ausgemalt, mir vorgestellt, davon geträumt. So verzweifelt habe ich glauben wollen, dass es irgendeine Erklärung gibt, einen Grund wider alle Logik, weshalb es die Passagiere geschafft haben könnten, sich lebend aus dem Wrack zu befreien.
Alle haben mir gepredigt, ich müsse loslassen.
Meine Schwester loslassen.
Es gab so wenig, woran man sich halten konnte – keine Aufzeichnung aus der Blackbox, kein Flugzeugwrack, keine Sichtungen. Es war, als habe sich die Maschine einfach in Luft aufgelöst. Medien und Foren für Verschwörungstheoretiker haben sich in den verschiedensten Spekulationen ergangen: Flugzeugentführer, eine thermostatisch ausgelöste Selbstentzündung, höhere Gewalt, Selbstmord des Piloten.
Kein Wort. Kein Hinweis. Zwei Jahre lang nichts. Nicht einmal eine Spur.
Bis jetzt.
Jetzt haben wir den Piloten.
6
Jetzt
Erin
Das Telefon zwischen Schulter und Ohr geklemmt, schließe ich meine Wohnungstür auf. Das Herz schlägt mir bis zum Halse. Klaviermusik klimpert, während ich in der Warteschleife der britischen Botschaft hänge.
Ich haste in die Küche, wo ich den Wein aus der Einkaufstüte nehme. Weil keine sauberen Gläser mehr da sind, kippe ich mit zitternden Händen etwas davon in einen Kaffeebecher. Mein Herz wummert wie ein Presslufthammer. Ich drücke zwei Schmerztabletten aus der Blisterfolie und spüle sie mit Wein hinunter.
Jemand von der Botschaft meldet sich am Telefon und teilt mir mit, Captain Mike Brass sei von der Polizei vernommen worden. Man werde mir das Vernehmungsprotokoll zeitnah per E-Mail zukommen lassen.
Mit meinem Weinglas gehe ich ins Gästezimmer, wo ich Bücher und Zeitungsausschnitte vom Schreibtisch wische und den Laptop hochfahre.
Ich klicke meine Mails an.
Nichts.
Meine Finger trommeln auf die Tischplatte. Nach einer Weile öffne ich verschiedene landesweite und internationale Nachrichten-Sites, darunter News24, Fiji Times, CNN und The Guardian und außerdem Twitter. Es dauert keine Minute, bis ich ein Dutzend Webseiten parat habe, und ich fange an, sie zu durchkämmen. Es wundert mich, dass ich in der Redaktion nichts von der Sache gehört habe. Ich arbeite zwar bei einem Wochenmagazin, doch wir bringen trotzdem aktuelle Nachrichten, wenn es darin menschelt.
Auf der Suche nach allen neuen Fakten, die ich kriegen kann, sauge ich Sätze, Schlagzeilen, Einleitungen, Zitate und Kommentare in mich auf. Doch bis auf die dürftigen Informationen, über die ich bereits verfüge, ist die Ausbeute gering.
Erst eine Stunde später schlüpfe ich aus dem Mantel. Es dauert zwei, bis mir einfällt, dass ich auch die Turnschuhe ausziehen könnte. Die Lasagne für die Mikrowelle, die auf der Küchenzeile vor sich hin taut, habe ich vergessen. Stattdessen esse ich Frühstücksflocken direkt aus der Packung. Trockenes Müsli rieselt mir über die Brust, als ich es mir mit vollen Händen in den Mund stopfe und mit großen Schlucken Wein hinunterspüle, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden.
Inzwischen habe ich so oft auf »Neue E-Mails empfangen« geklickt, dass mir schon der Finger brennt.
Ich betrachte die Wand voller Artikel über mir und mustere die verblassten Notizen und die sich einrollenden Ränder der Fotos. Ich hatte die Tür zu diesem Zimmer fest zugemacht. Lori weggesperrt. Selbst meine Fixierung auf dieses Thema ließ allmählich nach. Nun tanzen Wörter und Bilder vor meinen Augen und fordern Aufmerksamkeit. All die Fragen und Hinweise, die letztlich doch nur in eine Sackgasse führten. Die Schuld umschließt mich wie ein Schraubstock. Plötzlich springe ich auf, greife nach der Zeitung von heute und reiße die Titelseite fein säuberlich ab. Dann hefte ich sie fest in die Mitte meiner Sammlung, oberhalb des Fotos von Captain Mike Brass.
»TOTER« PILOT LEBENDIG AUF FIDSCHI AUFGETAUCHT.
Als ich den Artikel noch einmal lese, bleibt mein Blick an einem Satz hängen: Offenbar hat Brass unter falschem Namen auf Fidschis Hauptinsel gelebt.
Er hat das Flugzeug verlassen. Lebendig. Und ist aus freien Stücken verschollen geblieben.
Warum?
Ich sehe ihm ins Gesicht und in die kalten blauen Augen und frage mich, was wohl auf diesem Flug geschehen sein mag. Was wollte der Pilot unter allen Umständen vor der Welt geheim halten? Einen Teil seiner Geschichte kenne ich bereits. Außer mir kennt sie niemand. Doch das ist nicht genug. Nicht annähernd genug.
Ich stemme die Hände gegen die Tischplatte und presse die Handflächen auf das Holz. Dann konzentriere ich mich darauf, tief bis ins Zwerchfell zu atmen. Ich hole noch einmal Luft und schließe die Augen. Lasse den Kopf vornüberhängen. Ich habe ein starkes Druckgefühl in den Nebenhöhlen, und mein Nacken krampft sich vor Anspannung zusammen.
Der Pilot lebt.
Streng deinen Verstand an.
Wo ist das Flugzeug jetzt? Wo sind die anderen Passagiere?
Bitte, Lori. Was ist passiert, als du in diese Maschine gestiegen bist? Sag es mir. Sag mir, was geschehen ist.
Ich warte darauf, ihre Stimme zu hören, sie in mir zu spüren. Heiße Tränen rinnen mir aus den Augenwinkeln. Doch diesmal ist da keine Stimme. Kein Bauchgefühl.
Nur Stille.
Das Läuten meines Telefons schreckt mich auf. »Ja?«
»Ich bin’s, Pete.«
Ich berühre meine Schläfe mit den Fingerspitzen. Seit über einem Jahr habe ich nicht mit Loris Ex gesprochen. »Oh«, sage ich, weil mir nichts Besseres einfällt.
»Ich habe gerade die Nachrichten geschaut und gehört, dass der Pilot wiederaufgetaucht ist. Ich pack’s nicht, Erin. Stimmt das wirklich? Er lebt?«
»Ja. Er wird gerade in einem Krankenhaus verhört. Ich warte darauf, dass die mir das Vernehmungsprotokoll mailen.«
Ich beuge mich vor und klicke »Neue E-Mails empfangen« an.
Nichts.
»Mein Gott. Die ganze Zeit war er am Leben. Und hat sich nicht gerührt. Ich fass es nicht.«
Ich schweige.
»Was hältst du davon?«
Ich antworte nicht auf seine Frage. Stattdessen stelle ich selbst eine, ein mieser kleiner Seitenhieb. Es wundert mich, dass ich überhaupt noch die Kraft dazu habe. »Wie geht es Zoe?«
Kurz ertappe ich mich bei der Hoffnung, dass es vorbei sein könnte. Dass Zoe irgendeinem tragischen, grausigen Schicksalsschlag zum Opfer gefallen ist. Einem tödlichen Unfall mit einer Kugelhantel. Oder ist sie gar über ihre Yogamatte gestolpert und hat sich das Genick gebrochen? Dann jedoch denke ich an das Baby der beiden – ein ganz besonders niedliches und pausbäckiges kleines Mädchen, das Petes Lächeln hat – und sehe mich gezwungen, meine Wunschvorstellungen zu modifizieren. Eine Trennung in aller Freundschaft vielleicht?
»Zoe geht es prima. Aber was ist mit dir, Erin? Bei dir alles klar?«
Diese Frage hat Pete mir zuletzt bei der Gedenkfeier für Lori gestellt. Was für ein abgrundtief entsetzlicher Tag. Ich war absolut gegen eine Gedenkfeier gewesen und hatte mich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, Lori aufzugeben. Ich wollte sie mit aller Macht festhalten.
Ich werde von einem Ping gerettet, als eine Mail in meinem Posteingang landet. »Das Vernehmungsprotokoll ist da …« Stirnrunzelnd beuge ich mich über den Bildschirm.
»Was steht drin?«
Ich achte nicht auf Pete. Lese weiter.
Dem Protokoll geht eine E-Mail von Dr. Alba vom Central Hospital auf Fidschi voran, in der er erklärt, eine CT-Aufnahme habe ergeben, dass Captain Mike Brass an einem Gehirntumor leidet, vermutlich der Grund seines Zusammenbruchs. Ich überfliege die Erläuterungen zum Thema Erinnerungslücken und Sprachfähigkeit und klicke die angehängte Mitschrift der Vernehmung an.
Sie ist kurz und umfasst nur knapp zwei Seiten. Mein Blick brennt sich durch Satz um Satz, und ich sauge die Antworten des Piloten in mich auf. Nach wenigen Momenten bin ich am Ende angelangt. »Nein … nein … Das kann doch nicht alles sein.«
Eine Anmerkung ganz am Schluss teilt mir mit, die Befragung habe auf Anweisung des Arztes beendet werden müssen, da es der Zustand des Patienten nicht erlaubt habe, fortzufahren.
»Bist du noch dran?«, fragt Pete.
»Ja …« Meine Beine unter der Schreibtischplatte zittern. Ich presse die Fersen gegen die kalten Dielenbretter und zwinge mich, sie still zu halten.
»Und was steht jetzt im Protokoll?«
»Nicht sehr viel.« Ich lese es Pete laut vor.
Officer Enrol: Können Sie bestätigen, dass Sie Mike Brass, Kapitän des Fluges FJ209, sind?
Mike Brass: Ja.
Officer Enrol: Nach zweiundzwanzig Minuten Flugzeit haben Sie die Flugsicherung angefunkt und gemeldet, dass alles in Ordnung sei. Acht Minuten später ist das Flugzeug vom Radar verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Können Sie beschreiben, was nach dem letzten Funkspruch geschehen ist?
Mike Brass: Ein … Problem … (Bricht ab. Starker Hustenanfall. Eine Schwester bringt ihm einen Becher Wasser und steckt ihm einen Strohhalm in den Mund.).
Officer Enrol: Könnten Sie das genauer ausführen? Was für ein Problem? Ein technisches Problem?
Mike Brass: (keine Antwort)
Officer Enrol: Wir nehmen an, dass die Maschine in Schwierigkeiten geraten ist. Laut Wetterdaten zog eine massive Schlechtwetterfront auf, die in der Wettervorhersage unterschätzt worden war. Mussten Sie notlanden?
Mike Brass: Habe versucht … (Schweigen).
Officer Enrol: Haben Sie versucht notzulanden?
Mike Brass: Hatte keine Kontrolle … (Schweigen).
Officer Enrol: Können Sie uns sagen, wo die Maschine jetzt ist?
Mike Brass: (keine Antwort)