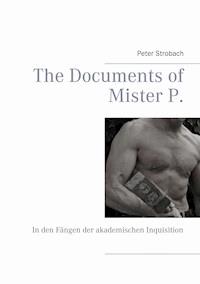
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte meines Lebens im deutschen industriell-universitären System. Es ist eine Geschichte, die maßgeblich durch mein Habilitationsverfahren an der Universität Erlangen im Sommer 1990 geprägt wurde, und die kein vernünftig denkender Mensch jemals so für möglich halten würde. Dennoch ist es die Wirklichkeit, wie die vielen in diesem Buch gezeigten authentischen Dokumente beweisen. Somit ermöglicht dieses Buch dem Leser auf der Grundlage meiner über 30-jährigen Erfahrung als Ingenieur und Fachgruppenleiter in der Industrieforschung, sowie als Professor einen atemberaubenden Einblick in die der öffentlichen Wahrnehmung gänzlich verborgenen Praktiken in der Industrie und an den Universitäten und Hochschulen, sowie deren individueller Verzahnung, auch mit dem Rechtssystem dieses Staates.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I was born here and I’ll die here against my will
It looks like I’m moving, but I’m standing still
Sometimes my burden is more than I can bear
It’s not dark yet, but it’s getting there
- Bob Dylan-
27. November 2015
BoD - Books on Demand GmbH, Norderstedt
Meinen lieben Eltern in treuem Gedenken gewidmet
Warum schrieb ich dieses Buch?
Dieses Buch zeichnet ein Bild meines Lebensweges, der ganz maßgeblich durch den Ausgang eines Habilitationsverfahrens geprägt wurde, welches ich im Sommer 1990 an der Universität Erlangen durchgeführt habe.
Im Rahmen dieses Habilitationsverfahrens wurde ich für pädagogisch ungeeignet erklärt, womit mir die Fähigkeit, das Amt eines Professors auszuüben, auf Lebenszeit abgesprochen wurde.
Von einem Mangel an pädagogischer Eignung konnte allerdings keine Rede sein. In Wirklichkeit war die Begründung der mangelnden pädagogischen Eignung nur ein billiger Vorwand, den die Professoren der Universität Erlangen benutzten, um meine Habilitation zur Ablehnung zu bringen. Es waren allein niedrige persönliche Beweggründe, die ausschlaggebend für die Ablehnung meiner Habilitation waren.
In diesem Buch stelle ich die gesamte Akten- und Faktenlage dar, aus der hervorgeht, dass es einen Mangel an pädagogischer Eignung niemals gegeben hat. Die an dieser Stelle an verantwortlicher Position stehenden Professoren der Universität Erlangen handelten wissenschaftskriminell, da sie wesentliche, gutachtlich belegte Fakten unterschlugen und stattdessen niedrige persönliche Motive in den Vordergrund ihres Handelns stellten.
Trotz der erdrückenden Beweislage war es mir nicht möglich, diesen Fall einer rechtlichen Aufarbeitung zuzuführen, da der Vorsitzende Verwaltungsrichter der Kammer am Verwaltungsgericht Ansbach, welche diesen Fall zu verhandeln hatte, selbst ein Absolvent und Doktorand der Universität Erlangen war. Er wurde an dieser Stelle installiert, um sämtliche gegen die Universität Erlangen gerichteten Klagen nach Möglichkeit abzuweisen. Ein in einem Rechtsstaat völlig unvorstellbarer Zustand war hier die Wirklichkeit! Selbst der Bayerische Innenminister, dem diese Verwaltungsgerichte unterstehen, ist der Sohn eines ehemaligen Rechtsprofessors der Universität Erlangen!
Aus dieser Konstellation erstarkt die Universität Erlangen zu einer absolutistischen Macht, die keinerlei Kontrolle mehr unterliegt, und die machen kann und auch macht, was sie will.
Dem ist es auch geschuldet, dass ich im Jahre 2012 aufgrund des ablehnenden Bescheids der Universität Erlangen vom 3.8.1990 sogar rechtskräftig und bestandskräftig pädagogisch ungeeignet erklärt wurde, obwohl ich von 1993 bis 2015 als lebenslang verbeamteter Professor des Bundeslandes Baden-Württemberg an der Fachhochschule Furtwangen unterrichtet und in diesem Amt meine pädagogische Eignung über die vielen Jahre vollumfassend und nachvollziehbar unter Beweis gestellt habe.
Damit enthüllt dieser Fall den ganzen Irrwitz der deutschen Habilitation und das Wesen der Institutionen dieses Staates, welche diesem Irrwitz zur vollen Entfaltung verhelfen. Mit Hilfe der deutschen Habilitation wurde mir ein gigantischer Lebensschaden zugefügt, der sich in Worten nicht fassen lässt. Die Parallelen der Habilitation mit der Inquisition des Mittelalters sind offensichtlich. In diesem Buch lege ich alle Fakten und Beweise auf den Tisch.
Röhrnbach, im November 2015
Peter Strobach
Vorwort
Am deutschen Habilitationswesen wird die Hochschulwelt genesen
Guten Tag! Ich begrüße Sie als Leserin oder Leser dieses Buches. Zuerst einige Informationen über mich: Mittlerweile vollendete ich mein 60. Lebensjahr. 22 Jahre lang war ich Professor. Jetzt bin ich beurlaubt - auf eigenen Wunsch. Es wird Zeit für einen Rückblick.
Warum wurde ich eigentlich Professor? Weil ich pädagogisch ungeeignet bin! Sie werden sagen: Das ist doch paradox! Die pädagogische Eignung ist schließlich die wichtigste Voraussetzung für jedes Lehramt und damit auch für das Professorenamt, denn schließlich wird ein Professor an allererster Stelle die Fähigkeit besitzen müssen, Vorlesungen zu halten und Studenten zu unterrichten.
Um festzustellen, ob jemand pädagogisch geeignet ist oder nicht, gibt es in Deutschland die Habilitation, einen akademischen Grad, vergleichbar einem Doktorgrad. Den Habilitationsgrad oder genauer ausgedrückt den Grad eines habilitierten Doktors kann man an einer Universität erwerben, sofern man gewisse Eingangsvoraussetzungen erfüllt.
Am Ende eines Habilitationsverfahrens wird bestätigt, ob jemand wissenschaftlich und pädagogisch für das Professorenamt geeignet ist, oder eben nicht. Dieses lebenswegentscheidende “Urteil” wird von der Habilitationskommission gefällt, einer Art Tribunal, bestehend aus Professoren des Fachgebiets, auf dem man sich habilitieren, das heißt, auf dem man die wissenschaftliche und pädagogische Eignung zum Professor bestätigt haben will.
Solche Habilitationsverfahren unterliegen der Hoheit der Universitäten. Das bedeutet, innerhalb eines solchen Habilitationsverfahrens kann jede Universität machen was sie will. Es gibt keinerlei Möglichkeit der äußeren Einflussnahme. Es gibt keine Berufung und es gibt keine Kontrollinstanz. Die Parallelen zu Inquisition des Mittelalters sind unverkennbar.
Insbesondere gibt es bei der Habilitation auch einen Prüfer, der dem Kandidaten unbekannt ist. Dieser spielt die Rolle eines akademischen Oberinquisitors.Er fällt in der Regel das Urteil über den Kandidaten und die Habilitationskommission stimmt zu.
Dieses Urteil wird ganz wesentlich bestimmt von den wissenschaftlichen Thesen und den Überzeugungen des Kandidaten, und ob sich diese mit den Ansichten des akademischen Oberinquisitors decken. Decken sie sich nicht oder missfällt der Kandidat dem akademischen Oberinquisitor persönlich, wird dieser Möglichkeiten finden, um den Kandidaten zu Fall zu bringen, und zwar ganz gleich, ob die Thesen des Kandidaten richtig oder falsch, innovativ oder rückständig sind. Gleichfalls ist es für das Bestehen oder Nichtbestehen ganz unwesentlich, ob der Kandidat nun pädagogisch geeignet ist oder nicht.
Der akademische Oberinquisitor hat die Möglichkeit, die wissenschaftlichen Thesen des Kandidaten zum “Hexenwerk” und den Kandidaten zum Unmenschen zu erklären. Das kommt einem Gottesurteil gleich. Der Kandidat ist lebenslang gebrandmarkt. Alle Türen bleiben ihm fortan verschlossen.
In diesen Fällen werden sich die Mitglieder der akademischen Inquisition nicht selten auch in eine Art akademischen Blutrausch hineinsteigern, in dem sie jeden Bezug zur Wirklichkeit verlieren und es als ihre Hauptaufgabe erkennen, den Kandidaten ein Leben lang zu verfolgen und zu verunglimpfen, um diesen als Menschen und als Wissenschaftler vollkommen zu vernichten.
Zwischen der Habilitation und der Inquisition des Mittelalters gibt es daher nur zwei wesentliche Unterschiede:
Die Inquisition konnte einen Delinquenten zum unmittelbaren leiblichen Tod verurteilen, während die Habilitation einen Kandidaten lediglich zum wissenschaftlichen Absterben und zum Ausschluss aus dem Hochschuldienst als Professor verurteilen kann. Aber auch dieses hat in der Regel weitreichendste, lebensumfassende Folgen, bis hin zum möglichen mittelbaren Tod des Kandidaten.
Es ist mir kein Fall bekannt, in dem sich jemals ein Mensch freiwillig in die Hände der Inquisition begeben hat. In die Hände der Habilitation oder akademischen Inquisition begibt man sich jedoch immer freiwillig, getrieben von der jugendlichen Überzeugung des eigenen Könnens und dem eigenen Ehrgeiz, bei gleichzeitiger Unkenntnis der Heimtücke und der Hinterlist, welche der Institution der Habilitation als akademische Inkarnation der Inquisition anhaftet.
Diesen Umständen ist es geschuldet, dass praktisch alle jüngeren Menschen, die sich in die Fänge der akademischen Inquisition begeben, Schüler von akademischen Inquisitoren (Professoren) sind. Damit haben sie die Thesen der akademischen Inquisitoren verinnerlicht. Sie gleichen ihnen praktisch wie ein Ei dem anderen. Schließlich sollen auch sie einmal solche akademischen Inquisitoren werden.
Der betreuende akademische Inquisitor, der sie durch das akademische Inquisitionsverfahren geleitet, sitzt selbst in der akademischen Inquisitionskommission (Habilitationskommission), dem Tribunal, das schließlich das Urteil fällt. Der betreuende akademische Inquisitor kennt somit den akademischen Oberinquisitor. Damit ist sichergestellt, dass die “Schäflein” eines solchen akademischen Inquisitors das akademische Inquisitionsverfahren unbeschadet überstehen können, und am Ende ihren angestrebten Habilitationsgrad erhalten und zwar weitgehend unabhängig davon, ob sie nun tatsächlich pädagogisch geeignet sind oder nicht. Und auch weitgehend unabhängig davon, ob sie wissenschaftlich geeignet sind oder nicht.
Ja - es geht sogar so weit, dass pädagogisch ungeeignete Schäflein der akademischen Inquisitoren durch die akademische Inquisition für pädagogisch geeignet erklärt werden können. Dies ist einfach dem praktischen Zwang geschuldet, dass der Zeitvertrag eines solchen Schäfleins irgendwann ausläuft und dieses Schäflein dann anderweitig innerhalb des deutschen Hochschulsystems untergebracht werden muss in den Fällen, in denen ein solches Schäflein wirklich für sonst nichts mehr zu gebrauchen ist, oder das Schäflein ein Söhnchen oder Töchterchen eines bekannten und anerkannten akademischen Inquisitors ist.
Genauso gibt es auch den umgekehrten Fall, dass ein pädagogisch begnadeter Mensch durch die akademische Inquisition für pädagogisch ungeeignet erklärt werden kann, indem man sein Habilitationsverfahren zum Scheitern bringt und ihn vielleicht auch noch auf persönlicher Ebene verunglimpft. Ein solcher armer Mensch ist dann für den Rest seines Lebens gebrandmarkt.
Sein Leben wird zu einer einzigen Hetzjagd, in der ihn die Häscher der akademischen Inquisition verfolgen, bis er gestorben oder in Rente gegangen ist.
Ich bin einer dieser Menschen. Einer, der durch großes Geschick und Können, aber auch durch eine gehörige Portion Glück den Häschern der akademischen Inquisition in einer über 25 Jahre dauernden Hetzjagd immer wieder entkommen ist.
Sie werden sich jetzt fragen, wie ich als so geächteter und pädagogisch ungeeignet erklärter Mensch trotzdem Professor werden konnte. Lesen Sie meine Geschichte, dann werden Sie es erfahren!
Röhrnbach, im November 2015
Peter Strobach
Inhaltsverzeichnis
1 Das Studium an der Fachhochschule Regensburg (1974-1978)
1.1 Der Anlauf zum Ing. “grad noch”
1.2 Wie ich lernte zu lernen
1.3 Das Praxissemester im CERN
1.4 Ein Studium mit Defiziten
Literatur
2 Meine erste Anstellung als Ingenieur und der Rückblick auf die Fachhochschule (1978)
2.1 Die erste Enttäuschung
2.2 Wachsende Zweifel
2.3 Das Märchen vom praxisorientierten Fachhochschulstudium
2.4 Die Erfahrung mit den Wegweisern
2.5 Die Verlegenheitsstelle bei MBB-Apparate in Ottobrunn
2.6 Die Initialzündung
2.7 Ein schwerer Entschluss
3 Das Studium an der Technischen Universität München (1978-1983)
3.1 Der erste Tag an der TU
3.2 Die Abiturienten als Konkurrenten
3.3 Die Einführung in die höhere Mathematik von Josef Heinhold
3.3.1 Die Atmosphäre in den Vorlesungen am Mathematischen Institut
3.3.2 Die Besseren und die Schlechteren
3.3.3 Der Übungsbetrieb
3.3.4 Die Gruppe der Leistungsträger
3.3.5 Eine eindrucksvolle Erinnerung
3.4 Die Vorlesungen von F.L. Bauer und R. Bulirsch
3.5 Bei Lindermayers in Neubiberg
3.6 Der Sohn des Professors
3.7 Die befristeten Beschäftigungsverhältnisse als Entwicklungsingenieur bei MBB-UF
3.8 Mein Besuch bei Gerd Hauske
3.9 Meine Aufnahme als Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung
3.10 Das Studium nach dem Vordiplom
3.10.1 Auf einen Sprung in die Vorlesungen des Hauptdiploms
3.11 Die Diplomarbeit
3.12 Das Wiedersehen mit Georg Fischer
3.13 Der doppelt genähte Ingenieur
3.14 Die Suche nach einer Promotionsgelegenheit
Literatur
4 Die Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der UniBw München (1983-1985)
4.1 Wissenswertes über die UniBw
4.2 Warum ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der UniBw wurde
4.3 Das Institut für Mathematik und Datenverarbeitung (WE 1)
4.3.1 Professor Neuburger
4.3.2 Die Arbeitsgruppe um Werner Wolf
4.3.3 Die Begegnung mit Achim von Brandt
4.4 Die Arbeit am Signalprozessor
4.5 Der Oberschnee und der Unterschnee
4.6 Die ICASSP-84 in San Diego
4.7 Die Methode der verallgemeinerten Residualenergien
4.8 Die Lehrverpflichtungen
4.9 Die Offenbarung
4.10 Der AEG-Schock
4.11 Die Doktorprüfung
4.12 Die ICASSP-86 Tokyo
Literatur
5 Die Siemens ZFE und meine Habilitation in Erlangen (1986-1992)
5.1 Mein erster Eindruck von Siemens
5.2 Warum ich trotzdem zu Siemens ging
5.3 Erste Eindrücke von der Siemens ZFE
5.4 Die Arbeiten zur 64 kBit Videocodierung
5.5 Das QSDPCM-Verfahren
5.6 Das Höllenrennen
5.6.1 Zu Besuch bei David Staelin am MIT
5.6.2 Eine Vorlesung mit Bede Liu in Princeton
5.6.3 Die Auszeichnungen der Jahre 1987 und 1988
5.6.4 Die erste Begegnung mit Alfred Fettweis
5.6.5 The Documents of Mister P
5.6.6 Das Wissenschaftsreferat
5.6.7 Wie man mir den Johann-Philipp-Reis-Preis wegnahm
5.6.8 Haben Sie ein kleines Auto?
5.6.9 Die innere Stimme
5.7 Der Anfang vom Ende
5.8 Der Realisierungsversuch der ZFE
5.9 Meine Bewerbung im IBM Forschungslabor Rüschlikon
5.10 Meine Habilitation an der Universität Erlangen
5.10.1 Wie wird man Professor?
5.10.2 Mein Buch
Linear Prediction Theory
5.10.3 Die Kontaktaufnahme mit den Professoren
5.10.4 Die Prüfung des Habilitationsantrags
5.10.5 Die ICASSP-90 in Albuquerque
5.10.6 Die Vorlesungen im Sommersemester 1990
5.10.7 Meine Bewerbung um die Professur (C4) für Bildverstehen an der Universität Stuttgart
5.10.8 Der Crash vom 13. Juli 1990
5.10.9 Das Stolpern über die eigenen Theoriefüße
5.10.10 Die Konstruktion der Ablehnung
5.10.11 Die schwebende Habilitation
5.11 Die Kesselschlacht von Neuperlach
5.11.1 Die Bewerbung an der TU Clausthal
5.11.2 Der Alltag im Kessel von Neuperlach
5.11.3 Der Besuch von Carl Camenish
5.11.4 Das MED-Projekt
5.11.5 Die Ernennung zum Fachgruppenleiter
5.11.6 Das Himmelfahrtskommando
5.11.7 Die Bewerbung um die Nachfolge von Alfred Fettweis
5.11.8 Der Besuch von Josef Hohnerkamp
5.11.9 Die Rufe nach Kiel und Furtwangen
Literatur
6 Die Zeit als Professor an der Fachhochschule Furtwangen (1993-2015)
6.1 In der Stunde der Enttäuschung
6.2 Die Schlacht um den befristeten Dienstvertrag
6.3 Der Fuß in der Tür
6.3.1 Die Professoren-Dienstbesprechung
6.3.2 Die Vorlesung “Elektrotechnik 1”
6.3.3 Die schlechten Verlierer
6.3.4 Der Pädagogikpabst
6.3.5 Die New York Academy of Sciences
6.3.6 Der Signalprozessor-Spielbaukasten
6.3.7 Die Diplomarbeit in Freiburg
6.4 Die allgemeinen Rahmenbedingungen
6.4.1 Das Zimmerl in Neukirch
6.4.2 Die Fahrten nach Furtwangen
6.5 Der Antrag auf Wiederaufnahme des Habilitationsverfahrens
6.6 Die Zeit von 1995 bis 2008
6.6.1 Die ICIP-96 in Lausanne
6.6.2 Das Listing in Who’s Who in the World
6.6.3 Die ICASSP-97 in München
6.6.4 Die Begegnung mit Billy the Kid
6.6.5 Der Einäugige und die Blinden
6.6.6 Das Schifferlprojekt
6.6.7 Das Fortbildungssemester an der Universität Passau
6.6.8 Der Vorstoß von Murat Kunt
6.6.9 Die Master-Vorlesung “Signal Processing”
6.6.10 Der Tod meines Vaters
6.6.11 Der Anruf von Jakob Schillinger
6.6.12 Die Suche nach dem Sohn des Professors
6.7 Die Klage gegen die Universität Erlangen
6.7.1 Die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Ansbach
6.7.2 Der Berufungsantrag vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
6.7.3 Die erste Verfassungsbeschwerde
6.7.4 Der zweite Habilitationsantrag
6.7.5 Die zweite Klage gegen die Universität Erlangen
6.7.6 Die Konsequenzen
6.8 Der Beurlaubungsantrag
6.9 Meine letzte Fahrt nach Hause
A Dokumente, Kommentare und Analysen
A.1 Die Schule und die Lehre - Wie alles begann
A.1.1 Abschlusszeugnis der Realschule Freyung (21.07.1971)
A.1.2 Die Zeit in der Lehrwerkstatt (01.09.1971 - 31.08.1972)
A.2 Wie entfesselt - Meine Tätigkeit als freier Mitarbeiter bei MBB-UF (30.04.1980)
A.3 Von ganz unten nach ganz oben - Das Gutachten von Professor Josef Heinhold
A.4 Get Grants or get out - Nicolaus-Fonds (1980)
A.5 Die beginnende Demontage - Das Zeugnis von Ulrich Appel, Professor (C3), vom 07.01.1986
A.6 Ein Zwischenhoch - Dokumente aus der Zeit bei Siemens ZFE (1986 - 1992)
A.7 Das Gutachten des Professors Rolf Unbehauen aus Erlangen (04.07.1990)
A.8 Die Stellungnahme des Rechtsvertreters der Universität vom 20.07.1990
A.9 Pädagogisch ungeeignet! - Der Ablehnungsbescheid vom 03.08.1990
A.10 Die Versetzung der Habilitation in den “Schwebezustand”
A.11 Die Weihnachtsgrüße von Alfred Fettweis (Dezember 1990) .
A.12 Die Bewerbung um den Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der TU München (August 1991)
A.13 Die Ernennung zum Senior Member IEEE (August 1991)
A.14 Die Vertretung des Abteilungsleiters (05.06.1992)
A.15 Dokument einer verlorenen Schlacht - Das Siemens-Zeugnis vom 31.12.1992
A.16 Die “Didaktik Hitline” und das Inversionsgesetz der deutschen Habilitation
A.17 Das Trojanische Pferd - Die Ernennung zum Professor auf Lebenszeit (29.10.1993)
A.18 Mein Antrag auf unbefristete Freistellung von den Lehraufgaben (15.04.2012)
A.19 Die letzten Evaluationen
A.20 Der Brief an einen Toten (18.05.2015)
A.21 Die letzte studentische Mail (19.05.2015)
Kapitel 1
Das Studium an der Fachhochschule Regensburg (1974-1978)
Meinen ersten berufsbefähigenden Abschluss erwarb ich im Februar 1978 an der Fachhochschule Regensburg. Der ausgehändigten Ingenieur-Urkunde ist zu entnehmen, dass ich fortan den akademischen Grad eines INGENIEUR (GRAD.) führen durfte.
1.1 Der Anlauf zum Ing. “grad noch”
Mein Studienfreund Johann Steckenbiller hatte sich im Verlauf des Studiums oft ironisch über diesen Grad geäußert und meinte, damit wolle man wohl zum Ausdruck bringen, dass ein Absolvent seinen Ingenieurabschluss “grad noch” (gerade noch) erreicht hatte, was mir gelegentlich schon zu denken gab. Denn schließlich war der Johann deutlich älter als ich, schon so um die 30. Wegen des beträchtlichen Altersunterschieds nannte ich ihn manchmal auch den “Opa”. Die meiste Zeit des Studiums verbrachte ich in seinem “Windschatten”. Er hatte einige Jahre Berufspraxis als Fernmeldemechaniker bei der Post hinter sich und war im Studium sehr fleißig. Er war der Beste im Semester. Wir wohnten beide im J.M. Sailer-Haus Studentenwohnheim in der Lessingstraße, nur einige hundert Meter von der Fachhochschule entfernt.
So ergab es sich zwangsläufig, dass wir auch außerhalb der Vorlesungszeiten regen Kontakt pflegten. Für mich war das nun eine ganz andere Situation als in der Schule, wo ich sofort nach Schulschluss nach Hause fuhr. Zuhause war die Schule vergessen und es gab eine Menge anderer Dinge, die mich viel mehr interessierten. Daher waren meine schulischen Resultate auch kaum mehr als mittelmäßig ausgefallen. Die Hausaufgaben, die ich während meiner gesamten Schulzeit wirklich selbst gemacht habe, konnte man wahrscheinlich an den fünf Fingern einer Hand abzählen. Für das alltägliche schulische Überleben hatte mir allein der gesunde Menschenverstand schon genügt. Meine Mathematiklehrer von damals würden es wahrscheinlich für die größte Lüge der Menschheitsgeschichte halten, wenn ihnen heute jemand erzählen würde, dass ich später im Vordiplom Mathematik an der Technischen Universität München die Bestnote 1.0 erzielte.
1.2 Wie ich lernte zu lernen
Zu Beginn des Studiums an der Fachhochschule war ich von solchen Ergebnissen jedenfalls noch meilenweit entfernt. Hier hat mir die Arbeitsgemeinschaft mit Johann Steckenbiller enorm auf die Beine geholfen. Ich beobachtete ihn, wie er selbständig mathematische Formeln entwickelte und lernte es von ihm. Damals trug ich kein “Alfa-Gen” in mir, d.h., ich wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass ich es einmal besser könnte als er. Er war ganz selbstverständlich der Boss gewesen.
Ausgehend von meinen schulischen Leistungen dachte ich mir zu Anfang, ich könnte schon zufrieden sein, wenn ich die Fachhochschule überhaupt erfolgreich abschließen würde. Doch schon während der ersten beiden Semester hatten die neuen Rahmenbedingungen und auch mein Abstand von zuhause ihre deutlichen Auswirkungen, als ich in der Physik-Vorprüfung nach dem zweiten Semester mit der Note 1.0 das beste Ergebnis des Semesters erzielte.
Die Fächer Physik und Chemie hatten mir schon immer gut gefallen, aber während der Schulzeit hatte ich mich zuhause nie damit beschäftigt. Umso größer war nun die Steigerung gewesen, nachdem ich nun erstmals ein Buch in die Hand genommen hatte, um daraus zu lernen. Es war das Buch Dobrinski, Krakau, Vogel: Physik für Ingenieuren gewesen, das heute noch als Standard-Lehrbuch im Handel erhältlich ist [1]. Professor Dr. Krakau hatte auch die Vorlesung gehalten und ich hatte die Prüfung bei ihm abgelegt. Dies war wohl die einzige Vorlesung an der Fachhochschule gewesen, die man mit einer Universitätsvorlesung vergleichen oder sogar gleichsetzen konnte.
1.3 Das Praxissemester im CERN
Das 6. Semester an der Fachhochschule war ein Praxissemester. Es sollte in einem Industriebetrieb abgeleistet werden. Doch Professor Krakau sandte mich nach Genf, in das Europäische Kernforschungszentrum CERN. Dort wurde ich in eine Arbeitsgruppe eingegliedert, welche die Experimente in den Intersecting Storage Rings (ISR) betreute.
Bei den Intersecting Storage Rings handelt es sich um eine riesige unterirdische Anlage, in der hochenergetische (also auf hohe Geschwindigkeit beschleunigte) Elementarteilchen in evakuierten Aluminiumröhren auf gegenläufigen Kreisbahnen bei jedem Umlauf mehrere Kollisionsstellen (sogenannte Intersection Points) passierten, wo sie kollidieren konnten. Durch diesen Zusammenprall wurden die Teilchen in ihre Bestandteile zerlegt. Für diese Bestandteile der Materie interessierte man sich. Deshalb war jeder dieser Kollisionspunkte von einer Unmenge von Detektoren umgeben, welche diese Bruchstücke der Materie messtechnisch erfassen sollten, damit man ihre Eigenschaften untersuchen konnte. An der Entwicklung und Weiterentwicklung dieses riesigen Detektorsystems durfte ich nun mitarbeiten.
Als ich nach sechs Monaten aus Genf zurückkam, sah ich die Welt mit anderen Augen, angesichts der vielen Eindrücke, die ich dort gesammelt hatte und angesichts dessen, was ich dort gelernt hatte.
Am Ende meines Studiums an der Fachhochschule kehrte ich noch einmal für weitere zwei Monate ins CERN zurück, um meine Abschlussarbeit dort anzufertigen, die ebenfalls extern von Professor Krakau betreut wurde. Rückblickend war das CERN die einzige individuelle Förderung, die mir über meine gesamte Ausbildung hinweg, einschließlich meines späteren Universitätsstudiums und einschließlich meiner späteren Promotion, zuteil wurde.
1.4 Ein Studium mit Defiziten
Und nun hielt ich meine Ingenieururkunde in Händen. Wir - der Johann und ich -trafen uns ein letztes Mal im Sailer-Haus um unsere Zimmer zu räumen. Da kam uns ganz beiläufig und fast gleichzeitig auf einmal der Satz “jetzt wär’s eigentlich recht, Elektrotechnik zu studieren!”über die Lippen. Natürlich war das irgendwo Unsinn, denn wir hatten ja gerade eben ein Studium der Elektrotechnik abgeschlossen. Aber es zeigte doch, dass wir beide das Gefühl teilten, ein Studium mit Defiziten absolviert zu haben.
Im CERN hatte sich dieses Gefühl bei mir schon breit gemacht. Die anderen Studenten, auch aus anderen Ländern wie England und Frankreich, kamen alle von Universitäten. Ich bemerkte, diese Studenten hatten viel bessere Kenntisse als ich, insbesondere in Mathematik.
Bei einer Feier sprach mich einer der Physiker an und wir unterhielten uns über die spätere Perspektive einer Promotion. Ich staunte nicht schlecht. Für mich als zukünftiger Absolvent einer Fachhochschule stand dieser Weg ja gar nicht offen.1 Aber in dieser wissenschaftlichen Welt des CERN war die Fachhochschule ja auch gänzlich unbekannt gewesen und meinem Gesprächspartner war gar nicht bewusst gewesen, dass ich mich auf einem derart beschränkten Ausbildungsweg - effektiv in einer akademischen Sackgasse - befand.
Literatur
1. P. Dobrinski, G. Krakau und A. Vogel, Physik für Ingenieure, 11. Auflage, Teubner, Wiesbaden, 2006.
1 Mittlerweile können Absolventen von Fachhochschulen bzw. deren Nachfolgeeinrichtungen direkt promovieren, vorausgesetzt sie finden einen Betreuer an einer Universität, die am Ende auch den Doktorgrad verleiht. Denn ebenso wie die früheren Fachhochschulen haben auch deren Nach folgeeinrichtungen kein eigenes Promotionsrecht.
Kapitel 2
Meine erste Anstellung als Ingenieur und der Rückblick auf die Fachhochschule (1978)
Kaum hatte ich meinen Ingenieur in der Tasche, da ging es auch schon darum, eine erste Anstellung zu finden. Hier dachte ich natürlich zu allererst an CERN. Dort waren immer wieder Stellen für Ingenieure ausgeschrieben und die waren deutlich besser dotiert als in der deutschen Industrie. Tatsächlich hatte ich Glück und es war gerade eine Stelle freigeworden, die vom Profil und von den Anforderungen her gut zu meinen Themen im Praxissemester und in der Abschlussarbeit passte. Also bewarb ich mich um diese Stelle und wurde auch bald zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Dieses fand vor einem richtigen Auswahlausschuss statt und verlief sehr positiv, da ich mich im CERN ja schon auskannte.
2.1 Die erste Enttäuschung
Der Wermutstropfen kam dann am Ende, als man mir erläuterte, dass ich mit meinem Ing.(grad.) von der Fachhochschule die Einstellungsvoraussetzungen nicht erfüllte. Denn Ingenieur bedeutete im CERN Diplomingenieur (Universität). Ein “Fachschulingenieur” wie ich konnte im CERN allenfalls als Techniker eingestellt werden. Als solchen hätte man mich gerne genommen.
Aber ich war natürlich enorm enttäuscht. Schließlich hatte ich mich während meiner Zeit im CERN schon zugehörig gefühlt und nun zeigte sich, wie es sich in der Wirklichkeit verhielt. Verbittert fuhr ich nach Hause. Techniker im CERN wollte ich nicht werden. Schließlich war es mein Jugendtraum gewesen, einmal Ingenieur zu sein. Auf meiner Urkunde von der Fachhochschule stand ja auch zu lesen, dass ich ein Ingenieur war. Und nun wurde es nicht anerkannt. Also war es eine Lüge gewesen.
Ich fühlte mich vom deutschen Hochschulsystem betrogen und hintergangen. Immer wieder dachte ich an die Worte von Johann Steckenbiller, mit denen er den Ingenieursgrad von der Fachhochschule zynisch in die Ecke gestellt hatte. Wie wahr seine Worte doch gewesen waren. Er hatte eben viel mehr Erfahrung als ich gehabt, auch bezüglich der realistischen Einschätzung unseres Abschlusses.
2.2 Wachsende Zweifel
Er hatte in diesem Zusammenhang auch oft von dem Diplomstudium an der Technischen Universität München gesprochen. Er kannte die Tochter eines Dozenten an der Fachhochschule Regensburg. Sie war nach dem 2. Semester bereits an die “TU”2 nach München gewechselt.
Der Vater predigte in Regensburg gegenüber den Studenten die hohen Werte der “praxisorientierten” Fachhochschulausbildung, während die Tochter bei der erstbesten Gelegenheit an die TU wechselte. Langsam begriff ich: Da stimmt was nicht. Wir werden verschaukelt. Der Johann hatte das - auch aufgrund seiner Reife und seiner Erfahrung - schon viel früher gemerkt.
Ich habe mich oft gefragt, warum er diesen Schritt an die TU nicht auch gemacht hat. Wir hatten nie offen darüber gesprochen. Vielleicht fühlte er sich schon zu alt, oder er wollte eine Familie gründen. Für mich war ein solcher Wechsel nach dem 2. Semester kein Thema gewesen. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich die TU schaffen könnte, in Anbetracht der abenteuerlichen Geschichten, die man sich an der Fachhochschule von den enormen Anforderungen an dieser “Eliteschmiede” allenthalben erzählte.
Die abenteuerlichsten Geschichten dieser Art wurden von einem Lehrbeauftragten Diplomingenieur namens Kaunzner verbreitet, der an die Fachhochschule gekommen war, um Hochfrequenztechnik zu unterrichten. Er meinte, nur einer aus unserem Semester könnte die TU vielleicht schaffen, und das war der Johann.
2.3 Das Märchen vom praxisorientierten Fachhochschulstudium
In unserem Semester hatte es überhaupt nur einen einzigen Studenten gegeben, der von einem Gymnasium gekommen war und ein “richtiges” Abitur besaß. Es war Georg Fischer, genannt “Schorschi” aus Cham. Ein Dozent 3 namens Breitbeil, der uns in Grundlagen der Elektrotechnik unterrichtete, fragte ihn einmal, weshalb er nicht an die TU gegangen war. Schließlich hätte er sich mit seinem Abitur gleich dort einschreiben können. Der Schorschi antwortete, er wäre an die Fachhochschule gekommen, weil man ihn an seiner frühreren Schule dahingehend beraten hatte, dass dies die praxisorientierte Ingenieurausbildung4 sei. Daran war er interessiert gewesen. Auf diese Weise hatte man ihn dazu überredet, an der Fachhochschule anstatt an der TU zu studieren.
Der sogenannte Praxisbezug wurde an der Fachhochschule wirklich an allen Ecken und Enden hervorgehoben. Dies lässt sich vielleicht am Beispiel des Faches “Messtechnik” am Besten verdeutlichen, das in unserem Semester von einem verschlafenen Dozenten namens Weinbuch vertreten wurde. Ich erinnere mich noch gut an einen Tag, an dem er besonders verschlafen wirkte. Eigentlich war er überhaupt nicht in der Verfassung, um einen Unterricht durchzuführen. Also sprach er: “Heute machen wir eine praktische Übung: Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Labor und finden dort eine Batterie, ein Kabel, einen Schalter und eine Lampe. Was können Sie daraus bauen? - Eine Stunde Bearbeitungszeit...”. Das war der “Praxisbezug” an der Fachhochschule.
2.4 Die Erfahrung mit den Wegweisern
Als ich damals aus dem CERN zurückgekommen war, musste ich etwas mit meinem Bafög regeln. Also fuhr ich zum Studentenwerk, das in einem anderen Stadtteil an die Uni Regensburg angegliedert war. Dort hatte man an der Eingangstür einen Wegweiser angebracht. Dieser zeigte rechts ab für Uni-Studenten und links ab für Fachhochschüler. Wir wurden also offiziell nicht einmal als Studenten wahrgenommen, sondern nur als Schüler - als Fachschüler. Irgendwo beschlich mich damals schon ein mulmiges Gefühl. Wir wurden doch da irgendwie grob verschaukelt.
2.5 Die Verlegenheitsstelle bei MBB-Apparate in Ottobrunn
All das war mir wieder durch den Kopf gegangen, als ich schließlich im April 1978 eine Stelle als Entwicklungsingenieur bei Messerschmitt-Boelkow-Blohm (MBB) und hier im Unternehmensbereich Apparate in München-Ottobrunn annahm. Es handelte sich um eine “Verlegenheitsstelle”, d.h., man nimmt sie an, weil man nichts Besseres gefunden hat.
Bei den Apparaten handelte es sich effektiv um wehrtechnisches Gerät. Ich wurde einem alten Fachhochschulingenieur zugeordnet, dem Meindl Franz, der auch aus Niederbayern kam, so wie ich. Wir hätten uns verstehen sollen. Aber ich war das CERN-Klima gewöhnt und das war eine ganz andere “Hausnummer” gewesen. Ich wurde von Tag zu Tag unglücklicher auf dieser MBB-Stelle.
Auch war es schwer gewesen, eine Wohnung in Ottobrunn zu finden. Der Meindl Franz hatte eine alte, leerstehende Wohnung in der Schellingstraße ausgemacht, in der ich vorübergehend unterkommen konnte. Das war insgesamt schon eine traurige Situation. Als ich eines Abends in der Umgebung spazieren ging, stand ich plötzlich vor einem Gebäude mit der Aufschrift “Technische Universität München”. An diesem Abend hätte ich niemals geglaubt, dass ich noch im selben Jahr hier ein Studium beginnen würde, und zwar im ersten Semester!
2.6 Die Initialzündung
In dieser Phase erhielt ich eines Tages Post vom Johann. Er war wieder in den Fernmeldedienst eingetreten und hatte sich nun entschlossen, den Diplom-Ingenieur (Universität) über ein Fernstudium nachzuholen. Er fragte mich, ob ich da nicht mitmachen wollte, wo wir doch immer so gute Partner gewesen waren.
Das wirkte auf mich wie eine Initialzündung auf eine Stange Dynamit. Es war eine Idee, wie ich mich vielleicht aus der beklemmenden Lage auf meiner ungeliebten MBB-Stelle befreien konnte. Ich besprach das Ganze mit meinem Vater. Die Geschichte mit der Fernuniversität gefiel meinem Vater nicht. Wenn schon - denn schon, meinte er. Dann sollte ich es doch gleich “richtig” machen, womit ein reguläres Studium an der TU gemeint war.
2.7 Ein schwerer Entschluss
Doch dabei ging es nicht zuletzt auch um’s Geld. Ich war inzwischen “schon” 23 geworden und mein Vater war nur ein armer Arbeiter gewesen. Ich fühlte die Verpflichtung, nun endlich selbst Geld zu verdienen. Aber mein Vater ermutigte mich und sprach “wir machen das richtig!”. Dabei kam uns die damalige Bafög-Regelung entgegen, wonach für ein Zweitstudium wenigstens ein Darlehen gewährt wurde. Das war der entscheidende Punkt und ich entschloss mich zu dem Schritt. Ohne das Darlehen hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, auch wenn mein Vater es bezahlt hätte. Ich hätte ihm das nicht zumuten können.
So schrieb ich an den Johann, dass ich es direkt über die TU machen würde. Meine MBB-Stelle kündigte ich im Spätsommer 1978 und schrieb mich an der TU für das kommende Wintersemester ein.
Einerseits war es eine Befreiung, andererseits war es ein sehr schmerzlicher Schritt. Nicht nur wegen der finanziellen Situation, sondern auch deshalb, weil ich wieder im 1. Semester anfangen musste. Ich hatte effektiv vier Jahre verloren.
2 Heute lautet die offizielle Bezeichnung TUM. Damals sprachen wir nur von der TU.
3 Damals war der Begriff des Professors für einen Lehrenden an der Fachochschule nicht durchgängig gebräuchlich. Die Mehrzahl von ihnen besaß nicht einmal einen Doktorgrad und wissenschaftlich ausgewiesen waren sie schon gleich gar nicht. Wir nannten sie “Dozenten”.
4 Das Argument der besonderen Praxisorientierung wird von den Fachhochschulen bis heute in Anspruch genommen, um Studenten anzulocken. In Wirklichkeit ist jedes Ingenieurstudium praxisorientiert, ganz gleich ob es an einer Fachhochschule oder an einer technischen Universität durchgeführt wird. Daher handelt es sich bei dem Argument der besonderen Praxisorientierung der Fachhochschulen um unlautere, irreführende Werbung.
Kapitel 3
Das Studium an der Technischen Universität München (1978-1983)
Nach einem Traumsommer, den ich mit meinen Eltern am Waginger See verbracht hatte, kehrte ich im Herbst 1978 wieder nach München zurück, um das Studium der Elektrotechnik an der TU aufzunehmen. Und zwar im 1. Semester. Von der Fachhochschulausbildung wurden nur die Industriepraktika angerechnet. Also - das ganze Studium nochmal von vorne!
3.1 Der erste Tag an der TU
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag an der TU, als alle Anfänger im großen Physikhörsaal versammelt waren, um eine Einführung in das Studium zu erhalten. Es waren mindestens 500 Anfänger hier anwesend. Sie warfen mit Papierfliegern umher. Ich blickte an die Decke des Hörsaals. Dort sah ich ein grobmaschiges Gitter, welches einen großen Lüftungsschacht verschloss. Darin steckten jede Menge von diesen Papierfliegern, die hier überall herumschwirrten, gebastelt und auf ihre Flugbahn gebracht von den flinken Fingern der “kleinen Kinder”, die hier auf ihre Einführung warteten.
Ich dachte an die Zeit im CERN zurück und fragte mich: Was hat dieses Deutschland nur aus dir gemacht und womit hast du es verdient, hier unter diesem Haufen kleiner Kinder wieder ganz von vorne beginnen zu müssen?
Meine innere Antwort auf diese Frage hätte Resignation sein können. Bei der Einschreibung an der TU war mir noch ein anderer Bekannter aus meiner Zeit an der Fachhochschule Regensburg aufgefallen. Ich schaute mich um, ob er nun auch zu dieser Einführungsveranstaltung gekommen war. Aber er war nirgendwo zu entdecken. Wahrscheinlich hatte er den Gedanken, alles noch einmal ertragen zu müssen, nicht ausgehalten und hatte schon an dieser Stelle das Handtuch geworfen.
Bei mir führte diese Situation zu einer ganz anderen Einstellung. Ich fragte mich, ob es denn wirklich gerechtfertigt war, mich auf eine Stufe mit den frischgebackenen Abiturienten zu stellen. Schließlich hatte ich nie ein Gymnasium besucht, sondem war über die Realschule, eine berufliche Ausbildung, die man damals “Lehre”5 nannte und die Fachoberschule an die Fachhochschule gekommen. Und nun hatte mich dieses Bildungssystem nach diesem langen Weg und einer bereits begonnenen beruflichen Tätigkeit als Ingenieur auf eine Stufe mit den frischgebackenen Abiturienten gestellt, die rund 4 Jahre jünger waren als ich. Es ergab sich ganz von selbst, dass ich mit einigen von ihnen ins Gespräch kam. Sie erschienen mir ganz schön “grün”.
3.2 Die Abiturienten als Konkurrenten
Dann begann der reguläre Vorlesungsbetrieb. Die Abiturienten betrachtete ich als Konkurrenten und wollte wissen, wie ich im direkten Vergleich mit ihnen abschneiden würde. Allein dieses Moment gab mir schon einen enormen Auftrieb. Ich wollte es ihnen zeigen. Als primäres Motivationsmoment stand an dieser Stelle aber der Wunsch, meine Defizite in den Grundlagenfächern, allen voran in Mathematik, nun endlich auszugleichen.
Wenn ich diese Grundlagen einmal verinnerlicht hätte, so dachte ich mir, könnte ich mir alles andere leicht selbst erarbeiten. Dieses Prinzip hatte ich damals bereits erkannt und ich habe es auch später, als ich selbst Professor geworden war, in den Mittelpunkt meiner Lehre gestellt.
Dies war auch im CERN schon deutlich zu Tage getreten, dass es zu allererst auf eine Festigung dieses elementaren theoretischen Fundaments ankam, das an der Fachhochschule nicht systematisch und nicht korrekt aufgebaut worden war. Denn an der Fachhochschule mangelte es an der nötigen Zeit und vor allem mangelte es auch an hinreichend qualifiziertem Lehrpersonal. Im Rückblick konnte allein der Professor Krakau einen Vergleich mit dem Lehrpersonal im Grundlagenbeich an der TU aushalten. Alle anderen Dozenten, die mich an der Fachhochschule unterrichtet hatten, konnte man im Vergleich dazu direkt vergessen.
3.3 Die Einführung in die höhere Mathematik von Josef Heinhold
Das galt insbesondere für die “Einführung in die Höhere Mathematik”, die in meinem Anfangssemester an der TU im Herbst 1978 von Josef Heinhold gehalten wurde, der damals Ordinarius und Leiter des Instituts für Statistik und Unternehmensforschung an der TU war. Er wirkte auf die Studenten so, wie man sich einen richtigen Professor vorstellte. Beginnend bei seinem ganzen äußeren Erscheinungsbild, natürlich immer korrekt gekleidet, gewählt im sprachlichen Ausdruck und dem Habitus eines Gelehrten im fortgeschrittenen Alter.
Die Vorlesungen fanden in den großen Hörsälen des mathematischen Instituts statt und liefen immer exakt nach demselben Schema ab. Kurz vor Beginn der Vorlesung stand Professor Heinhold mit seinem Oberassistenten bereits vor dem Seiteneingang des Hörsaals und betrat diesen exakt und beinahe sekundengenau zu Vorlesungsbeginn. Man hätte es sich nicht vorstellen können, dass er einmal zu spät kommen könnte. Auch war sein Auftreten von Anfang an vor einer besonderen Frische und von einer Leichtigkeit gekennzeichnet, die eben auch zum Ausdruck brachte, wie spielend er den Stoff beherrschte.
Er hängte sich das Mikrofon um und schon begann die Vorlesung, in deren zügigem und bestimmten Ablauf er regelmäßig genau 9 große Tafeln vollschrieb, die aus 3 nebeneinander angeordneten Tafelsätzen bestanden, deren Einzeltafeln elektrisch in die Höhe gefahren werden konnten. So war am Ende der Vorlesung immer die ganze vordere Wand des Hörsaals vollgeschrieben. Daraus konnte man sich am Schluss jeder Vorlesung durchaus ein Bild davon machen, welches Pensum er im wahrsten Sinne des Wortes abgearbeitet hatte. Das war natürlich mit einer Fachhochschulvorlesung, so wie ich sie erlebt hatte, in keiner Weise vergleichbar.
3.3.1 Die Atmosphäre in den Vorlesungen am Mathematischen Institut
Diese Hörsäle waren auch unvergleichlich größer und sie waren ausgelegt wie überdimensionale Kinosäle. Hunderte von Studenten konnten darin Platz finden. Sie zwängten sich in enge Reihen, in denen man nur ein kleines Schreibbrett vor sich hatte, dann begann schon die nächste Reihe. Trotz dieses Fassungsvermögens waren die Hörsäle überfüllt. Wenn man zu spät kam, musste man mit einer Stufe im linken oder rechten Seitengang, oder gar nur mit einem Stehplatz in der Nähe der Eingangstüren vorlieb nehmen.
Da herrschte natürlich eine ganz andere Atmosphäre als in den seminaristischen Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule, wo man jederzeit problemlos eine Zwischenfrage stellen konnte. Hier war es praktisch gar nicht möglich, Zwischenfragen aus dem Hörerkreis zuzulassen, wenn man nicht den regulären Ablauf der Vorlesung gefährden wollte.
In seltenen Fällen gab es dennoch Momente, in denen man spüren konnte, dass etwas nicht richtig rübergekommen war und der gesamte Zuhörerkreis ein Problem hatte. Dann meldete sich vielleicht einer der Topstudenten (manchmal war ich das...) und formulierte eine Frage. In so einer Situation konnte man schon vorhersehen, wie Professor Heinhold reagieren würde. Er wandte sich an seinen Oberassistenten: “Wollen wir eine Zwischenfrage zulassen?” Der Oberassistent nickte in solchen Fällen immer und Professor Heinhold beantwortete die Frage ausführlichst auf seine eigene, väterliche Art.
Einmal passierte mir das Missgeschick, dass ich ihn bei einer solchen Fragestellung mit “Herr Heinhold” ansprach. Es war mir einfach so rausgerutscht. Im ganzen Hörsaal wurde es sofort mucksmäuschenstill. Es folgte eine spannungsgeladene Pause. Danach hatte Professor Heinhold es “verdaut” und beantwortete die Frage auf die gewohnte Weise, aber man hatte schon deutlich gemerkt, wie sehr ihm mein Lapsus Linguae zu schaffen gemacht hatte.
3.3.2 Die Besseren und die Schlechteren
Diejenigen, die sich getraut hatten den Vorlesungsfluss mit einer solchen Frage zu unterbrechen, wurden schnell im Semester bekannt. Man konnte sich schon denken, dass es die Besseren waren, die solche Fragen stellten. Denn die Schlechteren hatten den doch recht abstrakten Vortrag ja gar nicht soweit verstanden, dass sie überhaupt in der Lage gewesen wären, eine Frage zu formulieren.
Es gab dementsprechend auch viele, die in diesen Vorlesungen total “abgehängt” wurden. Das war eben eine ganz andere Situation als in der Schule.
Begleitend zur Vorlesung gab Professor Heinhold zu dieser Zeit auch eine Buchreihe “Einführung in die höhere Mathematik” heraus. Auch hier gab es genügend Anfänger, die vom Niveau dieser Bücher überfordert waren. Ich kann mich noch gut an die Ausgabe einer Studentenzeitung aus dieser Zeit erinnern, die auf der Titelseite die Abbildung eines aufgeschlagenen Buches zeigte, in der Gestalt eines weit aufgerissenen Haiflschmauls mit scharfen Zähnen und darauf prangte der Titel: “Reingold - Einführung in die Höhere Mathematik”.
Das brachte die ganze Frustration eines Teils der Hörer zum Ausdruck, von Schülern, die den Übergang von der schulischen Welt in diese weitaus forderndere Welt in den Anfangssemestern an der TU einfach intellektuell nicht verkrafteten. Sie hatten nicht die nötige “Power” und gaben auf. Ich sah darin einen durchaus wünschenswerten und notwendigen Selektions- und Abhärtungsprozess.
3.3.3 Der Übungsbetrieb
Dabei gab es neben der abstrakten Vorlesung auch einen regelmäßigen, sehr gut organisierten Übungsbetrieb. In diesen Übungen wurde das große Semester in einzelne Gruppen von höchstens 30 Teilnehmern aufgespalten. Hier wurden die Aufgabenblätter, die regelmäßig eine Woche zuvor zur Bearbeitung ausgegeben worden waren, von Assistenten vorgerechnet. Natürlich gab es hier auch die Möglichkeit, leicht jederzeit Zwischenfragen zu stellen.
Es gab also konkrete Aufgaben, und man hatte eine realistische Chance, den Stoff zu verarbeiten. Darüber hinaus gab es auch umfangreiche Sammlungen von Prüfungen früherer Semester. Man konnte sich also ein Bild davon machen, was im Vordiplom verlangt werden würde und es stand damit hinreichend Übungsmaterial zur Verfügung. Daneben wurden die Lösungen zu den Übungen in jeder Woche auch noch in einem eigens dafür vorgesehenen Schaukasten im mathematischen Institut ausgehängt und man hatte obendrein die Möglichkeit, seine eigenen Lösungen einige Tage vor dem Besprechungstermin zur Korrektur abzugeben. In den Übungen erhielt man sie dann korrigiert zurück.
Das war schon ein beeindruckender Aufwand und eine sagenhafte Ordnung, die da herrschte. Kein Vergleich mit den schlampigen Verhältnissen an der Fachhochschule. Organisiert hat das der Übungsleiter oder Oberassistent Konrad Leufer, ein Oberstudienrat im Hochschuldienst. Er war die pädagogische Eignung in Person.
3.3.4 Die Gruppe der Leistungsträger
Konrad Leufer leitete selbst eine dieser Übungsgruppen, die er ausdrücklich als die Leistungsgruppe des Semesters bezeichnete. Durchschnittliche Studenten, die Schwierigkeiten mit dem Stoff hatten waren aufgefordert, nicht in diese Leistungsgruppe zu gehen.
Diese war für die Topleute des Semesters vorgesehen, die mit den ausgegebenen Übungsaufgaben keine Schwierigkeiten hatten und diese schon locker zuhause gelöst hatten. In der Übung hatten sie dann die Gelegenheit, ihre Lösungen selbst vorzurechnen und so bereits Erfahrungen mit der Präsentation ihrer Ergebnisse vor einem Auditorium zu sammeln.
Oft kam es in dieser Gruppe auch soweit, dass ganz neue Aufgaben oder Lösungen vorgeschlagen und diskutiert wurden. Das sagte mir sehr zu und bald wurde ich ein Hauptakteur in dieser Spitzengruppe. Alle vier Semester des Vordiploms liefen auf diese Weise ab. Die Topleute kannten sich bald und tauschten sich untereinander aus. An der Fachhochschule war ich nur eine graue Maus gewesen. Jetzt wurde ich allmählich zu einem Alfatier.
Eines Tages schlug ich sogar eine neue Übungsaufgabe zum Thema der partiellen Differentialgleichungen vor. Diese Aufgabe war so elegant, dass sie in das reguläre Übungsprogramm des mathematischen Instituts aufgenommen wurde.
3.3.5 Eine eindrucksvolle Erinnerung
In den späten 90er Jahren, als ich selbst schon Professor geworden war, lief ich eines Abends durch das mathematische Institut, wo immer viele Aufgabenblätter zu den laufenden Übungen auf den Arbeitstischen vor den Hörsälen von den Studenten liegen gelassen wurden. Ich nahm ein solches Aufgabenblatt in die Hand und erkannte darauf zu meinem großen Erstaunen meine Aufgabe zu den Differentialgleichungen, die ich damals als Student vorgeschlagen hatte. Die Aufgabe hatte all die vielen Jahre am mathematischen Insititut unverändert überlebt. Ich war beeindruckt.
3.4 Die Vorlesungen von F.L. Bauer und R. Bulirsch
In den ersten vier Semestern verbrachte ich viel Zeit am mathematischen Institut. Dort gab es auch eine Ecke, wo die Informatik-Studenten ihre ALGOL-Programme abgeben konnten. Bald kam ich mit ihnen ins Gespräch. Sie nahmen mich in eine ihrer Vorlesungen mit, die von einem kauzigen Professor gehalten wurde. Sein Name war - FL.Bauer.
Damals hätte ich es mir nicht träumen lassen, dass ich später einmal eine der frühen Arbeiten von F.L. Bauer über die Eigenwertberechnung von Matrizen mit Hilfe der sogenannten Treppeniteration in einem wichtigen Punkt generalisieren würde. Nämlich in dem Punkt der Schätzung und Verfolgung der Eigenwerte und Eigenvektoren von zeitvarianten symmetrischen Matrizen, sowie der Singulärwerte und Singulärvektoren zeitvarianter nichtsymmetrischer Matrizen. Diese Generalisierungen veröffentlichte ich in meinen Aufsätzen “Low Rank Adaptive Filters” von 1996 [1] und “Bi-Iteration SVD Subspace Tracking Algorithms” von 1997 [2], sowie einer Reihe weiterer Beiträge6 zu diesem Thema.
Daneben besuchte ich gelegentlich auch noch andere Vorlesungen am mathematischen Institut, vorrangig die Vorlesungen von R. Bulirsch, dessen äußeres Erscheinungsbild durch eine eigenwillige Modelfrisur geprägt war. Er hatte einen fähigen Assistenten namens Dr. Seidel, der es sich in seinem Büro gerne bequem einrichtete.
3.5 Bei Lindermayers in Neubiberg
Gegen Ende meiner Zeit bei MBB-Apparate war ich in ein möbliertes Zimmer in Neubiberg eingezogen. Dieses Zimmer wurde zu meiner Bleibe, während der gesamten Zeit an der TU und darüber hinaus. Die tägliche Fahrt von Neubiberg ins Stadtzentrum war mit einem erheblichen Zeitverlust verbunden. Ich versuchte einen Platz in einem Studentenwohnheim zu bekommen, um eine Umgebung herzustellen, wie sie in Regensburg bestanden hatte. Aber in München herrschten ganz andere Verhältnisse. Hier existierten ellenlange Wartelisten für einen Heimplatz. Irgendwann gab ich es auf und nahm die lange S-Bahn-Fahrt in Kauf.
3.6 Der Sohn des Professors
Bei diesen täglichen S-Bahn-Fahrten fiel mir ein Student auf, der denselben Weg hatte wie ich. Wir lernten uns bald kennen. Es war Martin Lange, der Sohn von Professor Lange, dem Inhaber des Lehrstuhls für Hochfrequenztechnik an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. Er studierte ebenfalls Elektrotechnik an der TU im 1. Semester.
Auf diese Weise hatte ich wieder einen Partner gewonnen, zumindest für die Zeit bis zum Vordiplom, wo sich unsere Wege dann trennten. Nun war ich der Ältere, denn der Martin war natürlich auf dem direkten Weg über das Abitur an die TU gekommen. Anders als die anderen Abiturienten hatte er bereits einen beachtlichen Wissensvorsprung. Kein Wunder, wo sein Vater doch Professor für Hochfrequenztechnik war.
Oft staunte ich nicht schlecht über die Tricks, die er schon so drauf hatte. Beispielsweise die Berechnung des Gesamtwiderstands eines an diametral gegenüberliegenden Ecken kontaktierten Widerstandswürfels, bestehend aus gleichen Kantenwiderständen. Er kannte schon den Lösungsansatz über die Äquipotentialflächen. Nebenbei las er regelmäßig den Scientific American. Ich war beeindruckt.
Im Vordiplom erzielten wir beide fast dieselben Ergebnisse, wobei er im Schnitt eine Idee besser war. Bald bemühte er sich um eine Werkstudentenstelle am Lehrstuhl für Mikrowellentechnik von Professor Groll. Er sprach oft davon und insbesondere von “seinem” Dr. Detlefsen. Das war sein Betreuer. Und er hatte auch schon ein aufregendes Arbeitsgebiet zugeteilt bekommen: Radar-Abstandsmessung.
Offenbar hatte sein Vater all diese Dinge in die Wege geleitet. Ich zweifelte nicht eine Sekunde daran, dass er ebenfalls einmal Professor für Hochfrequenztechnik werden würde, wie sein Vater, denn er arbeitete auch mit dem entsprechenden Einsatz. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er eines Tages zu mir sagte: “Du, Peter, ich habe wieder ein Kilo abgenommen!” Da staunte ich nicht schlecht. Ich hatte noch nie so intensiv gearbeitet, dass ich dabei abnahm. Das hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Vielleicht war ich körperlich auch robuster. Er war ein “70-Kilo-Mann”, wohingegen ich ein schlanker “85-Kilo-Mann” war.
Schließlich ermahnte er mich noch, ich sollte mich doch auch beizeiten nach einer solchen Werkstudentenstelle umsehen, um mich an einem Lehrstuhl bekannt zumachen. Damit ich später auch eine Assistentenstelle bekäme.
Aber ich dachte natürlich nicht im Traum daran, mich für einen lächerlichen Werkstudenten-Hungerlohn an einem Lehrstuhl einzureihen. Schließlich war ich ein Ingenieur mit Berufserfahrung gewesen und schließlich gab es da noch meine Kontakte zu MBB. Und dort benötigte man oft sehr gute, selbständig arbeitende Ingenieure für dringende Entwicklungsaufgaben.
3.7 Die befristeten Beschäftigungsverhältnisse als Entwicklungsingenieur bei MBB-UF
So fand ich gleich für die ersten Semesterferien eine Springerstelle7 bei MBB-UF (Unternehmensbereich Flugzeuge), wo zu dieser Zeit gerade die ersten Tornados zusammen genietet wurden. Dort gab es eine Riesen-Testumgebung für die Mapperund TF (Tiefflug) Radarsysteme des Tornado-Jets. Hier häuften sich eine Menge dringender Entwicklungsarbeiten, die vom Hauptprojekt abgespalten und einem guten Mann oder einer guten Frau zur weitgehend selbständigen Bearbeitung übergeben werden konnten.
Das war nun meine Aufgabe und es war ein Glücksfall, denn es war anspruchsvoll und interessant. Obendrein erhielt ich ein gutes Ingenieursgehalt, denn hier ging es wirklich um was. Ich verdiente fast doppelt soviel wie ein Berufsanfänger. Das war natürlich mit einer Werkstudentenstelle an der TU nicht zu vergleichen.
Der Zeitdruck hinter diesen Projekten machte mir nichts aus. Ich nahm jedenfalls dadurch nicht ab. Meine finanziellen Sorgen, die mich bei der Entscheidung für dieses Zweitstudium noch so gedrückt hatten, waren mit einem Mal verschwunden, nachdem ich auf dieser Springerstelle in zwei Monaten locker soviel verdienen konnte, wie ich das ganze Jahr über brauchte.
Zu dem regulären Gehalt erhielt ich jedes Mal sogar noch eine extra Prämie, da die Arbeiten am Ende immer zur besonderen Zufriedenheit des Arbeitgebers ausgefallen waren. Dabei profitierte ich ganz klar davon, dass hier konkrete Ziele erreicht werden mussten und dass das Erreichen dieser Ziele wichtig war für den Erfolg eines übergeordneten Gesamtprojekts.
Insgesamt war ich dreimal auf diese Weise für MBB-UF befristet tätig gewesen8. In Abb. A.2 sieht man das Zeugnis, das mir MBB-UF für meinen letztmaligen Einsatz vom 1.3.-30.4.1980 ausgestellt hat, sowie in Abb. A.3 das zugehörige Anschreiben über die Gewährung einer Prämie für herausragende Leistungen. Dies ist auch ein Beispiel für ein Industriezeugnis, wie es besser nicht ausfallen könnte. Der erste Unterzeichner dieses Zeugnisses in Abb. A.2 ist der damalige Bereichsleiter Avionik und Bewaffnung Kuny, also nicht nur ein gewöhnlicher Abteilungsleiter.
3.8 Mein Besuch bei Gerd Hauske
Obwohl ich finanziell nun eigentlich abgesichert war, bezog ich weiterhin noch das Bafög Darlehen, das ja zinslos war. Zu Beginn des 3. Semesters musste ich eine Verlängerung beantragen. Dabei wurde auch ein Nachweis meiner bisherigen Studienleistungen im Vordiplom I verlangt, der beim zuständigen Bafög-Beauftragten der TU vorgelegt werden sollte. Dieses Amt hatte damals Gerd Hauske inne, ein C2-Professor am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik von Professor Marko.
Also begab ich mich an den Lehrstuhl für Nachrichtentechnik und fand dort bald das Büro von Gerd Hauske. Bei meinem Eintreten fiel mir gleich eine ganze Kiste voller Apfelsinen auf, die da auf dem Boden stand. Es war schon Winter geworden und dies war vielleicht der Vitaminvorrat, der vor einer Erkältung schützen sollte.
Ich brachte mein Anliegen vor und legte meinen Bafög-Verlängerungsantrag, sowie den geforderten Nachweis über die Ergebnisse im Vordiplom I auf den Tisch. Da stand: Mathematik 1.0 und Physik 1.0. Als Gerd Hauske auf diese Noten blickte, entfuhr ihm spontan dieser Satz: “Sind sie verrückt?”. Ich war ganz schön überrascht, angesichts dieser Reaktion.
Aber diese Notenkombination war wirklich relativ unwahrscheinlich. Legt man einmal zugrunde, dass nur 3 bis 4 von hundert Studenten in einem dieser Fächer eine 1.0 erzielen konnten, dann kommt man unter der Annahme der statistischen Unabhängigkeit der beiden Notenprozesse zu dem Ergebnis, dass nur etwa jeder tausendste Student die 1.0 in beiden Fächern gleichzeitig erzielen konnte. Also war die Reaktion von Gerd Hauske aus dieser Sicht vielleicht nachvollziehbar.Möglicherweise hatte er noch nie zuvor einen solchen Fall erlebt.
Damals interessierte ich mich auch dafür, woran Gerd Hauske arbeitete. Es waren Themen aus dem damals sehr im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehenden Fachgebiets der Kybernetik. Es ging darum, Methoden der Nachrichtentechnik, und hier insbesondere Methoden der Systemtheorie auf die Beschreibung der Signalübertragungsvorgänge in biologischen Systemen anzuwenden. Also beispielsweise die Signalverarbeitung des visuellen Systems des Menschen zu studieren.
Dieses Thema war naturgemäß sehr experimentierlastig. Die Theorien mussten ja anhand realer Daten überprüft werden, die in Testreihen mit Versuchspersonen gewonnen wurden.
Für die Kybernetik konnte ich mich nicht erwärmen, sah aber später eher zufällig einige Arbeiten von Gerd Hauske, welche in ein paar kleinen deutschen Fachzeitschriften erschienen waren. Im Laufe meiner späteren Publikationstätigkeit hätte ich niemals in einer dieser Zeitschriften veröffentlicht. Da hätte ich meine Manuskripte eher weggeworfen. In dieser Beziehung war ich später ziemlich rigoros.
Als Beispiel dafür kann man auch einen Fall erwähnen, als ich später einmal ein Manuskript für die Fachzeitschrift IEEE Transactions on Signal Processing im Review-Verfahren9 locker hätte durchbringen können, wenn ich mich nur kompromissbereit gegenüber den Gutachtern (den “Reviewern” oder “Referees”) gezeigt hätte. Aber die Begleitumstände waren von einer Art, dass ich es nicht über mich brachte. Stattdessen zog ich es vor, die Reviewer zu crashen10 und warf das Manuskript anschließend in den Papierkorb. Manch anderer hätte alles dafür getan, wenn er nur ein einziges Manuskript einmal in dieser Fachzeitschrift durchgebracht hätte.





























