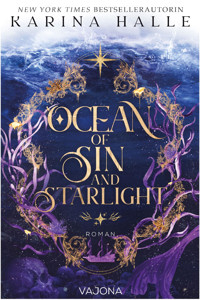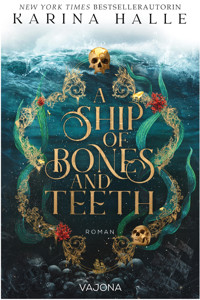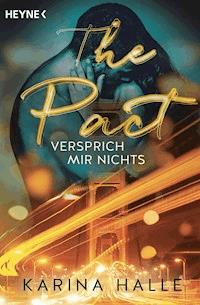9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Being with you-Serie
- Sprache: Deutsch
Ihre Liebe ist gefährlich, doch können sie ihr widerstehen?
Brigs McGregor hat die schlimmste Zeit seines Lebens hinter sich. Doch seine neue Stelle am King´s College in London ermöglicht ihm vielleicht einen Neuanfang. Gäbe es da nicht ein Problem: Natasha, die Frau, die er über alles geliebt und verloren hat, taucht wieder in seinem Leben auf. Das Band zwischen ihnen ist so stark wie immer, doch das Geheimnis, das sie verbindet, könnte beide auf ewig brechen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
KARINA HALLE
The Lie
VERTRAUE MIR NICHT …
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Hanne Hammer
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
ZUMBUCH
Brigs McGregor hat die schlimmste Zeit seines Lebens hinter sich. Doch seine neue Stelle am King’s College in London ermöglicht ihm vielleicht einen Neuanfang. Gäbe es da nicht ein Problem: Natasha, die Frau, die er über alles geliebt und verloren hat, taucht wieder in seinem Leben auf. Das Band zwischen ihnen ist so stark wie immer, doch das Geheimnis, das sie verbindet, könnte beide auf ewig brechen …
ZUM AUTOR
Karina Halle war Reise- und Musikjournalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Self-Publisherin und New York Times-Bestsellerautorin. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrem Hund auf einer Insel vor der Küste Britisch-Kolumbiens.
LIEFERBARE TITEL
The Pact
The Offer
The Play
Für Scott
Prolog
Brigs
Edinburgh, Schottland – Vor vier Jahren
»Es tut mir leid.«
Ich hatte es so oft einstudiert, dass ich dachte, die Worte würden nur so aus meinem Mund strömen, sobald ich ihn öffnete. Die ganze Rede. Das ganze Geständnis. Ich dachte, wenn ich es mir im Kopf immer wieder vorsagte, würde die grausame, befreiende Wahrheit leichter herauskommen, wenn die Zeit reif ist.
Aber so ist das nicht.
Ich kann mich nicht mal erklären. Ich falle lediglich auf die Knie, meine Beine zittern von dem ganzen Stress, dem Stress, den ich mir gemacht habe. Aber er verblasst angesichts dessen, was sie gleich fühlen wird.
Miranda sitzt auf der Couch, wie ich sie gebeten habe, ihre Teetasse steht ordentlich auf der Untertasse. Ich konzentriere mich auf den Dampf, der aufsteigt. Ich dachte, ich könnte mich angemessen verhalten und ihr in die Augen sehen, aber das kann ich nicht. Ich bin feige, will den Schmerz nicht sehen, die tiefen Wunden, die ich ihr zufüge.
»Was tut dir leid?«, fragt sie mit ihrer ruhigen Stimme. Sie ist immer so gelassen, übersteht jeden Sturm, dem ich sie aussetze. Die Tatsache, dass ich auf den Knien liege und wie ein Trottel zittere, hat an ihrem Ton nicht das Geringste geändert. Vielleicht trifft es sie doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe.
Aber das ist verdammtes Wunschdenken.
Ich hole tief Luft und atme dann stoßweise wieder aus. Ich wünschte, der fallende Regen würde das Geräusch übertönen.
»Es tut mir leid«, wiederhole ich. Meine Stimme klingt hohl, wie eine Aufnahme auf einem verstaubten alten Tonband. »Ich muss dir etwas sagen.«
»Das sehe ich«, sagt sie, und jetzt bemerke ich eine gewisse Gereiztheit in ihrer Stimme. »Du hast mir gesagt, dass ich mich hinsetzen soll, und jetzt kniest du vor mir. Ich hoffe, du machst mir nicht noch mal einen Antrag.«
Alles wäre so viel einfacher, wenn das der Fall wäre.
Endlich wage ich es, ihr in die Augen zu sehen.
Meine Ehefrau ist wunderschön. Die wiedergeborene Grace Kelly. Ein Hals wie ein Schwan. Ich erinnere mich an unser erstes Date. Wir waren gerade erst mit der Highschool fertig, doch schon da hatte ich den Eindruck, dass sie voller Geheimnisse steckte. Sie war einfach perfekt. Ich bin mit meinem schäbigen Auto angekommen und habe sie ins Kino und zum Abendessen eingeladen, ins beste Restaurant, das ich mir leisten konnte, aber das Essen war trotzdem grauenhaft. Und sie hat das alles geduldig ertragen und nicht mal mit der Wimper gezuckt. Wenn ich mit ihr zusammen war, hatte ich das Gefühl, jemand zu sein, und vielleicht ist das der Grund, warum ich sie geheiratet habe. Sie war alles und ich nichts.
Sie ist immer noch alles, und ich bin nichts. Gerade jetzt könnte das nicht offensichtlicher sein.
»Brigs«, sagt sie mit gerunzelter Stirn. Sie hat kaum Falten, selbst wenn sie so das Gesicht verzieht. »Du machst mir Angst.«
Ich räuspere mich, doch es hilft nicht viel. »Ich weiß.«
»Geht es um Hamish?«, fragt sie, und ihre Augen weiten sich vor Panik.
Ich schüttele schnell den Kopf. »Nein, es hat nichts mit Hamish zu tun.«
Ich bin dankbar, dass der kleine Mann brav ins Bett gegangen ist, als er sollte. Der Regen fällt jetzt heftiger, hämmert gegen die Fenster, was ihn schon immer besser eingeschläfert hat als jedes Schlaflied.
»Ich will nur, dass du das weißt«, sage ich zu ihr und lege meine Hand auf ihre Hände. Sie sind so weich, als hätte sie keinen einzigen Tag in ihrem Leben gearbeitet. Ich habe sie damit aufgezogen, dass sie zur feinen Gesellschaft gehört, eine Tochter aus reichem Hause ist. Im Moment lassen sie sie furchtbar verletzlich erscheinen. »Ich will nur, dass du weißt, dass … ich habe viel darüber nachgedacht. Es war nie meine Absicht, dich zu verletzen.« Ich blicke auf, bettele sie mit den Augen an. »Das musst du wissen.«
»O Gott«, sagt sie, ringt nach Luft und zieht ihre Hände unter meiner weg. »Brigs, was hast du getan?«
Das Gewicht meiner Entscheidung erstickt mich.
Es gibt keinen leichten Weg, ihr das zu sagen.
Keinen Weg, den Schlag zu mildern.
Ich will sie nicht verletzen.
Aber ich muss.
»Ich …« Ich schlucke die Rasierklingen in meiner Kehle hinunter, schüttele den Kopf und kämpfe gegen die Hitze hinter meinen Augen an. »Miranda, ich will die Scheidung.«
Sie sieht mich ausdruckslos an, so ruhig, dass ich mich frage, ob sie mich überhaupt gehört hat. Meine Hände zittern. Mein Herz braucht gleich eine Reanimation.
»Was?«, flüstert sie endlich ungläubig.
Für einen Außenstehenden führen wir eine glückliche Ehe. Doch wir haben beide gewusst, dass das kommen würde. Vielleicht hat sie den Auslöser nie gesehen, aber sie hat gewusst, dass es kommen würde. Sie muss es gewusst haben.
»Wir sind doch beide schon lange sehr unglücklich«, erkläre ich.
»Ist das dein Ernst?«, fragt sie schnell. »Willst du dich wirklich scheiden lassen?«
»Miranda.« Ich lecke mir die Lippen. »Du musst doch gewusst haben, dass das passieren würde. Wenn nicht von meiner Seite, dann von deiner.«
»Wie kannst du es wagen«, sagt sie, stößt barsch meine Hände weg und steht auf. »Wie kannst du es wagen, mir so was zu unterstellen? Ich war glücklich … ich war gerade … ich war gerade …«
Sie schüttelt heftig den Kopf und durchquert das Wohnzimmer. »Nein«, sagt sie und lehnt sich gegen den Kamin. »Nein, ich werde mich nicht scheiden lassen. Ich werde dich nicht gehen lassen. Du kannst mich nicht verlassen. Du … Brigs McGregor wirst Miranda Harding McGregor nicht verlassen. Ohne mich bist du nichts.«
Ich lasse ihre Worte an mir abprallen, obwohl mein Glaube an sie zu dieser Situation geführt hat. »Miranda«, sage ich leise, und ihr Name klingt irgendwie fremd für mich, so wie es manchmal passiert, wenn man ein Wort zu oft wiederholt. »Bitte.«
»Nein!«, schreit sie, und ich zucke zusammen, hoffe, dass sie Hamish nicht weckt. »Ich weiß nicht, was dich auf diesen dummen Gedanken gebracht hat, aber eine Scheidung ist nicht die Lösung. Das ist nur … irgend so ein Hirngespinst von dir. Du bist unglücklich mit deiner Arbeit. Du fühlst dich nicht wie ein Mann. Du funktionierst nicht wie ein Mann.«
Ein Schlag unter die Gürtellinie. Ich hätte wissen müssen, dass das ihre erste Verteidigungsstrategie sein würde. Unsere Probleme im Bett, die wir seit dem letzten Jahr haben. Ich kann es ihr nicht verdenken.
»Nein«, sagt sie noch mal. »Ich kann damit leben. Und wenn ich kein weiteres Kind bekomme, ist das auch in Ordnung. Aber meine Familie … mein Ruf … dazu wird es nicht kommen. Wir haben ein gutes Leben, Brigs. Dieses Haus. Sieht dir dieses Haus an.« Sie gestikuliert wild mit den Armen, ihre Augen glänzen wie im Fieber. »Sieh dir das alles an. Wir haben alles. Die Leute sehen zu uns auf. Sie beneiden uns. Warum solltest du das wegwerfen wollen?«
Mein Herz rutscht mir bis in den Magen und beginnt zu brennen. »Bitte«, sage ich leise, denn ich will nicht, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt, aber wenn es sein muss, dann muss es eben sein. »Ich bin nicht … ich will dich nicht verletzen. Aber ich liebe dich nicht mehr. Das ist die Wahrheit, und es tut mir leid. Es tut mir so leid.«
Sie blinzelt, als hätte ich sie geschlagen. Dann sagt sie: »So? Welches verheiratete Paar liebt sich noch? Sei realistisch, Brigs.«
Jetzt bin ich überrascht. Ich runzele die Stirn. Ich hätte nicht erwartet, dass sie so um uns kämpft. Um eine lieblose Ehe, die für sie okay ist.
»Wir bekommen das wieder hin«, sagt sie schließlich, ihre Stimme ist wieder unheimlich ruhig. »Das ist nur ein kleineres Problem. Wir bekommen das hin. Du wirst mich wieder lieben, und wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Es ist okay. Niemand muss das erfahren. Wir lieben beide unseren Sohn, und das reicht. Willst du nicht, dass er mit einem Vater aufwächst, mit einer kompletten Familie? Weißt du nicht, dass eine Scheidung ihn kaputt machen würde? Ist es das, was du für ihn willst?«
Es ist, als würde mir ein Eispickel in die Brust gerammt, Kälte breitet sich in mir aus. Denn natürlich, natürlich will ich das für ihn. Genau das hat mich immer wieder zurückgehalten. Doch Kinder spüren es, wenn ihre Eltern unglücklich sind. Hamish verdient etwas Besseres als eine von Angst überschattete Kindheit.
»Getrennte Eltern sind besser als Eltern, die unglücklich miteinander sind«, sage ich, flehe ich sie an. »Du weißt das. Hamish ist so klug, so klug. So intuitiv. Kinder bekommen so viel mehr mit, als wir denken.«
Ihre Augen verengen sich. »Ja? Aus welchem Selbsthilfebuch hast du das denn geklaut? Verdammt, Brigs. Hör dir doch einmal selbst zu. Was für einen Unsinn du redest.«
»Möchtest du, dass er in einem Haus aufwächst, in dem ich seine Mutter nicht liebe? Ist es das, was du willst? Meinst du nicht, dass er das mitbekommen wird? Dass er das wissen wird?«
»Das wird er nicht«, sagt sie vehement. »Hör mit den Entschuldigungen auf.«
Ich stehe auf und hebe die Hände, fühle mich total hilflos. Ich habe höllische Schuldgefühle. »Das sind keine Entschuldigungen. Das ist die Wahrheit.«
»Ich scheiß auf deine Wahrheit, Brigs«, blafft sie.
Wieder donnert es. Ich bete, dass der Donner unseren Streit übertönt, dass Hamish immer noch selig schläft und nicht mitbekommt, dass sich seine Zukunft gerade verändert. Nicht zum Schlechten, bitte, lieber Gott, nicht zum Schlechten. Nur verändert.
Sie geht zu dem alten Barwagen hinüber und schenkt sich aus dem Dekanter ein Glas Scotch ein, wie eine Heldin aus einem Hitchcock-Film. Spielt ihre Rolle.
Sieht sie nicht, wie müde ich bin, so zu tun, als ob?
Wird sie nicht auch langsam müde?
»Willst du auch einen?«, fragt sie mich über die Schulter, fast kokett, das Glas in den manikürten Händen. Ihr Vater hat uns die Gläser und den Dekanter zur Hochzeit geschenkt.
Ich schüttele den Kopf, versuche, mich zu beruhigen.
Sie kippt den Scotch hinunter. »Wie du willst. Dann trinke ich deinen mit.«
Sie schenkt noch ein Glas ein, hält es grazil in der Hand und geht zur Couch hinüber, wo sie sich mir gegenübersetzt. Sie schlägt die Beine übereinander und sieht zu mir hoch, wirft den Kopf zurück, sodass ihr eine Welle blonden Haars in die Stirn fällt. Sie hat ihre Gefühle wieder im Griff, tut und handelt wieder so als ob, als würde dadurch alles in Ordnung kommen.
»Du bist ein Idiot, Brigs. Das bist du immer gewesen. Aber ich vergebe dir. Wir alle entscheiden uns mal falsch.«
Ich seufze tief und schließe die Augen. Sie begreift es einfach nicht.
»Die Leute entlieben sich dauernd«, fährt sie fort, trinkt das Glas halb aus und stellt es zurück auf den Glastisch neben der Couch. Das Klacken ist furchtbar laut in diesem Zimmer, das immer leerer zu werden scheint. »Das ist eine Tatsache. Eine sehr traurige Tatsache. Aber du kannst dich wieder verlieben. Ich werde mir mehr Mühe geben. Das werde ich wirklich. Ich werde alles tun, damit du bleibst. Das weißt du. Du weißt, wie ich sein kann. Wenn ich etwas einmal habe, lasse ich es nicht mehr los. Ich kämpfe. Und ich halte fest, was mir gehört.«
Ich weiß das. Deshalb muss ich ihr die Wahrheit sagen. Die schreckliche Wahrheit. Denn nur dann wird sie es begreifen. Nur dann wird sie verstehen, was ich meine.
Ich wünschte, ich müsste das nicht tun.
»Es tut mir so leid«, flüstere ich.
»Ich vergebe dir.« Sie trinkt ihren Scotch aus, wischt sich mit der Hand über die Lippen, ohne den Lippenstift zu verschmieren.
»Es tut mir so leid«, sage ich noch mal und merke, wie sich Tränen hinter meinen Augen sammeln. Ich schüttele heftig den Kopf. »Die Wahrheit ist die … ich liebe jemand anderen. Ich habe mich in eine andere Frau verliebt.«
So.
Jetzt ist es heraus.
Und es trifft sie wie ein Ziegelstein.
Ihr Kopf zuckt zurück, ihre Augen werden groß vor Verwirrung. Vor Furcht. Vor Angst. »Was?«, ruft sie. Sie starrt mich an, die Wut baut sich langsam auf, bis sie aus ihr herausbricht. »In wen? In wen? Sag mir verdammt noch mal, in wen?«
»Das spielt keine Rolle«, sage ich, aber sie ist bereits auf den Beinen, grinst mich höhnisch an, ihr Gesicht ist rot und verzerrt. Unfähig, weiter so zu tun, als ob.
»Sag es mir!«, schreit sie, greift sich an den Kopf, die Zähne entblößt, die Augen wild. »Sag es mir! Ist es jemand, den ich kenne? Susan? Carol?«
»Es ist niemand, den du kennst, Miranda. Es ist einfach passiert, ich …«
»Fick dich!«, schreit sie wieder.
»Bitte. Hamish schläft.«
»Oh, fick dich!« Sie hämmert mit den Fäusten auf meine Brust ein und stößt mich weg. »Fick dich, dass du mich lächerlich gemacht hast. Was ist das für eine Frau, so ein junges Flittchen? Bekommst du ihn bei ihr hoch? Ha, hat sie dein Problem gelöst?«
»Ich habe nie mit ihr geschlafen«, erkläre ich ihr schnell.
»Oh, Scheiße!«, schreit sie. »Verdammte Scheiße. Brigs. Brigs, das kann nicht dein Ernst sein. Du liebst eine andere.« Sie schüttelt den Kopf, spricht mit sich selbst. »Du, ausgerechnet du. Der Herr Professor. Der ruhige Mr. McGregor. Nein. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es verdammt noch mal nicht glauben.«
»Ich weiß, dass es schwer ist, das zu hören.«
Klatsch.
Sie schlägt zu. Fest.
Noch einmal.
Und noch einmal.
Erst auf die eine Seite und dann auf die andere, und ich halte ihr die Wange hin, weil ich es verdient habe. Ich habe gewusst, dass das kommen würde, hätte sie anders reagiert, würde ich die Frau, mit der ich verheiratet bin, nicht kennen.
»Du Arsch! Du Wichser!« Sie versetzt mir einen weiteren Stoß und rennt durch das Zimmer zum Barwagen. Sie greift nach dem Dekanter mit dem Scotch, trinkt ein paar Schlucke direkt daraus, dann beginnt sie zu husten und spuckt etwas von dem Getrunkenen aus.
»Miranda, bitte.«
»Du bist so widerwärtig!«, kreischt sie, als sie wieder Luft bekommt. »Du pathetisches kleines Arschloch! Du hast mit einer anderen Frau geschlafen. Du …«
»Das habe ich nicht«, schreie ich, während ich die Arme hochreiße. »Ich habe nie mit ihr geschlafen, bitte, glaub mir das.«
»Und selbst wenn ich dir glauben würde, meinst du, dass dir das einen Freibrief gibt?« Sie spuckt die Worte fast aus. »Liebe ist eine Entscheidung, Brigs, und du hast dich hierfür entschieden. Du hast dich entschieden, mich nicht zu lieben, und du hast dich entschieden, sie zu lieben, diese verdammte Hure. Irgend so ein Nichts. Du hast dich entschieden, unser verdammtes Leben zu ruinieren!« Mit diesen Worten greift sie nach dem Dekanter und wirft ihn nach mir. Ich ducke mich gerade noch rechtzeitig, sodass er gegen den Schrank hinter mir kracht und in tausend Stücke zerbricht.
»Mami?«, wimmert Hamish von der Tür aus und reibt sich die Augen.
Verdammt!
Ich wirbele herum, versuche zu lächeln. »Mami geht es gut«, sage ich zu ihm. »Geh wieder schlafen, Kumpel.«
»Stürmt es draußen?«, fragt er und geht auf die Scherben zu.
»Hamish!«, schreie ich und strecke die Hände aus, um ihn aufzuhalten.
Er bleibt stehen, bevor er in die Scherben tritt, und blinzelt mich an. In seiner Gegenwart hebe ich sonst nie die Stimme. Doch bevor ich ihn hochnehmen kann, kommt Miranda durch das Zimmer gerannt und packt ihn am Arm.
»Komm, Baby. Wir gehen. Wir gehen«, sagt sie und zieht ihn aus dem Wohnzimmer in die Diele.
Ich laufe ihnen hinterher und sehe gerade noch, wie Miranda nach ihren Autoschlüsseln und nach ihrem Mantel greift. Hamish weint inzwischen, und sie nimmt ihn auf den Arm.
»Was tust du da?«, rufe ich und stürme hinter ihnen her.
Schnell rennt sie aus dem Haus in den Regen. Ich bin direkt hinter ihr, meine nackten Füße versinken in dem kalten Matsch, und ich rutsche fast aus, während sie auf den Sedan zusteuert.
Das kann nicht ihr Ernst sein. Das kann sie nicht tun.
Als sie Hamish auf den Beifahrersitz setzt und die Tür schließt, bekomme ich ihren Arm zu fassen. Der Kindersitz ist nicht mal da – er ist im Haus, das Dienstmädchen hat ihn sauber gemacht, nachdem Hamish heute Nachmittag seine Milch darüber verschüttet hat.
»Du kannst ihn nicht mitnehmen!«, rufe ich ihr über den Sturm und Regen hinweg zu.
»Lass mich los!«, schreit sie und versucht, sich freizumachen. »Ich nehme ihn dir weg, du Mistkerl.«
»Nein, hör zu!« Ich greife fester nach ihrem Arm.
Hamish jammert im Auto, der Regen läuft an den Scheiben hinunter.
»Denk einmal nach. Du hast den Scotch getrunken. Draußen stürmt es furchtbar, und Hamish braucht seinen Kindersitz. Hör mir einfach zu!«
»Wenn du mich nicht gehen lässt«, schäumt sie vor Wut, »werde ich jedem erzählen, dass du mich geschlagen hast, und du wirst deinen Sohn nie wiedersehen.« Sie zieht stärker, und meine Finger graben sich automatisch in ihre weiche Haut. »Du kannst deine Scheidung haben, Brigs. Aber ihn bekommst du nicht.«
»Miranda, bitte. Lass mich den Kindersitz holen. Ich weiß, dass du wütend bist, aber lass mich ihn holen! Lass mich ihn einfach holen.« Inzwischen sind wir beide bis auf die Haut durchnässt, meine Füße versinken langsam im Matsch. Ich habe das Gefühl, von meiner eigenen Verzweiflung begraben zu werden. »Bitte, okay? Bitte.«
Sie starrt mich an, ängstlich, aufgebracht. Dann nickt sie, während ihr der Regen das Gesicht hinunterläuft.
Ich habe keinen Plan. Aber ich weiß, dass ich sie nicht von hier wegfahren lassen werde, nicht in ihrem hysterischen Zustand, nicht bei diesem Wetter. Ich sehe Hamish an. Er weint. Sein Gesicht ist rosa in dem trüben Licht, durch den Regen fast nicht zu erkennen.
»Nur einen Moment«, sage ich. »Daddy ist gleich wieder da.«
Ich drehe mich um, renne zum Haus und frage mich, ob ich die Polizei anrufen muss, ob sie sich in der Zeit, während ich den Kindersitz hole, beruhigt. Ob …
Das Geräusch der sich öffnenden Autotür.
Ich halte inne und wirbele herum.
Sie ist auf ihrer Seite eingestiegen und knallt die Tür zu.
»Nein!«, schreie ich. Ich versuche zu rennen, rutsche aus und falle hin. Matsch spritzt um mich auf. »Miranda, warte!«
Das Auto fährt in dem Moment an, als ich auf die Füße komme, und ich spüre die Kälte und den Regen nicht, höre weder den Wind noch den Motor, ich spüre nur Entsetzen. Ungefiltertes, reines Entsetzen.
Die Räder drehen sich einen Moment wütend, bevor das Auto rückwärts die Einfahrt hinunterrollt.
Ich renne hinter ihr her.
Ich erreiche das Auto und schlage mit den Händen auf die Motorhaube, starre sie durch die arbeitenden Scheibenwischerblätter an. Sehe ihr Gesicht. Ihre Demütigung. Ihre Panik. Ihre Schande.
Sein Gesicht. Verzweifelt. Verwirrt. Die perfekte Mischung aus uns beiden. Den perfekten kleinen Jungen.
Ihr Gesicht. Sein Gesicht.
Die Scheibenwischerblätter wischen sie klar.
Sie schaltet und gibt Gas, genug, dass mir der Kühlergrill in die Hüfte stößt. Ich springe schnell nach rechts, um nicht überfahren zu werden.
Ich rolle auf dem Boden zur Seite, aus dem Weg, und kämpfe mich wieder auf die Füße, als Miranda wendet und die Straße hinunterrast.
»Miranda«, schreie ich. Panik erfasst mich für eine Sekunde, lässt mich wie erstarrt auf der Stelle stehen bleiben, hilflos, hoffnungslos.
Aber das bin ich nicht.
Ich muss ihnen folgen.
Ich renne zurück zum Haus, greife nach meinem Handy und den Schlüsseln zu dem alten Aston Martin, renne wieder hinaus und springe ins Auto.
Das verdammte Teil braucht ein paar Sekunden, um anzuspringen, und ich werfe einen Blick auf mein Handy und frage mich, ob ich die Polizei anrufen soll. Ich weiß nicht mal, ob sie zu viel getrunken hat, um noch zu fahren, und ich will ihr keinen Ärger einhandeln, doch wenn sie sie anhalten können, bevor ich das kann, bevor sie sich und Hamish vielleicht verletzt, dann sollte ich das tun. Ich muss etwas tun.
Ich weiß, dass sie zu ihren Eltern will, zu den Hardings, über die Brücke nach St. Davids Bay. Dort fährt sie immer hin. Vielleicht sollte ich ihre Mutter anrufen. Damit sie nach ihr Ausschau halten. Mrs. Harding wird mich dafür noch mehr hassen, aber nicht so sehr, wie sie mich hassen wird, wenn Miranda ihnen erzählt, was ich getan habe.
Das Auto springt endlich an. Ich gebe Gas und sause die Einfahrt hinunter auf die Hauptstraße, eine kurvenreiche, sich windende Verkehrsader, die zur M8 führt.
»Verdammt!«, schreie ich und schlage wiederholt mit der Faust auf das Lenkrad, während der Selbsthass mich zu ersticken droht. »Verdammt!«
Warum habe ich mir ausgerechnet diesen Abend ausgesucht, um ihr alles zu sagen?
Warum musste ich nach London fahren?
Warum musste ich mich hierfür entscheiden?
Warum hat es mich getroffen?
Ich stelle mir eine Million Fragen, hasse mich selbst, weil ich zugelassen habe, dass sich alles so entwickelt hat, und wünsche mir sehnlichst, anders gehandelt zu haben.
Ich frage mich Dinge, auf die ich nur eine Antwort habe: weil ich Natasha liebe.
Es läuft immer wieder auf diese schreckliche Wahrheit hinaus.
Ich liebe sie.
So sehr.
Zu sehr.
Genug, um alles wegzuwerfen.
Weil ich die Lüge nicht länger leben kann.
Aber die Wahrheit tut nicht nur weh, sie zerstört.
Die Straße biegt scharf nach links ab, als sie am Braeburn Pond entlangführt und in dem strömenden Regen, in dem die Scheibenwischer immer schneller arbeiten, hätte ich es fast nicht gesehen.
Doch das nicht zu tun ist unmöglich.
Der kaputte Zaun am Straßenrand.
Der Dampf, der jenseits der Böschung aufsteigt.
Dort, wo ein Auto von der Straße abgekommen ist.
Ein Auto ist von der Straße abgekommen.
Ich trete auf die Bremse, das Auto gerät kurz ins Schleudern, und ich fahre an den Rand.
Ich verbanne die Gedanken aus meinem Kopf.
Die Gedanken, die mir sagen, dass sie das sind.
Dass sie das sein können.
Aber falls sie es sind, musst du sie retten, sagt ein Gedanke.
Ich kann sie retten.
Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, die Panik wegzuschieben, aber ich schaffe es.
Ich steige aus dem Auto, der Regen peitscht mir ins Gesicht.
Die Luft riecht wie verbrannter Asphalt.
Der Teich wird von dem Sturm aufgewühlt.
Und als ich am Straßenrand stehe, sehe ich dort unten den schwachen Schein von Scheinwerfern, ein falsch gesetztes Signalfeuer in der Dunkelheit.
Ich sehe die Böschung hinunter.
Die Welt um mich herum beginnt sich zu drehen.
Eine Weide hat die Motorhaube des Sedan zertrümmert, dieselbe Motorhaube, auf der ich vor Minuten noch die Hand hatte, als ich sie angefleht habe, nicht zu fahren.
Das Auto steht schräg. Stützt sich auf die kaputte Front.
Dampf steigt auf.
Und doch habe ich noch Hoffnung.
Ich muss Hoffnung haben.
Ich schreie, gebe Laute von mir, die ich nicht kontrollieren kann. Vielleicht rufe ich nach ihnen, vielleicht rufe ich um Hilfe. Ich stolpere die Böschung hinunter zu dem Auto.
Bete.
Bete.
Bete.
Dass ihnen nichts passiert ist.
Nichts passiert ist.
Die Windschutzscheibe ist total zertrümmert, das gezackte Glas rot befleckt.
Dümmlich starre ich das leere Auto an.
Dann drehe ich den Kopf.
Zu der Stelle vor der Motorhaube.
Und dem Gras zwischen dem Auto und dem Teich.
Wo zwei Körper liegen, in der dunklen Nacht.
Zwei Körper, ein großer und ein kleiner.
Beide verletzt.
Beide bewegungslos.
Ein Moment der Klarheit überkommt mich, als die Wahrheit sich setzt.
Meine Wahrheit.
Diese reale Wahrheit.
Und in dem Moment möchte ich nach dem zerklüfteten Stück Glas greifen, das zu meinen Füßen liegt.
Es an meine Kehle führen.
Und es beenden, bevor ich es fühlen kann.
Doch das wäre der Ausweg des Feiglings.
Also stolpere ich vorwärts.
Erbreche mich auf mein Hemd.
Mein Herz ist gelähmt.
Ich weine.
Schreie.
Gebe Geräusche von mir, wie sie Tiere von sich geben.
Ich stolpere an Miranda vorbei.
Zu Hamish.
Falle auf die Knie.
Und wiege meine Wahrheit in den Armen.
Und ich fühle es.
Ich werde nie aufhören, es zu fühlen.
Den Regen.
Den Tod.
Das Ende von allem.
Meine Welt wird schwarz.
Und bleibt so.
Kapitel 1
Brigs
Edinburgh – Heute
Plopp.
Der Korken von einer Flasche mit alkoholfreiem Sekt fliegt durch die Luft. Das Zeug ist kein Dom Pérignon, doch wegen meines Bruders und seines Entzugs muss es reichen. Außerdem kommt es nicht darauf an, was wir trinken, sondern was wir feiern.
»Herzlichen Glückwunsch, Bruderherz«, sage ich zu Lachlan, greife nach seiner massiven Schulter und drücke sie fest. Ich strahle ihn an, bin mir meines allzu breiten Lächelns durchaus bewusst, doch ich bin glücklicher, als ich es seit Langem war. Vielleicht liegt es an dem echten Champagner, den ich mit unserer Mutter getrunken habe, bevor Lachlan und seine Freundin gekommen sind.
Moment. Nicht seine Freundin.
Kayla ist jetzt seine Verlobte. Und wenn man mich fragt, wurde es auch langsam Zeit.
Lachlan nickt, lächelt matt in akuter Verwirrung, die in mir nur den Wunsch aufkommen lässt, ihn noch mehr zu verwirren. Das ist schließlich der Job eines älteren Bruders, und da unsere Familie ihn adoptiert hat, als ich schon mit der Highschool fertig war, habe ich diese wichtigen Jahre der Hänseleien und Kabbeleien verpasst, die den meisten Geschwistern vergönnt sind.
Meine Mutter kommt zu uns und schenkt den gefakten Sekt erst in unsere Gläser und dann in Kaylas Glas, die brav an Lachlans Seite steht. Wie gewöhnlich hält sie Körperkontakt zu ihm – ihre Hand ruht auf seinem Kreuz –, und ihre Wangen sind vor Rührung gerötet. Ich wünsche mir fast, dass sie in Tränen ausbricht, damit ich mich später über sie lustig machen kann. Sie ist so ein quirliges Mädchen mit einer so riesengroßen Klappe, dass sich auf ein wenig Verletzlichkeit wundervoll herumreiten ließe.
»Auf Lachlan und die zukünftige Mrs. McGregor«, sagt meine Mutter und prostet dem glücklichen Paar zu. Bevor sie mit den anderen anstößt, sieht sie zu meinem Vater hin, der etwas abseits steht, um Fotos zu machen. Er liegt schon die ganzen letzten Minuten auf der Lauer. »Jetzt beeil dich und komm zu uns, Donald.«
»Okay«, sagt er, macht noch ein Foto von uns mit erhobenen Gläsern, und gesellt sich zu uns. Sie gibt ihm sein Glas, und wir stoßen an.
»Willkommen in der Familie, Kayla«, sage ich aufrichtig. Ich sehe schnell Lachlan an, bevor ich hinzufüge: »Ich habe ihn von Tag eins an genervt, dir einen Antrag zu machen, weißt du. Ich kann nicht fassen, dass er so lange gebraucht hat, vor allem bei einem Mädchen wie dir.«
Die Falte zwischen Lachlans Brauen wird tiefer, sein Kiefer spannt sich. Ich schätze, ich bin der Einzige, der es wagt, ihn zu ärgern, ohne Angst zu haben. Mein Bruder ist ein Riese von einem Mann, sein Körper scheint nur aus Bart, Muskeln und Tattoos zu bestehen, und er ist vor Kurzem zum Kapitän des Rugbyteams von Edinburgh ernannt worden. Du willst dich nicht mit ihm anlegen, es sei denn, dein Name ist Brigs McGregor.
»Brigs«, mahnt meine Mutter.
»Oh, ich weiß«, sagt Kayla ruhig, bevor sie einen Schluck von ihrem Sekt trinkt. »Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte meine Ringe nicht auf der Anrichte liegen gelassen, um es ihm leichter zu machen, die richtige Größe zu finden.«
»Gutes Mädchen«, sage ich und stoße noch mal mit ihr an, und obwohl mich plötzlich eine flüchtige Erinnerung daran streift, wie ich einen Ring für Miranda aussuche, schlucke ich sie mit den Perlen im Sekt hinunter. Ich habe gelernt, so mit der Vergangenheit umzugehen – man akzeptiert sie und macht weiter.
Man macht weiter.
Gestern waren wir alle bei dem Rugbyspiel zwischen Edinburgh und Munster und haben uns die Ärsche abgejubelt. Natürlich waren wir nicht nur da, weil Lachlan gespielt hat. Er hatte uns vor ein paar Wochen gesagt, dass er ihr während des Spiels einen Antrag machen wollte und es schön wäre, wenn die Familie da wäre. Obwohl ich letzte Woche erst mit dem Unterrichten angefangen habe, bin ich Freitagabend von London nach Edinburgh geflogen.
Es ist mir zwar schwergefallen, nichts von seinem Vorhaben zu verraten, aber ich bin froh, dass ich den Mund gehalten habe, denn dadurch ist der Moment noch großartiger geworden, vor allem, als Lachlan den Teil mit dem Antrag erst mal ansatzweise vermasselt hat. Trotzdem war es verdammt romantisch.
»Das ist so aufregend«, kreischt meine Mum. Ich glaube, ich habe sie seit Langem nicht mehr vor Vergnügen kreischen hören. Sie stellt ihr Glas auf den Couchtisch und klatscht in die Hände, wobei ihre Armbänder klirren. »Habt ihr schon darüber nachgedacht, wo die Hochzeit stattfinden soll? Und wann? Und was für ein Kleid du tragen willst, Kayla? Du wirst wunderschön aussehen, meine Liebe.«
Ich würde wirklich gern weiterlächeln. Wirklich. Aber das Lächeln schwächelt bereits.
Weitermachen. Weitermachen. Weitermachen.
Die Erinnerungen, wie meine Mutter und Miranda nach einem Kleid gesucht haben. Wie lange sie gebraucht haben – Monate –, bevor sie das perfekte gefunden hatten. Wie Miranda dieses Kleid zu Hause weggepackt hat, es im Kleiderschrank versteckt und mir verboten hat, einen Blick darauf zu werfen.
Ich habe Wort gehalten. Und an unserem Hochzeitstag hat es mir wirklich den Atem verschlagen.
Ich wünschte, diese Erinnerung wäre rein. Ich wünschte, ich könnte trauern wie jeder normale Mann. Den Kummer spüren und nicht die Scham.
Alles ist meine Schuld.
Der Gedanke jagt durch meinen Kopf, ein Blitz im Gehirn.
Alles ist meine Schuld.
Ich schließe die Augen und atme langsam durch die Nase, erinnere mich, was mein Therapeut mir beigebracht hat.
Weitermachen. Weitermachen. Weitermachen.
Es war nicht meine Schuld.
»Brigs?«, höre ich meinen Vater sagen. Ich öffne die Augen und sehe, dass er mich neugierig betrachtet. Er lächelt mir schnell ermutigend zu. »Alles in Ordnung?«, fragt er leise, gedämpft, und dafür bin ich ihm dankbar. Meine Mutter und Kayla machen Hochzeitspläne und haben nichts bemerkt.
Lachlan dagegen beobachtet mich. Er kennt meine Auslöser, so wie ich seine kenne. Doch während wir ihm zuliebe alkoholfreien Sekt trinken können, können wir nicht mir zuliebe das verdammte Leben ignorieren. Wir können nicht so tun, als gäbe es Liebe und Heirat und Babys nicht, nur weil mir all das genommen wurde.
Alles ist meine Schuld.
Ich atme aus und setze ein Lächeln auf. »Alles in Ordnung«, sage ich zu meinem Vater. »Ich schätze, ich bin ein bisschen gestresst, wegen meiner Seminare morgen. Das ist die erste richtige Uniwoche. Die allererste zählt nicht wirklich. Da haben alle entweder keine Peilung oder sind verkatert.«
Er lacht leicht. »Ja, ich erinnere mich an diese Tage.« Er trinkt den Sekt aus und wirft einen Blick auf seine Uhr, wobei er es schafft, ein paar übrig gebliebene Tropfen auf dem Teppich zu verkleckern. »Wann geht dein Flug heute Abend?«
»Um zehn«, antworte ich. »Ich sollte wohl besser hochgehen und sehen, ob ich alles habe.«
Ich gehe zur Treppe, als Lachlan mir hinterherruft: »Ich fahre dich zum Flughafen.«
»Mach dir keine Mühe«, sage ich. Der intensive Blick seiner Augen verrät mir, dass er reden will. Das heißt, er will, dass ich rede. Im letzten Jahr, in dem ich meinen neuen Job am Kings College angetreten habe und nach London gezogen bin, hat Lachlan dafür gesorgt, dass ich zurechtgekommen bin, dass es mir gut gegangen ist. Vielleicht weil ich ihm geholfen habe, Hilfe bei seinem Alkohol- und Drogenproblem zu bekommen, vielleicht weil er mich ganz allgemein klarer sieht, als Bruder und als Freund.
Unser Verhältnis war immer ein bisschen angespannt und schwierig, aber zumindest ist er jetzt einer der wenigen Leute, auf die ich zählen kann.
»Es macht keine Mühe«, sagt er schroff, die Lachlan-Variante von ausdauernder Liebe. »Ich setze Kayla zu Hause ab, dann bring ich dich hin.«
Ich atme aus und nicke. »Klar, danke.«
Ich gehe schnell nach oben und versichere mich, dass meine Übernachtungstasche gepackt ist. Wenn ich in Schottland bin, schlafe ich gewöhnlich in meinem alten Zimmer bei meinen Eltern. Mein altes Bett anzusehen, geschweige denn, darin zu schlafen, gibt mir das Gefühl, furchtbar alt zu sein, aber es hat auch etwas Tröstliches.
Meine Wohnung in Edinburgh Mitte ist zurzeit vermietet, sodass ich dort nicht bleiben kann. Irgendwann werde ich sie wahrscheinlich verkaufen. Ich habe meine Anstellung als Professor für Filmwissenschaft an der Universität mit Vorsicht und ohne echte Langzeitverpflichtung angenommen. Ich habe mir eine schöne Wohnung in Marylebone gemietet, doch solange ich nicht das Gefühl habe, dass dieser Job von Dauer ist und ich für längere Zeit dort bleiben werde, bin ich vorsichtig, was mein neues Leben angeht.
»Wie geht es Winter?«, fragt Lachlan mich später, nachdem ich mich von meinen Eltern und Kayla verabschiedet habe und wir in seinem Range Rover sitzen, an dem auf der A 90 die Lichter vorbeifliegen.
»Er kann einen ganz schön auf Trab halten«, sage ich und trommele mit den Fingern gegen die Türkante. »Und manchmal ist er ein richtiger Scheißkerl. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich meine Nachbarn beschweren werden, wenn er noch mal mitten in der Nacht bellt.«
»Er ist nicht mal ein Jahr alt«, sagt Lachlan. »Gib dem Ganzen Zeit. Er ist noch ein Welpe.«
»Ja. Eine richtige Scheißmaschine.«
Lachlan ist ein Hundeexperte und Hunderetter. Wenn er sich nicht gerade als Spitzenrugbyspieler betätigt, betreibt er eine Auffangstation für Hunde, insbesondere für Pitbulls, und versucht, das Bewusstsein für sie zu schärfen. Kayla arbeitet für ihn, und bis jetzt hat sich die Organisation – Ruff Love – ganz gut bewährt. Er ist der Grund, weshalb ich Winter adoptiert habe. Letztes Weihnachten, als er noch ein Welpe war, habe ich ihn während eines Schneesturms bei dem Haus unseres Großvaters in Aberdeen gefunden, wo er sich in der Scheune der Nachbarn versteckt hatte. Da die Nachbarn den Hund nicht haben wollten, gab es nur die beiden Möglichkeiten: dass ich den weißen Flaumball nahm oder dass Lachlan ihn in seine Auffangstelle brachte. Der verdammte Hund ist mir ans Herz gewachsen, und inzwischen kann er eine ganz schöne Nervensäge sein und sieht aus, als wäre er am Set von Games ofThrones herumgelaufen. Trotzdem wäre das Leben ohne ihn ganz schön langweilig, obwohl ich extra für ihn eine Hundesitterin engagieren muss, bei der er seine geballte Energie loswerden kann, wenn ich in der Uni bin.
»Wenn dir irgendwas hiervon zu schwierig wird … kannst du mir einfach sagen, dass ich die Klappe halten soll, das weißt du. Ich verstehe das«, sagt Lachlan kurz darauf.
Ich sehe ihn an, sein Gesicht wird halb von den Schatten verschluckt. »Wenn mir was zu schwierig wird?«
Er räuspert sich und sieht mich abwartend an. »Du weißt schon. Das mit Kayla und mir. Dass wir heiraten. Ich weiß, dass das nicht leicht sein kann … du und Miranda …«
Ich ignoriere die eiserne Faust in meiner Brust und versuche, die Schultern zu entspannen. »Sie ist tot, Lachlan. Es bringt nichts, so zu tun, als wäre das nicht so, und um den heißen Brei herumzureden.« Ich blicke aus dem Fenster, verliere mich in der Dunkelheit und dem Schein der vorbeisausenden Scheinwerfer. »Das Leben geht immer weiter, das habe ich gelernt, und ich bin dabei, meinen Frieden damit zu machen. Nur weil einige Dinge für mich vorbei sind, heißt das nicht, dass sie für alle anderen auch vorbei sind. Du wirst Kayla heiraten, und die Hochzeit wird wunderschön werden. Und dann wird sie ein paar Monsterbabys zur Welt bringen, da bin ich mir sicher. Ich will auf keinen Fall, dass wir nicht darüber reden, ich will für dich da sein und mich darüber freuen. Das Leben geht weiter, und auch ich werde weiterleben. Das werde ich. Dein Leben und deine Liebe und dein Glück hören nicht auf, nur weil ich all das verloren habe. Weder Miranda noch Hamish hätten das gewollt.«
Schweigen breitet sich im Auto aus, und ich kann spüren, wie er mich auf seine entnervende Weise ansieht. Ich drehe mich nicht zu ihm um. Ich lasse meine Worte einfach stehen.
»Aber es ist nicht nur das«, sagt er vorsichtig. »Ich sehe es in deinen Augen, Brigs. Das habe ich immer getan. Du wirkst gequält. Und das nicht von Traurigkeit oder Kummer. Von Miranda oder Hamish. Du quälst dich selbst. Wann wirst du mir endlich erzählen … warum? Was ist damals wirklich passiert?«
Ich schlucke schwer.
Weitermachen. Weitermachen. Weitermachen.
Scheinwerfer. Straßenlaternen. Alles wird heller. Der Flughafen ist nicht mehr weit.
»Lachlan, ich mochte dich lieber, als du nicht so viel geredet hast«, sage ich und fokussiere die Lichter. Ich konzentriere mich darauf, sie zu zählen, während sie vorbeischwirren und nicht über seine Frage nachzudenken.
Ich höre, wie er sich nachdenklich den Bart kratzt.
»Von Kayla kommen da keine Klagen«, sagt er.
Ich verdrehe die Augen, froh, mich auf etwas anderes konzentrieren zu können. »In den Augen dieser Frau kannst du nichts Falsches tun. Das ist Liebe, Kumpel. Und mal ehrlich, ich freue mich wirklich, dass dir das passiert ist. Du verdienst es von allen am meisten.«
Ein paar Sekunden vergehen. »Du weißt schon, dass wir keine haben werden«, sagt er.
Ich sehe ihn kurz an. »Was werdet ihr nicht haben?«
»Kinder«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Wir haben darüber gesprochen, aber … sie ist nicht scharf darauf, und um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Ein Kind mit meinen Genen … das wäre nicht fair.«
Ich muss sagen, dass ich überrascht bin, das von Lachlan zu hören, schon weil er Kayla so sehr liebt. Andererseits überrascht es mich nicht, wie sie die Sache sieht. Kayla hat den mütterlichen Instinkt einer Klapperschlange. Ich meine das nett.
»Schade«, sage ich, »denn Gene hin oder her, ich glaube, du wärst ein wunderbarer Vater. Ein sehr viel besserer, als ich das jemals war, so viel ist sicher.« Ich seufze und schließe kurz die Augen. Als ich sie wieder öffne, fahren wir vor dem Flughafen vor. »Aber du tust, was für dich richtig ist. Wenn ihr keine wollt, dann bekommt ihr keine. Das Letzte, was die Welt braucht, ist noch ein ungewolltes Kind. Kayla und du, ihr habt eure Hunde und einander und ein sehr volles Leben. Das reicht. Glaub mir.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, Jessica dreht durch, wenn sie das erfährt«, sagt Lachlan. Er nennt unsere Mutter beim Vornamen, wie immer. Er hält vor dem Abflugbereich. »Ich bin ihre letzte Chance auf Enkelkinder.«
»Sie hatte ein Enkelkind«, blaffe ich, die Worte klingen wie Gift. Das Blut rauscht laut in meinen Ohren. »Es hieß Hamish.«
Bilder von Hamish ziehen an mir vorbei. Eisblaue Augen, rötliches Haar. Ein breites Lächeln. »Warum? Warum, Papa?«, hat er unablässig gefragt. Er war erst zwei, als er mir genommen wurde. Heute wäre er fast sechs. Ich habe mich immer auf den Tag gefreut, an dem er in die Schule kommt. Ich wusste, dass seine Neugier ihn zu größeren und besseren Dingen hinführen würde. Obwohl ich Miranda am Ende nicht mehr geliebt habe, habe ich meinen Jungen geliebt. Und selbst als ich so egoistisch war, mir ein anderes Leben für mich zu erträumen, hatte er immer die oberste Priorität.
Es hätte nicht so kommen sollen.
Lachlan sieht mich mit großen Augen und einer vor Reue gerunzelten Stirn an. »Brigs«, krächzt er, »es tut mir leid. Es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint.«
Ich schüttele schnell den Kopf, versuche, den Ärger abzuschütteln. »Alles gut. Mir tut es leid. Ich … ich weiß, was du gemeint hast. Es war ein langer Tag, und ich muss einfach nach Hause und etwas Schlaf bekommen.«
Er nickt und runzelt beschämt die Stirn. »Ich habe es verstanden.«
Ich atme tief durch, dann sage ich bemüht munter: »Okay, Zeit mich der Security-Hölle zu stellen. Danke, dass du mich gefahren hast, Lachlan.« Ich greife nach meiner Tasche auf dem Rücksitz und steige aus.
»Brigs«, sagt er, bevor ich die Tür schließe, und lehnt sich über den Sitz, um mich anzusehen. »Ernsthaft. Pass auf dich auf. Wenn du aus irgendeinem Grund irgendetwas brauchst, ruf mich an.«
Die Faust in meiner Brust lockert sich. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich wünschte, er würde sich nicht so viele Sorgen um mich machen. Ich wünschte, ich würde mich nicht so fühlen, als wäre das nötig.
Ich winke ihm zu und gehe meines Wegs.
❊ ❊ ❊
Sämtliche Radiomoderatoren lassen sich endlos darüber aus, wie wunderbar das Wochenende war, noch einmal ein richtiges Sommerwochenende mit Rekordtemperaturen und sengender Sonne. Natürlich war es auch das Wochenende, an dem ich in Schottland war, und natürlich regnet es in Strömen, als ich mich jetzt für den Montag fertig mache.
Im Dielenspiegel erhasche ich einen Blick auf mich und mustere mich kritisch. Ich trage einen stahlgrauen Anzug, mit einem hellgrauen Hemd darunter und ohne Krawatte. In der vergangenen Woche ging es einzig und allein darum, dass die Studenten sich wohlfühlten – und ich bin in Hemd und Jeans oder T-Shirt und Hose gekommen –, doch diese Woche wird es ernst. Ein paar der Studenten in meinen Seminaren sind in meinem Alter, deshalb sollte ich zumindest so aussehen, als ob ich es auch ernst meine, selbst wenn ich Hundehaare auf den Schultern habe.
Mein Blick wandert zu Winter, der neben der Couch sitzt und mit dem Schwanz auf den Boden klopft, wenn sich unsere Blicke treffen, und wieder zurück zum Spiegel. Im Moment ist er ruhig, doch ich weiß, dass er meine Wohnung in eine Turnhalle verwandeln wird, sobald ich weg bin. Dem Himmel sei Dank für Shelly, meine Hundesitterin. Sie hat ihn auch am Wochenende gehabt und macht einen Wirbel um ihn wie um ein ungebärdiges Kind.
Ich streiche mir das Haar zurück und mustere die grauen Strähnen an meinen Schläfen. Ich trage das Haar inzwischen ziemlich kurz. Glücklicherweise habe ich wieder zugenommen, sodass ich nicht mehr aussehe wie ein Schwächling. Ich gehe fast jeden Morgen ins Fitnessstudio und habe den ganzen Sommer über viel getan, um wieder in Form zu kommen. Endlich scheint es sich auszuzahlen. Nach dem Unfall und meinem darauf folgenden Nervenzusammenbruch (oder meinem mentalen Umweg, wie sie es in meinem alten Job ausgedrückt haben, bevor sie mich haben ziehen lassen; als könnte das, was mir passiert ist, so präzise erklärt werden wie eine Umleitung im Straßenverkehr) habe ich nichts gegessen. Ich habe nicht gelebt. Erst als ich den Mut aufgebracht habe, einen Arzt zu konsultieren, mir Hilfe zu holen und diese auch anzunehmen, habe ich mich wieder aus der Dunkelheit herausgearbeitet.
Ich würde gern sagen, dass ich mich an das alles nur verschwommen erinnere, an die Jahre am unteren Ende der Spirale, wo die Welt um mich herum düster war, wo Schuld und Hass wie Teer an mir klebten. Aber ich erinnere mich lebhaft an alles. Bis ins kleinste, schrecklichste Detail. Vielleicht ist das meine Strafe, sind das meine Fesseln für mein Verbrechen.
Ich weiß, dass es ein Verbrechen war, mich zu verlieben.
Ich verdiene jede Strafe dieser Welt.
Und das Schlimmste von allem ist, dass ich in manchen Nächten, in den dunkelsten, in denen ich fühle, wie allein ich wirklich bin, wie furchtbar meine Entscheidungen die Welt aus den Angeln gehoben haben, an sie denke.
Nicht an Miranda.
Ich denke an sie.
An Natasha.
Ich denke an den Grund, aus dem mein Urteilsvermögen getrübt war, den Grund, aus dem ich mein persönliches Glück über das meiner Familie gestellt habe. Ich denke an das erste Mal, dass ich mich wirklich verliebt habe. Es war kein Stolpern mitten hinein in Luxus und Bequemlichkeit wie mit Miranda. Es war ein Sprung von einer Klippe, ohne Fallschirm, Bungee-Jumping ohne Seil. In dem Moment, in dem ich Natasha gesehen habe, wusste ich, dass ich verloren war und dass mich nichts würde aufhalten können. Man sollte meinen, dass sich Erinnerungen an die Liebe wie das einzig Wahre anfühlen, doch diese Erinnerungen sind anders als die Liebe. Liebe ist gut. Liebe ist gütig. Geduldig. Rein.
Sagt man.
Unsere Liebe war von Anfang an ein Fehler. Ein wunderschöner, dem Leben huldigender Fehler.
Selbst wenn ich es mir zugestehen würde, mich zu erinnern – zu fühlen –, wie es war, ihr in die Augen zu sehen, diese Worte zu hören, die sie einmal leise geflüstert hat, würde mir das nicht guttun. Diese Liebe hat so viel zerstört. Sie hat mich zerstört, und ich habe das willig zugelassen. Um dann alles Gute in meinem Leben zu zerstören.
Die Erinnerungen an die Liebe sind Gift.
Mein Therapeut hat mir gesagt, dass ich sie willkommen heißen muss. Akzeptieren muss, dass sich dauernd Menschen in Menschen verlieben, in die sie sich nicht verlieben sollten, dass ich mitgerissen wurde und einmal im Leben die Kontrolle verloren habe und dass ich mir unabhängig davon nicht die Schuld an Mirandas und Hamishs Tod geben darf. Es war schlechtes Timing. Es war ein Unfall. Jeden Tag lassen sich Menschen scheiden, und es endet nicht so.
Es fällt nur schwer zu glauben, denn nichts davon wäre passiert, hätte ich mich nicht in eine andere Frau verliebt. Es wäre nicht passiert, hätte ich Miranda an jenem Abend nicht gesagt, dass ich mich scheiden lassen wollte. Sie würden noch leben. Und von mir wäre noch mehr übrig als die archaischen Überreste eines Mannes.
Und Natasha ist verloren, selbst wenn die Erinnerungen bleiben. In meinem tiefen, fast schon selbstmörderischen Schmerz habe ich ihr gesagt, dass das mit uns ein Fehler war und das alles unsere Strafe ist. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nie mehr sehen will.
Das ist jetzt vier Jahre her. Sie hat sich daran gehalten.
Ich seufze und betrachte mein Gesicht. Ich sehe gequält aus, genau, wie Lachlan gesagt hat. Meine Augen wirken kälter, eisbergblau, mit dunklen Schatten darunter. Doch Lachlan kennt die Wahrheit nicht, das tut nur mein Therapeut. Für alle anderen ist Natasha ein Geheimnis, eine Lüge.
Ich setze ein Lächeln auf, ein Wolfslächeln, wie mir scheint, strecke die Schultern und verlasse mit Schirm und Aktentasche das Haus.
Meine Wohnung liegt in der Baker Street, direkt gegenüber des Sherlock-Holmes-Museums. Und wenn ich ganz besonders mutlos bin, kann ich Stunden damit verbringen, zu beobachten, wie die Touristen draußen Schlange stehen. Was einer der Gründe ist, weshalb ich mich für diese Wohnung entschieden habe. In meiner Jugend war ich ein großer Fan von Holmes und allem, was Sir Arthur Conan Doyle sich ausgedacht hat. Den Pub nebenan mag ich auch sehr. Er ist großartig, um Frauen abzuschleppen, und wenn sie direkt aus dem Museum kommen, weißt du wenigstens, dass sie etwas im Kopf haben.
Nicht dass ich mehr als ein paar Drinks mit diesen Mädchen kippen würde – ich bin hauptsächlich wegen der Gesellschaft dort. Anschließend ziehen sie betrunken und glücklich ihrer Wege, und ich bin der Gentleman, der Mann, von dem sie ihren Freundinnen texten: »Schottische Männer sind wirklich gut erzogen. Er hat mir einen Drink spendiert, ohne etwas dafür zu erwarten.« Obwohl es manchmal im Schlafzimmer endet. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht bereit bin, mich auf jemanden einzulassen. Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich bin kaum bereit für diesen Job.
Doch, du bist bereit, sage ich mir, während ich dem Regen ausweiche und zur Tube hinuntergehe, den Übergang zu meiner Linie nehme. Diese Woche werde ich die Ziele für dieses Semester abstecken; diese Woche werde ich die Studenten wissen lassen, was sie zu erwarten haben. Diese Woche werde ich endlich mit der Arbeit an meinem Buch anfangen: Die tragischen Clowns: komödiantische Leistungen im frühen amerikanischen Kino.
Während meine Gedanken durcheinandergeraten, wird mir bewusst, dass der Zug gleich die Türen schließt. Halbherzig renne ich darauf zu, bevor ich jäh stehen bleibe.
Im Zug ist eine Frau, sie steht mit dem Rücken zu den sich schließenden Türen.
Ich kann sie nur von den Schultern aufwärts sehen.
Ihr Haar ist dick, halb nass, honigblond und fällt ihr in den Rücken.
Nichts an diesem Mädchen sagt mir, dass ich sie erkennen sollte. Sie kenne.
Und doch tue ich das irgendwie.
Vielleicht nicht als Blondine, doch ich könnte schwören, dass ich sie kenne.
Ich gehe auf die Türen zu, während der Zug anfährt, starre ihm wie ein Irrer hinterher, als er tosend in den dunklen Tunnel fährt, versuche durch reine Willenskraft die Frau dazu zu bewegen, den Kopf zu drehen, nur ein klein wenig. Doch ich bekomme ihr Gesicht nicht zu sehen, und dann ist sie verschwunden, und ich stehe am Rand des Bahnsteigs, allein.
»Der nächste kommt bestimmt gleich«, sagt ein Mann hinter mir und schlendert mit einer Zeitung in der Hand an mir vorbei.
»Ja«, antworte ich geistesabwesend. Ich fahre mir mit der Hand über den Kopf, bringe mich zur Vernunft.
Sie war es nicht.
Wie kannst du jemanden an seinem Hinterkopf erkennen?
Indem du Monate damit verbracht hast, dir jeden Zentimeter von ihr, den du nicht berühren konntest, einzuprägen, denke ich. Deine Augen haben getan, was deine Hände, dein Mund und dein Schwanz nicht konnten.
Ich atme tief durch und trete von der Bahnsteigkante zurück. Die Woche damit zu beginnen, nach Geistern zu sehen, wo keine sind, ist das Letzte, was ich jetzt brauche.
Ich warte auf den nächsten Zug, steige wie üblich bei Charing Cross aus und gehe zur Universität.
Kapitel 2
Natasha
Edinburgh – Vor vier Jahren
»Natasha, haben Sie einen Moment? Hier ist ein Brigs McGregor, der Sie sprechen möchte.«
»Brigs wer?«, frage ich ins Telefon. »Ist das ein Vorname?« Es knackt in der Leitung, und ich kann meine Supervisorin Margaret kaum verstehen. Das kommt davon, dass sie mich hier oben in dieses Kabuff gesteckt und es zu einem Büro erklärt haben. Offensichtlich waren sie so erpicht darauf, eine Praktikantin hierzuhaben, die sich den Arsch aufreißt und umsonst arbeitet, dass sie aus dem Nichts ein Büro hervorgezaubert haben. Ich bin dankbar, dass ich nicht auf einer Toilette tippen muss.
»Kommen Sie einfach runter«, sagt Margaret, bevor sie auflegt.
Seufzend puste ich mir eine verirrte Haarsträhne aus den Augen. Ich stecke knietief in Drehbüchern, die für das Kurzfilmfestival eingereicht wurden. Sie sollten das Highlight meines Jobs sein, doch da neunzig Prozent dieser Drehbücher ätzend sind, sind meine Arbeitstage ausgesprochen langweilig.
Als ich mich für das Praktikum bei dem Edinburgher Kurzfilmfestival beworben habe, hielt ich das für eine gute Möglichkeit, zusätzliche Erfahrungen zu sammeln, bevor ich mit dem letzten Jahr meines Masterstudiums anfange, vor allem, da ich meine Masterarbeit über den Einfluss von Festivals auf Spielfilme schreiben will. Zumindest glaube ich, dass ich das will. Und ich habe gedacht, dass es bei all den Schwachköpfen, mit denen ich an der Uni herumhänge, eine nette Abwechslung wäre, für den Sommer aus London herauszukommen und Edinburgh kennenzulernen.
Doch während ich davon ausgehe, dass das alles stimmt – ich bekomme gutes Material für meine Masterarbeit, und ich liebe Edinburgh –, habe ich nicht damit gerechnet, die kleine Sklavin der Truppe zu sein. Nicht dass ich klein bin, nicht mit diesen Hüften und diesem Arsch, der kaum in das verdammte Kabuff-Büro passt, doch ich mühe mich praktisch von morgens um acht bis abends um sieben ab und habe manchmal das Gefühl, den ganzen Laden allein zu schmeißen. Jetzt haben sie mich zum Beispiel an die Drehbücher für den Wettbewerb gesetzt, der momentan läuft (das Drehbuch, das gewinnt, bekommt die nötige finanzielle Unterstützung, es zu verfilmen) und erwarten von mir, dass ich den Gewinner auswähle. Während ich mich einerseits durch die Verantwortung geschmeichelt fühle, bin ich mir andererseits nicht ganz sicher, ob ich das wirklich entscheiden sollte.
Ich bin auch nicht überrascht, dass da ein Mann ist, der mich sprechen will, denn immer, wenn ein Filmemacher mit einem Vorschlag oder einer Frage hereinschneit – oder weil er irgendwie mit uns arbeiten will –, wird er zu mir abgeschoben. Ich bin erst seit drei Wochen hier, und alle erwarten, dass ich schon alles weiß.
Glücklicherweise bin ich eine ziemlich gute Schauspielerin. Ich meine, zumindest zu Hause in Los Angeles war ich das.
Ich stehe auf und verlasse das Büro, gehe den engen Gang mit den Steinwänden und den Holzböden entlang, bevor ich die Treppe zum Hauptgeschoss und zur Rezeption hinuntersteige, wo Margaret emsig etwas in ihren Computer tippt. Ihre fliegenden Finger halten im Schreiben inne, und sie nickt zu den Sitzplätzen an der Tür unter den ganzen beschissenen Filmplakaten hin.
»Das ist Professor McGregor von der Universität Edinburgh«, sagt sie, bevor sie sich wieder ihrer Arbeit zuwendet.
Ein Mann erhebt sich von seinem Platz und lächelt mich an.
Er ist groß und breitschultrig und trägt ein schwarzes Hemd und Jeans.
Er ist verdammt attraktiv, sein Kinn ist markant mit genau der richtigen Menge Bartstoppeln, er hat hohe Wangenknochen und durchdringende, hellblaue Augen.
Er ist auf die Art attraktiv, die deine Gehirnzellen deaktiviert.
»Hallo«, sagt er und kommt mit ausgestreckter Hand auf mich zu.
Sein Lächeln ist blendend weiß und absolut teuflisch.
»Brigs«, sagt er, als ich seine Hand ergreife.
Sein Griff ist warm und fest.
»Sie müssen Natasha sein«, fährt er fort.
Richtig. Das ist der Teil, wo ich etwas sage.
»Ja-a«, stammele ich und verfluche mich sofort, dass ich nicht selbstsicherer klinge. »Entschuldigung, ich war abgelenkt von … Brigs, sagten Sie? Ein interessanter Name.« Ist das ein interessanter Name? Mann, ich übertreffe mich heute ja selbst.
Aber er lacht, und sein Lächeln wird breiter.
»Ja, meine Eltern haben offensichtlich große Erwartungen in mich gesetzt. Hören Sie, haben Sie einen Moment Zeit für mich?«
Ich werfe einen Blick zu Margaret hinüber. »Sicher. Margaret, haben wir einen freien Raum?«
Sie schüttelt den Kopf, ohne aufzublicken. Gewöhnlich führe ich Gespräche in einem der anderen Büros.
»Okay, na schön.« Ich sehe Brigs entschuldigend an. »Kommen Sie mit. Wir müssen uns mit meinem Büro begnügen, und ich entschuldige mich schon mal vorab, dass es im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Kabuff ist. Sie haben mich wie Rapunzel untergebracht.«
Ich gehe den Gang entlang und steige die Treppe hinauf, werfe ihm über die Schulter einen Blick zu, um mich zu vergewissern, dass er mir folgt. Ich erwarte, dass er auf meinen Hintern starrt, weil er genau vor seiner Nase und riesig ist, doch stattdessen sieht er mich an, als hätte er erwartet, dass sich unsere Blicke begegnen.
»Da sind wir«, sage ich, als wir oben ankommen, trete in mein Büro und quetsche mich zwischen Schreibtischkante und Wand hindurch. Mit einem Seufzer lasse ich mich auf meinem Stuhl nieder.
»Wow, Sie haben wirklich nicht übertrieben«, sagt er und bückt sich, damit sein Kopf nicht an die Decke stößt. »Gibt es vielleicht irgendetwas, worauf ich mich setzen kann?«
Ich deute mit dem Kopf zu dem Stuhl, auf dem im Moment noch Drehbücher liegen. »Wenn Sie mir die Drehbücher geben.«
Er stapelt sie auf meinem Schreibtisch und nimmt Platz, die langen Beine vor sich ausgestreckt.
Ich spähe über den Stapel zu ihm hin und lächle ihn so charmant an wie nur möglich. Ich wünschte, ich hätte mir die Mühe gemacht, einen Blick in den Spiegel zu werfen, bevor ich ihn abgeholt habe. Wahrscheinlich habe ich Kohl zwischen den Zähnen. »So, wie kann ich Ihnen helfen Professor McGregor?«
»Brigs.«
Und wieder ist da dieses Lächeln.
»Brigs«, sage ich und nicke. »Und lassen Sie mich unserer Unterhaltung vorausschicken, dass ich nur eine Praktikantin und erst seit drei Wochen hier bin und keine Ahnung habe, was ich tue.«
»Eine Praktikantin?«, fragt er und reibt sich mit der Hand über das Kinn. »Aber nicht aus meinem Kurs.«
»Ich bin an der Uni in London.«
»King’s College?«
»Nein, schön wär’s. Das kann ich mir nicht leisten.«
»Ah, die Studiengebühren für die Internationalen. Sind Sie Kanadierin? Amerikanerin?«
»Sie meinen, ich klinge nicht britisch?«, scherze ich. »Ich bin Amerikanerin. Und ja, die Studiengebühren waren zu hoch, obwohl ich durch meinen Vater einen französischen Pass habe, aber den habe ich erst seit diesem Jahr. Was soll’s, ich fasele. Sorry. Ich studiere Filmwissenschaft an der Met. Das war etwas billiger.«
Er nickt. »Eine ordentliche Uni.«
»Eine sehr diplomatische Professorenantwort.«
»Ich bin ein diplomatischer Professor.«
Mein Gott, ein Verhältnis mit einem Professor wie ihm zu haben. Aber ich bin fünfundzwanzig, und er sieht aus, als wäre er Mitte dreißig, es wäre also nicht so skandalös und …
Meine Gedanken brechen ab, als mein Blick auf seinen Ehering fällt.
Oh.
Na gut, das war ja klar.
Trotzdem starre ich ihn an, verheiratet oder nicht.
»Also, was führt Sie her?«, bringe ich heraus.
»Na ja, es ist lustig«, sagt er und fährt sich mit der Hand durch das mahagonifarbene Haar. »Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier, und jetzt sind plötzlich zwei Gründe daraus geworden.«
Ich runzele die Stirn. »Okay.«
»Der eine Grund ist, dass unser Masterstudiengang Schwierigkeiten hat, mit den berühmten Studiengängen unten in London zu konkurrieren. Deshalb haben wir uns gedacht, dass uns eine Förderung des Filmfestivals vielleicht die richtige Aufmerksamkeit am richtigen Platz einbringen könnte. Es kann letztendlich nur eine gewisse Anzahl Gewinner geben, und wenn das Festival vorbei ist und die gescheiterten Filmemacher hinschmeißen wollen, werden wir sie uns schnappen, uns ihr geringes Selbstwertgefühl zunutze machen und sie als Studenten gewinnen.«
Ich ziehe einen Schmollmund. »Das ist eine sehr pessimistische Betrachtungsweise.«
»Ich bin Realist«, sagt er strahlend.
»Und Opportunist.«
»Das ist das Gleiche.«
Na ja, wir könnten wirklich noch ein paar Sponsoren gebrauchen. »Schön, wir müssen das Margaret und Ted vorlegen, doch ich denke schon, dass wir an einer Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert sein könnten. Und was ist der zweite Grund?«
»Dass Sie für mich arbeiten.«
»Entschuldigung?«