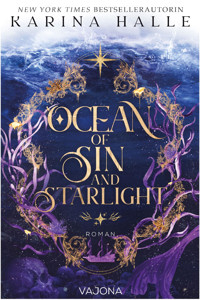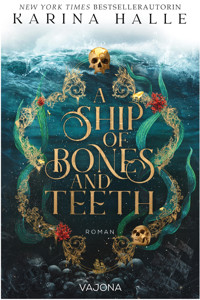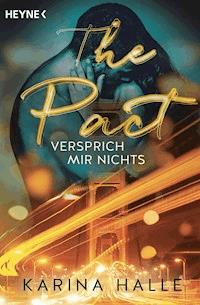9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Being with you-Serie
- Sprache: Deutsch
Sie war immer mutig, doch das Spiel mit ihm könnte sie verbrennen …
Kayla Moore war bisher immer auf der Suche nach wilden Abenteuern. Doch sie spürt, dass ihr das nicht mehr ausreicht. Sie hat genug von Bekanntschaften für eine heiße Nacht. Gerade da taucht Lachlan McGregor in ihrem Leben auf. Der unwiderstehliche schottische Rugbyspieler ist ein äußerst geheimnisvoller Bad Boy. Schweigsam und unglaublich attraktiv. Und Kayla muss sich entscheiden: Will sie sich erneut auf das Spiel der Liebe einlassen oder hat sie zu viel Angst davor?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
KARINA HALLE
The Play
SPIEL NICHT MIT MIR …
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Sabine Schilasky
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
ZUMBUCH
Kayla Moore war bisher immer auf der Suche nach wilden Abenteuern. Doch sie spürt, dass ihr das nicht mehr ausreicht. Sie hat genug von Bekanntschaften für eine heiße Nacht. Gerade da taucht Lachlan McGregor in ihrem Leben auf. Der unwiderstehliche schottische Rugbyspieler ist ein äußerst geheimnisvoller Bad Boy. Schweigsam und unglaublich attraktiv. Und Kayla muss sich entscheiden: Will sie sich erneut auf das Spiel der Liebe einlassen oder hat sie zu viel Angst davor?
ZUM AUTOR
Karina Halle war Reise- und Musikjournalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Self-Publisherin und New York Times-Bestsellerautorin. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrem Hund auf einer Insel vor der Küste Britisch-Kolumbiens.
LIEFERBARE TITEL
The Pact
The Offer
Für Bruce, Pitbulls und andere missverstandene Wesen, die im Leben selten eine zweite Chance bekommen.
»I’ll awake you from this living sleep«
– Matador, Faith No More
Prolog
Edinburgh, Schottland
1987
In der Nacht zuvor hatte es zu schneien begonnen. Der Junge wachte auf dem Fußboden am Feuer auf, wie er es manchmal tat, wenn der Wind zu kalt blies und Mum die Stromrechnung nicht bezahlt hatte. Doch bis zum Morgen war das Feuer aus, nur noch glimmende Asche, und er konnte weder seine Finger noch seine Nase fühlen: Die einzigen Teile, die aus der kratzigen Wolldecke hervorlugten.
Trotz der feuchten Kälte, die in dem kleinen, dunklen Wohnzimmer herrschte, war der Junge froh, als er aufwachte. Heute war sein besonderer Tag. Er wurde fünf, und letztes Jahr an seinem Geburtstag, als er keine Geschenke bekommen hatte, hatte seine Mutter ihm versprochen, fest versprochen, wenn er fünf und ein großer Junge wäre, dürfte er zum Spielzeugladen gehen und sich etwas aussuchen.
Deshalb hatte er während des letzten Jahrs viel in weggeworfenen Katalogen geblättert, die er im Müll der Siedlung fand. (Manchmal musste er am Rand warten, während einige grobe, unberechenbare Gestalten nach Essen oder etwas Verpfändbarem wühlten.) In den Katalogen hatte er nach Spielsachen gesucht, die ihm gefallen würden. Wenn er welche entdeckte, riss er die Seiten raus und nahm sie mit ins Schlafzimmer, das er sich mit seiner Mutter teilte. Dort versteckte er die Blätter in der Innentasche seiner einzigen Jacke.
Hatte er bei den Katalogen kein Glück, blätterte er in den Zeitschriften in der Bücherei. Dort verbrachte er die meiste Zeit. Er ging nicht zur Schule, was er eigentlich sollte, damit seine Mutter ihrer Arbeit nachgehen konnte. Die Bücherei war ihm der liebste Ort. In den chaotischen Slums von Muirhouse fiel niemandem ein kleiner Junge auf, der in zu engen und fadenscheinigen Sachen stundenlang auf dem Fußboden in der Bücherei hockte, sich Zeitschriften ansah und von einem anderen Leben träumte.
Als sein Geburtstag näher rückte, war ihm eigentlich nicht mehr wichtig, was für ein Spielzeug er am Ende bekam. Er wollte einfach etwas, das ihm gehörte. Und obwohl er wusste, dass sich Jungen wie er Spielzeugsoldaten oder Autos wünschen sollten, wollte er einfach etwas Tröstliches. Ein Stofftier zum Beispiel, einen Bären vielleicht oder einen Hund. Er mochte Hunde, sogar die von seinem Nachbarn, die nachts immerzu bellten und beißen wollten, wenn man ihnen zu nahe kam. Auch diese Hunde mochte er.
Der Junge stand auf, fröstelte sogar mit der umgehängten Decke und ging ans Fenster. Seine großen, graugrünen Augen weiteten sich vor Staunen. Aller Dreck und Unrat auf den gottverlassenen Straßen war unter einer weißen Schneedecke verschwunden. Es war der erste Schnee dieses Jahr in Edinburgh, und der Junge konnte nicht umhin zu denken, dass er für ihn war, für seinen besonderen Tag. Mit kalten, ungelenken Fingern zog er sein Kreuz an der Kette unter dem Hemd hervor und küsste es, um Gott zu danken.
Er wollte seiner Mutter von dem Schnee erzählen, deshalb lief er über den dünnen Teppich, der voller Risse und Brandlöcher von Zigaretten war, und zum Schlafzimmer.
Er hätte wirklich anklopfen sollen. In seiner Aufregung vergaß er eine der wenigen Regeln, die seine Mutter ihm auferlegt hatte: »Wenn ich einen Freund hier habe, musst du im Wohnzimmer schlafen« und »Wenn meine Tür zu ist, mach sie niemals auf«.
Doch er öffnete sie.
Das Fenster hatte einen Sprung, durch den der Wind eindrang und die verblichenen Vorhänge bauschte. Unter dem Fenster stand das Bett, in dem seine Mutter in einem fleckigen Nachthemd auf dem Bauch lag und schlief.
Ein nackter Mann stand über ihr und rauchte Pfeife.
Der Junge erstarrte, doch es war zu spät. Der Mann sah ihn, schleuderte wütend die Pfeife weg und war in Sekunden quer durchs Zimmer geeilt, um den Jungen an der Gurgel zu packen.
»Glaubst du, dass du über mich urteilen kannst?«, fauchte der Mann ihm ins Gesicht. Sein Atem roch nach Zwiebeln und Blut.
Der Junge schloss die Augen und schüttelte ängstlich den Kopf.
Er hatte den Mann schon einige Male gesehen – seine Mutter hatte so viele Freunde. Sie alle verschwanden immer im Schlafzimmer, manchmal für Stunden, manchmal für Minuten. Dann hörte er sie husten, lachen und an guten Tagen freudige Rufe ausstoßen. An schlechten Tagen hörte er Gebrüll, das Weinen seiner Mutter und das Poltern von Sachen, die herumgeworfen wurden. An solchen schlechten Tagen hatte seine Mutter hinterher blaue Flecken und Wunden. Dann redete sie nicht mit ihm, ging nicht raus. Er blieb einfach bei ihr und brachte ihr dünnen Tee aus Beuteln, die schon mehrfach benutzt worden waren, weil nichts anderes da war.
»Glaubst du das?«, schrie ihn der Mann wieder an und drückte ihm den Hals zu.
Der Junge konnte nicht atmen. Er dachte, dass ihn dieser schreckliche Mann mit der lila Knollennase und den fiesen Augen umbringen würde.
Und ein bisschen wünschte er es sich sogar.
»Hey«, sagte seine Mutter vom Bett aus, während sie sich langsam regte. »Was ist los?« Ihre Stimme war matt, und sie lallte, als sie sich aufsetzte. »Lass meinen Sohn in Ruhe.«
Der Mann ließ ihn los und drehte sich wütend zu der Frau um. Keuchend griff sich der Junge an den wunden Hals, versuchte zu sagen, dass es ihm leidtat, aber es kam nichts heraus.
Es spielte sowieso keine Rolle. Plötzlich drehte sich der Mann wieder zurück und hieb ihm mit der Rückhand ins Gesicht, sodass abertausend Scherben in seinem Kopf zu explodieren schienen und er rückwärts flog.
Er knallte gegen den Türrahmen und landete mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden. Dort betete er stumm zu demselben Gott, dem er für den Schnee gedankt hatte, dass er nie wieder solchen Schmerz spüren würde.
Doch es war natürlich nicht vorbei. Vorher hatte er noch ein ganzes Leben voller Schmerz durchzustehen.
»Du hältst die Klappe«, brüllte der Mann seine Mutter an.
Sie sah zu Tode verängstigt aus, schaffte es aber trotzdem, ihrem Sohn zu sagen, dass er aufstehen, ins Bad gehen und die Tür verriegeln solle.
Der Junge konnte sich kaum rühren, doch irgendwie bekam er es hin. Er rappelte sich mit pochendem Schädel auf, hustete würgend und ging ins Bad. Der Fußboden war nass von Urin. Linkisch schob er den Riegel vor, setzte sich auf die Toilette und wartete.
Es gab Geschrei, dann noch mehr Geschrei, schließlich knallte eine Tür zu.
Sanftes Klopfen verriet ihm, dass mit seiner Mum alles okay war.
»Mach dich lieber fertig«, sagte sie, als er die Tür einen Spalt öffnete. Bei ihrem Lächeln sah er ihre schiefen, gelben Zähne, und sie zog den Bademantel über ihrem hageren Körper zusammen. Ihre Brustknochen standen vor wie Gitterstäbe. »Heute ist dein Geburtstag, und ich habe nicht vergessen, was ich dir versprochen hatte.«
Bei den letzten Worten kippte ihre Stimme, und sie ging hastig weg, die Schultern eingefallen und den Kopf gesenkt.
Bald waren sie beide angezogen. Sie stapften durch den Schnee zur Bushaltestelle. Der Junge konnte nicht anders, als jedem und allem zuzulächeln, an dem sie vorbeikamen: den unheimlichen Leuten, die auf der Straße schliefen und mit sich selbst redeten, den Hunden, die zitterten und wegliefen, den Ratten, die Aas am Straßenrand fraßen. Nichts davon störte ihn, denn ihm kam die Welt hell und rein vor. Er kickte den Schnee auf und beobachtete, wie er langsam zu Boden rieselte. Und er sagte seiner Mum, so müsste es im Himmel sein, wenn man den ganzen Tag in den Wolken wanderte.
Sie wischte sich eine schwarze Mascara-Träne weg und stimmte ihm zu.
Die Busfahrt dauerte lange, doch am Ende waren sie in einem der riesigen Einkaufszentren. Das war der große Moment, auf den sich der Junge seit einem Jahr freute.
Er bemerkte nicht mal die komischen Blicke, mit denen manche Leute sie beide ansahen. Viel zu sehr war er auf sein Spielzeug konzentriert, und darüber schien ihm die Welt zu entgleiten. Trotz der Beule an seinem Hinterkopf und der geschwollenen Wange, die sich allmählich violett färbte, war dies der glücklichste Tag seines Lebens.
»Also, wir haben nicht viel Zeit«, sagte seine Mutter. »Such dir bitte schnell dein Geschenk aus, und ich bezahle es.«
Der Junge hörte das Drängen in ihrer Stimme, und auf einmal war das alles zu viel für ihn. Hier gab es Action-Figuren, Superhelden, Autos und Lastwagen, Pferde, Puppen, Stofftiere, Baukästen, Malsachen, Lego und eine Million andere Dinge, die er sich wünschte. Vollkommen überwältigt stand er da und blickte sich immer wieder um. Sein Herz pochte wie wild.
»Bitte«, sagte seine Mutter. Sie stand schon an der Kasse, bereit zu bezahlen. Und der Junge bekam solche Angst, dass er gar nichts kriegen würde, wenn er sich nicht das Richtige aussuchte. Gleichzeitig war er alt genug, um zu wissen, dass sie nicht viel Geld hatten, weshalb alles Ausgefallene und Teure nicht infrage kam.
Panisch bewegte er sich auf die Stofftiere zu. Sie steckten alle in einem Karton – Giraffen, Bären, Hunde, Katzen. Alle sahen aus, als bräuchten sie ein neues Zuhause, und es brach ihm das Herz, dass er nur eins mitnehmen konnte.
Aber er musste sich entscheiden. Er wollte schon nach einem Stoffwelpen greifen, als ihm ein Löwe auffiel, der halb in dem Haufen vergraben war, sodass nur seine Katzenaugen und die flauschige gelbe Mähne herausschauten. Dies war kein Ort für solch ein majestätisches Tier.
Der Junge zog den Löwen heraus. Er fühlte sich so weich und kuschelig in seinen Armen an. Mit dem Löwen rannte er zu seiner Mutter und hoffte, dass sie es sich nicht anders überlegt hatte.
Sie sah den Löwen an und lächelte. Er hatte es gut gemacht.
Nachdem sie bezahlt hatte, umfing er den Löwen mit aller Kraft. Es fühlte sich so gut an, etwas festzuhalten, und ihm war, als würde der Löwe auch ihn halten, ihm für die Rettung danken.
»Wie heißt der Löwe denn?«, fragte seine Mutter leise. Es lag so viel Traurigkeit in ihrer Stimme, dass sie beinahe den Zauber brach, der den Jungen bannte, diesen schwindelerregenden Zauber der Liebe.
»Lionel«, sagte er nach kurzem Überlegen. »Lionel der Löwe. Und ich hab ihn lieb.«
»Und du weißt, dass er dich auch liebhat, nicht?«, fragte sie und wischte sich die Nase mit dem Ärmel ihres falschen Pelzes ab. Dabei verschmierte sie ihren roten Lippenstift. »Genauso wie ich dich liebhabe.«
Seine Mutter sagte ihm nicht oft, dass sie ihn liebhatte, daher überraschte es ihn. Es machte seinen Geburtstag noch viel schöner.
Bald saßen sie wieder im Bus, doch sie fuhren nicht zurück nach Hause. Die Straßen waren ganz fremd, und nach und nach ließen sie die Stadt hinter sich. Die Höfe um sie herum wurden größer, der Schnee tiefer.
»Wo wollen wir denn hin?«, fragte er. »Hier geht es nicht nach Hause.«
»Wir fahren Freunde von mir besuchen«, antwortete sie.
Das gefiel dem Jungen nicht. Er umklammerte seinen Löwen noch fester. Er mochte die Freunde seiner Mutter nicht.
Sie legte eine Hand auf seine Schulter, sah ihn jedoch nicht an. Sie waren die Einzigen in dem Bus, und der Junge fühlte sich noch einsamer.
»Keine Angst«, sagte sie schließlich. »Da gibt es auch Jungen in deinem Alter.«
Das machte es für ihn nicht besser. Er verstand sich nicht mit anderen Kindern, ob sie in seinem Alter waren oder nicht. Er war schüchtern und wurde oft getriezt, weil er so still war. Folglich zog er sich noch mehr in sich selbst zurück.
Schließlich hielt der Bus vor einer hohen Mauer mit einem gewaltigen Eisentor. Die Mutter nahm seine Hand und hielt ihre Handtasche dicht vor sich, während sie in den Schnee ausstiegen. Der Bus fuhr weg, und der Junge wünschte, er hätte drinnen bleiben können. Sie waren in den Bergen, mitten in der Einöde, und auch wenn sein Zuhause kalt und schmutzig war, war es doch sein Zuhause.
Der Junge konnte das Schild an der Mauer nicht lesen, deshalb fragte er seine Mutter, was dort stand.
»Da steht, dass wir willkommen sind«, antwortete sie und scheuchte ihn weiter, bis sie vor dem Tor standen. Dort drückte sie auf den Klingelknopf.
Der Junge starrte durch die Eisenstäbe zu dem riesigen Herrenhaus auf dem Hügel. Es gefiel ihm nicht. Irgendwas daran machte ihm Angst – vielleicht die Gitter vor den Fenstern, der Efeu an den Mauern oder wie riesig alles aussah. Es ähnelte einem lauernden, gefährlichen Monster. In diesem Moment war er froh, dass er einen Löwen wie Lionel hatte, was ihn jedoch nicht davon abhielt, die Fersen tief in den Schnee zu graben.
»Komm schon«, zischte seine Mutter und zerrte ihn mit, bis sie die Stufen hinaufstiegen.
Die Haustür ging auf. Ein großer, dünner Mann mit einer Hakennase und nach hinten gekämmtem Haar erschien und blickte auf sie herab.
»Herzlich willkommen, Miss Lockhart«, sagte er und bedeutete ihnen, ins Haus zu kommen.
Der Mann redete mit ihnen, während sie hineingingen, aber der Junge hörte nicht zu. Ihn erschreckte die Kälte hier überall. Angefangen bei den eklig gelben Lichtern bis hin zu dem seltsamen Gefühl, dass hier alles wie in einer Fabrik wirkte – geradezu feindselig. Hier gab es ganz üble Schwingungen, wie an einem Ort, an dem nur Schlimmes lauerte.
Doch seine Mutter zog ihn weiter einen leeren Flur entlang, bis sie in ein Büro kamen. Dort setzten sie sich beide auf ledrige Stühle dem Mann gegenüber, und seine Mutter reichte ihm einen Umschlag aus ihrer Handtasche.
»Ich gehe davon aus, dass alles in Ordnung ist«, sagte der Mann mit tiefer, gefühlloser Stimme.
Seine Mutter nickte. »Ist es.« Sie stockte und sah ihren Jungen mit unendlichem Bedauern an, bevor sie sich wieder dem Mann zuwandte. »Ich hoffe, dass Sie gut für ihn sorgen. Es ist nicht seine Schuld, sondern meine.«
Der Mann nickte bloß und sah die Papiere durch.
»Wovon redest du?«, fragte der Junge sie. »Wann fahren wir nach Hause?«
»Mein Junge«, sagte der Mann und sah ihn mit seinen kleinen Augen an.
Der Junge spürte förmlich, wie sie ihm Löcher in die Seele bohrten.
»Dies ist dein neues Zuhause.«
Er verstand das nicht, schüttelte den Kopf und sah zu seiner Mutter, doch die weinte und stand von ihrem Stuhl auf.
»Mum!«, schrie er. Er ließ seinen Löwen fallen, damit er mit beiden Händen ihren Mantel packen konnte. Sie zog ihn beinahe von seinem Stuhl. Er sprang auf, als sie zur Tür ging, wollte ihr nach, wurde jedoch vom unbarmherzigen Griff des Mannes zurückgehalten. »Mum!«, schrie er wieder, beide Arme nach vorn gestreckt.
An der Tür blieb sie kurz stehen. Die Wimperntusche rann ihr über die Wangen.
»Es tut mir so leid, Lachlan«, schluchzte sie. Ihre Hand umfing den Türrahmen so fest, dass die Fingerknöchel weiß wurden. »Ich liebe dich. Aber ich kann dich einfach nicht bei mir behalten. Es tut mir so leid.«
»Aber Mum!« Lachlan schrie, als würde seine Stimme aus ihm hinausbersten. »Ich bin auch ganz artig, versprochen! Du kannst Lionel zurück zu dem Laden bringen, aber nimm mich mit nach Hause, bitte!«
Seine Mutter schüttelte bloß den Kopf und flüsterte: »Lebwohl.«
Lachlan weinte weiter, heulte, versuchte, sich dem Mann zu entwinden, während er zusah, wie seine Mutter wegging, bis sie schließlich verschwunden war.
»Bitte!«, brüllte er, und für einen so kleinen Jungen war er sehr laut. Er merkte, wie seine Beine nachgaben, und nun hielt der Mann ihn aufrecht, sodass seine Füße unter ihm in der Luft baumelten. »Bitte, komm zurück, Mum, bitte! Nimm mich mit nach Hause! Ich will nach Hause!«
»Dies ist dein Zuhause«, wiederholte der Mann. Er bog Lachlans Kopf zurück, bis sein Mund an Lachlans Ohr war, und flüsterte: »Und wenn du nicht aufhörst, zu schreien und Laute von dir zu geben wie ein kleiner Blödmann, kriegst du zwanzig Schläge mit meinem Gürtel. Ist es das, was du an deinem ersten Tag im Hillside Orphanage willst? Ja?«
Doch Lachlan konnte nicht aufhören zu schreien. Ihm war völlig egal, ob er geschlagen würde. Das war erst heute Morgen passiert und auch schon viele Male vorher. Der wahre Schmerz war der, den er in sich spürte, der in ihm wütete, ihn zerriss. Er hatte das Gefühl, in Eiswasser zu ertrinken, und die Flut begann in seiner Seele.
»Na gut«, sagte der Mann und warf Lachlan auf den Boden. Er hob Lionel auf und hielt den Stofflöwen in die Höhe. »Wenn du dein verdammtes Maul nicht hältst, wirst du den nie wiedersehen. Ich schenke ihn einem anderen Jungen.«
Er war alles, was Lachlan noch hatte. Also war er still. Wimmernd presste er die Lippen zusammen, während sein Kinn bebte. Der Mann gab ihm den Löwen, und er hielt ihn ganz fest, bis das Stofffell nass von seinen Tränen war.
Sein fünfter Geburtstag war der letzte, den er für sehr lange Zeit feierte.
Lachlan sah seine Mutter nie wieder.
Er kam nie wieder nach Hause.
Und die Flut in seiner Seele ebbte nie richtig ab.
Kapitel 1
San Francisco – heute
Kayla
»Wie lange muss man schwanzlos sein, um wieder als Jungfrau zu gelten?«
Steph und Nicola sehen mich an, als hätte ich sie mit meiner Frage restlos überfordert.
»Kayla«, ermahnt Nicola mich.
»Was?« Ich zucke mit den Schultern und sehe sie fragend an. »Von uns dreien hier solltest du es doch am besten wissen. Wir mussten dir praktisch die Schwänze ins Gesicht drücken, bis du mit Bram losgelegt hast. Also, gilt man wieder als Jungfrau oder nicht?«
»Ich hatte einen Vibrator, Idiotin«, erwidert Nicola, lehnt sich in der Sitznische zurück und sieht mich mit diesem Blick an, den ich nur zu gut kenne. Es ist der »Was ist eigentlich mit dir los, und wieso sind wir immer noch befreundet?«-Blick.
»Vibrator zählt nicht«, erkläre ich ihr. »Ich rede von einem echten Penis. War es wie ein zweites erstes Mal, als Bram es dir besorgt hat? Der Brammer-Hammer? Rein, raus, danke Bram?«
Sie verdreht die Augen und wechselt einen Blick mit Steph. Nicola ist erst seit wenigen Wochen wieder mit Bram zusammen und mit ihrer Tochter Ava bei mir ausgezogen und bei ihm ein. Und obwohl ich Bram manchmal nicht ganz traue, weil man meiner Meinung nach scharfen Schotten grundsätzlich nicht trauen sollte, muss ich vor allem zugeben, dass ich es vermisse, Nicola und Ava bei mir zu haben. Ohne sie ist es irgendwie einsam, und ich neige dazu, dann abends herumzusitzen, Fertiggerichte in mich hineinzustopfen und Wiederholungen von The Vampire Diaries zu sehen.
Natürlich ist ein Grund, weshalb ich ganz allein bin und mich von Konserven ernähre, der, dass ich mich vor Wochen zum Zölibat entschlossen habe. Und das heißt nicht nur keinen Sex, sondern kein Flirten, keine Dates, kein Tinder, nichts. Ich werfe nicht mal einen zweiten Blick auf Jungs oder Männer. Und ich darf sagen, dass es klappt.
So ist es viel einfacher. Weniger stressig.
»Ist alles in Ordnung, Kayla?«, fragt Steph.
»Ja, warum?«
»Weil du die Tischkante umklammerst, als würdest du gleich zum Hulk werden.«
Ich blicke auf meine Hände und stelle fest, dass meine Fingerknöchel noch bleicher sind als sonst schon. Langsam lasse ich los. Vielleicht bin ich doch ein bisschen gestresst.
»Bist du sicher, dass diese Keine-Männer-Nummer gut ist?«, fragt sie und trinkt einen Schluck Bier.
Ehrlich gesagt, ist ihre Skepsis genau das, was ich hören will. Eine Ausrede, die ganze Geschichte über den Haufen zu werfen. Aber wenn ich eines bin, dann ist es entschlossen.
»Sie ist gut«, antworte ich, hebe den Kopf und zwinge mich zur Entspannung. Ich greife nach meinem Weinglas, obwohl es schon das zweite ist und ich leicht beschwipst bin. »Es geht nur so«, ergänze ich ernst.
»Und warum genau machst du das noch mal?«, fragt Nicola.
Ich sehe erst in ihre dunkelbraunen Augen, dann in Stephs babyblaue. Meine beiden besten Freundinnen, lässig elegant in ausländischen Designersachen. Sie beide sind der Grund dafür, sie mit ihren glücklichen Strahlegesichtern und ihren Beziehungen mit diesen verfluchten McGregor-Brüdern. Nicola hat sich nach ihrem Riesenkrach gerade wieder fröhlich mit Bram versöhnt, und Stephanie ist mit seinem Bruder Linden verheiratet. Es hilft auch nicht, dass ich vor ewiger Zeit was mit Linden hatte, lange bevor er und Steph zusammenkamen. Nicht dass er mir mein Grinch-Herz (drei Nummern zu klein) gebrochen hätte, aber manchmal erinnert es mich daran, was ich hätte haben können und nicht habe.
Genau genommen bin ich neidisch. Und wenn ich neidisch bin, sogar auf meine Freundinnen, verwandle ich mich schon mal in eine fiese kleine Ninja. Ich will aber keine fiese kleine Ninja sein, sondern nur eine ganz normale (auch wenn es mir fehlt, eine Sex-Ninja zu sein). Also heißt Männern abzuschwören Enttäuschungen abzuschwören.
Heute Abend haben mich Steph und Nicola praktisch aus dem Haus gezerrt und auf einen Mädelsabend in unseren Pub, The Burgundy Lion in Haight, geschleppt. Von Alkohol und Männern umgeben zu sein ist nie eine gute Idee, wenn man schwanzabstinent ist. Zum Glück bin ich ungeschminkt, in Yoga-Hose und einem weiten T-Shirt mit der Aufschrift »No Pants Party« unterwegs, also reißen sich die Jungs nicht direkt darum, mit mir zu reden. Es sei denn, sie halten »No Pants« für eine Aufforderung.
»Ich mache das, weil ich es gründlich satt habe, mich in dieser blöden Stadt zu verabreden. Es ist pure Zeitverschwendung, und ich schwöre, dass die Männer immer blöder werden. Ich kann mich nicht mal mehr anständig flachlegen lassen. Es ist, als wären sämtliche Männer in San Francisco entweder vergeben, schwul oder hätten Angst vor gierigen Vaginen.«
Die beiden wechseln noch einen Blick. Neuerdings scheint sich diese geheime Kommunikation bei ihnen durchzusetzen.
»Was?«, frage ich. »Es ist wahr. Und ihr würdet mir beide zustimmen, wären eure Vaginen nicht von diesen Kilt-Lüpfern eingenommen.«
»Kannst du bitte aufhören, Vagina oder Vaginen zu sagen?«, bittet Nicola. »Das Wort verliert allmählich an Bedeutung.«
Ihr Handy vibriert auf dem Tisch, und sie sieht aufs Display. »Bram ist unterwegs.«
Stöhnend stütze ich mein Kinn auf die Hand und streiche mir übers Gesicht. »Ach, wieso das denn? Ich dachte, das soll ein Mädelsabend sein? Das Letzte, was ich sehen will, seid ihr zwei, wie ihr euch anhimmelt und doofe Anspielungen macht.«
»Linden kommt auch«, sagt Steph verlegen.
Ich sehe sie streng an.
»Tut mir leid.« Sie wirkt kein bisschen bedauernd. »Aber falls es dich tröstet, Linden und ich sind langweilig und verheiratet, also ist der ganze Anhimmelkram vorbei.«
»O bitte!«, sage ich, während Nicola einen ähnlich ungläubigen Laut von sich gibt. »Ihr seid noch schlimmer als Bram und Nicola, weil ihr pathologisch glücklich verheiratet seid. Erinnerst du dich an Bridget Jones? Ich bin Bridget. Und ihr … seid die anderen.«
Nicola nickt. »Das stimmt.« Dann strahlt sie mich an. »Also musst du bloß deinen Hugh Grant treffen.«
Ich funkle sie an. »Sie kommt am Ende nicht mit Hugh Grant zusammen!«
Nicola runzelt verwirrt die Stirn.
»Ach, als würdest du einen Mark Darcy wollen«, springt Steph ein. »Außerdem kommen Linden und Bram nicht allein.«
O Gott! Mich überläuft ein kalter Schauer.
»Was? Mit wem kommen sie denn?«, frage ich matt. Wenn es ein Typ ist, werde ich sehr sauer, erst recht, wenn er Single ist.
Noch ein Blick. Ich kann sie regelrecht im Geiste kichern hören.
»Mit ihrem Cousin Lachlan«, antwortet Steph.
Lachlan McGregor. Als gäbe es nicht schon genug verdammte McGregors in der Stadt, von der Welt ganz zu schweigen. Ich kenne Lachlan nicht persönlich, was zusätzlich dafür spräche, zu Hause zu bleiben, aber Steph und Nicola haben die wenigen Male, die sie ihn gesehen hatten, hinterher von nichts anderem geredet. Er ist Rugbyspieler, so geheimnisvoll, so toll gebaut, bla, bla und noch mal bla. All der Kram, den ich nie wissen wollte, weil die Sorte mein sexuelles Kryptonit ist, besonders in dieser Stadt, wo ein herber, wilder Mann eine Nadel im metrosexuellen Heuhaufen darstellt.
»Warum tut ihr mir das an?«, rufe ich aus und greife nach meinem unordentlichen Haarknoten. »Ich bin im Pyjama hier! Ich bin ungeschminkt, und mein Haar ist nicht gebürstet. Gott, sind meine Zähne überhaupt geputzt? Stinke ich?« Rasch schnuppere ich unter meinen Achseln und atme mir in die Hand. Mmm, Eau de Alki.
»Dir das antun?«, wiederholt Steph. »Bis vor einer Stunde wusste ich gar nicht, dass er kommt. Quatsch, ich wusste nicht, dass sie überhaupt vorbeikommen wollen.«
»Ach«, sage ich und streiche unter meinen Augen entlang, um nach möglichen Schwellungen zu tasten. »Ich hätte es wissen müssen. Sie wohnen praktisch hier.«
»Na ja, ich arbeite hier«, erinnert mich Nicola. »Und Lindens bester Freund James führt den Laden. Aber was macht es schon, wenn Lachlan hier ist? Du musst ja nicht mit ihm schlafen.«
Ich greife nach Stephs fliederfarbener Balenciaga-Tasche – ein Geschenk von Linden, das ich ihr immer schon klauen wollte – und wühle darin nach einem Spiegel und Make-up, weil ich nichts dabeihabe, nicht einmal Geld, da wir im Lion gewöhnlich umsonst trinken.
»Natürlich muss ich nicht mit ihm schlafen. Trotzdem brauche ich keine Versuchung. Und was ist, wenn er noch da ist, wenn mein Eid schwächelt? Ich könnte meinen eigenen schottischen Schwanz haben, bevor er wieder in die Heimat jettet.«
»Ich dachte, du bist gegen schottische Schwänze«, sagt Steph.
»Ich bin gegen McGregor-Schwänze. Und hattest du nicht gesagt, dass Lachlan sowieso nicht sein richtiger Cousin ist? Dass er adoptiert wurde?«
Sie nickt. »Tja, ich mach es dir mal leicht, Süße. Selbst wenn du dein normales, schwanzverschlingendes Ich wärst, glaube ich nicht, dass er Interesse hätte.«
Ich stocke. »Hey, schwanzverschlingend ist mein Wort! Stiehl mir nicht meinen Mist. Und außerdem, warum nicht? Ist er schwul?« Einer meiner Brüder, Toshio, ist schwul, und ich frage mich, ob ich die zwei verkuppeln kann.
»Ich glaube nicht«, antwortet Steph und sieht Nicola an. »Ich glaube, Bram hat gesagt, dass er was mit irgendeiner Justine hatte.«
Nicola runzelt die Stirn. »Ja, dieselbe Justine, mit der Bram unterwegs war, weißt du noch?«
»Du hattest gesagt, das war kein richtiges Date – dass sein Dad sie verkuppelt hatte«, erinnere ich sie.
»Ja.« Sie schmollt die Erinnerung weg. Der Auftakt zwischen ihr und Bram war ziemlich chaotisch. Tatsächlich haben sie sich gegenseitig gehasst. Und dann wurde Nicola auf einmal ganz kitschig und verliebte sich.
»Okay, also hat er eine Freundin«, sage ich zu Steph. »Das hättest du auch gleich sagen können.«
»Ich glaube, es waren nur ein oder zwei Dates, genau weiß ich es nicht. So oder so ist er irgendwie unnahbar.«
»Ja, stimmt«, pflichtet Nicola ihr energisch nickend bei. »Ich glaube, mit mir hatte er gerade mal zwei Wörter gewechselt, und er ist oft bei uns.«
Ich schnaube, nehme Stephs Taschenspiegel und betrachte mein Gesicht. Mir ist bewusst, dass ich auch ohne Make-up nicht so schlecht aussehe. Von meiner Mutter habe ich die hohen Wangenknochen, die dunklen Augen und die langen schwarzen Wimpern, die ohne Mascara auskommen. Von meinem Vater habe ich die vollen Lippen und die Sommersprossen. Dennoch könnte ich sehr viel besser aussehen. Meine Wangen sind fleckig vom Alkohol, mein dichtes Haar ist eine Katastrophe, und ich bin angezogen wie eine Pennerin.
Und das ist ein Glück für dich, ermahne ich mich.
»Ja, du hast recht«, sage ich.
»Hä?«
Ich sehe Steph verwundert an. »Oh, entschuldige. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Du weißt doch, dass ich das tue.«
»Da sind sie«, sagt Nicola. Ich kann das blöde Grinsen in ihrer Stimme hören.
Seufzend drehe ich mich zur Tür um. Unter dem gedämpften Licht, inmitten der Holzvertäfelung mit grünen und messingfarbenen Akzenten und der manipulierten Jukebox, die ausschließlich James’ Musik spielt, erscheinen Bram, Linden und Lachlan McGregor. Das Dreiergespann scharfer Schotten.
Doch noch während dieser Gedanke in meinem Verstand aufleuchtet, blinzle ich, den Blick auf Lachlan gerichtet, den ich endlich zum ersten Mal sehe. Mir wird klar, dass »scharf« eine Untertreibung ist. Während Linden und Bram auf ihre charmante, ansprechende Art idiotisch gut aussehen, ist Lachlan ein völlig anderes Wesen.
Ja, im Grunde ist er ein Tier.
Lachlan ist gut einen halben Kopf größer als Bram – und das will einiges heißen, denn Bram ist schon ziemlich groß – und fast doppelt so breit. Wie ein Mammutbaum ragt er unsagbar weit auf, fest und wahrscheinlich unbeweglich, und ich verspüre jetzt schon den Drang, quer durch die Bar zu ihm zu rennen, um aus der Nähe zu sehen, wie riesig er ist. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich direkt von ihm abprallen würde. Im Ernst, seine Statur scheint von einem Comic-Superhelden abgekupfert zu sein, von den dicken Armen, auf denen lauter dunkle Tattoos prangen, über seine breite harte Brust bis hin zu den gewaltigen Schultern und dem V-förmigen Oberkörper. Selbst in dem schlichten, dunkelgrünen T-Shirt und der dunklen Jeans wirkt er überwältigend.
Und ich kann nicht aufhören zu starren. Mich kümmert es nicht mal, weil auch alle anderen in der Bar das schottische Dreiergespann angaffen. Allerdings fahre ich mir mit den Fingern über den Mund, um mich zu vergewissern, dass ich nicht sabbere. Er dürfte der umwerfendste Mann sein, den ich je gesehen habe.
Während Bram uns zunickt und Linden winkt, blickt sich Lachlan aufmerksam in dem Pub um, beinahe, als sei er ein Cop, der den Laden nach Verdächtigen absucht. Oder ein Verbrecher auf der Suche nach einer Gelegenheit zum Klauen. Da ist ein Anflug von elektrisierender Gefahr in seinem prüfenden Blick, und für einen Moment frage ich mich, wie es wäre, genauso angesehen zu werden. Vermutlich würde ich in Flammen aufgehen.
Doch als sie näher kommen und Lachlans Blick endlich meinem begegnet, erkenne ich nichts als Gleichgültigkeit in seinen Augen.
Rasch sehe ich weg, da mir auf einmal bewusst wird, wie ich wirken muss, und verfluche mich erneut, weil ich mich von meinen Freundinnen herschleppen ließ, statt zu Hause Damon Salvatore zu sehen. Bei dem ist mir wenigstens egal, dass er mich im Pyjama sieht.
»Hey, Süßer«, sagt Steph zu Linden und grinst ihn idiotisch an, wie bereits erwähnt. Ich ignoriere die Nettigkeiten der Paare und blicke stattdessen auf meinen Wein, während ich auf das schreckliche Vorstellen warte. Mein Blick wandert zum Fußboden und ihren Schuhen – blanke Budapester bei Bram, Keds bei Linden und Wanderstiefel bei Lachlan.
»Kayla«, sagt Bram fast behutsam. Ich liebe es, dass sie mich behandeln wie eine scharfe Bombe, die jederzeit hochgehen könnte.
Langsam blicke ich zu seinen dunklen Augen auf.
»Das ist unser Cousin Lachlan.« Er tritt zur Seite und zeigt auf das Tier von einem Mann. »Lachlan, das ist Kayla.«
Ich gebe mich cool, nicke und sage: »Freut mich.«
Er runzelt die Stirn, als überlegte er, warum ihn interessieren sollte, wer ich bin. Dabei bildet sich eine steile Falte zwischen seinen Augenbrauen, und ich würde gern mit dem Finger über sie streichen. Seine Augen sind von diesem lebendigen Haselnussbraun, das ins Grüne tendiert. Sein kantiges Kinn ist von einem perfekten Dreitagebart bedeckt, sein Haar ist dicht, braun und sieht zum Fingereintauchen aus. Und dann seine Lippen – die verschlagen mir die Sprache.
»Kayla«, sagt er. Seine Stimme ist sehr tief und sehr rauchig, als gehörte er in einen Film Noir aus den Vierzigern, und sein schottischer Akzent ist millionenmal stärker als der von Linden oder Bram. Mein Name hört sich aus seinem Mund an wie ein gälisches Dessert.
O Mann, ich brauche eine kalte Dusche, sofort!
»Wir brauchen eine größere Sitznische«, holt mich Nicola in die Wirklichkeit zurück. Obwohl ich den Blick nicht von Lachlan und all seiner Pracht abwenden will, ist dies der ideale Zeitpunkt, klug zu sein und sofort zu verschwinden.
Hastig trinke ich meinen Wein aus, bevor ich aufstehe. Ich bewege mich weg von Lachlan, weil ich fürchte, dass seine Nähe wie die Umkreisung eines schwarzen Lochs wirkt. Also bereite ich schon meine Ausrede vor, als Bram eine Hand ausstreckt und meinen Arm berührt.
»Kayla, kann ich dich mal kurz sprechen?«, fragt er, und ich sehe ihn verwundert an. Er wirkt ausnahmsweise ernst, und aus irgendeinem unerfindlichen Grund fühle ich mich wie ein kleines Mädchen, das sich Ärger eingehandelt hat. Wahrscheinlich, weil ich mich oft in Schwierigkeiten bringe.
»Okay«, sage ich rasch und werfe Nicola einen besorgten Blick zu. Sie zuckt nur mit den Schultern, wirkt selbst überrascht, und die anderen gehen in eine größere Sitznische.
Bram tippt auf den Tisch. »Setz dich. Ich muss dich etwas fragen.«
»Falls du mich bitten willst, bei dir einzuziehen, ist die Antwort Nein«, sage ich und setze mich zögernd.
»Haha. Eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten.« Er stockt und zieht die dunklen Brauen zusammen. »Du arbeitest doch bei The Bay Weekly, nicht?«
»Ja«, antworte ich gedehnt. Ich überlege täglich, meinen Job aufzugeben, aber das erzähle ich ihm nicht.
»Wie du weißt, suche ich noch nach Kapital für den Apartment-Komplex. Lachlan ist hier, um zu helfen. Er hat im Laufe der Jahre einige sehr gute Investitionen gemacht, also hat er Geld, und wie sich herausstellt, liegt ihm viel an Wohltätigkeit. Aber wir brauchen mehr Investoren, und wir haben schon alles versucht, um sie zu bekommen.«
Ich nicke, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich ihm dabei helfen kann. Bram mag mich schon mehrfach rasend wütend gemacht haben, aber der Kerl besitzt ein Herz aus Gold und versucht, die Mittel für seine Wohnanlage in der Stadt zusammenzubekommen. Gekauft hat er sie mit seinem eigenen Geld, und er stellt die Wohnungen Familien mit niedrigem Einkommen, Kranken, Alten und anderen Menschen in Not zur Verfügung. Wie Nicola mir erzählte, kann er das allein nur begrenzte Zeit durchhalten, ehe ihm das Geld ausgeht, und bisher zeigt sich die Stadt San Francisco nicht besonders spendabel, dabei braucht sie solche Wohnungen dringend.
»Deshalb habe ich gedacht«, fährt Bram fort, »dass du vielleicht bei der Zeitschrift ein gutes Wort für uns einlegen kannst. Wir brauchen alle Publicity, die wir kriegen können.«
Enttäuscht verziehe ich das Gesicht. »Tut mir leid. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich arbeite in der Werbung. Ich bin für die Einzelhändler zuständig, die bei uns ihre Werbung schalten. Vielleicht könnte ich eine Anzeige unterbringen oder so …«
Bram schüttelt den Kopf. »Danke, aber Werbeanzeigen kann ich selbst aufgeben. Es geht mir eher um … einen Artikel, ein Editorial, irgendwas in der Richtung wäre nützlich.«
Meine Chefin Lucy ist nicht das Problem, aber Joe, der Herausgeber, ist ein richtiges Arschloch. Und wenn ich das erreichen wollte, was Bram sich vorstellt, müsste ich mich an ihn wenden.
Dennoch ist Nicola meine Freundin, und Bram hat das Herz am rechten Fleck. Ich seufze. »Okay, ich rede morgen mal mit dem Herausgeber und sehe, was ich tun kann. Ich könnte den Artikel nicht schreiben, aber sicher kann es jemand anders. Falls sie interessiert sind.«
»Nicola hat erzählt, dass du Journalismus studiert hast. Warum könntest du nichts schreiben? Es würde dem Ganzen eine persönlichere Note geben, meinst du nicht?«
In meinem Bauch regt sich das übliche hohle Gefühl. »Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert«, korrigiere ich. »Und dann hat es mich in die Werbung verschlagen. Ich kann schreiben, aber … sie würden mich nicht lassen, selbst wenn ich es versuche. So einen Beitrag würden sie an einen der Redakteure geben. Und die sind alle gut. Ich sehe, was ich tun kann, okay?«
Er lächelt mich an. Hübscher Teufel! »Danke, Kayla. Deine Seele ist gar nicht so schwarz, wie immer gesagt wird.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Ich muss doch sehr bitten! Schließlich bin ich in der Werbung!«
Zwar wollte ich eigentlich gehen, doch irgendwas treibt mich an, mich zu den anderen zu setzen. Linden, Steph und Lachlan sind auf einer Seite der Nische, also setzen Bram und ich uns neben Nicola, als eine Kellnerin mit weiteren Getränken kommt. Mir wird ein Weinglas hingerückt, und ich stöhne innerlich, weil mir klar wird, dass es unhöflich wäre, jetzt zu gehen.
»Worum ging es?«, fragt Steph uns.
»Ich wollte bloß sehen, ob Kayla beim Weekly einige Strippen ziehen kann«, erklärt Bram und sieht hinüber zu Lachlan.
Sein Cousin nickt einmal kurz. Sein Blick huscht zu mir und zurück zu Bram. Ich habe kaum Eindruck auf ihn gemacht, und dabei heißt es sonst, ich sei unvergesslich (nicht ausnahmslos auf die schmeichelhafte Art, aber immerhin).
»Es wäre super, wenn du das könntest«, sagt Nicola vom anderen Tischende her. »Das würde Lachlan ein weiteres Date mit Justine ersparen.«
Darüber lacht Bram, und Lachlan lehnt sich zurück, eine Hand an seinem Light Beer. Auch du Schande. Seine Hände! Ich stehe total auf Männerhände, und seine sind groß, breit und stark.
Lachlan bedenkt Bram mit einem strengen Blick, und ich bemerke eine zarte Vernarbung auf seiner Stirn und den Wangenknochen sowie eine winzige Krümmung in der Nasenmitte. Er sieht aus wie ein Schläger, ein Kämpfer, Spieler.
»Was tue ich nicht alles für meinen Cousin«, sagt Lachlan, und ich versinke in seinem Akzent. Sein Ton ist beinahe amüsiert, auch wenn seine Miene versteinert bleibt.
»Du meinst, mit wem tust du es nicht für deinen Cousin«, scherzt Linden. Dazu sagt Lachlan nichts.
Ah, also ist er ein Weiberheld, so wie die anderen McGregors. Dachte ich mir doch. Ich meine, wie kann man so aussehen, so männlich, ursprünglich, verwegen, mit solchen Lippen und Augen, ohne dass einem die Frauen zu Füßen liegen?
Ich seufze innerlich. Mir macht es nichts aus, dass er ein Spieler ist, weil ich selbst eine Spielerin bin. Oder früher war. Also schätze ich, das ist es, was mich stört. Ich könnte niemals die Ware testen. Obwohl Abstinenz das Beste ist, muss ich dringend flachgelegt werden, und Lachlan McGregor wäre der Mann dafür. Wieder und wieder.
Vorausgesetzt natürlich, dass er mich überhaupt attraktiv findet. Oder irgendwas. Und so, wie ich es hin und wieder an seinem Blick sehe, in diesen harten, moosgrünen, unlesbaren Augen, weiß ich, dass es nicht dazu kommen wird. Vielleicht steht er wirklich auf diese Justine, auch wenn Nicola es wie einen Witz dargestellt hat.
Zum Glück kommt James herüber und fragt, ob wir noch was trinken möchten, und ich nutze die Gelegenheit zur Flucht. Steph und Nicola protestieren und sagen, sie wollen sich später ein Taxi mit mir teilen, aber ich halte es keine Sekunde länger mit dem schottischen Tier mir gegenüber aus.
Ich winke eilig zum Abschied, sehe Lachlan kaum an und verschwinde aus dem Laden.
Kapitel 2
Kayla
Am nächsten Morgen wache ich ein bisschen angeschlagen auf. Das ist die Strafe für die drei Gläser Wein gestern Abend. Es bedarf nicht viel, mich betrunken zu machen, und leider bedeutet das auch, dass nicht viel nötig ist, damit ich mich am nächsten Tag beschissen fühle.
Irgendwie schaffe ich es aufzustehen, bevor der letzte Schlummeralarm schrillt, und dusche kalt. Wirklich kalt. An manchen Tagen ist das die einzige Methode für mich, um richtig wach zu werden und halbwegs zur Besinnung zu kommen.
Hinterher beschließe ich, mir extra viel Mühe mit meinem Aussehen zu geben, um wieder wettzumachen, dass ich gestern Abend unterirdisch ausgesehen habe. Anschließend fahre ich gerade noch rechtzeitig ins Büro, ehe mir ein Donnerwetter fürs Zuspätkommen blüht.
Nicht dass mich meine Vorgesetzte Lucy jemals anschreien würde, obwohl ich dauernd zu spät komme. Die meiste Zeit sagt sie eigentlich gar nichts, was sowohl gut als auch schlecht ist. Es gibt keine Kritik, aber auch kein Lob.
Als ich frisch von der Universität kam, hatte ich jede Menge hohe Ziele. Wer hatte die nicht? Ich dachte, ich würde aus der Uni spazieren und geradewegs eine fantastische Karriere starten. Bram hatte mit seiner Vermutung, dass ich schreiben könne, nicht allzu weit danebengelegen. Ich habe Journalismus im Hauptfach und Werbung im Nebenfach studiert. Die Fächer schienen die beiden unterschiedlichen Seiten von mir anzusprechen – die visuelle wie die introvertierte. Und beides war kreativ.
Doch der Arbeitsmarkt war überflutet von lauter naiven Träumern wie mir. Ich hatte höllisches Glück, dass sich nach meinem Praktikum in der Herstellung des Bay Area Weekly eine offene Stelle auftat. Ich war Assistentin in der Werbung für Einzelhandel und Kleinanzeigen. Drei lange Jahre arbeitete ich unter zwei verschiedenen Chefs, machte alle Schichten, die ich konnte, bis ich schließlich aufsteigen durfte. Ich übernahm zunächst die Kleinanzeigen, dann die Einzelhändler.
Der Job ist okay. Kein bisschen aufregend, was ihn vermutlich nicht ganz so okay macht, doch aus der Warte von jemandem, der nur um des Jobs willen einen Job braucht, ist es ganz in Ordnung. Und da ich schon so lange dabei bin, habe ich die vollen Vergütungen, drei Wochen Urlaub im Jahr und ein Gehalt, das mir erlaubt, eine Miete in San Francisco zu bezahlen, was an sich schon an ein Wunder grenzt.
Dennoch ist es nicht das, was ich mit meinem Leben anfangen will, obwohl ich mir eigentlich nicht erlaube, von etwas anderem zu träumen. Ich meine, ich bin dreißig. Ich weiß, dass ich sagenhaft unreif bin, trotzdem hätte ich diese Frage allmählich mal klären müssen. Verdammt, ich müsste mir inzwischen über eine Menge Sachen im Klaren sein.
Steph und Nicola hatten es in gewisser Weise leichter. Beide wussten, dass sie in die Modebranche wollten, und auch wenn sie einige Hürden zu nehmen hatten, bis sie da ankamen, wo sie heute sind, haben sie es geschafft.
Und dann bin da ich, die helfen, kreativ sein und sich ausdrücken will, aber nicht genau weiß, wie. Ich weiß nur, dass von neun bis fünf eine Arbeit zu machen, die mich nicht interessiert, eine noch größere Leere in meinem Herzen hinterlässt. Wenn ich mich bei meinen Freundinnen darüber beklage, sagen beide, ich solle den Sprung ins kalte Wasser wagen und herausfinden, was ich machen will. Wenn ich mich bei meiner Mutter oder meinen Brüdern beklage, erzählen sie mir, ich solle dankbar sein, dass ich den Job habe, meine Miete bezahlen und mir Essen leisten kann. Das Problem ist, dass sie alle recht haben.
Ich muss allerdings zugeben, seit Bram mit der Artikel-Idee kam, regt sich etwas in mir, ähnlich einem schlummernden Vulkan. Zuerst dachte ich, es läge daran, dass ich mir dauernd erotische Szenen mit Lachlan ausmale; doch jetzt ist mir klar, dass ich vielmehr daran denke, wie es wäre, selbst zu schreiben. Meinen Namen gedruckt zu sehen. Meine Worte öffentlich zu machen. Auf die eine oder andere Art das Leben anderer zu verändern.
Während ich also an meinem Schreibtisch sitze und mit dem Stift meinen Pferdeschwanz aufwickle, wobei ich vorgebe, E-Mails zu lesen, frage ich mich, wie es wäre, in dem Großraumbüro gegenüber zwischen all den Redakteuren zu sitzen und eine Sache mit Leidenschaft zu verfolgen.
Ich sehe Candace an, meine ehrgeizige Kollegin in der Anzeigenabteilung, und sage ihr, dass ich gleich wieder da bin. Dann raffe ich meinen Mut zusammen und mache mich auf den Weg den Korridor hinunter zum Büro meiner Chefin. Meinen Mut brauche ich nicht für sie, sondern für denjenigen, mit dem ich danach reden muss.
Ihre Glastür steht offen, weshalb ich nur leicht anklopfe. »Lucy?«, frage ich und sehe hinein. Sie blickt über ihren Computerbildschirm hinweg und durch große Brillengläser zu mir auf.
»Hi, Kayla«, sagt sie. »Was gibt’s? Wie war der Margarita-Montag?«
»Ist ausgefallen«, antworte ich. »Ich war nur kurz in der üblichen Bar.« Irgendwie bin ich für Margarita-Montage berühmt. Dabei mag ich Tequila gar nicht so gern, aber ich liebe fruchtige Cocktails und mexikanisches Essen, weshalb ich seit ein paar Jahren jeden Montag in ein mexikanisches Restaurant gehe. Manchmal kommen Steph und Nicola mit, manchmal Leute von der Arbeit.
»Hör mal, ich habe einen Freund, der eine Wohnanlage in SOMA hat und Wohnungen an Leute in Not vermittelt, du weißt schon, bezahlbarer Wohnraum. Bisher finanziert er das alles allein, weil er keine Investoren findet. Ich glaube, er braucht nur ein bisschen Hilfe, und da habe ich mich gefragt, ob einer der Redakteure etwas über das Projekt schreiben könnte. Es ein bisschen bekannter machen. Es ist eine gute Sache, und ich glaube, die Stadt braucht solche Projekte dringend.«
Lucy zuckt mit den Schultern. »Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber wenn er keine Anzeige schalten will, musst du Joe fragen. Vielleicht findet er jemanden.« Sie lächelt mir zu. »Es ist richtig nett von dir, dass du das Projekt unterstützen willst.«
Ich nicke und verdrehe die Augen, bevor ich ihr Büro verlasse und weiter den Korridor hinuntergehe. Warum sind alle so verblüfft, wenn ich mal etwas Nettes tun will? Es ist ja nicht so, als wäre ich die reine Bosheit. Nur zu ungefähr vierzig Prozent. Das ist nicht mal die Hälfte.
Nachdem ich tief Luft geholt habe, steuere ich Joes Büro am Ende des Flurs an. Ich bin erst wenige Male hier gewesen, und Joe entspricht dem Klischee vom mürrischen, schlecht gelaunten Herausgeber.
Seine Tür ist geschlossen, und ich höre, dass er drinnen jemanden anschreit, also warte ich. Dabei beobachte ich einige meiner Kollegen in ihren Arbeitsnischen. Manche tippen hektisch und tragen gigantische Kopfhörer, andere sind an ihren Handys, reden und machen sich Notizen; wieder andere starren bloß mit leerem Blick auf ihre Bildschirme. Und dann ist da mein Freund Neil, der sich die Nägel feilt, wobei er vor Konzentration die Augenbrauen zusammenzieht.
Alle Redakteure – Neil ausgenommen – sehen eifrig, geschäftig und leidenschaftlich aus. Es schmerzt ein bisschen, dass ich das nicht habe.
Schließlich geht die Tür auf, und Mia, eine Journalistin, die ich kenne, kommt mit gesenktem Blick heraus, einige Blätter in ihrer Hand und vor Wut oder Scham gerötete Wangen.
Na super. Er hat also auch noch schlechte Laune.
Ehe ich es mir anders überlegen an, klopfe ich an die Tür und rufe: »Sir?«
»Was?«, kläfft er, und ich nehme es als Aufforderung, reinzukommen.
Joe sitzt an seinem Schreibtisch, die Hemdsärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt, sodass man seine Affenunterarme sieht.
»Ah, Sie«, sagt er abfällig und sieht mich kaum an. »Sie arbeiten bei den Anzeigen. Warum sind Sie hier?«
Ich trete nur einen Schritt weit ins Zimmer und antworte: »Ich habe eine Idee für eine Story, und Lucy hat mir gesagt, dass ich sie Ihnen mal vorstellen könnte.«
Das macht ihn stutzig. »Eine Story? Sie? Lassen Sie mich raten: Sie wollen eine Kolumne über Ihre Margarita-Montage schreiben.«
Woher zum Teufel weiß er davon?
»Nein, warten Sie«, fährt er fort. »Etwas über Dating in der Stadt und wie öde es ist.«
Ich runzle die Stirn. Ich habe keine Ahnung, wie er auch von meinem Dating-Elend wissen kann.
»Nein«, sage ich langsam und verschränke meine Arme. »Es geht eigentlich um eine Wohltätigkeitsorganisation.« Ich erkläre ihm Brams Projekt und hoffe, dass er am Ende ein wenig beeindruckt ist.
Aber nein. Seine Augen sind richtig glasig geworden. Als ich fertig bin, reibt er sie sich und seufzt.
»Ich sehe mal, ob jemand darüber schreiben will. Falls nicht, haben Sie Pech.«
»Und was wäre, wenn ich den Beitrag selbst schreibe?«, frage ich.
»Sie? O nein. Man mag hin und wieder über uns lachen, aber wir bemühen uns, unser ernsthaftes Image zu heben, nicht, es zu torpedieren. Schreiben ist nicht Ihre Stärke.«
»Woher wissen Sie das?«, platze ich heraus.
Er sieht mich streng an. »Ich würde Sie ja bitten, mir das Gegenteil zu beweisen, aber dazu fehlt mir die Zeit.« Wieder seufzt er und blickt auf die Ausgabe der letzten Woche, die er in der Hand hält. »Die Story passt zu unserer neuen Agenda. Gehen Sie und suchen Sie sich jemanden, der sie für Sie schreibt.«
In diesem Moment möchte ich Bram umbringen, weil er mich in diese Lage gebracht hat. Trotzdem danke ich Joe und verlasse das Büro. Ich marschiere direkt auf Neil zu.
»Neil«, sage ich süßlich, lege die Hände auf seine Schultern und massiere sie ihm.
»Was habe ich dir über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz gesagt?«, kontert er.
»Du hast mir gesagt, sie zählt nur, wenn ich einen Schwanz habe.«
Er gibt einen zustimmenden Laut von sich. »Und hättest du einen, würde ich dich immerzu anfallen. Erklär mir noch mal, warum du mich nicht mit deinem Bruder verkuppelst.«
Ich drücke seine Schultern extra fest und hoffe, dass es ihm wehtut. »Weil du eine männliche Schlampe bist und ich Toshio wie verrückt liebe. Ich will nicht, dass sein Herz zertrampelt wird.«
»Erstens«, sagt er und jault leise, »ist das nicht wahr. Und zweitens würde er sofort jemand Neues finden. Ich habe gesehen, wie niedlich er ist. Genau wie du. Und übrigens kann ich das mit der Schlampe direkt zurückgeben.«
Ich verdrehe die Augen. »Hör mal, ehe wir jetzt ganz grob werden. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Eigentlich ist es ein Gefallen für einen Freund, aber ich habe Schwierigkeiten, ähm, ihm den zu tun.«
»Iiih, Gefälligkeiten«, sagt er.
Ich nehme meine Hände weg.
»Nicht aufhören«, befiehlt er sofort und tippt sich auf die Schulter.
Ich massiere ihn weiter. »Es ist eine gute Tat.«
»Doppel-Iiih. Und warum willst du eine gute Tat tun?«
Ich zucke mit den Achseln. »Weiß ich nicht. Will ich eben. Aber ich brauche deine Hilfe.« Zum dritten Mal heute erkläre ich Brams Situation.
»Das ist nicht mal der Typ, den du vögelst. Hältst du dich immer noch an diesen dämlichen Eid, schwanzlos zu bleiben?«
»Ja, tue ich, und, nein, ich vögle ihn nicht, aber er ist der Freund meiner Freundin.«
»Das kaufe ich dir nicht ab. Warum interessiert dich das wirklich?«
Weil er mich gebeten hat, möchte ich sagen. Weil es nett ist, sich gebraucht zu fühlen, als könnte ich irgendwas bewirken. Und weil, nun ja, vielleicht, weil an dem Deal noch ein heißer Rugbyspieler-Arsch hängt.
»Weil es mich interessiert«, sage ich. »Kannst du was schreiben?«
»Nein.«
Laut stöhnend trete ich einen Schritt zurück und werfe dramatisch die Hände in die Luft. »Wieso nicht? Bitte?«
»Kayla, Schätzchen, ich bin sowieso schon völlig überlastet. Warum fragst du nicht jemand anderen?«
Ich blicke mich um. Obwohl die Hälfte der Leute große Fans von Margarita-Montagen zu sein scheinen und es genießen, wenn ich zu viele Tequila Sunrise trinke und am Ende auf wackligen Tischen tanze, glaube ich nicht, dass sie mich genug mögen, um etwas zu schreiben, das ich vorgeschlagen habe.
»Oder schreib es selbst«, schlägt Neil vor.
Ich sehe ihn verwundert an. »Im Ernst? Das hatte ich Joe vorgeschlagen, und der hat mich ausgelacht.«
»Joe lacht jeden aus. So ist er eben. Und ein mürrischer alter Mann, der entweder dringend vögeln oder gevögelt werden muss, da bin ich mir nicht sicher.«
Ich verziehe das Gesicht.
»Ich sage dir, schreib trotzdem und reich es ein. Ich helfe dir sogar dabei, redigiere es und so. Putz es aus. Hast du nicht gesagt, dass du Journalismus studiert hast?«
»Kommunikation«, murmle ich. »Hauptfach Journalismus.«
»Das reicht. Die Hälfte der Leute hier hat nicht mal einen Uni-Abschluss. Ich zum Beispiel. Blanken Dusel und ein hübsches Gesicht.«
»Na gut.« Ich lehne mich an seinen Schreibtisch und sehe ihn flehend an. »Kannst du mir ein paar Tipps geben?«
Neil dreht sich auf seinem Stuhl um, faltet die Hände vor seinem Bauch auf dem makellosen violetten Hemd. Seine Lippen formen ein amüsiertes Lächeln, das mich an Filmbösewichte erinnert. »Als Erstes, Süße, brauchst du einen Ansatzpunkt.«
»Den habe ich dir doch eben erklärt. Reicher Bursche tut Gutes.«
Er stößt einen angewiderten Laut aus und wirft den Kopf in den Nacken. »Langweilig!«, brüllt er. Jemand im Hintergrund ranzt ihn an, leise zu sein, doch er winkt bloß ab. Dann stützt er die Ellbogen auf die Knie und deutet auf mich. »Nein. Kein reicher Bursche tut Gutes. Niemand interessiert sich für reiche Idioten, und falls es sich nicht um Oscar-Gewinnerinnen wie Susan Sarandon handelt, schert es die Leute im Allgemeinen auch nicht, was reiche Leute tun, ob gut oder schlecht.«
»Stimmt nicht«, widerspreche ich. »Die ganzen Klatschblätter berichten nur über die Reichen und alles, was sie Schlimmes machen.«
»Finde einen anderen Ansatz«, sagt er.
Ich zermartere mir das Hirn. »Die Stadt braucht solche Projekte. Jeder jammert, dass es keine bezahlbaren Wohnungen gibt. Die ganze Welt macht sich über uns lustig, weil wir absurd viele Obdachlose haben. Das ist eine Lösung. Es ist etwas Gutes, egal, wer es tut.«
»Kindchen, es gibt tonnenweise Leute, die jeden Tag Gutes tun. Die meisten interessiert es nicht, es sei denn, man bringt sie dazu, sich zu interessieren. Wir sind alle zu sehr darauf gedrillt, all die beschissenen Details des Lebens auszublenden, ebenso wie die Milliarden, die vom Leben verarscht werden. Wir sind allesamt egoistisch und selbstverliebt, fixiert auf unsere eigenen Bedürfnisse, bis jemand dafür sorgt, dass wir uns persönlich betroffen fühlen. Also, wie kannst du das schaffen?«
Heiliger Bimbam. Seit Jahren arbeite ich mit Neil zusammen, habe mit ihm in Clubs gefeiert, seine Hand gehalten, wenn er wegen eines Kerls mit Schnurrbart heulte, aber so klug wie jetzt ist er mir noch nie vorgekommen.
»Tja, Bram ist scharf.«
»Das hilft«, sagt er und merkt sichtlich auf.
»Und sein Partner noch viel mehr«, ergänze ich und stelle fest, dass ich verträumt lächle, als ein Bild von Lachlan meinen Kopf ausfüllt. »Ein Rugbyspieler aus Schottland.«
Neil setzt sich auf. »Ist er groß?«
»O ja, er ist groß«, antworte ich grinsend.
»Weißt du das aus Erfahrung? Was ist mit deinem Eid?«
Ich atme übertrieben laut aus. »Nein, das weiß ich nicht aus Erfahrung. Ich habe ihn nur gestern Abend in der Bar gesehen. Und er … er ist … einfach so ein Mann. Ich kann das nicht erklären, aber er dürfte wohl der heißeste Typ sein, den ich je gesehen habe. Und gebaut wie ein Mammutbaum.«
»Wie ein North-Cali-Mammutbaum?«, fragt er aufgeregt.
»Genau so«, sage ich. Mich freut, dass ich jemanden habe, mit dem ich meine plötzliche Obsession teilen kann. »Er ist mit Tattoos bedeckt, hat Geld und Lippen, an denen man dringend saugen will.«
»Unter anderem.«
»Und ich glaube, jemand erwähnte, dass er gut ist in dem, was er tut. Ich glaube, er hat einige Male für Schottland im World Cup gespielt.«
»Scheiiiiße«, sagt Neil grinsend und schwenkt eine Hand durch die Luft, als würde er mich mit Feenstaub bestreuen. »Kayla, das ist dein Ansatz. Das Scharfe. Und die Berühmtheit.«
»Du hast eben gesagt, es interessiert keinen, wenn Berühmtheiten Gutes tun. Und ich bin nicht sicher, dass er berühmt ist, nur weil er beim World Cup im Rugby dabei war. Das sieht sich keiner an.«
»Tja, dann ist er vielleicht zu Hause berühmt. Und falls nicht, schreibst du ihn zum Promi hoch. Das ist sowieso spannender. Außerdem kennst du unsere Leser – Frauen und Schwule.«
Ich ziehe eine Grimasse. »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du, wenn du nicht so schwul und niedlich wärst, total unmöglich wärst?«
»Ja, so komme ich damit durch«, sagt er und lässt seine Augenbrauen tanzen. »Also, geh und mach das. Interviewe ihn. Vergiss den anderen Typen. Und sieh zu, ob du einige Fotos von Mr. Mammutbaum bekommst. Vorzugsweise nackt. Du weißt ja, dass viele Rugbyspieler für Nacktkalender posieren. Ist irgendwie ihr Ding.«
Schlagartig schwindet mein Lächeln. Lachlan interviewen? »Kann ich nicht, na ja, über ihn schreiben, ohne direkt mit ihm zu reden?«
Neil sieht mich an, als sei ich ein Schwachkopf. »Woher willst du wissen, was du schreiben sollst, wenn du ihn überhaupt nicht kennst?«
»Ich könnte Bram fragen«, schlage ich hoffnungsvoll vor.
»Nein, du musst den Kerl interviewen. Wieso ist das ein Problem? Eigentlich solltest du sofort darauf anspringen. Und danach ihn.«
Ich zupfe nervös an meinem Haar. »Na, es ist nur … er ist nicht direkt superfreundlich. Oder gesprächig. Und ich glaube nicht, dass er mich mag.«
»Heißt das, er ist noch nicht deinem Charme verfallen?«, fragt er hämisch.
Ich sehe ihn so wütend an, wie ich kann. »Noch nicht. Und es ist nicht so, als hätte ich es gestern Abend überhaupt versucht.«
Er zuckt mit den Schultern. »Dann probier’s jetzt. Du willst diese Story, erarbeite sie dir.« Er wippt auf seinem Stuhl, völlig selbstsicher und anscheinend froh, dass ich mal erlebe, wie schwer sein Job tatsächlich ist.
»Schön, ich mach’s«, sage ich und stolziere zu meinem Tisch zurück. Ich höre ihn noch »Viel Spaß!« hinter mir herrufen.
Erst als ich wieder an meinem Schreibtisch bin, heben die Schmetterlinge in meinem Bauch ab, und die sind nicht von der netten Sorte. Ich werde wahnsinnig nervös.
Ehe ich ins Grübeln komme, wähle ich Brams Nummer und bete, dass ich ihn nicht bei irgendwas erwische, das er gerade mit Nicola tut.
»Kayla?«, fragt er überrascht.
»Ja, hi, Bram.«
»Hast du mit deinem Chef geredet?«
»Habe ich, aber hör zu … Ich werde den Artikel schreiben.«
»Das ist doch genial!«
»Aber ich soll Lachlan interviewen, nicht dich.«
Er stockt. »Lachlan? Warum? Was ist mit mir verkehrt?«
»Du bist nicht nachrichtenwürdig.«
»Und mein Cousin ist es?«
»Ja, schon. Ich meine, hast du ihn dir mal angesehen?«
»Hast du dir mich mal angesehen?«
»Habe ich, Bram. Bedaure. Du bist nicht mein Typ.«
Er schnaubt ungläubig.
»Ich sage es dir, wie es ist. Jetzt gib mit Lachlans Nummer, oder es wird überhaupt keine Story über dein Wohnprojekt erscheinen.«
»Okay, ja, gut«, sagt er rasch.
»Und du deine«, kontere ich. Er gibt mir die Nummer, ich notiere sie. Natürlich ist es eine internationale.
»Kann ich ihm schreiben, denn das ist sonst ein Ferngespräch?«, frage ich.
»Klar«, sagt Bram. »Ich glaube allerdings, dass du mehr aus ihm rausbekommst, wenn du persönlich mit ihm redest. Am Telefon ist er nicht sehr gesprächig.«
»Was du nicht sagst.«
»Eben. Aber pass auf, worüber ihr auch redet, stell Lachlan keine persönlichen Fragen, okay.«
Ich setze mich auf, denn jetzt wird es spannend. »Warum nicht?«
Er seufzt sehr laut und sehr gedehnt. »Tu es einfach nicht, Kayla. Ich kenne dich. Du willst von jedem alles über das Privatleben wissen, und wir alle finden das witzig, aber er ist anders. Wenn du du selbst bist, schreckst du ihn nur ab. Er ist sehr verschlossen. Er hat … na ja, sei einfach professionell. Wenn du zu tief gräbst, wird er wahrscheinlich nur um sich schnappen, und du kriegst gar nichts.«
»Schnappen? Ist er ein Hund?«
Oder ein Tier?
»Na, er ist eben verschlossen, und er hält nichts von Blödsinn. Also konzentrier dich auf das Wesentliche.«
»Aha.«
»Als da wäre …«
Diese Lippen. Diese Hände. Diese Augen. Aber ich sage: »Das Wohnprojekt.«
»Richtig. Hey, habe ich mich eigentlich schon dafür bedankt, dass du das machst?«
»Nein, hast du nicht.«
Dann lege ich auf, bevor er eine Chance hat, mehr zu sagen.
Ehe ich wieder die Nerven verliere, tippe ich die ewig lange Nummer in mein iPhone ein und schreibe ihm. Na ja, eigentlich starre ich erst mal minutenlang aufs Display, tippe dann verschiedene Sätze ein und lösche sie wieder, ehe ich noch mehr aufs Display glotze. Was Bram über ihn sagte, macht mich nur noch nervöser, als ich sowieso schon war. Ich meine, mit Leuten kann ich umgehen. Ehrlich. Ich bin nicht ängstlich. Aber hier bewege ich mich auf unbekanntem Terrain. Ich bin keine Journalistin, auch wenn ich das studiert habe, und auf einmal fühle ich enormen Druck auf meinen Schultern.
Endlich! Ich schreibe ihm: Hi, hier ist Kayla, die Freundin von Nicola. Wir sind uns gestern Abend in der Bar begegnet. Bram möchte, dass meine Wochenzeitschrift etwas über das Wohnprojekt bringt, und mein Redakteur meint, ein Interview mit dir wäre eine gute Idee. Wäre das okay für dich?
Und dann warte ich.
Und warte.
Stunden vergehen.