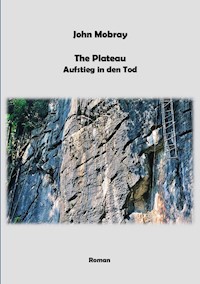
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Fünf Schulfreunde aus den USA beschließen, in Kanada zwei Tage in einem Nationalpark auf einem Felsen in der freien Natur zu verbringen, um ihren 15jährigen Schulabschluss in Form einer Herrenpartie zu feiern. Sie haben sich lange nicht gesehen und hoffen auf interessante Gespräche. Alle verbindet aber auch eine unschöne Geschichte aus der Vergangenheit. Sie vermeiden darüber zu reden, aber die Erinnerungen daran holen sie doch immer wieder ein. Sie versuchen das mit Berichten über ihre erfolgreichen Karrieren zu übertünchen, aber werden dann auf äußerst brutale Art mit ihrer Schuld konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
The Plateau
Aufstieg in den Tod
Copyright: © 2021 John Mobray
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
“The Plateau”
Der Mann zwang sich nicht auf den Körper vor sich zu sehen, und auch möglichst alle Emotionen abzuschalten. Er hatte die Augen ganz fest zusammengekniffen, aber hätte ziemlich genau erzählen können, was man in seiner Blickrichtung so erkennen konnte. Der Boden, auf dem er hinter dem anderen Mann kniete, lag etwa 40 Meter über dem Niveau der umliegenden Gegend. Bevor sie aufgebrochen waren hatte er sich im Internet über diese geologische Besonderheit informiert. Es war weiß Gott keine spektakuläre Sache, nichts, was irgendwelche Freaks mit dem Kitzel der Gefahr oder einer besonderen Herausforderung anlocken könnte. Die steinerne Erhebung war schlicht und ergreifend das Ergebnis einer vor Jahrtausenden abgelaufenen Geländebildung, die allerdings etwas aus dem Rahmen des Üblichen gefallen war. Diese ungewöhnliche Formgebung hatte für die modernen Menschen schon seit gut 140 Jahren eine gewisse Anziehungskraft entwickelt, die heute besonders bei den Vertretern der Generation Z eine besondere Faszination auszuüben schien. Vielleicht war es die Gewissheit, vor einer durchaus nicht allzu schwer zu bewältigen Herausforderung zu stehen, aber diese nicht unterschätzen zu dürfen.
"The Plateau" lag zirka 25 Kilometer von Yellowknife in Kanada entfernt. Nach Yellowknife kam man ganz komfortabel über den Luftweg, wobei der Flughafen bestenfalls in der Kreisklasse der Destinations spielte, und im Jahr gerade einmal 127.000 Passagiere abfertigte. Das war aber auch keine Überraschung, denn der Ort selbst hatte außer einer florierenden Holzindustrie im Umland so gut wie gar nichts zu bieten. Die Stadt selbst war ein planerisch unorganisierter und zusammengestückelter Haufen von Gebäuden verschiedener Zeitepochen. In den Jahren des Goldrush war das Gerücht aufgekommen, dass in den naheliegenden Flusstälern enorme Mengen des Edelmetalls zu finden wären. Nichts davon hatte gestimmt, und die regelrecht verhungernden Goldschürfer hatten den mithilfe von Baumstämmen und Brettern damals schnell hochgezogenen Ort voller Wut und Verzweiflung in Schutt und Asche gelegt. Erst als der Goldrush von 1799 abgeflaut war, und sich eine große Ernüchterung bereitgemacht hatte, kehrte in die Gegend etwas Frieden und Vernunft zurück. Die Überlebenden mussten sich wohl oder übel mit den Tatsachen anfreunden und verstehen, dass es hier keinen schnellen Reichtum durch das Gold geben würde.
So war in Yellowknife ein bescheidener und anpackender Typus Mensch entstanden der davon ausging, dass ihm nichts geschenkt werden würde. Glücklicherweise waren die Leute schon damals klug genug gewesen in die Zukunft ihrer Kinder durch Bildung zu investieren. Das Land rings um sie herum würde ihnen noch viele Jahre Verdienst bieten können, aber sie wussten, dass sie nicht auf Ewigkeiten davon leben konnten. Zwar hatten Geologen noch einige Vorkommen an Zinn finden können, aber deren Abbau wäre extrem teuer und damit vollkommen unwirtschaftlich gewesen. So hatte sich ziemlich schnell die Erkenntnis breit gemacht, in einem wenig mit Rohstoffen ausbeutbaren Naturparadies zu leben. Es lag also geradezu auf der Hand, sich mit der Vermarktung der eigentlich noch einigermaßen unberührten Natur eine Erwerbsquelle für die Leute vor Ort aufzubauen. Die Stadt war zu dieser Zeit schon fast blutleer, denn wer konnte, zog weg. Es war einzig und allein dem Bürgermeister Will Hernes zu danken, dass er auf welchen Wegen auch immer einen Investor davon überzeugen konnte, einige aufgegebene Häuser in dem Ort zu günstigen Unterkünften für Naturfreunde zu verwandeln. Der Standard war mies, aber man ging davon aus, dass ohnehin nur zwei Zielgruppen nach Yellowknife kommen würden.
Eine breit angelegte soziologische Studie in Kanada aus dem Jahr 2009 hatte ergeben, dass viele der über Fünfzigjährigen, die übrigens in der überwiegenden Anzahl beruflich erfolgreich und finanziell gut bis sehr gut abgesichert waren, ein diffuses Gefühl über ihren eigenen Anteil an den negativen Wirkungen auf die Umwelt verspürten. Wenn man grob zurückrechnete, waren diese Leute so um 1980 nach Abschluss ihrer Ausbildungen in einen Job eingestiegen. Zu dieser Zeit gab es zwar schon etliche Organisationen, die die ungebremste Ausbeutung und Zerstörung der Natur anprangerten, aber ihre Stimmen hatten noch kein großes Gewicht. Aber nach und nach hatte sich der Wind gedreht, und immer tiefer drangen solche Diskussionen in die Gesellschaft ein. Die jetzigen Best Ager hatten sich angepasst um nicht anzuecken, und gingen eben ökologisch konform auf Wanderurlaube. Dafür bot die Gegend um die unattraktive Stadt mehr als genug Platz.
Die andere Zielgruppe war die Generation ihrer eigenen Kinder. So im Schnitt am Anfang und um die Mitte der 1990iger Jahre geboren, hatten die Mädchen und Jungen keinen einzigen Moment erleben müssen, in dem ihnen irgendetwas gefehlt hätte. Natürlich betraf das nicht die gesamte Generation, aber nie zuvor waren so viele Kinder so im Wohlstand aufgewachsen. Sie waren von ihren Eltern schon krankhaft übertrieben umsorgt und in etlichen Dingen wohl so auch teilweise lebensfremd geworden. Allerdings manifestierte sich dies auch in einer Abneigung gegen diese Überversorgung, und dieser wollten sie zumindest einmal im Jahr mit einer für sie unschädlichen Revolte entkommen. Die Lösung war einfach: Gruppen von Männern oder Frauen spielten für ein paar Tage die unangepassten lässigen Typen, die in den Urlaubstagen mal richtig die Sau rausließen und auf alle Konventionen schissen. Dazu zählte auch das Zurschaustellen einer spartanischen Lebensweise, und diese wurde ihnen in den Billigunterkünften in der Stadt bestens geboten. Die Eltern gingen also mit Wanderstöcken auf ihre überschaubaren Touren, die Kinder suchten eine machbare Herausforderung, die aber nicht zu mickrig ausfiel.
"The Plateau" erstreckte sich bis zu seiner höchster Felskante auf exakt 149,87 Meter über dem mittleren Meeresspiegel. Das klang zwar einigermaßen beeindruckend aber man musste in Betracht ziehen, dass die Gegend um Yellowknife herum selbst schon auf zirka 110 Meter Höhe lag. Die rund 25 Kilometer bis zum "Plateau" wiesen kaum Höhenunterschiede auf, so dass man wohl einigermaßen richtig lag wenn man davon ausging, dass die Erhebung an die 40 Meter hoch war. Es hatte allerdings auch noch nie jemanden ernsthaft interessiert ob das tatsächlich so war, denn wenn man unten am Fuß des Gebildes stand, sprach es allein aufgrund seines Anblicks für sich. Im ersten Moment war jeder, der dort stand, von dieser Komposition überrascht. Mitten aus einem dicht bewachsenen Waldstück ragte ein Felsklotz heraus. Er wies eine fast kreisrunde Grundfläche von etwa 60 Meter Radius auf. Darauf baute sich eine Gesteinsschicht auf, die auf den ersten Blick vielleicht sechs Meter hoch war. Vom Standpunkt des Beginns des Aufstiegsweges nach oben konnte man sehen, dass schon hunderte von Leuten Fragmente des Gesteins auf ihrem Anstieg herausgetreten hatten. Mit der Zeit hatte sich eine Art harmloser und leicht ansteigender Wanderweg ergeben, der sich schneckenförmig an den Grundkörper anpresste. Wenn man diesen beschritt kam man folgerichtig von der Sichtachse des Beginns des Aufstiegsweges weg und sah dann, dass "The Plateau" eine absolut skurrile Form hatte. Die erste Anhöhe war fast eben, hatte eine kaum sturzgefährliche nahezu wie planiert wirkende Gesteinsoberfläche und erschien langweilig. Aber von dort aus konnte man erkennen, dass auf dieser Ebene eine weitere aufsaß, die zirka acht Meter höher lag. Darüber wuchs das Gestein noch weiter in die Höhe. Es war ein faszinierender Anblick. Wie in einem altertümlichen Amphitheater bildete der Fels in seinem Rücken eine Art nicht besonders kräftigen halbkreisförmigen Bühnenhintergrund, der schätzungsweise jeweils an der Hälfte der zweiten Ebene ansetzte. In Bezug zu der Grundfläche des Gebildes war diese Ebene schon kleiner und maß im Radius noch ungefähr 40 Meter. Auf dieser Fläche gab es dann aber den eigentlichen aufstrebenden Aufbau des Berges. Vom Rücken der schmalen Felswände her ragte das Gestein erst rund und dann schnabelartig nach vorn, so dass der Kletterer nicht einmal fünf Meter Abstand bis zur Kante der zweiten Ebene hatte. Rechts und links davon war der Abstand deutlich größer, es war eigentlich nur die mittige Stelle, die etwas angsteinflößend war. Bis zur obersten Fläche waren es noch ungefähr 15 Meter. Dann würde man vor der Theaterkulisse, vor der Theaterrückwand, stehen, und hätte die Spielfläche für sich.
Als die ersten Kletterer hochgehen wollten waren sie der Überzeugung gewesen, mit dem Berg leichtes Spiel zu haben. Da der Fels ziemlich zerklüftet war bot er viele Tritte und Halte. Er war zirka acht Meter in einem etwa 80-Grad-Winkel aufgewachsen, um dann aber in dieser Höhe einen Gesteinsvorsprung fast einen Meter nach vorn zu wölben. Dieser zog sich über die gesamte Breite der Formation hin. Der Vorsprung an sich war gar nicht hoch, nicht einmal 20 bis 30 Zentimeter. Darüber sprang der Fels wieder etwas zurück, und als ob die Spielereien bei seiner Entstehung nicht schon ausgereicht hätten, schien der Fels dann nach vorn zu kippen und zeigte mehr als 105 Grad Neigung bis zum obersten Plateau. Wer vor dem "Plateau" an einer günstigen Stelle stand konnte sehen, dass die Falllinie von der obersten äußersten Plattform und deren Kante bis zum Fuß des Aufstiegsbeginns auf der zweiten Ebene eigentlich fast senkrecht war.
Aus dieser Ansicht hatte die ersten Besteiger in den 70iger wohl geschlussfolgert, dass sie nur den komplizierten Vorsprung bewältigen müssten, und dann mit ihren traditionellen Techniken den restlichen Aufstieg abhaken könnten. Tatsächlich war es nicht schwierig gewesen bis unter den Vorsprung zu kommen, aber dann begannen die Probleme. Die Unterkante des Felsens hatte sich als brüchig herausgestellt. Man konnte dort Sicherungshaken nicht stabil einschlagen. Um aber diese Stelle bewältigen zu können war einer auf die Idee gekommen, eben mehrere Haken relativ eng aneinander zu setzen und damit den Zug bei einem eventuellen Absturz auf die einzelnen Haken zu verteilen. Ein erfahrener Boulder hatte sich als erster vorgewagt und war tatsächlich bis zum Ende des Vorsprungs gekommen, aber hatte dann keinen Griff mehr gefunden, war abgerutscht und in das Seil gefallen. Wenig überraschend waren alle Haken sofort aus dem porösen Gestein herausgebrochen, und der Mann war erst gegen die Felskante geschleudert worden und dort hart aufgekommen, was er aber noch überlebt hatte. Da die weiter unten angebrachten Haken aber nachlässig eingeschlagen waren, stürzte er dann bis auf den Grund der zweite Ebene etwa sechs Meter ungebremst ab. Diese Plattform war zwar eben, aber bestand nur aus Gestein. Ein nicht einmal zehn Zentimeter hohes und vor etlicher Zeit aus der Formation herausgebrochenes Gesteinsfragment lag genau dort, wo er mit dem Hinterkopf aufschlug. Obwohl der Mann einen Schutzhelm getragen hatte, war dieser an der Aufschlagstelle zerborsten und der Stein hatte den Hinterkopf des Mannes auf brutale Art aufgerissen, so dass Blut, Gehirnmasse und Knochenteile aus der zersplitterten Schädelschale ausgetreten waren.
Nach diesem üblen Misserfolg waren die Behörden eingeschritten und hatten die Besteigung des "Plateau" zunächst einmal auf unbestimmte Zeit verboten. Es war aber so, als hätte gerade dieser Unfall viele Leute angelockt, die diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen wollten. Natürlich war es eine absolut fehlgeleitete Aussage, sich an dem Felsen "rächen" zu wollen. Aber in der Kletterszene waren viele Dinge eben nicht mit dem normalen Menschenverstand zu erklären. Sicher konnte man verstehen, dass es Eins zu Null gegen die Bergsteiger stand, aber eine Vermenschlichung von Gestein war doch schon mehr als abwegig. Die weiteren Versuche erbrachten keine neuen Erkenntnisse, die Unterseite des Vorsprungs konnte aufgrund ihrer Porosität nicht mit Haken gesichert werden, und verhinderte zumindest an dieser Stelle einen Aufstieg.
Die halbkreisförmige "Theaterrückwand" war nicht einfacher zu bezwingen. Sie reckte sich extrem steil bis auf 40 Meter Höhe empor, aber schien auf den ersten Blick erklimmbar. Bei den ersten Aufstiegsversuchen stellte sich heraus, dass das Gestein zur Zeit seiner Entstehung aus unterschiedlichen Materialien geschichtet worden war. Bis auf etwa 15 Meter Höhe war es homogen und sehr stabil. Darüber ließ die Festigkeit nach, war aber noch ausreichend. Erst in zirka 20 Meter Höhe, also in ungefährer Höhe der auf der Vorderseite der Formation befindlichen zweiten Ebene, wurde der Fels regelrecht löchrig. Er bestand aus Serpentinit, welcher an seiner olivgrünen Farbe zu erkennen war. Die Schicht war kaum zwei Meter hoch, sie war irgendwann bei der Gebirgsbildung entstanden. Allerdings wies sie bestimmten Stellen hartes Gestein auf. Von einem Gebirge konnte man von der einzelnstehenden Formation weiß Gott nicht sprechen, aber ein Geologe hätte leicht erklären können, warum gerade diese steinerne Erhebung an dieser Stelle erhalten geblieben war, und rings um sie heute flaches Land war. Es war nur schwer mit menschlichen Zeitdimensionen zu ermessen, wie Jahrtausende eine Landschaft aus Urstromtälern geformt und abgeschliffen hatten. Auch die in den Flüssen transportierten Gesteinsarten oder die wechselnden klimatischen Bedingungen hatten einen zufälligen Brei an Sedimenten geschaffen, der sich vollkommen chaotisch irgendwo abgelagert hatte, und dann durch weitere Einflüsse zum Teil zu magmatischem Gestein verwandelt worden war. Aber es gab tausende Spielarten, wie Sedimente entstanden waren, welche Besonderheiten sie aufwiesen, und wo sie sich abgelagert hatten. Manche Formationen waren recht homogen, andere bunt durcheinandergewürfelt.
An der "Theaterrückwand" war also die nächste Problemstelle aufgetaucht. Da es aber unterhalb der Stelle gute Tritte gab hatte man diese dann doch bewältigen und vor und nach dieser Schicht Haken stabil einschlagen können.
Dieser Weg nach oben stellte also für einen geübten Kletterer kein großes Hindernis da.
Er war gut mit Haken gesichert und wer es darauf anlegte, konnte in gut 15 Minuten auf dem hochaufragenden und doch recht breiten Grat der "Theaterrückwand" stehen.
Dave Brody
Die Abneigung seinem Vater gegenüber war im Verlauf der vergangenen Jahre nicht geringer geworden, sie hatte sich im Gegenteil immer mehr erhöht. Aus einem anfänglichen pubertären Unverständnis der Notwendigkeit, sich als Familienvater um das Auskommen der Frau und der Kinder kümmern zu müssen, und dazu auch bestimmte Dinge zähneknirschend in Kauf zu nehmen, war immer schneller der Eindruck entstanden, dass sein Vater ein mutloser und duckmäuserischer Typ war, der sich mit seinem Arsch immer ganz eng an eine imaginäre Wand herandrückte, um ja nicht einen Konflikt hineingezogen zu werden. Was den Bereich der Arbeit anging konnte sich Dave natürlich kein Urteil erlauben (weil er das nicht miterleben konnte), aber aus dem allgemeinen Verhalten seines Vaters schlussfolgerte er, dass er auch dort zu den Schwanzeinziehern gehörte. Schon die wochentägliche Prozedur des Eintretens in das durchaus attraktive einstöckige und recht solide gebaute Holzhaus sagte ihm, dass sein Vater sein devotes Verhalten, wie sicher auch im Büro praktiziert, auch zu Hause fortsetzen würde.
Dave hatte erstmalig mit ungefähr zehn Jahren mitbekommen, dass seine Mutter ein ausgewachsenes Alkoholproblem hatte, ohne dass er es damals schon so konkret hätte benennen können. Dass Mom früh kaum das Frühstück für ihn und seine Schwester Lea auf den Tisch bringen konnte (sein Vater war da schon auf dem Weg zur Arbeit), hatte er lange auf einen großen und durch irgendwelche Umstände veranlassten Schlafmangel geschoben. Etwa klarer sah er dann, als er zufällig und heimlich einmal abends durch eine angelehnte Tür spähend eine Szene mitbekommen hatte, in der seine Mutter in dem unaufgeräumten Wohnzimmer ohne einen Rest von Beherrschung über ihre den Dienst versagenden Beine gestolpert und einen Moment auf dem Teppich liegen geblieben war. Als es ihr dann gelungen war wieder aufrecht zu stehen, war ihr jegliche Körperkontrolle entglitten, und sie hangelte sich von Möbel zu Möbel bis ins Schlafzimmer.
Dave hatte zu dieser Zeit noch keinerlei Erfahrungen mit irgendwelchen Rauschmitteln gemacht, denn er wuchs ja eigentlich in einem guten bürgerlichen amerikanischen Haushalt auf. Am Wochenende saßen alle vier gemeinsam am Frühstückstisch, und obwohl er es als zehnjähriger Junge lieber nicht wahrhaben wollte sah er, dass seine Mutter ihre flatternden Hände nicht unter Kontrolle hatte und keinen Kaffee trank, weil sie die Tasse vermutlich nicht hätte halten können. Erst um die Mittagszeit herum, und vermutlich nach einigen Drinks, war seine Mom wieder als normal zu empfinden. Sie konnte hervorragend kochen und war um diese Zeit dann auch in guter Form, gesprächig und freundlich. In dieser Stimmungslage blieb sie bis nach dem Abendessen, um danach zunehmend regelrecht zusammenzufallen. Sie saß dann mit seinem Vater vor dem Fernseher und sah sich Filme an. Dave bezweifelte, dass sie der Handlung richtig folgen konnte, denn ab und zu fiel ihr Kopf gegen die Polsterwangen ihres hohen Ohrensessels. Da er und seine Schwester nach 20 Uhr ihre Zimmer nicht mehr verlassen durften und sich im Bett aufhalten mussten blieb ihnen auch noch längere Zeit verborgen, dass ihr Vater seine Frau dann stets bei ihm untergehakt zu ihrem Bett bugsieren musste. Alice Brody wirkte dann wie eine von ihren Schnüren abgetrennte Marionette, die ohne Hilfe einfach zusammenfallen würde. Warum sein Vater nichts gegen den offensichtlichen Verfall seiner Mutter unternahmen konnte er nicht verstehen, aber er sollte es später in seinen eigenen Beziehungen erleben, wie schnell jemand ohne Aufgaben den Kompass im Leben verlieren konnte.
Zwei Jahre später war die Situation dann vollends aus dem Ruder gelaufen, weil seine Mutter zunehmend aggressiver auftrat. Bis zum Mittag schien sie nicht zu trinken, und in dieser Zeit wickelte sie die nur absolut notwendigen Dinge ab, die mit der Haushaltführung zu tun hatten. Richard Brody war Bezirksleiter bei einem größeren Baustoffhändler in der Stadt und aus seinem Job ergaben sich ganz einfach viele geschäftliche Kontakte mit nicht ganz unbedeutenden Personen des Ortes. Man lud sich in größeren Abständen gegenseitig zu einer Party ein. Wenn seine Frau Alice auf einem bestimmten Level der Trunkenheit blieb war sie eine durchaus liebenswerte und schlagfertige Gastgeberin, die die anwesenden Leute gut unterhalten konnte. Erst wenn die Gäste das Haus verlassen hatte trank sie schnell und viel weiter, bis ihr Mann sie dann zu ihrem Bett brachte, in dem sie noch angezogen sofort einschlief.
Es gelang noch eine ganze Weile Alice Brodys Suchtprobleme vor der Öffentlichkeit einigermaßen verschlossen zu halten, aber es waren doch schon etliche Gerüchte in Umlauf gekommen, weil sie sich bei ihren wenigen Einkäufen recht seltsam verhalten und wie abwesend gewirkt hatte. Auch ihre unklare Sprache sowie Bewegungsprobleme waren aufgefallen. Dave wurde in der Schule wegen dem Verhalten seiner Mutter verächtlich betrachtet, weil in den Familien seiner Mitschüler öfter einmal über die eigenartige Missis Brody gesprochen wurde.
Er selbst konnte seiner Mutter nicht helfen und er betete, dass sein Vater endlich etwas unternehmen würde.
Er hoffte allerdings vergeblich.
Martin Mc Allister
Dass er andere Interessen als die Jungs in seiner Klasse hatte war augenfällig, und das stempelte ihn zwar zu einem Außenseiter, aber er wurde von den anderen nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, da er für sie sehr nützlich sein konnte. Schon in den ersten Schuljahren hatte sich herausgestellt, dass er unbestritten das größte Mathetalent an der Schule war. Diese besondere Begabung erstreckte sich aber nicht nur auf dieses Fach, sondern wies er auch in anderen naturwissenschaftlichen Gebieten auf. Der Junge hatte seine Eltern nicht lange beknien müssen ihm einen PC zu kaufen, und das war seine bevorzugte Spielwiese nach der Schule geworden. Er hatte schon zu dieser Zeit begriffen, dass Computer und das Internet eine gravierende Veränderung vieler Prozesse in der Gesellschaft herbeiführen würden. Er begann sich näher damit zu beschäftigen und war sich sicher, dass er, sofern er etwas auf diesem Gebiet leisten könnte, eine gute Zukunftsperspektive haben könnte. Das bezog er nicht vordergründig auf einen gut bezahlten Job oder eine steile Karriere, sondern vor allem auf das, was in diesem Feld zukünftig an Entwicklungen zu erwarten war. Wohin die Reise gehen konnte sah er an einem kürzlich erschienenen Egoshooter: "Far Cry" von Crytec. Eine bislang nie gesehene Grafik zeigte die Möglichkeiten moderner Hard- und Software. Er war einigermaßen beeindruckt und fühlte sich in seiner Entscheidung bestätigt, sich später beruflich auf Informatik zu konzentrieren. Bis zum Abschluss der High-School hatte er noch zwei Jahre vor sich und er würde diese Zeit nutzen, sich schon entsprechende Kenntnisse anzueignen.
Sein Vater war Fuhrunternehmer und besaß 15 Trucks, die im Nah- und Fernverkehr vor allem in Michigan unterwegs waren. Seine Mutter half ein paar Stunden in der Buchhaltung mit. Die Auftragsdisposition lief über Telefon, E-Mail und händisch geführte Listen. Bei der Größe des Unternehmens war das alles so machbar, und es stellte sich manchmal sogar als durchaus flexible Lösung heraus. Aber auch alles andere, wie die Auftragskalkulation, die Angebotsabgabe und die Einsatzplanung lief nach diesem altmodischen Schema ab. Martin hatte mit seinen Eltern darüber gesprochen.
"Ach, lass mal, wir machen das seit vielen Jahren so" hatte sein Vater gesagt "und es funktioniert gut. Unsere Kunden kennen uns gut, sind mit uns zufrieden, und: sie vertrauen uns, dass wir sie nicht bescheißen. Na jedenfalls nicht mehr, als das andere machen. Es gibt keinen Grund etwas zu ändern."
"Doch" hatte Martin erwidert "schau dir an, wie sich beispielsweise Amazon ausbreitet. Der Kunde verlangt schnellste Lieferung, da wirst du auf die Dauer nicht mehr mit Zettel und Bleistift auskommen. Wenn du noch kalkulierst, hat ein Konkurrent schon ein computergeneriertes Angebot abgegeben. Der andere wird über eine Software ermitteln lassen, ob sich ein Auftrag lohnt oder eher nicht. Und er wird seine Frachtkapazitäten als Pool betrachten. Möglicherweise fährst du für einen Kunden mal mit Verlust, aber kannst eventuell auf Folgeaufträge hoffen. Das kann kein noch so guter Logistiker überblicken. Es gibt viel zu viele wechselseitige Abhängigkeiten. Das schaffen nur Computer und Software."
"Wenn du dich damit beschäftigen willst, dann tue es doch" hatte sein Vater recht uninteressiert geantwortet.
In dieser Zeit hatte Martin Mc Allister gelernt, dass bloßes Loslegen nach ein paar vagen Vorstellungen immer in eine Sackgasse führen würde. Er hatte eine grobe Programmstruktur im Kopf und Teile der Software funktionierten ganz gut, aber das Gesamtsystem an sich war wenig tauglich. Er warf alles wieder über den Haufen und unterteilte die Aufgabe in Teilgebiete und legte deren wechselseitige Abhängigkeiten fest. Für jedes Teilgebiet entwickelte er ein Softwaremodul. Dann schuf er die Schnittstellen, und das Ergebnis überzeugte. Seine Software kam im Betrieb der Eltern zum Einsatz und führte zu einem Effektivitätssprung.
Für ihn stand fest, dass er Informatik studieren würde.
Fred Brown
Er war von den Menschen in seiner Umwelt schon immer als Inbegriff der Durchschnittlichkeit wahrgenommen worden, und er wusste selbst, dass das stimmte. Sein ganzes Leben lang war er nur mit geringem Antrieb von einer Etappe zur anderen weitergestolpert, ohne jemals ernsthaft in Schwierigkeiten geraten zu sein. Irgendwie hatte er verinnerlicht, mit wenig Aufwand das erreichen zu können, was für ihn im Rahmen seiner selbstgewählten Möglichkeiten lag. Große Ansprüche an sich hatte er nie formuliert, und die Meinung anderer Leute über ihn war ihm ziemlich egal. Er wollte eigentlich nichts weiter, als sich ein vernünftiges bürgerliches Leben aufzubauen, in dem dann die Routine dominieren würde. Dazu zählte er die Gründung einer Familie und eine berufliche Karriere, deren Tempo er selbst bestimmen könnte. Da ihm großes Selbstvermarkungstheater fremd war, hatte er sich für ein Jurastudium entschieden. In diesem Metier würden Paragraphen und Fakten zählen, und das kam seiner beherrschten Art entgegen. So wie er organisiert war spulte er die zähen Inhalte beharrlich ab und empfand sogar so etwas wie Befriedigung, wenn er in Fallbeispielen genau auf der Linie der Lösung lag. Diese dröge Logik gab ihm die Gewissheit, dass man ein Leben zumindest in Bezug auf die Rechtsprechung doch in Regeln pressen konnte. Er schloss mit besten Noten ab, und seine Anstellung in einer Kanzlei zeigte ihm mit dem ersten Gehaltscheck, dass er nichts falsch gemacht hatte. Da er offenbar immer die Ruhe behielt und nie die Fassung verlor, wurde er zum Mann für die Fälle mit schwierigen Mandanten. Manchmal fragte er sich selbst, ob er tatsächlich so kalt und gefühllos wäre, und dann war er sich sicher, dass es so war. Er dachte aber kaum darüber nach und ging davon aus, dass jeder Mensch besonders wäre, eben auf seine ganz spezielle Art. Diese Distanziertheit beförderte ihn aber zu einem gefragten Partner vor Gericht, denn seine Verhandlungen waren gut vorbereitet, seine Ausführungen klar strukturiert, und seine Umgangsformen immer verbindlich.
Nach einem Jahr in einer Kanzlei in Detroit war ihm eine Partnerschaft angeboten worden, die er gern angenommen hatte. Sein bereits üppiges Salär könnte nunmehr im Jahr je nach Auftragslage bis zu 1,7 Millionen Dollar betragen. Fred Brown kam aufgrund seiner gut organisierten Arbeitsweise auf ungefähr zehn Stunden Beschäftigung am Tag. Am Samstag setzte er sich mehr symbolisch zu Hause am Vormittag zwei Stunden vor den Laptop und erledigte Dinge, die auch ein Sachbearbeiter hätte tun können, die er aber selbst abhaken wollte um den jeweiligen Fall komplett zu kennen. Meistens ging er dann in der Nähe eine Kleinigkeit essen und legte sich dann zwei Stunden auf die Couch. Danach zockte er an seinem Computer noch eine Weile, ließ Druck beim Ansehen eines Pornos ab und schlief dann entspannt ein.
Über einen Fall kam er an eine recht attraktive Frau heran, mit der er dann ein längeres Verhältnis über knapp anderthalb Jahre hatte. Allerdings fühlte er sich zunehmend eingeengt in seiner Entscheidungsfreiheit und beschloss, zunächst nur seinem Beruf und seinen Neigungen nachzugehen. Das war vermutlich auch besser so gewesen, denn er spürte eine starke Affinität zu pornographischen Bildern von kleinen Kindern. Da er aus dem Fach kam wusste er ganz genau, dass er haarscharf am Rande der Legalität marschierte, aber er vertraute auf die Anonymität des Netzes. Sein Verstand sagte ihm, mit der Sache aufzuhören, aber seine innere Stimme war dagegen. Erst als ein Kinderpornoring öffentlichkeitswirksam aufgeflogen war hörte er damit auf, aber wusste, dass das Internet nichts vergaß, und er für alle Zeiten Leichen im Keller hatte.
Gegen seine grundsätzliche Meinung, allein besser zurecht zu kommen, trat er jedoch eine nicht als rational zu bezeichnende Flucht nach vorn an, um seinem Leben eine angemessene bürgerliche Tünche zu verpassen. Sie hieß Judith und war Lehrerin. Anfangs gefiel ihm ihre Interessiertheit und das gute Allgemeinwissen, wenig später war er von ihren ständigen Belehrungen und Korrekturen nur noch genervt. Aber es war bereits zu spät, sie hatten zwei Kinder: Beth und Nick. Er fand sich damit ab nur der Zweitredner zu sein und sehnte sich nach der Zeit zurück, als er tun konnte, was er wollte.
Doch sein Beharrungsvermögen in diesen Zuständen war deutlich größer als die Energie, seinem Leben noch einmal eine andere Richtung geben zu wollen.
Allan Blacksmith
Wenn er mit einem Kunden einen Auftrag besprach brachte er immer seinen Standardspruch ("Die Qualität meiner Arbeit ergibt sich schon aus meinem Namen") an, und er erreichte immer die gewünschte Wirkung. Tatsächlich betrieb die Familie Blacksmith seit 1884 in der Stadt eine Schmiedewerkstatt, die zur Zeit ihrer Gründung durch seinen Urgroßvater Herbert ihre Arbeit in einem Hinterhof in der Westvorstadt unter übelsten Bedingungen begonnen hatte. Herbert Schmied, ein deutscher Auswanderer, hatte es für sinnvoll gehalten, sich in der Neuen Welt von allem zu lösen, was er in seinem Heimatland zurückgelassen hatte, und dazu zählte auch als besonderes Symbol sein Name. Aus Herbert Schmied wurde Herb Blacksmith, und dieser Name hatte in der Stadt bis heute einen guten Ruf. Anfangs ging es um grobe Schmiedearbeiten für Kutschen und Wagen, später kam ab und an ein Auftrag für einen Schmiedezaun oder eine Tür dazu. Solche Arbeiten nahm Herbert Schmied aus zweierlei Gründen an, obwohl sie wirtschaftlich ein Desaster waren: sie dienten seiner Selbstverwirklichung als Handwerkskünstler, und sie materialisierten das Ergebnis der Arbeit der Firma in der Stadt an exponierten Stellen. Die Zäune waren extrem filigran gearbeitete aber eben auch starke Schutzwälle für die Grundstücke der Vermögenden. Schmied war ein knorriger Westfale, der nur sehr schlecht englisch sprach, aber viel mehr als gedrechselte Worte demonstrierten diese Produkte die Leistungsfähigkeit seiner Firma. Dabei hatte er niemals aus den Augen verloren, dass sein Unternehmen von den Brot-und-Butter-Aufträgen lebte, und das andere eine Art Werbekampagne war. Diese Rechnung war schnell aufgegangen, so dass die "Blacksmith Company" expandieren konnte und ihren Sitz vor die Tore der Stadt verlagerte. Um 1910 hatte sich der Gründer auf das Altenteil zurückgezogen und die Fortführung der Geschäfte in die Hände seiner Söhne Alexander und Phillip gelegt. Beide hatten im Betrieb des Vaters gelernt und wussten von der technischen Seite her, worum es in einer Schmiedefirma ging. Von der Geschäftsführung indes hatten sie keine Ahnung, ließen sich öfter übervorteilen und standen 1914 kurz vor dem Ruin. Der Krieg in Europa half ihnen mit einer guten Auftragslage über die Krise hinweg, aber sie waren nur im operativen Geschäft gefangen, und es gab keine Ideen für die Zukunft. Trotzdem konnten sie das Geschäft aufrechterhalten und es sogar etwas vergrößern. 1919 war Alexanders Sohn Thomas zur Welt gekommen (Phillips Ehe sollte kinderlos bleiben) und dieser stieg 1942 als Metallurgie Ingenieur in "Blacksmith" ein. Alexander und Phillip waren in den Jahren davor auf dem Teppich geblieben und hatten vor allem versucht, den technischen Standard zu verbessern, und keine Expansion im Auge gehabt.





























