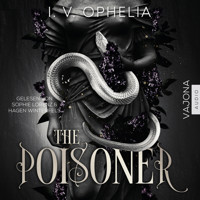
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VAJONA Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Giftmischerin-Reihe
- Sprache: Deutsch
»Hast du dich jemals gefragt, wie lange es dauern würde, bis eine tödliche Dosis Arsen dich umbringt? Fünfunddreißig Stunden, neunundzwanzig Minuten und fünfzehn Sekunden. Ich muss es wissen. Ich habe selbst mitgezählt.« Alina Lis, Botanikerin und Hobbygiftmörderin, vertreibt sich die Zeit damit, widerliche Männer, in ihrem verdrehten Sinn für poetische Gerechtigkeit, zu töten. Als sie den eingebildeten Playboy, Silas Forbes, ins Visier nimmt, muss sie feststellen, dass menschliche Männer das geringste ihrer Probleme sind. Die ungewöhnliche Verbindung der beiden sorgt für Klatsch und Tratsch in der wohlhabenden Gesellschaft. Während ihr mysteriöses Band stärker wird, kommt eine erschreckende Wahrheit ans Licht – verborgene Identitäten, lauernde Feinde und Fragen, die so zahlreich sind wie die Köpfe der Hydra, brodeln in dieser eindringlichen Gothic-Geschichte voll stürmischer Leidenschaft.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I. V. Ophelia
The Poisoner
Übersetzung von Katherina Kisner
The Poisoner
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel
»The Poisoner«.
Copyright © 2024 THE POISONER by I. V. Ophelia.
All rights reserved.
The moral rights of the author have been asserted.
Published by I. V. Ophelia in English.
Alle Recht der deutschsprachigen Ausgabe © 2026. The Poisoner
by VAJONA Verlag GmbH
Übersetzung: Katherina Kisner
Lektorat: Anne Masur
Korrektur: Sophy Stone und Dejana Fulurija
Umschlaggestaltung: Jaqueline Kropmanns – Design
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Teil der SCHÖCHE Verlagsgruppe GmbH
Nicht einem der Charaktere sollte es erlaubt sein, den Anspruch auf hohes Ansehen zu erheben. Der eine oder andere von ihnen dürfte selbst für die unsensibelsten Naturen unter uns schwer zu ertragen sein. Sie wurden rein für fiktionale Zwecke erschaffen. Lasst es euch schmecken, meine Lieben.
–I.V. Ophelia
Anmerkung der Autorin
Zum Inhalt
Das Werk ist ein Gothic-Roman mit expliziten Sexszenen. Da das Buch auch Horror- und Mystery-Elemente enthält, können Beschreibungen von Gewalt, Blut und Blutvergießen vorkommen. Die Charaktere könnten unangemessene Substanzen konsumieren, weshalb von Nachahmung dringend abgeraten wird. Einige Szenen enthalten leichte BDSM-Elemente, die in der Realität nur von erfahrenen Partnern praktiziert werden sollten. Vorangegangene Gespräche über Vertrauen, Einverständnis und Grenzen bilden die Basis dieser Sexpraktiken. Nicht alle Handlungen in diesem Buch dienen der sexuellen Befriedigung und sollten nicht als Vorlage für eine gesunde oder realistische sexuelle und emotionale Beziehung verwendet werden.
Wie immer gilt: Zu schildern heißt nicht, es auch zu billigen.
Kinks
Zu den wichtigsten Kinks gehören:
Vampire, Primal, Non-/Dubcon, eine Variation von »Knotting«, risikobewusster Konsenskink (RACK), Jagen/Verfolgung, Beißen, an den Haaren ziehen, Blood Play (Blutspiele), gespaltene Zungen, leichte Creature Features (körperliche Merkmale übernatürlicher Wesen), Brat/Brat-Tamer-Dynamik, Spucken, Predicament (Zwangslagen-Spiel) und gegenseitiges Stalken.
Erwähnenswerte Kinks, die zwar enthalten sind, aber angesichts ihres Kontexts nicht unbedingt eine romantische/erotische Wirkung beabsichtigen:
Auspeitschen, unangemessener Gebrauch von Reis, Erniedrigung/Lob und Sadismus.
Meine liebste Leserin, mein liebster Leser, wenn du dir unsicher bist, was der eine oder andere aufgelistete Kink bedeutet, recherchier bitte den Begriff, um sicherzustellen, dass du dich mit voller Kenntnis der Sachlage darauf einlässt. Beachte den Hinweis auf sensible Inhalte auf der vorherigen Seite.
Prolog
Hast du dich jemals gefragt, wie viel Zeit vergeht, bis eine tödliche Dosis Arsen dich vergiftet?
Fünfunddreißig Stunden, neunundzwanzig Minuten und fünfzehn Sekunden.
Ich sollte es wissen. Schließlich habe ich die Zeit selbst gemessen.
Kapitel 1
Die Giftmischerin
Meine Absätze klackerten auf dem nassen Kopfsteinpflaster, als ich aus der Kutsche stieg. In dieser Nacht regnete es ununterbrochen. Schwere Wassertropfen prasselten aus dem dunklen, weiten Himmel hernieder und blitzten kurz im Licht der Straßenlaternen auf, bevor sie auf die Erde trafen. Der Lakai spannte einen Regenschirm über mir auf, während ich dastand und an den weißen Steinhäusern emporblickte. Die Fenster waren voller Licht und Leben. In jedem der Räume hielten sich Menschen auf, und Herzlichkeit waberte durch die vielen Korridore. Die Silhouetten dahinter ließen erahnen, was im Inneren vor sich ging. Phoebes Stadthaus musste – bedachte man die Größe – mindestens um die fünfzig Zimmer fassen. Man könnte sich mit Leichtigkeit darin verlaufen und würde nie wieder hinausfinden.
»Alina!«, quiekte Phoebe vom Türrahmen aus auf. »Mit angemessener Verspätung«, witzelte sie. »Du trägst Schwarz?«
»Schwarz passt zu jedem Anlass.« Ich begrüßte sie lächelnd und trat ein.
»Nun, heute ist aber nicht jeder Anlass. Es ist eine Party, keine Totenwache.« Meine liebe Freundin seufzte dramatisch auf und warf resigniert die Hände in die Luft. Sie wusste von meinen speziellen Neigungen und wäre nicht die Erste, die mich davon abzubringen versucht hätte.
Beim Anblick des pikierten Rotschopfes zuckte meine Augenbraue amüsiert nach oben. »Phoebe, bewahre nur die Ruhe. Ich habe doch versprochen, dass meine Kleidung dem Anlass angemessen sein würde.« Ich streifte meinen Umhang ab, der sofort von einem ihrer Bediensteten weggebracht wurde. Dann legte ich ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. »Außerdem kann man gar nicht vorbereitet genug sein. Was, wenn ein Gast dich so sehr aus der Fassung bringt, dass du ihn erschlägst? Dann wäre ich dem Anlass angemessen gekleidet.«
Es war für Phoebe unmöglich, ihre gereizte Miene aufrechtzuerhalten, und ihr angespannter Gesichtsausdruck wich einem strahlenden Lächeln. Sie schlang die Arme um meinen Hals und drückte mich fest an sich. »Schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns so viel zu erzählen! Trotz der vielen Briefe musst du mir unbedingt alles über deine kleinen Nachforschungen, auf die du dich im letzten Jahr eingelassen hast, berichten!«
»Du hast nicht viel verpasst. Ich bin mir sicher, dass du viel spannendere Geschichten zu erzählen hast als ich.«
»Nun, da du wieder zu Hause bist, sollten wir für ein paar Skandale sorgen.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und ein verschmitztes Lächeln huschte über ihr zartes, elfenhaftes Gesicht. Eine kupferrote Locke löste sich aus ihrem ordentlichen Dutt und umrahmte ihre blassen Wangen. Phoebe war eine jener jungen Frauen, deren Schönheit nicht gekünstelt wirkte. Ihre Haut erinnerte an Alabaster und war damit so blass, dass sie keine ihrer Regungen vor anderen verbergen konnte, da die Röte, die auf ihren rosigen Wangen erblühte, sie umgehend verriet. Das rote Haar ließ ihre grünen Augen noch hinreißender wirken.
»Dann werden wir eben für Skandale sorgen.« Ich erwiderte ihr Grinsen.
Phoebe und ich waren schon immer Freundinnen gewesen, zumindest, solange ich mich zurückerinnern konnte. Wir waren wie zwei Dornen derselben Rose und pflegten eine einfache Verbindung. Unsere Väter hatten oft bei der Herstellung von Arzneimitteln zusammengearbeitet, obwohl ihr Vater in zahlreiche andere Unternehmungen verwickelt war. Mein Vater hingegen war ein Visionär seiner Branche – er hatte sich dem Studium der Medizin durch Botanik, Chemie und Physiologie verschrieben. Ich bewunderte ihn dafür. Es war ein nobler Beruf und dank der Investitionen von Phoebes Vater hatte er es weit gebracht. Manchmal fragte ich mich, was er für die Menschheit noch hätte erschaffen können, wenn er letztes Jahr nicht gestorben wäre.
Bei seinem Verlust war ein Teil in mir zerbrochen, den ich nie ganz begreifen würde. Danach hatte ich mich auf unseren Landsitz zurückgezogen, wo ich das ganze letzte Jahr verbracht hatte. Aufgrund des gesellschaftlichen Drucks und meiner Freundschaft mit Phoebe hatte ich es nicht riskieren wollen, durch meine damalige Gemütslage aufzufallen. Der gute Ruf meines Vaters war das Einzige, was er mir hinterlassen hatte, und ich wollte ihn auf keinen Fall durch mein Verhalten beschmutzen. Eigentlich hatte ich nicht geplant, so schnell wieder zurückzukehren, aber mir hatte das Stadtleben gefehlt.
Niemals hätte ich damit gerechnet, dass ich die Abende bei Phoebe vermissen würde. Obgleich es möglich war, dass ich die Fähigkeit, mich unter die Gesellschaft zu mischen, nachdem ich tagelang gereist war, etwas überschätzt hatte. Ich fühlte mich überreizt, und das war noch untertrieben, wenn man das Chaos betrachtete, für das Phoebe sorgen konnte.
Im Inneren ihres Hauses war alles groß und prächtig. Angefangen von der außergewöhnlich dekorativen Treppe, die sich entlang der beiden gegenüberliegenden Wände des Raumes nach oben schlängelte, wo sie sich wieder vereinte, bis hin zu den Torbögen zu beiden Seiten der Treppe und unter der Empore. Dutzende Kunstwerke zierten die Wände und seltene Möbelstücke waren überall im Haus platziert. Bei einigen dieser Stücke würden selbst die besten Handwerker in Verzückung verfallen. Alles darin zeugte von Reichtum und ihrer hohen gesellschaftlichen Stellung. Das Stadthaus war perfekt, um Hunderte von Gästen zu beherbergen, die im Morgengrauen nach draußen torkeln würden, nur um sich eine Woche später erneut dort einzufinden.
Phoebes Hand legte sich um meinen Arm und sie zog mich zu einem der vielen Räume. Je näher wir ihm kamen, desto lauter schwoll das Summen der Gespräche an. Die Anwesenden waren alle in seidene Gewänder und maßgeschneiderte Anzüge gehüllt. Dabei waren schon die Schnittmuster dermaßen beeindruckend, dass sie selbst die modischsten Mitglieder der Gesellschaft einzuschüchtern vermochten.
Das Gewand, für das ich mich entschieden hatte, war einfach geschnitten. Es schmiegte sich an meine Taille, der das Korsett zusätzlich an Form verlieh, umschmeichelte meine Hüften und fiel dann gerade bis zum Boden. An der Rückseite war es leicht gerafft und hatte eine dezente Schleppe, die mir über den Boden folgte. Die schwarze Seide glänzte geschmeidig und das sanfte Licht spiegelte sich bei jeder Bewegung in den einzelnen Stofffalten wider. Der Ausschnitt war tief und reichte mir beinahe von Schulter zur Schulter. Rosen aus Stoff, die über das gesamte Kleid verteilt waren, rahmten das Dekolleté ein und betonten meine Brüste. Ein breites Spitzenhalsband mit einer passenden schwarzen Blume zierte meinen Hals. Einen guten Teil meiner Haare hatte ich hochgesteckt, während der Rest meiner pechschwarzen Locken mir frei über die Schultern fiel. Zwischen meinen behandschuhten Fingern ruhte ein Fächer aus schwarzen Federn, und die Seide der Handschuhe reichte mir bis über die Ellbogen.
Phoebes Kleid war ähnlich geschnitten, aber in einem zarten Rosa mit weißen Spitzendetails gehalten. Sie hatte ein dramatisches Korsett gewählt, das ihre Sanduhrsilhouette sowie die Brüste eindrucksvoll zur Geltung brachte. Die Handschuhe, die sie trug, waren aus dicker, weißer Spitze hergestellt worden, und ihr Fächer war mit Seide bezogen und mit ähnlichen Verzierungen wie ihr Kleid geschmückt. Ihre Entscheidung war auf ein ausgefallenes Schmuckensemble aus schweren Diamanten gefallen, die die Partie um ihren Hals und ihre Ohrläppchen liebkosten. Phoebe erstrahlte wie die unschuldigen Tropfen des Morgentaus auf den rosa Rosen, die in ihrem Garten blühten. Ich hatte immer geglaubt, dass sie die schönste Frau auf Erden war, und bis heute hatte sie mich nicht enttäuscht.
»Außerdem ist mir zu Ohren gekommen, dass uns Benjamin mit seiner Anwesenheit beehrt, um unsere Freundin Mary nicht aus den Augen zu lassen. Was ziemlich delikat zu werden verspricht, denn wie mir ein Vögelchen gezwitschert hat, könnte sie sich bereits einen Liebhaber genommen haben.« Phoebe warf mir einen Blick zu, während sie meinen Arm berührte – ihr musste aufgefallen sein, dass ich mit den Gedanken ganz woanders war. »Alina, was bedrückt dich? Du wirkst abwesend.« Sie runzelte die Stirn und tippte mir mit dem Zeigefinger leicht gegen die Schläfe.
»Es ist nichts. Ich muss mich bloß wieder in der Gesellschaft einfinden«, murmelte ich, hakte mich bei ihr unter und folgte ihr an der Menge vorbei. Mit Champagnerflöten, die wir uns vom nächstbesten Tablett genommen hatten, schlossen wir uns den anderen Gästen an.
Während ich schon immer Unnahbarkeit vermittelt hatte und vielleicht etwas makaber wirkte, strahlte Phoebe Eleganz und Gastfreundschaft aus. Ich persönlich störte mich nicht daran, da ich ohnehin lieber Distanz zu Fremden wahrte. Davon abgesehen zog ich allein durch meine Anwesenheit genügend Aufmerksamkeit auf mich. Wenn ich so darüber nachdachte, war es doch recht amüsant, herauszufinden, welche Charaktere es wagen würden, mich anzusprechen.
Phoebe unterhielt sich mit ein paar aufgeblasenen Persönlichkeiten, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Nach einer Weile verschwammen die Gesichter zu einer monotonen Masse, sodass ich gar nicht mehr sagen konnte, ob ich ihnen einst begegnet war oder nicht. »Das ist meine liebe Freundin Alina Lis. Ihr gehört die Apotheke neben dem Blumenladen im West End. Sie ist so etwas wie eine Wissenschaftlerin!«
Als ich begriff, dass sie von mir sprach, krampfte sich alles in mir zusammen. Ich wusste ihre Begeisterung für mein Metier zu schätzen, aber nicht alle Männer sahen es gern, wenn eine Frau über Eigentum oder ein Erbe verfügte, geschweige denn in einem wissenschaftlichen Bereich arbeitete. Ursprünglich hatte der Laden meinem Vater gehört und war nach seinem Tod an mich übergegangen.
»Neuerdings verfasse ich Kolumnen über die Toxizität von Schönheitsprodukten, die in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert werden, und biete weniger gefährliche Alternativen an. Wenn Sie die Boulevardpresse lesen, wäre es möglich, dass Sie bereits etwas von mir gelesen haben.« Ich lächelte höflich, denn ich hoffte, dass die Kommentare über Frauen, die ihre Kompetenzen überschritten, ausbleiben würden. Manchmal beruhigte es die Männer, wenn sie erfuhren, dass meine Berufung auch feminine Aspekte beinhaltete. Mich ständig rechtfertigen zu müssen, war anstrengend. Lieber spielte ich das Ganze etwas herunter, um den Frieden zu wahren.
Apropos Frieden: Die Produkte, die unter der Ladentheke liefen und Frauen vorbehalten blieben, die eine unliebsame Person loswerden wollten – ob durch Heirat oder anderweitig an sie gebunden –, sollten lieber gänzlich unerwähnt bleiben. Dank meiner außergewöhnlichen Kenntnisse in Botanik und Chemie hatte ich – als professionelle Giftmischerin, wenn man so wollte – schon einigen Ehemännern ins Jenseits verholfen. Über diesen Teil meines Geschäfts wusste Phoebe nichts, aber da sie den aufgeschnappten Klatsch und Tratsch so gern mit mir teilte, fiel es mir nicht schwer, meine nächsten Probanden zu erwählen.
Ich zog es vor, sie nicht als Opfer zu bezeichnen. Das waren sie ganz und gar nicht.
Die Arbeit einer Giftmischerin war praktisch nie erledigt, denn die Wirkung eines Giftes konnte immer noch verbessert werden. Es musste raffinierter, reiner und tödlicher sein – bis man etwas Neues kreierte und den Prozess von vorne begann. Deshalb bezeichnete ich die Empfänger gerne als Probanden, denn jede Leiche hinterließ ein paar kokette Andeutungen darauf, wie das Gift bei dem nächsten Sünder noch effektiver eingesetzt werden konnte.
Es dauerte nicht lange, bis Phoebes Pflichten als Gastgeberin ihre gesamte Aufmerksamkeit erforderten, und so ließ sie mich mit der Menge allein, während ich noch sprach.
»Ah, dann sind Sie also so etwas wie eine Apothekerin?« Auch wenn der Mann mit seinen Worten ins Schwarze getroffen hatte, drehte er sich mit einem spöttischen Lächeln seinem Freund zu, bevor er sich erneut an mich wandte. »Sagen Sie mal, was haben Sie denn mit Ihren Haaren gemacht? Da – in Ihrem Gesicht.«
Ich setzte ein schmallippiges Lächeln auf und strich mir mit den Fingern über die Augenbraue. »Es ist nichts Schlimmes. Das ist Poliosis. Dadurch färben sich die Härchen auf meiner linken Gesichtshälfte weiß.« Ich behielt einen höflichen Tonfall bei, um es ihm verständlich zu machen – nicht, dass so ein Dummkopf wie er das verstehen würde.
»Wenn Sie Apothekerin sind, müssten Sie doch wissen, wie man ein solches Leiden kuriert.«
»Das ist kein Leiden, sondern mehr so etwas wie ein kurioses biologisches Phänomen.« Ich sog die Luft tief ein, um mich nicht zu weiteren unvorteilhaften Äußerungen hinreißen zu lassen. »Ich ziehe es vor, es als eine Rarität zu bezeichnen.«
Unwissenheit war etwas, womit ich rechnete, und ich machte sie niemandem zum Vorwurf. Dummheit ist keine Entscheidung, die man selbst trifft, weshalb ich mich stets bemühte, Verständnis aufzubringen. Ich bezweifelte, dass es für Klatsch und Tratsch gesorgt hätte, wäre ich blond geboren worden. Bedauerlicherweise hatte ich das schwarze Haar meiner Mutter geerbt, das wie ein Kaninchen mit Melanismus auf frisch gefallenem Schnee hervorstach.
Ich entschuldigte mich, verließ die Runde, und tauschte auf dem Weg in einen anderen Raum mein leeres Champagnerglas gegen ein volles aus.
Dort folgten die immer gleichen Gespräche mit anderen Ladys über einige meiner Texte, hauptsächlich aus den Boulevardzeitungen, in denen es um Schönheitspflege ging. Es war schön zu wissen, dass meine Arbeit wertgeschätzt wurde, selbst wenn die andere Hälfte davon – aus guten Gründen – im Verborgenen blieb. Eines Tages würde ich womöglich die Berühmtheit von Giulia Tofana erlangen, aber vorerst blieb es unter mir und den Frauen, die mich am meisten brauchten. Persönliches Vergnügen war wie getrocknete Blumen, die man am besten vor dem Licht schützte, um ihre Lebendigkeit zu bewahren.
Ich hob den Blick, um die neue Szenerie zu erfassen. Der Raum hatte hohe Decken und die Wände waren mit einer beeindruckenden Sammlung von Gemälden geschmückt. Leinwände unterschiedlicher Größen waren in eklektischer Harmonie an jeder Wand angeordnet worden. Porträts, exotische Landschaften, geliebte Haustiere und hier und da eine seltsame folkloristische Szene befanden sich darunter. Stolz waren sie in goldverzierten Rahmen zur Schau gestellt worden. Gemächlich flanierte ich durch die Menge und ließ meine Aufmerksamkeit Gemälde für Gemälde zuteilwerden. Räume wie dieser schrien geradezu nach Geld.
Das Trillern der Instrumente, die gerade gestimmt wurden, riss mich aus der Betrachtung der dekadenten Kunstausstellung. Sämtliche Gäste strömten in den großen Ballsaal. Das Parkett war in einem komplizierten Muster mit komplementären Braun- und Beigetönen gebeizt worden. In einer der Ecken fand ich ein Klavier und die Musiker mit ihren Instrumenten vor. Unter den anderen Anwesenden hatte ich einen Platz am Rande des Saals gefunden und wartete gespannt auf den Beginn der Feierlichkeiten. Ich spielte mit einer Haarsträhne, und trank einen Schluck von meinem Champagner, wobei er mir beinahe aus den Mundwinkeln lief.
Nur mit der Ruhe, Alina. Die Nacht ist zu jung, um nachlässig zu werden.
Ich drückte mich in eine der Ecknischen und betrachtete die Menge, die sich in Tanzpaare und Schaulustige teilte. Heute entschied ich mich dafür, nur zuzusehen. Es lag etwas Beruhigendes darin, die Menschen zu beobachten. Ich stellte mir gern die Frage, wie es war, jemand anderes zu sein. Mein Blick schweifte über die Auswahl an Paaren, die herumwirbelten und wogten. Darunter waren aufeinander abgestimmte Ehepaare, die den Abend routiniert ablaufen ließen. Aber auch voneinander angezogene Liebende, die in der Gegenwart des anderen strahlten. Und dann gab es noch diejenigen, deren Blicke sich erwartungsvoll zum ersten Mal begegneten und die Vorsicht und Neugierde in ihren Bewegungen walten ließen. Das Schauspiel ließ mich an Vögel denken und an die Art, wie einige Arten ihre Partner anlockten.
Schon bald stand die Luft im Raum und es wurde so heiß, dass mir der Kopf schwirrte. Nur gut, dass ich meine Suche nach alkoholischen Erfrischungen nicht fortgesetzt hatte. Das dichte Gedränge von Körpern erschwerte mir das Fortschleichen in den nächsten Raum. Allerdings wusste ich von meinen früheren Erkundungen, dass sich darin ein Loungebereich befand.
Warum tue ich mir das an? Ich hätte den Abend nutzen sollen, um mich auszuruhen.
Schließlich stolperte ich in den angrenzenden Raum und drückte mir zwei Finger auf die Nasenwurzel, um die aufsteigende Übelkeit zu lindern.
Ein spitzer Schrei brachte mich wieder zur Besinnung.
Zwei Gestalten lümmelten sich auf der Chaiselongue an der gegenüberliegenden Wand.
In der Mitte der Chaiselongue hatte sich ein Mann mit weit gespreizten Beinen positioniert, während die Frau dazwischen balancierte. Seine behandschuhte Hand lag um ihren Hals, wobei die andere fest um ihren Arm geschlungen war. Er war ganz in Schwarz gekleidet, was das Babyblau des Kleides der Frau nur umso stärker zur Geltung brachte.
Das Klicken meiner Absätze erregte seine Aufmerksamkeit.
Langsam ließ er den Blick durch den Raum schweifen, bevor er – scheinbar vollkommen gelassen – auf mir zum Erliegen kam. Der Mann verharrte regungslos, und selbst nach einem Zucken aufgrund der schändlichen Position, die er eingenommen hatte, das auf Reue hindeutete, suchte ich sie bei ihm vergebens.
Seine Augen waren von einem kalten, blassen Grau. Ein Grau, das sein Gegenüber nur durch einen kurzen Blick bezwingen konnte. Das goldblonde Haar fiel ihm leicht ins Gesicht. In jeder anderen Situation hätte man ihn für einen Engel halten können, doch die himmlische Wärme erreichte seine Augen nicht.
Seine leblosen Augen, die jegliche Form von Behaglichkeit aus der Luft zwischen uns herauszusaugen schienen, würde ich niemals mehr vergessen können.
Sein Griff um die Frau wurde erbarmungsloser und sie stieß einen Schluchzer aus, der unscharf in meinen Ohren klang. Alles, was ich noch hören konnte, war das Rauschen des Blutes durch meine Adern.
Ein hungriges Grinsen kroch über seine scharfkantigen Gesichtszüge. Feuchte, purpurrote Spuren liefen ihr den Hals hinunter und befleckten den schönen, blauen Seidenstoff ihres Kleides.
Ich hätte schwören können, dass etwas in seinen Augen aufblitzte.
Brutale Männer waren für mich kein Mysterium. Mit dieser Spezies hatte ich bereits Bekanntschaft machen müssen. Aber nie zuvor war ich einem von ihnen begegnet, der sich so dreist darüber freute, erwischt worden zu sein. Fehlende Diskretion, jeglicher Mangel an Scham.
Etwas Wildes lag in seinem Blick, als er ihr Kinn packte und ihren Hals weiter nach vorn streckte. Mit seiner rot glänzenden Zunge fuhr er ihre Halsschlagader entlang und ließ mich für keine Sekunde aus den Augen, als wollte er fragen: Was wirst du tun?
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich den Mann hätte leiden lassen – dass ich seine Hände in Einmachgläsern präpariert und ihm die Zunge herausgerissen hätte. Stattdessen tat ich etwas viel Schlimmeres.
Ich tat einfach gar nichts.
Kapitel 2
Das Ungeheuer
»Na los doch, winde dich ruhig weiter. Dann kann ich dir endlich zeigen, wie delikat eine Luftröhre sein kann«, raunte ich leise und strich mit meiner Unterlippe über das Ohr des hübschen Vögelchens. Ein zufriedenes Stöhnen löste sich aus den Tiefen meiner Kehle, als das zerbrechliche kleine Ding bei meinen Worten keuchte.
Ich ließ meine Lippen über ihren Hals nach unten gleiten. Konnte den metallischen Geschmack praktisch schon an den Wurzeln meiner Zähne spüren.
Sie wand sich noch ein letztes Mal in meinem Griff, bevor ich ihr in den Hals biss, während ich ihre Hüften zwischen meinen Beinen fester einklemmte, um sie an Ort und Stelle zu halten. Hitze durchflutete meine Kehle und wärmte meinen Körper schneller als reiner Whisky. Ich löste mich von ihr, um mein Werk zu betrachten, und zwang mich zur Zurückhaltung, um den Geschmack zu genießen und meine Mahlzeit etwas länger auszukosten. Außerdem wäre es unangenehmer, eine unnütze Last mitzutragen, als ihre Launenhaftigkeit ertragen zu müssen.
Klick.
Ich hasste Unterbrechungen.
Es dauerte einen Moment, bis ich meine Aufmerksamkeit von dem frischen Körper losreißen konnte und mein Blick auf die Gestalt im Torbogen fiel.
Oh? Für einen zweiten Gang war ich noch gar nicht bereit. Das musste meine Glücksnacht sein.
Ich musterte den Körper im Torbogen. Er erschien mir als ungleich appetitlicher als derjenige in meinen Armen.
Die großgewachsene, schlanke Gestalt war in einen butterweichen, schwarzen Stoff gehüllt. Unmittelbar setzten sich die Bilder vor meinem inneren Auge fest, wie der Stoff aufgefächert auf dem Boden aussehen würde. Wäre nicht ihre milchige Haut gewesen, hätte ich sie in ihrem schwarzen Kleid und dem mitternachtsschwarzen Haar für einen Schatten gehalten. Ihre Augen strahlten wie das Eis in der Tundra eine unversöhnliche Kälte und Beunruhigung aus.
Ein Grinsen schlich sich auf meine Züge, das ihre hübschen Wimpern vor Ungläubigkeit zum Flattern brachte.
Ist sie noch so nüchtern, dass sie sich an mich erinnern würde? War sie verängstigt oder fasziniert? Warum stand sie einfach nur so da? Warum befriedigte der Ausdruck auf ihrem Gesicht mich mehr als der Happen, den ich gerade genossen hatte?
Meine Finger gruben sich tiefer in die Beute auf meinem Schoß und entlockten ihr ein weiteres mattes Schluchzen.
Wut blitzte in ihren strahlenden Augen auf.
Würde sie einen ähnlichen Laut von sich geben, wenn ich die Hand in ihrem schwarzen Haar vergraben würde? Oder wenn sich meine Finger um ihren anmutigen Hals schließen würden? Würde sie sich wehren und mich wie eine Hexe verfluchen? Oder würde sie weinen und mich anflehen, weiterzumachen? Alles Fragen, auf die ich eine Antwort haben wollte.
Ich drückte meine Zunge auf den Hals der armen Seele vor mir und leckte langsam und gleichmäßig darüber. Eine Spur aus Blut und Speichel zeichnete sich auf ihrer Haut ab.
Was wirst du jetzt tun, Voyeurin?
Ein Feuer flammte in ihr auf. Wäre ich ihr näher gewesen, hätte ich es vielleicht riechen können. Es strömte aus ihr heraus, ähnlich wie Hitze aus einem Ofen. Aber mein Vergnügen währte nur kurz, denn während ich mich meinen Gedanken hingab, schwand sie dahin.
Wie schade.
Mein Appetit veränderte sich schlagartig. Das Mahl, das ich gerade zu Gesicht bekommen hatte, schien ungleich wertvoller zu sein als an die hundert alkoholgetränkten Häppchen, die ich am heutigen Abend ergattern würde.
Es war schon eine Weile her, seit der ungezügelte Jagdtrieb in mir erwacht war. Es hatte wohl nur etwas Besonderes gebraucht, das ebendiese Jagd erstrebenswert machte.
Wird der Ausdruck auf deinem Gesicht genauso köstlich sein, wenn ich dich erwische?
Kapitel 3
Die Giftmischerin
Ekelerregend.
Der Alkohol drängte sich zurück an die Oberfläche, weil ich meine Grenzen nicht einzuhalten wusste. Mein Kopf schwirrte, bis die Erinnerungen an die vergangene Nacht in meinem verhangenen Gehirn wieder auftauchten.
Seine toten Augen hatten sich in meine Netzhaut eingebrannt und folgten mir in meinen Alb- und Tagträumen.
Schließlich gab mein Magen nach und löste sich notgedrungen von einigen Erinnerungen, die bitter wie die Galle schmeckten, sodass ich sie dem Wasserklosett übergab.
Der Kater und das Trauma, das die Ereignisse des Abends nach sich zogen, riefen Übelkeit in mir hervor und ekelten mich an.
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich es nur dem Mann von gestern zu verdanken hatte, aber seit dem Moment, in dem ich das Mädchen in dem Griff der menschlichen Bärenfalle zurückgelassen hatte, lasteten die Schuldgefühle schwer auf mir. Das war der Augenblick, in dem mein Selbsterhaltungstrieb über das Bedürfnis nach Gerechtigkeit obsiegte. Das Gefühl, beschmutzt worden zu sein, würde ich wohl niemals mehr abschütteln können.
Ich hatte nicht ganz erfassen können, was ich gesehen hatte, aber die Gewissheit, dass es kein Traum gewesen sein konnte, reichte aus. Der hungrige Blick in seinen Augen konnte nur als ungehobelt, gar sinnlich, bezeichnet werden.
Meine Finger krallten sich in den Rand des Waschbeckens, während ich zögerlich auf mein Spiegelbild blickte und dabei hoffte, es möge doch herausspringen und mich ohrfeigen. Die dunklen Strähnen standen in alle Richtungen ab und waren von der Nacht vollkommen verfilzt.
Reiß dich zusammen. Es liegt noch Arbeit vor dir.
Ich sollte mich heute mit Phoebe treffen, aber geplagt von dem schuldhaften Unwohlsein, wagte ich mich kaum über die Grenzen des Badezimmers hinaus.
Bedauerlicherweise gelang es mir schließlich, mich notdürftig wieder zu fassen. Ich wanderte durch das Stadthaus und suchte nach bestimmten Kleidungsstücken, die irgendwo tief in den verstreuten Truhen verloren gegangen waren und nun darauf warteten, von ihrem Inhalt befreit zu werden.
Vor nicht allzu langer Zeit rannten Phoebe und ich mit unseren Holzpferden durch ebendiese Gänge und taten so, als wären wir Abenteurer, die das Haus zu ihrem Universum auserkoren hatten, das voller Möglichkeiten steckte, unsere endlosen Fantasien auszuleben.
Eastwater Manor war mein vorläufiges Zuhause. Das Haus war im Besitz von Phoebes Familie. Ich war nur Untermieterin, bis ich etwas anderes gefunden hatte.
Das Anwesen war im georgianischen Stil erbaut und wunderschön. Vier Stockwerke mit viel zu vielen Räumlichkeiten zeichneten es aus. Es lag am Ende einer ruhigen Straße, umgeben von ähnlich eleganten Häusern. Ein üppiger, von Mauern eingezäunter Garten, der vor den Blicken der Nachbarn geschützt war, erstreckte sich hinter dem Haus. Aber am liebsten war mir das bescheidene Gewächshaus, das zwischen dem wild wuchernden Efeu verborgen lag. Ich war dankbar, in einer der exklusivsten Gegenden Londons wohnen zu dürfen. Das Haus war in sanften Creme- und Weißtönen gehalten, umrahmt vom warmen Holz an den Geländern und Ecken. Es war der Ort, den ich sehr gern besuchte, als ich noch jung war. Schon damals glich es einem Labyrinth, was sich bis heute nicht geändert hatte. Nichts hatte sich verändert. Ich zog mir das erstbeste Tageskleid über, das ich in meiner Kleidertruhe fand. Meine Kleidung entsprach meiner düsteren Stimmung. Vermutlich würde selbst ein Skelett fröhlicher aussehen als ich.
Meine Hand fuhr über die komplizierten Schnitzereien entlang des Geländers. Das Morgenlicht fiel durch ein einzigartiges, rundes Fenster. Es wirkte wie ein Auge, das über den Flur wachte, und beleuchtete die zarten Blattgoldmuster in der elfenbeinfarbenen Tapete. Es hing über dem Treppenabsatz, trennte die Treppe vom nächsten Stockwerk und brachte Licht in den ansonsten dunklen Raum.
Ich rieb mir den Nacken, um die Verspannungen in meinen Muskeln zu lösen. Die dünne schwarze Spitze meines Kragens kitzelte mich unter dem Kinn. Ich eilte zur Tür, um den Briefkorb zu überprüfen und nach möglichen Paketen Ausschau zu halten. Der Wind, der mir entgegenwehte, erinnerte mich daran, wie nah wir dem Ende des Herbstes waren. Die Bäume entlang der Straße hatten ihre Blätter fast alle verloren und waren kahl. Das Getrappel von Pferdehufen und das Krächzen der Krähen weckten eine unbändige Sehnsucht nach ebendieser Jahreszeit in mir. Als ich die Tür hinter mir schloss, hallte das Klicken des Schlosses durch das Haus und prallte wie ein Gerücht von den Wänden zurück. Der Klang verhallte, sobald ich mich weit genug entfernt hatte; eine Erinnerung an die Einsamkeit, die mein Herz so innig festhielt.
o o o
»Ich wäre wirklich gern länger geblieben! Ich weiß nicht, was passiert ist. Das Fieber brach ganz plötzlich aus – ganz ohne Vorzeichen.« Ich lächelte verlegen, während ich ein weiteres Stück von meinem Gebäck abbrach.
Phoebe und ich hatten uns als Wiedergutmachung für meinen plötzlichen Aufbruch gestern Abend zum Frühstück im Park verabredet. Dort gab es ein kleines Café mit Stühlen und Tischen im Freien. Es war ein ruhiger Ort, an dem man Leute beobachten oder lesen konnte. Für uns war er perfekt, um den morgendlichen Klatsch und Tratsch auszutauschen.
»Ich war froh, als du mich angerufen und mir bestätigt hast, dass dir nichts fehlt. Nachdem du so plötzlich verschwunden warst, habe ich mir schreckliche Sorgen gemacht.« Phoebe zog einen Schmollmund, aber wir wussten beide, dass sie nicht lange böse bleiben konnte. »Hast du wenigstens ein paar Leute kennengelernt? Irgendjemanden getroffen? Ich will alle Einzelheiten hören.«
Ich schüttelte den Kopf, hielt dann aber inne und erinnerte mich an den seltsamen Mann. Meine brennenden Wangen mussten mich verraten haben, denn Phoebe stieß ein aufgeregtes Quietschen aus. Allerdings war die Röte in meinem Gesicht eher auf meine Wut als auf Schüchternheit zurückzuführen.
»Du hast tatsächlich jemanden kennengelernt, oder? Warum hast du nichts erwähnt?« Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, als würde sie darauf hoffen, gleich mit einem schlüpfrigen Gerücht versorgt zu werden. »Ich bin ganz Ohr.« Ihre behandschuhten Finger umklammerten erwartungsvoll die Teetasse.
»So war es nicht«, schalt ich sie, obwohl meine Mundwinkel bei ihrer Aufregung zuckten. »Es war nicht mehr als eine flüchtige Begegnung. Weiter ist nichts passiert.«
Phoebe warf mir einen missbilligenden Blick zu und rümpfte die Nase. Dann zog etwas hinter meiner Schulter ihre Aufmerksamkeit auf sich und sie vergaß sofort ihre Fragen.
Ihr elegantes Lächeln kehrte zurück. »Schau mal! Wir haben die Aufmerksamkeit des Illustrators dort drüben auf uns gezogen!« Sie deutete in seine Richtung, neigte den Kopf und sah dabei aus, als wollte sie nicht verraten, dass sie den Künstler entdeckt hatte.
Es wäre nicht das erste Mal, dass unser gegensätzlicher Stil die Aufmerksamkeit der umherziehenden Künstler der Stadt auf sich zog. Phoebe strahlte immerzu, war elegant und gepflegt. Ich hingegen favorisierte das Dunkle und Unheilvolle.
Infolge meiner Arbeit hatte ich die Angewohnheit, immer Schwarz zu tragen. Ich bot die Veranlassung für viele Beerdigungen – eine Veranstaltung, der gegenüber ich keinen Respekt zollen konnte und wollte. So war es nur passend, dass ich immer angemessen gekleidet war. Eine Hommage an mein besonderes Talent. Es gab keinen Grund, die Trauerkleidung zu wechseln, denn Männer starben jeden Tag – was für ein schöner Anlass zum Feiern.
Spirituelle Gründe hatten damit nichts gemein. Schwarz würde immer in Mode sein, ob nun als Trauergewand oder nicht. Außerdem ließen sich die Interaktionen mit anderen Menschen so auf ein Minimum beschränken, was einen zusätzlichen Vorteil bot. Wenn überhaupt, dann würden es die Geister der Verstorbenen für Schadenfreude halten, wenn sie mich jetzt gerade sehen könnten. Ein wirklich poetischer Gedanke.
Wir verweilten noch ein paar Minuten länger auf unseren Plätzen und gaben dem Illustrator die Gelegenheit, sich alles detailgenau einzuprägen, bevor wir unseren morgendlichen Spaziergang antraten.
»Mord! Ein Leichnam am Hafen! Der Ripper ist unter uns! Ein blutrünstiges Monster!«, rief ein Zeitungsjunge, der die Zeitung in den Händen hielt und sie den Leuten feilbot.
Ich warf dem Jungen eine Münze zu, schnappte mir eine Zeitung und beschleunigte meine Schritte. Phoebe hatte Mühe, mit mir Schritt zu halten.
»Ein Leichnam am Hafen? Das ist doch nichts Ungewöhnliches.« Sie runzelte die Stirn und versuchte, einen Blick auf die Zeitung zu werfen, während ich die Titelseite aufschlug.
»Nicht irgendein Leichnam«, murmelte ich mehr zu mir selbst. Ich konnte das Gesicht auf der Illustration kaum erkennen, vermutlich weil die Leiche selbst kein Gesicht mehr gehabt hatte, das es darzustellen gäbe. Zu sehen war die Silhouette einer Frau in einem eleganten Kleid.
Es hätte nur ein Klecks von schwarzer Tinte auf Papier sein können, aber ich erkannte das babyblaue Kleid trotzdem genau.
Meine Finger schlossen sich um das Papier und ich zerknüllte es, bevor ich es im Vorbeigehen in einem Mülleimer entsorgte, bevor ich mir nervös die Hände an meinem Rock abwischte, als wollte ich die Schuld von mir abwaschen.
Meine neue Zielperson hat sein hässliches Haupt erneut erhoben.
Phoebe und ich trennten uns an dieser Stelle, um unsere jeweiligen Besorgungen für den Tag zu erledigen. Meine erste Station war der Florist.
Caldwells’ Flora und pflanzliche Extrakte stand auf dem Schild.
Ich kannte Mrs. Caldwell schon seit meiner Kindheit. Mein Vater hatte sie stets mit seltsamen Wünschen überhäuft. Ihr Laden war einer der wenigen, der Blumen und Pflanzen auf Sonderbestellung importierte. Ihr Mann unterhielt enge Verbindungen zum Fracht- und Importgewerbe. Das war für meinen Vater, der ständig mit seltsamen Pflanzen experimentierte, um Medikamente, Tinkturen und was auch immer ihn gerade beschäftigte, herzustellen, die erste Anlaufstelle.
Schließlich war ich es dann, die für alles, was ich für meine Arbeit brauchte, auf sie angewiesen war, bis ich vor einem Jahr die Stadt verließ. Mrs. Caldwell pflegte keine Fragen zu stellen, außer: »Wie viel?« oder »Wie schnell wird es benötigt?« Im Laufe der Jahre war sie mir ans Herz gewachsen – eine erweiterte Familie sozusagen.
»Wurde meine Sonderbestellung geliefert? Die, die ich letzte Woche telefonisch aufgegeben habe?«, fragte ich und schaute über den Ladentisch zu der kleinen, rundlichen Frau.
»Alina! Ja. Es sieht so aus, als hätten sie mehr geschickt, als bestellt. Aber ich habe keine Verwendung für Ihre seltsame kleine Pflanze. Nehmen Sie einfach den ganzen Strauß mit!« Sie nestelte herum, zog eine flache Kiste hervor und knallte sie auf den Tresen. Als sie den Deckel abnahm, kam eine großzügige Menge von weißem Natternwurz zum Vorschein. Ich untersuchte die Ware, ohne die strauchartige Pflanze zu berühren, obwohl es mir schwerfiel, nicht mit den Fingern über die üppigen Blätter zu streichen. Sie war von einem satten Grün und an den Spitzen mit kleinen weißen Blüten übersät, ähnlich wie der Bärenklau.
Der Natternwurz sah unscheinbar aus, aber die chemische Substanz, die aus dem Gewächs gewonnen werden konnte, war etwas Grandioses.
Das wenig inspirierende Unkraut enthielt die Chemikalie Tremetol. Es dauerte ein paar Tage, bis die Symptome auftraten, und bei ausreichender Dosierung konnte sie Mensch und Tier schnell zur Strecke bringen. Es war hervorragend dafür geeignet, um es zwischen den Parfüm-Kreationen zu verstecken, bis sich der richtige Käufer fand.
»Es ist perfekt, Mrs. Caldwell«, hauchte ich. Ich konnte mein Grinsen nicht länger zurückhalten.
»Sie und Ihre seltsame Auswahl an Blumenarrangements. Ich verstehe nichts davon, aber es freut mich, wenn ich Sie glücklich machen kann.« Sie lachte leise. »Es ist einfach schön, Sie wieder zu Hause zu sehen. Haben Sie sich schon eingerichtet?«
Sie warf mir einen Blick zu, dem ich seit meiner Rückkehr aus der Abgeschiedenheit nur allzu oft begegnete. Mit diesem bestimmten Ausdruck voller Mitleid und Anteilnahme. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, wann immer ich ein altbekanntes Gesicht sah – eine nicht enden wollende Erinnerung daran, dass ich ein Mitglied der Familie weniger zählen durfte.
Meine Stimme klang hölzern. »Nochmals vielen Dank. Dann bis ganz bald.«
o o o
Es war zweckmäßig, dass Caldwell lediglich drei Blocks von der Apotheke meines Vaters – meiner Apotheke – entfernt war.
Ich balancierte die Kiste auf dem Arm und steckte den Schlüssel ins Schloss. Als ich die Tür aufstieß, ertönte das schrille Klingeln der Ladenglocke.
Wenn ich den Duft des Ladens in einem Parfüm einfangen könnte, würde meine Haut bis zum Ende meines Lebens nach nichts anderem mehr duften.
Im Inneren vermischte sich das Aroma der heiligen Vielfalt an Kräutern und antikem Holz. Jedes Mal, wenn ich den Raum betrat, überkam mich eine Welle der Nostalgie. Fast jeden Abend brachte mein Vater die duftende Essenz der Apotheke mit nach Hause, sofern er dort und nicht in der Leichenhalle tätig gewesen war. Ich liebte es, wenn mir das Odeur des Ladens nach Hause hinterherwehte, und kostete die Augenblicke aus, in denen es meinen Sinnen anhaftete. Dank des wunderbaren Ortes würde die Erinnerung an meinen Vater niemals verblassen. Es kam mir vor, als sei er stets in meiner Nähe, wenn ich im Laden war – in jeder Hinsicht, nur nicht physisch.
Hinter der dunklen Holztheke befand sich das Hinterzimmer. Ich bezeichnete es gern als mein Labor, auch wenn das unpassend und willkürlich war. Das war der Ort, an dem die Wunder geschahen.
Ausgebreitet auf den langen Werkbänken im Hinterzimmer lagerten die Messinginstrumente, die entweder meinem Vater gehört hatten oder aus dem Labor des King’s College stammten, weil sie ausgemustert worden waren. Unter den Werkbänken stapelten sich ordentlich Glasfläschchen in verschiedenen Formen, Farben und Größen. Staub bedeckte sämtliche Oberflächen, auf die er sich geduldig legte. Es roch weniger angenehm als im vorderen Teil des Ladens, eher nach Schimmel und Bleichmittel, und das einzige Licht fiel durch die schmalen, horizontal eingebauten Fenster herein, die sich weit oben an den Wänden befanden und zur Belüftung geöffnet werden konnten. Eine einfache Hintertür führte schließlich in die Gasse, in der die Abfalltonnen standen und die Ratten hausten. Früher pflegte ich meine Laborratten dort einzufangen, doch künftig wollte ich sie selbst züchten, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Soweit es irgendjemanden betraf, untersuchte ich die Toxizität von Verbindungen, die in Schönheits- und Wellnessprodukten verwendet wurden. Das lieferte mir einen guten Grund, um die Pflanzen zu sammeln, die ich sammeln musste. Die meisten Leute verstanden den akademischen Jargon ohnehin nicht und stellten kaum Fragen.
Gerade als ich die Kiste auf die Werkbank hievte, ertönte die Türglocke. Bedauerlicherweise würde die Sektion dieses schönen Exemplars noch warten müssen.
Den ganzen Tag schneiten Kunden herein und erkundigten sich nach Puder, nach Mitteln gegen diese oder jene Beschwerden oder nach Pflanzen, die ihre Haut heller und ihre Figur schlanker machen oder die dafür sorgen könnten, dass ihre Männer ihren ehelichen Pflichten nachkamen.
Das alles machte mir nichts aus. Dank meines Interesses an Botanik genoss ich auch diese Seite des Geschäfts. Ich bevorzugte es, wenn die Leute mich direkt fragten, als dass sie es der Boulevardpresse entnahmen und es ohne zu hinterfragen oder mithilfe von Fakten zu untermauern, glaubten. Nur deshalb verfasste ich regelmäßig eigene Artikel. Es war nicht schwer, Informationen so weit zu vereinfachen, bis sie wirklich jeder verstehen konnte: X ist giftig, verwendet Y.
Die Glocke läutete den ganzen Tag, aber ich freute mich besonders über ein bestimmtes Klingeln, wenn Madame Berdot den Laden betrat. Sie war eine von meinen langjährigen Kundinnen für Sonderbestellungen. Ich schätzte alle meine Kunden gleichermaßen, aber auf diese Kundin freute ich mich nach langen Wochen oder Monaten der Abwesenheit ganz besonders. Erst letzten Monat hatte ich ihr eine großzügige Menge des experimentellen Natternwurz-Gifts geschickt. Mit den Resten von den Proben aus den Vorräten meines Vaters hatte ich etwas Neues kreiert. Vor ein paar Wochen teilte sie mir mit, dass die Kreation gut wirke, was der Grund dafür war, dass ich mehr davon bestellte.
Ihr Beruf brachte bedauerlicherweise den Umgang mit unangenehmen Männern mit sich. Madame Berdot gehörte eines der renommiertesten Bordelle der Stadt unten am Hafen. Es war der perfekte Ort, um meine neuen Kreationen zu erproben, und sie war niemals abgeneigt, mir die besonders schändlichen Individuen für meine Experimente zur Verfügung zu stellen. Dafür musste die Bordellbesitzerin nur eine Regel einhalten: Sie durfte das Gift nur bei Männern mit einer besonders ausgeprägten Neigung zu Gewalt anwenden.
»Wir müssen reden«, sagte sie abrupt und warf den Kunden, die das Kräuterregal durchstöberten, einen Blick zu. Nervös fuhr sie sich mit den Händen über das gelockte blonde Haar und warf unter ihren smaragdgrün geschminkten Augenlidern einen hastigen Blick zur Eingangstür, obwohl sie gerade erst angekommen war.
»Natürlich, bitte.« Ich deutete hinter den Tresen auf den Hinterraum, um ungestört reden zu können.
Mit ihrer schweißfeuchten Hand ergriff sie mich am Arm. »Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat aufgehört, zu wirken.«
Ich hob die Augenbrauen. »Das ist unmöglich.«
»Aber es stimmt. Es hat funktioniert, das gebe ich zu, aber dann hat es auf einmal nicht mehr gewirkt. Sind Sie sich eigentlich der Gefahr bewusst, der Sie mich und meine Mädchen aussetzen?«
Ich senkte meine Stimme. »Das ist unmöglich, weil es sich mit der Zeit nicht hätte zersetzen können. Eine kleine Menge davon würde ein Pferd umbringen. Ich habe mich selbst davon überzeugt.«
»Es hat ihn einfach krank gemacht, doch dann kam er zurück und …« Die Stimme versagte ihr den Dienst. »Ich dachte, ich könnte die falsche Dosierung verwendet haben, aber dann wirkt es eben bei manchen und bei anderen nicht.«
»Sie schulden mir keine Erklärungen. Lassen Sie mich etwas anderes für Sie holen. Wurde jemand verletzt? Brauchen Sie irgendetwas?« Ich durchsuchte bereits die schmalen Schubladen hinter dem Tresen und zog ein kleines Fläschchen heraus. »Arsen. Wenn er jedoch eine unmittelbare Gefahr darstellt, würde ich schnellere und drastischere Alternativen empfehlen. Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein.«
Sie schnappte sich das Fläschchen aus meiner Hand und nickte. Ohne ein weiteres Wort verließ sie eilig meinen Laden. Ich vermochte nicht zu sagen, ob sie mir die Sache übel nahm, aber es wäre durchaus nachvollziehbar, wenn dieser Ausrutscher unsere berufliche Beziehung beeinträchtigte.
Da war also meine verlässliche Quelle für Probanden dahin.
o o o
Die Stadt versank unter dem grauen Schleier des Nebels und das Licht im Laden schwand. Der Schein der Lampe in meiner Hand wies mir den Weg, als ich abschloss, um die Nachtruhe einzuläuten. Der Boden war gefegt, die Regale waren eingeräumt und die Waren für den nächsten Tag aufgefüllt. So wie es aussah, blieb mir nicht mehr genügend Zeit, um mich meinen neuen Pflanzen zu widmen.
Bis morgen, meine schönen Exemplare.
Ich drehte der Tür den Rücken zu und lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Apothekerschrank mit den einhundertfünfzig Schubladen, die ich nach einzelnen Gegenständen durchsuchte. Bevor ich mich vergewisserte, dass ich nichts vergessen hatte, fiel mir der kleine Ledertornister ins Auge, in dem ich die Aufträge, die bald ausgeliefert werden mussten, aufbewahrte.
Ein tiefes, klickendes Geräusch, das ich nicht zuordnen konnte, hallte durch den Raum.
Das Geräusch war so seltsam, dass ich einen Moment brauchte, um zu begreifen, dass es nicht so etwas wie ein Tinnitus war, der in meinem Ohr erzeugt wurde. Es war eine Mischung aus dem Zirpen einer Zikade und dem Klappern einer Katze, das sie mit den Zähnen machte, wenn sie einen Vogel vor dem Fenster erblickte. Ein neugieriges und raubtierhaftes Geräusch.
Es hielt eine Minute an, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte.
Es kam aus den Tiefen des Labors, verborgen in der Dunkelheit, die durch die angelehnte Tür zu mir spähte.
Ich grübelte darüber nach, ob ich die Tür zuschlagen oder das Tier willkommen heißen sollte, indem ich sie weit öffnete. Schließlich entschied ich mich für Letzteres. Als ich die Tür aufstieß, floss das Licht der Lampe über den matten Boden. Es beleuchtete den Staub, der durch die Luft wirbelte – und ließ das seltsame Geräusch abrupt verstummen.
Zurück blieb nur ein dunkler, leerer Laden, gehüllt in absolute Stille.
Ich runzelte die Stirn, schloss die Tür und schnappte mir meinen Tornister samt der Lampe. Ich würde nicht versuchen, mir einzureden, dass es nur meiner Fantasie entsprungen war. Entweder hatte ich mit meiner neuen Lieferung Natternwurz ein exotisches Insekt hereingeschleppt oder es versteckte sich ein Tier in meinem Laden.
An diesem Abend gestaltete sich der Weg nach Hause länger als gewöhnlich. Von dem Geräusch kribbelte meine Haut unangenehm. Es hatte guttural und ungewohnt geklungen und es weckte meine Neugier insoweit, als dass ich gleich am nächsten Morgen herausfinden wollte, was der Ursprung davon war. Ich stellte mir oft die Frage, wie ich ein neu entdecktes Insekt oder Säugetier nennen würde.
Meine Beine waren schwer von dem vielen Laufen und Stehen an diesem Tag, als ich die Haustür erreichte. Im Flur begrüßte mich das Mondlicht, das durch das Fenster über der Treppe auf die sauberen Fliesen fiel.
Ich machte es mir im Wohnzimmer bequem und schenkte mir ein wohlverdientes Glas Scotch ein. Phoebes Vater, Mr. Aston, war ein wahrer Kenner von alkoholischen Getränken und hatte nur die Besten von ihnen im Haus. Außerdem hatte er ein Händchen dafür, seine Sammlung um einige der ältesten Flaschen und Fässer zu vervollständigen, die ich je gesehen hatte, wie ich bei meinem letzten Besuch auf ihrem Landsitz hatte feststellen dürfen.
Mit dem Kristallglas in der Hand streifte ich am Fuß der Treppe meine Stiefel ab, bevor ich hinaufging. Den Morgen war ich langsam angegangen, doch es half mir nicht gerade gegen meine Müdigkeit. Bei jeder Stufe, die ich höher stieg, schmerzten meine Muskeln.
Nach der ersten Treppenstufe hörte ich ein lautes Rascheln.
»Noch mehr Ungeziefer?«, stöhnte ich.
Meine Waffe der Wahl war ein Besen aus dem Schrank oben an der Treppe.
Kratz. Kratz. Kratz.
Ich spähte um die Ecke am Ende des Flurs, der nur nach links oder rechts weiterführte. Dann wartete ich. Ich lehnte mich an die Wand, trank einen weiteren Schluck von meinem Drink und lauschte auf das nächste Geräusch.
Kratz. Kratz. Kratz.
Schon wieder. Links befand sich mein Schlafzimmer. Ich zog den Besen über den Teppich, um zu überprüfen, ob ich irgendwelche Viecher einfangen konnte, die ich unterwegs entdecken würde.
Am Ende des Flurs stand meine Schlafzimmertür einen Spalt weit offen. Für einen Moment kehrte Stille ein. Die Flüssigkeit in meinem Becher schwankte hin und her, ebenso wie meine Haltung. Mit der anderen Hand umklammerte ich selbstsicher den Besen, während ich darauf wartete, dass sich das Geräusch im dunklen Schlafzimmer wiederholte.
Die Tür quietschte leicht, als ich ihr einen sanften Schubs verpasste, bevor sie den Raum freigab.
Es war zwecklos, in dem abgedunkelten Raum etwas finden zu wollen.
Also schlich ich mich durch den Raum, um die Lampe neben meinem Bett zu entzünden. Die Lampe flackerte, als ich am Rädchen drehte, und gab eine langsam wachsende Flamme frei, die den düsteren Raum erhellte.
Dann erklang das Geräusch noch mal. Direkt hinter mir.
Nicht das Kratzen, sondern das Klicken aus dem Laden.
Erneut erstarrte ich und lauschte angestrengt, als wollte ich mir selbst gut zureden, dass ich dieses Mal heraushören würde, was es erzeugte. Zumindest war es nichts, das ich in meinem Leben bereits gehört hatte. Ich war auf der Suche nach exotischen Pflanzen und Tieren um die ganze Welt gereist, aber nichts kam auch nur annähernd daran heran.
Als ich mich umdrehte, verstummte das Geräusch abrupt. Kein Lebewesen war in Sicht. Nur ein dunkler, leerer Raum.
Ich hätte schwören können, dass es nur wenige Meter entfernt gewesen war, aber nichts sprach dafür. Der einzige Beweis, der mir blieb, war tief in den Winkeln meiner Fantasie verborgen, begleitet von dem leisen Summen meines auserwählten Giftes.
Kapitel 4
Das Ungeheuer
Ist sie nicht einfach köstlich?
Alina Lis, das schmackhafte Arrangement, das sich vor mir ausbreitete.
Ihr dichtes, schwarzes Haar ergoss sich über die Seidenlaken. So wie es aussah, hatte sie nicht widerstehen können, sich die gesamte Nacht hindurch im Bett hin und her zu werfen und zu drehen. Vielleicht spürte sie die Anwesenheit eines Raubtiers, das ihr gemütliches Nest belauerte.
Kluges Mädchen, aber nicht klug genug.
Ich tat nichts weiter, als sie zu beobachten, und rang mir das Versprechen ab, mich zu benehmen. Nur dieses eine Mal. Es blieb genügend Zeit für Spiele. Mein Hunger wuchs seit meinem letzten Mahl, das ich in Vorbereitung auf sie genossen hatte.
Ich war ein Gentleman. Es gefiel mir, meine Beute kennenzulernen, bevor ich sie verspeiste. Das war nur höflich. Heute hatte ich schwer geschuftet, indem ich jede ihrer Bewegungen verfolgte. Ich hatte Informationen eingeholt und Nachforschungen angestellt, um mehr über mein faszinierendes neues Spielzeug zu erfahren.
Unumstritten hatte ich mir eine persönliche Belohnung verdient, besonders in Anbetracht der vielen Spaziergänge, die diese Frau zurücklegte. Zumindest konnte ich mir sicher sein, dass sie eine phänomenale Durchblutung haben musste, weil sie so aktiv war. Ich hätte nicht damit gerechnet, auch nur die Hälfte von dem zu erfahren, was ich über meine Mahlzeit herausgefunden hatte. Miss Lis bewegte sich schnell und einige ihrer Besorgungen waren schwer zu begreifen. Ihre Routine war von so vielen seltsamen Ritualen geprägt. Die Apotheke stellte allerdings eine interessante Entdeckung dar. Ich nahm an, dass sie ihr gehörte, da sie anscheinend die Einzige war, die die Schlüssel dafür besaß.
Es war schon eine ganze Weile her, dass ich ein Ziel hatte, das sich lohnte, verfolgt zu werden. So intim mit einem Leben zu werden, das zum Greifen nahe war. Nach der harten Arbeit wäre es enttäuschend, feststellen zu müssen, dass sie fade schmeckte. Vom Geschmack abgesehen hatte ich fast vergessen, wie aufregend es war, auf die Jagd zu gehen. Ich würde behaupten, die Zeit sinnvoll genutzt zu haben, indem ich mir ihre Gewohnheiten, ihr Leben und ihren Duft eingeprägt hatte. Es war, als gehörte sie schon mir. Das arme Ding wusste es nur noch nicht.
Der Körper auf dem Bett lockte mich näher heran. Eine Delikatesse, die nur für mich bestimmt war.
Diese schwer fassbare Kreatur war von einer solchen Schönheit, als sei sie von einer Hexe aus einem uralten Wald geschnitzt worden, der von alten Geistern heimgesucht wurde und voller jahrhundertealter Geheimnisse steckte. Ganz zu schweigen von ihren … einzigartigen Farben. Es sah aus, als hätte jemand raffinierten Zucker über gemahlene Kohle gestreut. Zufällig und einzigartig – zu schade, um es zu verschwenden.
Sie raschelte unter der Decke und drehte sich um.
Konnte sie spüren, wie nah ich ihr war?
Nah genug, um einen Bissen zu nehmen.
Vorsichtig hob ich den seidigen Stoff der Bettdecke an, in der Hoffnung, zu sehen, was sich unter ihrer typisch düsteren Kleidung verbarg. Ich war enttäuscht, dass sie ihr Nachthemd angezogen hatte, aber vielleicht war es besser so. In der Tat, es fühlte sich ganz falsch an.
Ein nackter Körper barg für mich keine Geheimnisse, aber ihren zu sehen, würde sich wie eine Sünde anfühlen. Eine Delikatesse durfte nicht in Eile verzehrt werden. Das wäre ziemlich ungehobelt. Das Haar fiel in lockeren Wellen über ihre blasse Haut bis zu ihren Hüften hinab und zeichnete dabei die Stellen nach, die ich berühren wollte. Lediglich die Umrisse ihres Körpers waren sichtbar, da der Stoff sie umhüllte. Auf eine unerklärliche Weise fühlte es sich immer noch so an, als würde ich unter die Kutte einer Nonne linsen.
Ich neigte meinen Kopf zur Seite, während ich sie betrachtete, ohne die Laken zu weit zu heben, um sie nicht zu stören. Wenn sie sich doch nur zu mir drehen würde! Ich wollte mehr von ihr sehen. Sie schirmte sich absichtlich vor meinem Blick ab. Also schön, ganz wie du es willst, aber nur für heute Nacht.
Ihr Duft kitzelte meine Nase und ich sog scharf die Luft ein.
Neben dem Bett sank ich auf meine Knie und starrte gebannt auf das verführerische Geschöpf vor mir. Vorsichtig strich ich ihr das Haar aus dem Nacken.
Ich kann nicht anders. Wer bin ich, dass ich mir die einfachen Freuden des Lebens vorenthalte?
Ich beugte mich näher zu ihr hinab, vergrub meine Nase in ihrem Haar und wickelte eine dunkle Strähne um meine Handfläche. Dann nahm ich einen tiefen Atemzug. In ihrer Gegenwart spielten meine Sinne wie im Rausch. Sie duftete nach spätblühender Traubenkirsche, Bittermandeln und Alkohol. Es gab noch andere, schwache Noten, die mir die Kehle zuschnürten und ein Brennen darin verursachten. Oh, ich wusste einfach, dass sie mich ins Wanken geraten lassen würde.
Die neuen Sinneseindrücke versetzten meinen Verstand in einen Rausch und sorgten dafür, dass sich die Erinnerung an sie tief in mein Gedächtnis eingrub. Schließlich war es unerlässlich, jede Beute wie seine Westentasche zu kennen, um jede ihrer Bewegungen vorhersehen zu können. Ich hätte nichts dagegen, diese hier mit der Zeit auf jede erdenkliche Weise kennenzulernen.
Unter dem Fleisch, hinter all den Regungen, lag etwas, das sich schwer fassen ließ, obwohl ich schon ein paar Mal etwas Ähnliches erlebt hatte.
Unverdünnt, stark, unberührt. Ein Tropfen dieser Süße weckte Hunger und Verlangen und vermochte Jeden um den Verstand zu bringen.
Sie hatte echt Glück, dass ich sie zuerst gefunden hatte.
Jeder andere hätte sie in Stücke gerissen, wenn er nah genug herangekommen wäre, um es zu erkennen.
»Ah … so süß«, murmelte ich und vergrub mein Gesicht in ihrer Halsbeuge.
Ich hatte recht, wenn ich sagte, dass sie etwas Besonderes war. Sie hatte eine mehr als seltene Blutgruppe, die nur wenigen Menschen eigen war, und einen Geschmack, der einzigartig auf der Welt war. Alina war das, was wir als Mellifluous-Wirt bezeichneten – eine wahrlich seltene Delikatesse.
Ich liebte es, recht zu behalten.
Ihr Blut hatte eine interessante Würze, die ihm eine aromatische Note verlieh. Sie war so verlockend, ihr Hals lag zart vor meinen Kiefern und wartete auf mich. Ich hätte ihn mit einem einzigen Biss entzweibrechen können.
Mein Blick glitt zu ihrem Gesicht hinauf. Es wirkte so weich und friedlich. Wie ein schlafendes Reh, eingehüllt in die Geborgenheit der Nacht, das darauf vertraute, von den in der Dunkelheit lauernden Schrecken verschont zu werden. Sie wirkte hilflos und vollkommen unschuldig.
Mein Körper verzehrte sich nach ihr.
Meine Eckzähne zuckten voller Vorfreude und flehten danach, in das zarte Fleisch unter mir eindringen zu dürfen. Die unberührte Haut zu verletzen, wäre das ultimative Aphrodisiakum. Das gleiche Gefühl hatte mich vergangene Nacht heimgesucht und mich dazu gebracht, meine letzte Mahlzeit unsäglich zu verpfuschen. Ich wusste, dass sie mein Werk an diesem Morgen in der Zeitung gesehen hatte, und wollte sie wissen lassen, dass ich es war.
Ich verlagerte mein Gewicht, um eine bequemere Position zu finden. Ein tiefes, aufgeregtes Klicken entrang sich meiner Kehle, als ich die Hüften bewegte und meine Zähne vor Kälte klapperten. Der Ausdruck in ihrem Gesicht, als sie die Skizze in der Zeitung gesehen hatte, ließ mich vor Erregung erzittern. Ich fragte mich, ob sie diesen Ausdruck noch einmal für mich auflegen würde. Das Summen in meiner Kehle war kaum zu unterdrücken, als ich daran dachte. Es war alles so aufregend. Warum hatte sie sich nicht nach mir erkundigt? Nicht einmal gegenüber der Polizei hatte sie mich erwähnt.
Wie ungezogen.
Sie war doch von der aufmerksamen Sorte. Ich hätte gedacht, dass sie zuerst die Polizei oder die Zeitung anrufen würde.
Woran bist du dran? Warum willst du nicht spielen?
Es war ziemlich frustrierend, mir die ganze Mühe zu machen, nur damit sie meine Geste ignorierte. Ihre Beweggründe waren unbegreiflich. Vielleicht musste ich einfach deutlicher werden. Normalerweise hätte ich mir diese Mühe nicht gemacht, aber sie hatte das Feuer in mir entfacht. Es war unmöglich, sie zu ignorieren und es war unvorstellbar, wie sie es schaffte, mich zu ignorieren.
»Ich freue mich auf das mit uns, kleiner Schatten«, flüsterte ich ihr ins Ohr, strich ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr und gewährte ihr eine letzte Nacht der Ruhe. Noch eine letzte Nacht, dann würde unser Spiel beginnen.
Kapitel 5
Die Giftmischerin
Blut, überall ist Blut.
Ich hocke auf meinen Knien und stütze mich mit den Händen am Boden ab, während ich auf meine Reflexion in der dickflüssigen, klebrigen Flüssigkeit starre.
Warum ist da so viel davon? Ist das mein eigenes Blut?
Ich schaue auf. Eine schwarze Leere umgibt mich und die scharlachrote Lache erstreckt sich so weit das Auge reicht. Mein ganzer Körper ist mit Blut besudelt.
Tröpfchen trüben meine Sicht, färben sie rot und lassen meinen Blick verschwimmen. Einerlei, wie oft ich versuche, sie mir aus den Augen zu wischen – meine Sicht wird nicht klarer. Es kommt mir vor, als würde umso mehr Blut heruntertropfen, je mehr ich versuche, es wegzuwischen.
»Ah … so süß.«
Eine verschwommene Gestalt in der Ferne stößt die Worte aus. Sie klingen, als wäre ich unter Wasser. Ich blinzle und reibe verzweifelt über meine Augen, um zu sehen, was sich mit mir im Zimmer befindet.
Die großgewachsene Gestalt hat mir den Rücken zugewandt. Blut tropft über die schlanken Muskeln. Es ist ein Mann und er sieht aus, als sei er aus Stein gemeißelt worden. Wenn er behaupten würde, er sei Luzifer höchstpersönlich, würde ich ihm glauben. Seine Erscheinung ist nicht von dieser Welt und sie verkörpert eine Mystik, die über die Eigenschaften eines Sterblichen hinausgeht.
Der Fremde dreht den Kopf, wirft einen Blick über die Schulter und sieht mich an. Das Grinsen ist mir vertraut und es harmoniert mit den leichenblassen Augen, aus denen er mich anschaut.
Als sich seine Mundwinkel zu einem Grinsen verziehen, ertönt in seiner Kehle das raubtierhafte Klicken, als sei er ein Dämon, der aus den tiefsten Abgründen der Hölle emporgestiegen ist. Ausdrücklich damit beauftragt, mich zu martern.
Ich taumele zurück, als meine Sicht wieder verschwimmt. Das raubtierhafte Spiegelbild seiner Augen im schwachen Licht ist alles, was ich sehen kann, während er sich nähert.
»Ich freue mich auf das mit uns, kleiner Schatten.«
Plötzlich stolpert mein Herz, was mich aus meinen Gedanken und zurück in die Realität reißt.
o o o
»Das kommt davon, weil du die ganze Zeit arbeitest, statt dich mit mir zu vergnügen«, nörgelte Phoebe und tippte auf den Rand ihrer Tasse.
»Daran liegt es nicht. Ich habe in den letzten Tagen nicht besonders gut geschlafen. Die Arbeit entspannt mich.«
»Die Arbeit entspannt dich? Oh bitte, wann hat ein normaler Mensch zuletzt so etwas geäußert und es auch noch so gemeint?«
»Ich meine es so«, gab ich lachend zu, aber Phoebes Gesichtsausdruck verriet mir, dass sie mir nicht glaubte.
Wir hatten beschlossen, uns bei Phoebe zu unserer morgendlichen Klatschrunde zu treffen, da der Regen unserem Spaziergang einen Dämpfer verpasst hatte.
»Vielleicht kannst du nicht schlafen, weil ein Ripper in den Straßen sein Unwesen treibt. Ich bin sicher, du hast die Meldung über die neuen Leichen gesehen«, murmelte Phoebe.
»Welche neuen Leichen?« Ich streckte neugierig meine Hand aus. »Zeig mir die Meldung.«
Sie reichte mir die Zeitung vom heutigen Morgen.
Im Hafen waren zwei Leichen gefunden worden. Die Abbildung zeigte ihre blassen Gesichter und starren Körper, die auf den matten Kopfsteinpflastersteinen abgelegt worden waren.
Auffällig war, dass die beiden Frauen sich ähnlich sahen. In der Zeitung stand, dass sie nicht miteinander verwandt waren und sich nicht einmal gekannt hatten. Aber sie kamen mir so vertraut vor.
Ihre Augen waren trüb, doch ein Hauch von heller Farbe war noch zu erkennen. Das dunkle, nasse Haar klebte an ihren Gesichtern und war vollkommen zerzaust.
Ein weiterer interessanter Aspekt war die Haut auf der linken Seite ihrer Gesichter oder das Fehlen dieser. Über der Augenbraue und über dem Auge war sie den Opfern präzise abgezogen worden. Die freigelegten Muskeln und die sauberen Wundränder deuteten darauf hin, dass dies sorgfältig, ja geradezu methodisch durchgeführt worden war.
Es gab keinen Zweifel daran, wer das getan hatte, aber ich fragte mich, warum es der Theatralik bedurfte.
Das war eine Botschaft an mich. Glaubt mir, sie war angekommen. Auch wenn das Motiv für meine Zeichnung bestenfalls geschmacklos war.
Die Abscheu musste mir ins Gesicht geschrieben stehen, denn Phoebe riss mir die Zeitung aus den Händen. »Genug Makabres für einen Morgen.«
Unzählige Gedanken schwirrten mir im Kopf herum. Würde er mich heute holen? Morgen? In zwei Wochen? Ich war erleichtert, dass er sich mir noch nicht gezeigt hatte. Eine solche Begegnung wäre wohl kaum erfreulich. Ich konnte nur hoffen, dass die Bedrohung sich nicht wiederholen würde. Der Glückspilz – zumindest musste er sich um die Polizei keine Sorgen machen. Vielmehr sollte er sich darum sorgen, was ich mit ihm anstellen würde, besonders, wenn die Provokationen nicht aufhörten.
Dennoch musste ich auf jedes mögliche Szenario vorbereitet sein, das er wählen könnte. Ich wusste nicht, was er tun würde, aber ich hatte das Gefühl, dass die Vorlieben dieses Ungeheuers zu grausam waren, um mir die Gnade zu gewähren, mich zu töten. Die Mühe, die er in seine Nachricht gesteckt hatte, wäre verschwendet, wenn er es schnell hinter sich bringen wollte.
Nachdem ich mich von Phoebe verabschiedet hatte, machte ich noch ein paar Besorgungen auf dem Markt und schaute in der Apotheke vorbei. Die Fläschchen und Metallstücke in meinem Tornister klirrten auf dem Heimweg. Die Dunkelheit machte mir keine Angst, aber ich wollte es vermeiden, mich in eine prekäre Lage zu begeben. Ich schloss den Laden früher ab, um dies zu gewährleisten.





























