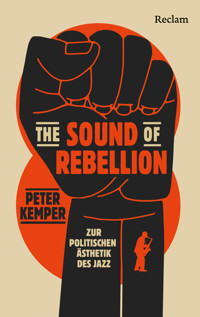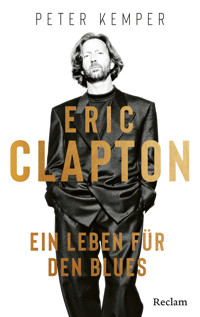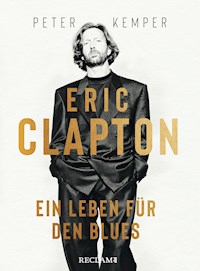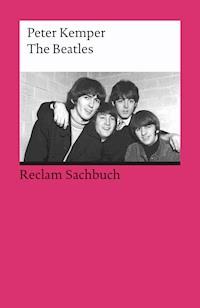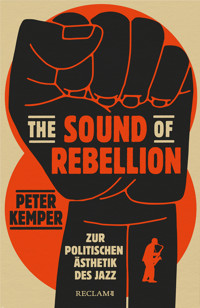
30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 30,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie politisch ist der Jazz? »Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über Black Music schreiben können. Der Diskurs zu diesen Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein.« Archie Shepp Der Musikjournalist Peter Kemper geht in seinem umfassenden Werk davon aus, dass Jazz schon immer in die Auseinandersetzung um Rassismus und soziale Ausgrenzung verstrickt war. Und schreibt ein Jazzbuch, wie es noch keines gab: Erstmals wird die Emanzipationsgeschichte der Afroamerikaner in den letzten 100 Jahren anhand der Geschichte des Jazz nachgezeichnet. Neben den wichtigsten stilistischen Meilensteinen beschreibt Kemper auch die prägendsten Persönlichkeiten und die einflussreichsten Strategien ihrer Rebellion. Jazzgrößen wie Louis Armstrong, Charles Mingus und Moor Mother haben ihre Arbeit stets als Ausdruck eines Lebens begriffen, das vom alltäglichen und institutionellen Rassismus geprägt war. Doch worin liegt der subversive Kern des Jazz genau? Im demokratischen Charakter der Improvisation? In kämpferischen Texten und Titeln? Oder in der Soundsprache selbst? Peter Kemper untersucht in seinem grundlegenden Werk, wie weit die Schlagkraft eines politisch verstandenen Jazz reicht, wo seine ästhetischen Potenziale und Grenzen liegen: Die perfekte Lektüre für Musikliebhaber, die sich für die politische Bedeutung von Musik interessieren und tiefer in die Welt des Jazz eintauchen möchten – und ein tolles Geschenk, nicht nur für ambitionierte Jazzfans. - Die Geschichte des Jazz als Emanzipationsgeschichte der Afroamerikaner - Mit spürbarer Leidenschaft geschrieben vom F.A.Z.-Musikkritiker und Jazz-Experten Peter Kemper - Ein Must-have für jeden Jazz-Fan: Aufwändig ausgestattet mit vielen Abbildungen und Fotografien
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 969
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Kemper
The Sound of Rebellion
Zur politischen Ästhetik des Jazz
Reclam
Für Hildegard,ohne die ich dieses Buch niemals hätte schreiben können.
2., durchgesehene Auflage
2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Coverabbildung: FinePic®
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962198-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011324-0
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung: Soundtrack afroamerikanischer Emanzipation
I. ›Onkel Tom‹ zeigt Zähne: Wie Louis Armstrong die Welt überraschte
II. Stil und Eleganz: Duke Ellingtons emanzipatorische Maskerade
III. Billie Holiday: »Strange Fruit« als kulturelle Kriegserklärung
IV. Von Charlie Parker zu Art Blakey: Bebop und Hard Bop als Beispiele stilistischer Militanz
V. Abbey Lincoln und Max Roach: Wir feiern unsere Hautfarbe!
Exkurs: Randy Westons Uhuru Afrika
Exkurs: Das African Piano des Abdullah Ibrahim
VI. Charles Mingus oder: Die Kreativität des Zorns
VII. John Coltrane – »Alabama« oder: Ein Attentat schreibt Jazzgeschichte
VIII. Albert Ayler: Der stumme Schrei – Ansätze zu einer ›spirituellen Politik‹
IX. Idealismus vs. Egoismus: Aufstieg und Fall der Jazz Composers Guild
X. Saxophon als Megaphon oder: Zur Gebrauchslyrik von Archie Shepp
XI. Miles Davis – Das Herz eines Boxers
Exkurs: Zum ›Jazz-Krieg‹ mit Wynton Marsalis – Zwischen Cakewalk und Ragtime
XII. Weltraum-Phantasien – Der Afrofuturismus von Sun Ra und seinen Erben
Exkurs: The Comet Is Coming – Zum Space-Jazz von Shabaka Hutchings
XIII. Great Black Music – Ancient to the Future: Zur Symbolpolitik des Art Ensemble of Chicago
XIV. Demokratie der Klänge: Ornette Colemans Vision kollektiver Verständigung
Exkurs: Charlie Haden’s Liberation Music Orchestra: Sound-Politik in Portugal
XV. Energie und Ekstase: Zur Sound-Strategie von Pharoah Sanders und Cecil Taylor
XVI. Black Music Matters – Kamasi Washington und seine Hip-Hop-Hood
XVII. The Future is Female – Zur Erinnerungspolitik von Matana Roberts, Moor Mother und Angel Bat Dawid
XVIII. Wie politisch kann die Sprache des Jazz sein?
Wer spricht? – Ein Nachwort in eigener Sache
Zu dieser Ausgabe
Literaturhinweise
Abbildungsnachweise
Personenregister (Namen/Bands)
Werkregister (Titel und Alben)
Zum Autor
Ich bin nicht schwarz,
aber es ist sehr oft so,
dass ich mir wünsche,
nicht weiß zu sein.
Frank Zappa, 1966
Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über Black Music schreiben können. Der Diskurs zu diesen Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein.
Archie Shepp, 2021
Einleitung
Soundtrack afroamerikanischer Emanzipation
Um den Jazz ranken sich viele Mythen. Dass es sich dabei um eine genuin politische Musik handelt, dürfte einer der hartnäckigsten sein. »Ich fühle mich als Inbegriff von Black Lives Matter«1 erklärte der Saxophonist Kamasi Washington aus der Hip-Hop-Hood in Los Angeles selbstbewusst 2016. Schon knapp ein Jahrhundert zuvor hatte ein Jazz-Gentleman wie Duke Ellington kein Blatt vor den Mund genommen: »Jazz war während der ›plantation days‹ unsere Reaktion auf die Tyrannei, die wir erdulden mussten. Er erzählt eine Geschichte von Menschen, die in ihrer Entwicklung gehandicapt und furchtbar unterdrückt wurden«. 1944 präzisierte er: »Du kannst alles, was du willst, mit einer Posaune sagen, aber du solltest vorsichtig sein mit Worten«.2
Gern wird auch der plakativ-provokative Ausspruch von Archie Shepp aus den 1960er Jahren kolportiert: »Mein Saxophon ist das Maschinengewehr des Vietcong«.3
Und wer hätte von Louis Armstrong, der so oft als harmloser, ewig lächelnder ›Onkel-Tom‹-Typ kritisiert wurde, erwartet, dass er sich 1957 im Skandal von Little Rock offen gegen die Rassenpolitik der amerikanischen Regierung positionieren würde?
Ich habe 40 Jahre lang ein wundervolles Leben mit der Musik gehabt, aber ich spüre die Unterdrückungssituation so wie jeder andere Schwarze auch. […] So, wie sie meine Leute im Süden behandeln – die Regierung kann von mir aus zur Hölle fahren.
Jazz ist für Satchmo immer auch die klangliche Verkörperung schwarzer Erfahrung in den USA. Oder wie er es ausdrückte: »Was wir spielen, ist unser Leben.«4
Oft wird auch die politische Funktion des Jazz damit erklärt, dass sein zentrales Moment, die Improvisation, einen fortschrittlich ›demokratischen‹ Charakter besitzt. Dann weisen Jazzmusiker gern darauf hin, dass sie sich mit ihrer Kunst bereits automatisch in eine kommerzielle Außenseiterposition begeben haben und damit quer zu einer kapitalistischen Verwertungslogik stellen. Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang die Behauptung des Saxophonisten Mark Turner, schon die Entscheidung als Jazzmusiker zu leben, sei ein politisches Statement. Ein weiteres beliebtes Argument lautet, wer Jazz spiele, verhalte sich automatisch antirassistisch, weil er mit seiner Musik vielmehr einer pluralistischen Gesellschaft das Wort redet.
Man kann den Begriff ›Jazz‹ heute für ungeeignet halten, um die Vielfalt seiner Stile und die Kompliziertheit seiner künstlerischen Praxis zu fassen. Auch seine Bezüge zur verrufenen Kneipenkultur in New Orleans, mit Bordellen und sexuellen Praktiken lassen den Begriff in einem eher negativen Licht erscheinen. Doch all die von Musikern und Kritikern vorgeschlagenen Alternativen wie »Creative Music«, »African American Music« oder »New World Music« dienen zwar dem Selbstverständnis der Jazzszene, haben jedoch keine Ausstrahlung und keine Akzeptanz in einer breiteren musikinteressierten Öffentlichkeit. Die kennt allenfalls den Begriff ›Jazz‹ und verbindet damit auch die Vorstellung von einem bestimmten Sound, einer bestimmten Form von Improvisation und musikalischer Komplexität. Von vielen schwarzen Musikern wird der Ausdruck ›Jazz‹ gleichwohl als Ausdruck einer ›weißen Enteignung‹ abgelehnt, auch deshalb, weil er ihnen als zu einengend erscheint.
Und doch bleibt das Wort ein nützliches Kürzel, um damit eine ganze Musiktradition mit all ihren Erfolgen, Kämpfen und Widersprüchen zu identifizieren. Im Folgenden wird deshalb der Ausdruck ›Jazz‹ mit Bezug auf die mehr als 100-jährige Geschichte dieser Musik verwendet. Denn der Begriff bietet trotz seiner Mängel die am weitesten verbreitete Verständigungsgrundlage, auf der diese Musik, ihre soziale Dimension, ihre Protagonisten und ihr kritisches Potential verhandelt werden können: Worin besteht das oft und gern zitierte, jedoch bis heute rätselhafte ›Widerständige‹ des Jazz? Worin liegt sein ominöses Freiheitsversprechen begründet?
Eine Grundannahme dieses Buches lautet: Jazz ist als Innovation von Afroamerikanern entstanden und hat sich im Kontext ihrer Emanzipationsbewegung und ihres Kampfes um Bürgerrechte entwickelt. Als primär afroamerikanisches Akkulturationsprodukt bewegt sich diese Musik immer schon im Konfliktfeld zwischen schwarzer und weißer Politik und Praxis. Es fand eine Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen statt: der westafrikanischen und der nordamerikanischen. Wenn am Anfang jeder Jazz-Geschichtsschreibung das Verbrechen der Sklaverei und die damit verbundene Massendeportation von Einwohnern Westafrikas nach Nord- und Südamerika steht, dann stellt der ›Konflikt‹ zwischen der latenten Musikfeindlichkeit angelsächsischer Puritaner und der musikalisch geprägten Sozialisation der Westafrikaner das kulturelle Medium dar, in dem die frühen afroamerikanischen Musikstile wie Worksongs, Gospel/Spiritual und Blues als Vorläufer des Jazz ihren Ursprung haben. Jazz stand also immer im Spannungsverhältnis zwischen den ›races‹ und lässt sich deshalb nicht nur als »bloßer Gefühlsausdruck«, wie es der Saxophonist Joshua Redman nennt, sondern auch als »soziale Musik«, so Archie Shepp, begreifen. Doch wie haben es Jazzmusiker immer wieder geschafft, trotz eines rassistisch geprägten Umfelds eine Kunst von so kraftvoller Schönheit, überwältigender Würde und dauerhafter Ausstrahlung zu schaffen?
Im amerikanischen Sprachgebrauch bezieht sich der Ausdruck ›race‹ auf alle Fragen der Hautfarbe, der Ethnizität und gesellschaftlichen Schicht. Der Begriff lässt sich in seiner vielschichtigen Bedeutung nur unzureichend ins Deutsche übersetzen und kann nicht mit dem Begriff »Rasse« gleichgesetzt werden. Im Folgenden wird also nicht nur, um den historisch belasteten »Rasse«-Begriff zu vermeiden, der Ausdruck ›race‹ verwendet, wenn es um Fragen der Hautfarbe, der ethnischen Abstammung, der sozialen Stellung und spezifisch afroamerikanischer Diskriminierungserfahrungen geht. Vor diesem Hintergrund akzentuiert dieses Buch die Jazzgeschichte neu: als Entwicklung von ›race conflicts‹ und der allmählichen Politisierung von Jazzmusikern.
Das Thema ›Jazz und Rassismus‹ hat dabei verschiedene Facetten: Zum einen geht es um die Diskriminierung von Jazzmusikern in einer dominanten ›weißen‹ Hochkultur und Unterhaltungsindustrie. Zum anderen wurde nach und nach der Rassismus selbst zum Thema des Jazz. Musiker versuchten, sich mit klanglichen Mitteln zur Wehr zu setzen. Doch auch innerhalb der Jazzszene blieben ›racial tensions‹ nicht aus: Immer wieder kam es in der Black Community zu wechselseitigen Demütigungen und Desavouierungen. Erstmals wird hier also die Emanzipationsgeschichte der Afroamerikaner in den letzten 100 Jahren anhand der Jazzgeschichte nachgezeichnet, mit ihren wichtigsten stilistischen Wegmarken, in theoretischen Exkursen, einer Charakterisierung der prägenden Persönlichkeiten und den wirksamsten Strategien ihrer Rebellion.
Auf diese Weise lassen sich die Wurzeln des Jazz in Ritualen versklavter Afrikaner ebenso wie in Praktiken ihrer Kirche oder in rassistisch gefärbten Minstrel Shows aufspüren. In New Orleans und St. Louis haben Ende des 19. Jahrhunderts Ragtime-Pianisten und Blaskapellen afrikanische und europäische Einflüsse in ihrer Musik vermengt und so den Jazz aus der Taufe gehoben. In den späten 1920er und frühen 1930er Jahren verkörperte Duke Ellington mit seinem Orchester die Blüte der ›Harlem Renaissance‹, die versuchte, mit neuem ›black pride‹ die Gleichheitsansprüche von Afroamerikanern durch ihre Erfolge in Kunst und Kultur durchzusetzen. Die Bebop-Revolution mit ihrer Gallionsfigur Charlie Parker erwuchs im Kontext eines erneuerten Anspruchs auf Gleichbehandlung, wie ihn afroamerikanische Soldaten aus den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs in ihr Heimatland zurückgebracht hatten: Man war im Kampf gegen die faschistische Diktatur in Europa und Asien erfolgreich gewesen und forderte jetzt zu Hause dieselben Bürgerrechte ein, wie sie die weißen Heimkehrer längst hatten.
Nachfolgende Jazzstile wie Hard Bop, Funk-Jazz oder die Avantgarde des ›New Thing‹ in den 1960er Jahren lassen sich im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Civil Rights Movement und einem wachsenden afroamerikanischen Selbstbewusstsein verstehen. Selbst die Fusion-Experimente in den 1970er Jahren sowie der darauf reagierende Neotraditionalismus im folgenden Jahrzehnt können als Ausdrucksformen schwarzer Identitätssuche gelesen werden, die sich vor dem Hintergrund eines konservativen Neoliberalismus der fortschreitenden Emanzipation der Schwarzen in den USA verpflichtet sah.
Während sich der Jazz in Europa seit den 1960er Jahren mehr und mehr zu einer Kunstmusik entwickelte, konnte sich der instrumentale Jazz in den USA immer noch seiner soziopolitischen Wurzeln vergewissern. Ohnehin lässt sich die europäische Jazzgeschichte ohne die afroamerikanischen Vorleistungen nicht denken. Der Multiinstrumentalist Ken McIntyre, der mit vielen großen Jazzmusikern seit den 1970er Jahren zusammengearbeitet hat, war sich zeitlebens sicher:
Man kann afroamerikanische Musik nicht allein innermusikalisch verstehen. Denn sie entsteht immer im Spannungsfeld jener sozialen, politischen und ökonomischen Ereignisse, mit denen Schwarze zu tun haben. Das hängt alles miteinander zusammen.5
Wenn jemand wie Billie Holiday mit ihrem Protestsong »Strange Fruit« schon in den 1930er Jahren die Praxis der Lynchjustiz in den amerikanischen Südstaaten offen angeprangert hat, dann wurde das Lied darüber hinaus als Aufschrei gegen jede Form von Rassismus verstanden. Der Hard-Bop-Mitbegründer Art Blakey reagierte mit seiner Schlagzeugkomposition »Freedom Rider« 20 Jahre später unmittelbar auf eine explosive, politische Situation. Mit ihrer Freedom Now Suite lieferten Max Roach und Abbey Lincoln Anfang der 1960er Jahre eines der eindrucksvollsten Beispiele einer sozial engagierten Befreiungsmusik. Der Bassist und Komponist Charles Mingus belegt daneben mit zahlreichen Stücken, wie sich ein Jazzmusiker als Agitator und Aktivist verwirklichen kann.
Auch wenn Miles Davis selten explizit zur Rassenfrage in den USA Stellung nahm, müssen seine zahlreichen Innovationen als Ausdruck heroischer Selbstermächtigung eines schwarzen Musikers begriffen werden. Das gilt selbst für seinen Gegenspieler Wynton Marsalis. Davis’ langjähriger Weggefährte John Coltrane galt ebenfalls als eher ›unpolitischer‹ Mensch und schien viel mehr an religiösen Themen interessiert zu sein. Doch sein Stück »Alabama« von 1963 wird bis heute als Paradebeispiel eines politisch informierten Jazz herangezogen und scheint einer Grabrede von Martin Luther King nachempfunden zu sein. Mit Albert Ayler betrat zeitgleich ein Geisterseher des Saxophons die Bühne, der sich an einer ›spirituellen Politik‹ versuchte und daran zugrunde ging.
Viel offensiver ging der Saxophonist Archie Shepp mit den rassistischen Zumutungen in den USA um. In seinen Händen verwandelte sich das Instrument im Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ausgrenzung in eine musikalische Waffe. Selbst in den Weltraum-Phantasien eines Sun Ra schlummert ein fortschrittlicher Afrofuturismus, der nicht nur die Entfremdung des schwarzen Künstlers in der weißen Mehrheitsgesellschaft Amerikas spiegelt, sondern schwarze Identität neu zu denken versucht. Warum aber musste eine Musikerselbstorganisation wie die Jazz Composers Guild an ihrem Idealismus scheitern, nachdem sie mit ihrer October Revolution in Jazz den Beginn eines neuen »Black Arts Movement« angekündigt hatte?
Mythen, Maskerade, Rituale – mit seiner offensiven »Great Black Music« versucht das Art Ensemble of Chicago seit mehr als 50 Jahren in einer Art ›Psychopolitik‹ festgefahrene Wahrnehmungs- und Erfahrungsstrategien aufzubrechen, um ein alternatives Modell der Wirklichkeit zu entwerfen. In der scheinbar frei improvisierten Musik von Ornette Coleman lässt sich so etwas wie eine visionäre ›Demokratie der Klänge‹ ausmachen, die eine Blaupause für soziale Veränderung abgeben könnte. Und noch in den Soundekstasen des Saxophonisten Pharoah Sanders, wie auch des Pianisten Cecil Taylor, kann man eine ›Ökonomie der Verausgabung‹ identifizieren, die sich der ›Ethik der Warenwelt‹ verweigert und eine im Wortsinn macht-lose Souveränitätspolitik propagiert.
Durch Hip-Hop und Rap als weitere authentische afroamerikanische Musikformen sieht sich der Jazz seit den 1970er Jahren zunehmend herausgefordert. Wie improvisierte schwarze Musik vor dem Hintergrund der Black Lives Matter-Proteste ihre Deutungshoheit zurückgewinnen könnte, demonstriert der Saxophonist Kamasi Washington mit seinen Mitstreitern aus L. A.
Der Black Lives Matter-Bewegung fühlen sich auch schwarze Jazzmusikerinnen verpflichtet, deren Einfluss in der Jazzszene seit Jahren deutlich wächst. Ob Matana Roberts in ihrer klingenden Geschichtspolitik die Geister der Vergangenheit zu bannen versucht, ob die Spoken-Word-Artistin Moor Mother von einer neuen »Befreiungstechnologie« träumt oder Angel Bat Dawid ihre Performances zwischen Mythen-Erkundung und Exorzismus ansiedelt: Immer verstehen sich diese starken schwarzen Frauen als Kämpferinnen gegen einen noch immer nicht überwundenen Rassismus. Und selbst dann, wenn große Musikerinnen und Musiker sich nicht explizit politisch artikulieren, steckt in ihrer Arbeit – wie im Folgenden in vielen Fällen gezeigt werden kann – häufig ein subversiver Kern.
Was bedeuten diese praktischen Beispiele für eine Theorie des Jazz in philosophischer und soziologischer Hinsicht? Wie steht es um grundsätzliche Fragen wie: Was ist im Jazz eigentlich umstürzlerisch? Kann er als Kunstform reale Effekte in der Gesellschaft auslösen? Oder lässt sich seine politische Wirkung nur metaphorisch oder in Form von Analogien erfassen? Wie verhalten sich Musik im Allgemeinen und Jazz im Besondern zur menschlichen Sprache, die ja als komplexes Kommunikationssystem den politischen Diskurs naturgemäß dominiert? Hat beispielsweise das Saxophon eine eigene Stimme, kann es ›Sprachrohr‹ gegen die sozialen Zumutungen sein, mit denen Künstler zurechtkommen müssen? Wie verhalten sich Sound und Bedeutung zueinander? Gibt es ein ›vokales Erbe‹ Afrikas? Diesen Fragen widmet sich ein abschließendes Kapitel, das viele der zuvor diskutierten Jazzbeispiele aufnimmt und weiterdenkt.
Diese Arbeit gliedert die komplexe Thematik durch eine repräsentative Auswahl von Jazzmusikern, ihrer wichtigsten Werke und ihrer stilistischen Eigenheiten, an denen die Frage nach dem Verhältnis von Jazz und sozialem Engagement exemplarisch herausgearbeitet wird. Insofern können die einzelnen Fallstudien auch als ›Bausteine einer politischen Ästhetik des Jazz‹ verstanden werden.
Jedes der 18 Kapitel beginnt mit einer ›Story‹, die im Idealfall den Leser unmittelbar in die politisch-ästhetischen Auseinandersetzungen hineinzieht und ein typisches Zeitporträt liefert. Immer ist der Lesende dabei herausgefordert, seine eigenen Jazzerfahrungen mit dem Gesagten abzugleichen.
In Zeiten eines anhaltenden kulturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten, die sich in weiten Teilen noch immer als eine »White Power Nation« begreifen, scheint eine politische Selbstvergewisserung des Jazz und seines afroamerikanischen »Glutkerns« nötiger denn je. Weltweit gilt Jazz längst unangefochten als »America’s Art Form«, als wichtigster Beitrag der USA zum Weltkulturerbe. Heute besteht die größte Provokation des Jazz vielleicht darin, dass er liebgewonnene Gegensätze in Form binärer Oppositionen wie schwarz/weiß, eigen/fremd, innen/außen oder individuell/kollektiv destabilisiert. Als fluide Kunstform kann er so für die persönliche wie öffentliche Identitätsbildung von größter Bedeutung sein.
I. ›Onkel Tom‹ zeigt Zähne: Wie Louis Armstrong die Welt überraschte
Das achte Weltwunder liegt weder im Orient, noch im Okzident oder am Nordpol. Aber man findet es mitten in New Orleans, im florierenden Bundesstaat Louisiana. Es handelt sich dabei um keinen Tempel zur Gottesverehrung, sondern um ein gewaltiges, modernes Gebäude, das mit Hilfe der Intelligenz von Schwarzen und ihrem Kapital gebaut wurde. Der Name dieses pompösen und prunkvollen Gebäudes lautet Pythian Temple of New Orleans, La.1
Was der Schriftsteller Green Polonius Hamilton hier 1911 bejubelte, war ein zwei Jahre zuvor im Storyville-Distrikt errichtetes Hochhaus, das von der afroamerikanischen Presse im ganzen Land als Symbol neuer Größe der ›Negro Race‹ gefeiert wurde. Es verkörpere mit seiner gigantischen Erscheinung die Macht und den Stolz der Afroamerikaner angesichts all der wachsenden Feindseligkeiten während der Post-Reconstruction-Ära mit ihrer ›Jim-Crow‹-Ideologie.
›Jim Crow‹ stand für ein engmaschiges Regelwerk aus staatlichen und lokalen Gesetzen, das Schwarze von der weißen Gesellschaft distanzieren und entrechten sollte. In ihrem Auftreten, ihren Äußerungen und Umgangsformen mussten Menschen der afrikanischen Diaspora Weißen gegenüber in den USA öffentlich ihre Unterlegenheit demonstrieren. Es entwickelte sich eine ›racial etiquette‹, die keinerlei ›anmaßende Haltung‹ zuließ. Doch repräsentierte ein solches beeindruckendes Gebäude nicht eine einzige in Stein gemeißelte Respektlosigkeit?
Der ursprünglich in die Sklaverei hineingeborene Smith Wendell Green hatte es als Lebensmittelhändler, Versicherungsmakler und Verleger zu Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich geschafft, als Self-Made-Millionär 1908 zum Vorsitzenden der Colored Knights of the Pythias of Louisiana gewählt zu werden. Unverzüglich machte er sich an die Verwirklichung seiner Mission, mit dem Pythian Temple eine Institution ins Leben zu rufen, die sich um afroamerikanische Unterhaltung, Kunst, Bildung und soziale Aktivitäten verdient machen sollte. Mit seinen zahlreichen Büros, Versammlungsräumen und eigenem Theater war der Tempel allen sozialen und politischen Widrigkeiten zum Trotz der physische Beweis schwarzen Erfolgs.
Schnell wurde das Haus zum Treffpunkt der Black Community von New Orleans. Hier machte nicht nur der renommierte afroamerikanische Pädagoge und Bürgerrechtler Booker T. Washington auf seinen Lesereisen durch den Süden Station, auch der lokale Saxophonstar Sidney Bechet gastierte regelmäßig im Dachgartenrestaurant.
Im Jahr seiner Eröffnung besuchte ein Wohltätigkeitsverein aus der Nachbarschaft namens The Tramps das Pythian-Theater. Es war eine von zahlreichen Selbstorganisationen in New Orleans, die sich durch Musikveranstaltungen und Tanzabende finanzierte und gegen geringe Mitgliedsbeiträge Schwarze im Falle von Arbeitslosigkeit und Krankheit unterstützte. Jedes Stadtviertel besaß seinen eigenen Verein oder Club, der nicht selten auch für allfällige Begräbniskosten aufkam.
Die Tramps trafen sich an einem Samstagabend im Herbst 1909, um eine Vaudeville-Show der schwarzen Theatertruppe Smart Set zu besuchen. Die Musikkomödie spielte in einem afrikanischen Zulu-Dorf, und die mächtigen, schwarz geschminkten Zulu-Krieger mit ihren Baströcken und Speeren sollten einen nachhaltigen Eindruck auf John L. Metoyer ausüben. Vor allem eine Songzeile, die von der Proklamation eines neuen Zulu-Königs handelte, hatte es ihm angetan: »There never was and there never will be another king like me.«2
Nach der Vorstellung kehrten die Tramps in ihren Versammlungsraum in der Perdido Street zurück, und Metoyer taufte – noch ganz im Bann des Theaterzaubers – unterstützt von etwa 50 Gleichgesinnten die Organisation in The Zulus um. Schon seit 1901 waren die Vereinsmitglieder beim alljährlichen Mardi-Gras-Karneval mitmarschiert, doch erst beim Festumzug von 1910 traten sie als Zulus mit eigenem Wagen in Erscheinung. Auf ihm thronte mit William Story der erste »King of the Zulus« – mit blecherner Krone aus einer Schmalzdose und einer Bananenstaude als Zepter. Begleitet wurde seine Hoheit von vier Herzögen und schwarz geschminkten Tänzern, die sich in Bastkostüme und Tierfelle gehüllt hatten. Da sich der dann 1916 offiziell ins Leben gerufene Zulu Social Aid and Pleasure Club den teuren Modeschmuck nicht leisten konnte, den die anderen Karnevalsorganisationen (krewes) bei den Paraden in die Menschenmenge warfen, wich man auf relativ billige Kokosnüsse vom French Market aus, die aber schon bald aufwändig bemalt und zu begehrten Sammelobjekten wurden.
Nicht nur in der Erinnerung von Sidney Bechet war es damals der größte Traum eines jeden schwarzen Jungen in New Orleans, eines Tages als »King Zulu« während des Mardi Gras durch die Straßen zu paradieren. In den ersten drei Dekaden sollte sich auch niemand in der Black Community an dem karikaturhaften Bild stören, das die Zulus in der Öffentlichkeit von Schwarzen vermittelten. Doch als 1949 der berühmteste Sohn der Stadt, der Jazztrompeter Louis Armstrong, zum »King of the Zulus« gewählt wurde, war die Aufregung plötzlich groß.
Ein glücklicher, wenn auch umstrittener Regent: Louis Armstrong als »Zulu-King«.
Des Königs neue Krone
Zwar hatte der am 4. August 1901 in New Orleans geborene »Satchmo«, wie man ihn zuerst in England in Abwandlung seines Spitznamens »Satchel Mouth« (ein Mund wie ein satchel, ›Schulranzen‹) liebe- und respektvoll nannte, den Jazz nicht erfunden, doch seit den 1920er Jahren, als diese Musik zu ihrer ersten Blüte fand, avancierte er mit seinem unnachahmlichen Bühnentalent zu ihrem wichtigsten Botschafter. Glänzender Instrumentalist, expressiver Sänger, Scat-Virtuose, Schauspieler, Komiker, Schriftsteller: Louis Armstrong entwickelte sich spätestens seit den 1950er Jahren zu einem der wichtigsten Exportartikel der USA. Nicht nur in den Augen des US-Außenministeriums symbolisierte er geradezu beispielhaft, wie der Jazz als eine amerikanische Kulturleistung mit seiner Gruppendynamik und Bereitschaft zur kollektiven Improvisation zugleich für das westliche Ideal von Demokratie stehen konnte. Als weltweit berühmtester und erfolgreichster schwarzer Musiker sollte »Pops« – so seine hochachtungsvolle Titulierung im Kollegenkreis – nicht zuletzt bezeugen, dass es mit der sozialen und politischen Gleichstellung der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten unaufhaltsam voranging.
Schon der Komponist und Trompeter W. C. Handy, den man etwas überspitzt als ›Gründungsvater des Blues‹ bezeichnen könnte, sah in Armstrong eine unbekümmerte Herausforderung verkörpert, mit der er freimütig seine schwarze Männlichkeit in der von Weißen dominierten Kultur Amerikas zur Schau stellte. Als er Armstrong 1926 zum ersten Mal im Vendome Theater erlebte – im Herzen von Chicagos sogenanntem black belt gelegen –, hörte Handy eine »schwarze Erhabenheit«, ein beinahe herausforderndes Selbstwertgefühl in Armstrongs Trompetenton und seinem Gesang mitschwingen: »In dieser Stimme lebte der ›pride of race‹, den das schwarze Publikum so schätzte.«1
Hatte er mit seinen Hot Five und den Hot Seven Jazzgeschichte geschrieben und die Ursprünge des New-Orleans-Jazz in den 1930er und 1940er Jahren ständig revitalisiert, die Swing-Ära mit seiner Bigband unermüdlich befeuert, so löste Armstrong sein international überaus erfolgreiches Orchestra im August 1947 auf, um mit einer kleineren Combo, seinen sechsköpfigen All Stars, das traditionelle Spielideal des Jazz weiter zu pflegen. Während der 1930er und 1940er Jahre galt Armstrong als unumstrittener »hero to his race«, wie es Ricky Riccardi, Direktor des Louis Armstrong House Museum ausdrückt.2
Mittlerweile hatte sich in New Yorker Clubs eine neue Stilrichtung namens Bebop als eine Art Gegenbewegung zur fortschreitenden Kommerzialisierung des Swing entwickelt. In kleinen Gruppen eröffneten sich dem einzelnen Musiker ganz neue, weite Räume für die Improvisation – im Gegensatz zur erstarrten Routine in den engen Arrangements der Bigbands. Individueller Ausdruck wurde jetzt großgeschrieben. Dazu kamen komplexe Neuerfindungen: Aus schon vorhandenen Stücken wurden neue Melodien kreiert, zumeist rasende Kürzel. In dieser Reharmonisierung traten ungebräuchliche Akkorde an die Stelle der vertrauten Harmonien. Bebop betonte die spontane musikalische Interaktion von Musiker-Individuen und transformierte die Unterhaltungsmusik Jazz endgültig in eine Kunstmusik. Von schwarzen Musikern erfunden, war Bebop mit seinen komplizierten Strukturen zugleich ein Beleg für die von Weißen kaum mehr zu imitierende afroamerikanische Kreativität.
In just dieser Situation erschien Louis Armstrong am 21. Februar 1949 als erster Jazzmusiker überhaupt auf dem Titelblatt des Time Magazine. Für die Cover-Story hatte die renommierte Zeitschrift Satchmo ein paar Wochen lang begleitet, als ihn die Nachricht erreichte, für die anstehende Mardi-Gras-Parade zum »King of the Zulus« gewählt worden zu sein: für die Reporter ein gefundenes Fressen. Gleich im ersten Abschnitt der Story erklärt Armstrong enthusiastisch: »Davon habe ich mein Leben lang geträumt. Und ich will verdammt sein, wenn es nicht gerade so aussieht, als würde ich wirklich der König der Zulu-Parade werden. Nach dieser Sache bin ich gern bereit zu sterben.«3
Wie er drei Jahre später in einem Brief an eine Betty Jane Holder gestand, hatte er sich schon als kleiner Junge in die Figur hineinphantasiert, als er den Umzug durch die Straßen verfolgte. »Ich bin in der ganzen Welt herumgereist. Doch kein Ort, den ich je besucht habe, konnte den Gedanken in meinem Kopf verdrängen, dass ich selbst irgendwann der ›King of the Zulus‹ sein würde.«4
Einen Hymnus auf die Regentschaft hatte er bereits 1925 mit dem strahlenden Blech seines Kornetts in der von Lil Armstrong geschriebenen Vaudeville-Nummer »King of the Zulus« geliefert. Die Neuaufnahme des Stücks von 1957 mit seinen All Stars präsentierte dann einen Armstrong, der in seiner rezitierten Einleitung noch einmal voller Genugtuung auf seine Wahl zum »König« im Jahr 1949 zurückblickt.
Pops’ Plantagen-Freundlichkeit?
Junge Schwarze, wie die Bebopper von der Ostküste, beäugten die Zulu-Tradition in New Orleans mittlerweile kritisch, wo Afroamerikaner als unkultivierte Barbaren dargestellt würden, schwarz geschminkt im Stile einer längst verpönten »Blackfacing«-Tradition.
Auch dem Time Magazine war diese Skepsis nicht verborgen geblieben und so notierten die Reporter in ihrem großen Armstrong-Feature pflichtschuldig: »Schwarze Intellektuelle sehen in den Zulus und ihren Praktiken beleidigende Überbleibsel aus der Minstrel Show, der Zeit des ›Sambo-type Negro‹«. Nicht ohne eine gewisse Süffisanz schob das Magazin nach: »Für Armstrong wirkt diese Empfindlichkeit absurd, und niemand, der den unbekümmerten nichtintellektuellen Louis kennt, wird an seiner Aufrichtigkeit zweifeln.«1
Der Zulu Social Aid and Pleasure Club sollte sich in der Folgezeit immer wieder empört gegen den Vorwurf verwahren, das schwarze Make-up des King und seines Gefolges sei eine Form von »Blackface«. Vielmehr greife man damit auf eine Tradition im Süden der USA zurück, wo es schwarzen Sklaven verboten war, Masken zu tragen: Allein schwarzes Make-up sei ihnen erlaubt gewesen. Man habe sich nie und wolle sich auch nie am »Blackfacing« beteiligen, da auf diese Weise Afroamerikaner zu lächerlichen Trotteln degradiert würden. Doch als die Emanzipationsanstrengungen des Civil Rights Movement erstarkten, meldete sich 1964 die Zeitung Louisiana Weekly, die vor allem in der Black Community kursierte:
Wir, die Schwarzen von New Orleans, sind mittendrin in einem Kampf für unsere Rechte und für die Anerkennung unserer Menschenwürde, auf der diese Rechte basieren. Deshalb ärgern wir uns über die Zulu-Parade und lehnen sie ab. Dabei werden Schwarze von weißen Geschäftsleuten dafür bezahlt, durch die Stadt zu streifen, sich zu betrinken, sich wie unzivilisierte Wilde zu verkleiden und wie Affen mit Kokosnüssen zu werfen. Diese Karikatur repräsentiert uns nicht. Es handelt sich vielmehr um ein verzerrtes Bild, das sich gegen uns richtet. Deshalb rufen wir alle Bürger von New Orleans dazu auf, die Zulu-Parade zu boykottieren. Wenn wir Respekt von anderen verlangen, müssen wir ihn zunächst uns selbst gegenüber fordern.2
Schon in der Armstrong-Titelstory von 1949 konnte sich auch Time einen Seitenhieb auf die fast sprichwörtliche »Plantagen-Freundlichkeit« von Satchmo nicht verkneifen, die er laut seinem Manager »Mister Glaser« an den Tag lege. Der Tenor war klar: Armstrong sei zwar ein großer Künstler, aber nur weil er sich in altmodischer Manier an weiße Bedürfnisse anzupassen verstehe. Sein Instrumentalkollege, der Bebop-Trompeter Dizzy Gillespie, wurde wenige Monate später in einem Down Beat-Interview vom 1. Juli 1949 deutlicher: Louis verkörpere inzwischen einen »Plantagen-Charakter, den viele von uns jungen Leuten ihm übelnehmen.«3 Die von Armstrong bejubelte Proklamation zum »King of the Zulus« führte jedenfalls dazu, dass er zum ersten Mal eine breit gestreute negative Berichterstattung in der schwarzen Presse erhielt. Hinzu kam, dass viele Afroamerikaner mittlerweile von dem altmodischen Trompete-Posaune-Klarinette-Sound der Louis Armstrong All Stars gelangweilt waren.
Und Gillespie ließ nicht locker: 1952 veröffentlichte er mit »Pop’s Confessin’« eine bitterböse Parodie, in der er den raspelig-beißenden und zugleich breit grinsenden Sprechgesang Armstrongs parodierte und dessen typische High-Note-Phrasen auf der Trompete als klischeehafte Manierismen entlarvte.
Der Kritisierte ließ sich jedoch nicht lumpen und legte zwei Jahre später mit einer Verfremdung seines »Whiffenpoof Songs« nach, in der er den weitverbreiteten Drogenkonsum in der Bebop-Szene aufs Korn nahm:
All the boppers were assembled
And when they really high
They constitute a weird personel.4
Dass Armstrong mit den Modernisten des Bebop und ihrer afroamerikanisch gefärbten »Bewusstseinsrevolution« auf Kriegsfuß stand, hatte er bereits mehrfach unter Beweis gestellt:
Sie wollen alle anderen niedermachen, weil sie voller Bosheit sind, sie wollen sich einfach nur wichtigmachen … Dann spielen sie all diese verrückten Akkorde, die überhaupt nichts bedeuten. Erst werden die Leute neugierig, weil es ja was Neues ist, aber dann werden sie dem allen überdrüssig, weil es eben nicht gut ist und weil es keine Melodie gibt, an die man sich erinnern kann, und keinen Beat, auf den man tanzen kann.5
Doch über solche innermusikalischen, stilistischen Differenzen hinaus, bot Armstrong 1952 mit einer Decca-Veröffentlichung erneut eine Angriffsfläche für alle Verfechter von Political Correctness.
Onkel-Tom-Typ wider Willen
Die Neuaufnahme seines nun von Gordon Jenkins arrangierten Lieblingssongs »When it’s Sleepy Time Down South« vom November 1951 brachte nicht allein die schwarze Presse auf die Barrikaden. Das von den beiden Louisiana-Kreolen Louis und Otis René 1931 geschriebene Lied beschwor die Wonnen des Landlebens in den Südstaaten. Als die Autoren Armstrong den Song erstmals vortrugen, reagierte der enthusiastisch: »Das ist mein Lied, gebt mir eine Kopie, und ich werde es jeden Abend im Cotton Club singen.«1 Es geht darin um die ›Great Migration‹, jene große Wanderbewegung von nahezu sechs Millionen Afroamerikanern, die seit den 1920er Jahren aus dem Süden in die prosperierenden Städte des Nordens zogen. Gleichwohl sehnt sich der Sänger nach »dear old Southland … where I belong.« Armstrong verstand den Text als eine Huldigung an die Atmosphäre seiner Kindheit und Jugend in New Orleans: Reale Erinnerungen und Traumbilder vermischten sich darin bis zur Ununterscheidbarkeit. Deshalb störte sich Louis auch nicht an der unüberhörbaren Verwendung des Wortes »darkies« – damals wie heute eine dreiste Beleidigung afroamerikanischer Bürger:
You hear the banjos ringin’
the darkies singin’
They dance till the break of day.2
Gleichwohl machte Louis im Laufe seiner Karriere das Stück zu einer Art ›theme song‹, den er in Text- und Instrumental-Versionen zigmal einspielen sollte.
Auch die Aufnahme von 1951 enthielt das anstößige »darkies«-Unwort. Und sofort wurde in der Black Community der Ruf zum Boykott zukünftiger Armstrong-Konzerte laut. Zeitungen brachten Fotos, auf denen Schwarze in einer Bar in Harlem zu sehen waren, die Kopien der Platte in Stücke brachen. In dieser aufgeheizten Atmosphäre rang sich die Plattenfirma Decca zu einer Entschuldigung durch: Man habe den inkriminierten Take des Songs »aus Versehen« veröffentlicht. Um die Situation zu entschärfen, verpflichtete man Armstrong zu einer Neuaufnahme der beanstandeten Textzeilen, jetzt mit dem unverfänglichen Begriff »people« anstelle des Skandalworts.
Armstrong war wütend über die Reaktion der medialen Öffentlichkeit: »Ist das nicht eine verdammte Schande?« Er fühlte sich missverstanden und machte seiner Frustration bei der Neuaufnahme des Titels Luft: »Guten Morgen Gentlemen. Wie soll ich denn bitteschön heute Morgen die ›black sons-of-bitches‹ nennen?«3
Nicht allein Dizzy Gillespie und die Bebopper fanden Armstrongs Äußerungen beschämend und peinlich. Selbst der in der Black Community hochangesehene Autor James Baldwin konnte sich in seiner Kurzgeschichte Sonny’s Blues einen kleinen Seitenhieb auf Satchmo nicht verkneifen. In einem Gespräch fragt der Erzähler seinen jüngeren Bruder, der Jazzmusiker werden will: »›Du meinst so jemand wie Louis Armstrong?‹ Sein Gesicht verfinsterte sich, als hätte ich ihn geschlagen. ›Nein, ich meine überhaupt nicht diesen altmodischen, bodenständigen Scheißdreck.‹«4
In den 1950er Jahren machte immer wieder die Rede von Louis Armstrong als typische ›Onkel-Tom-Figur‹ die Runde, eine Etikettierung, die ihn zutiefst verletzte. Schon Billie Holiday konnte bei ihrem Versuch, ihn in Schutz zu nehmen, eine gewisse Doppeldeutigkeit nicht vermeiden: »God bless Louis Armstrong! He Toms from the heart.«5 Mit ›Onkel-Tomismus‹ (»Uncle Tomism«) ist gemeint, dass ein Musiker sich und seine Kunst an ein weißes Publikum verkauft, um es zu unterhalten, und nicht primär, um sich selbst zu artikulieren. Dieses Konzept geht auf die Figur des Onkel Tom in Harriet Beecher Stowes Abolitionisten-Roman Onkel Toms Hütte zurück, in dem der Romanheld ein Musterbeispiel afroamerikanischer Unterwürfigkeit liefert.
Ein Jazz-Botschafter der guten Laune
Kein Wunder, dass Louis Armstrongs Bühnen-Performance mit dem ansteckenden Lachen, dem ständigen Grimassieren, mit rollenden Augen und gebleckten Zähnen, dem obligatorischen weißen Taschentuch an der Stirn, um den Schweiß abzuwischen – dass er mit all diesen clownesken Gesten zum prototypischen Onkel Tom des Jazz wurde, weil auch sein vordringlichstes Ziel die Unterhaltung eines vornehmlich weißen Publikums zu sein schien. Armstrong hatte für solcherlei Vorwürfe überhaupt kein Verständnis:
Ich denke, dass ich immer Großes geleistet habe, um meine ›race‹ moralisch aufzurichten. […] Einige Leute, auch Schwarze, haben das Gefühl, ich verhalte mich zu ›soft‹ in der Rassenfrage. Manche haben mich sogar als ›Onkel Tom‹ angeklagt, weil ich nicht ›aggressiv‹ genug sei. Wie können sie so etwas sagen? Ich habe Pionierarbeit geleistet, wenn es darum ging, in vielen Südstaaten die ›color line‹ zu durchbrechen. […] Ich selbst musste im Zusammenhang mit Jazz viele Schmähungen erdulden, war sogar an einigen sehr gefährlichen Orten, was nicht meine Schuld war – und das beinahe 40 Jahre lang.6
Er hatte in seinen eigenen Bands immer wieder weiße Musiker engagiert und damit einen Beleg für gelungene Integration geliefert, etwa mit der Verpflichtung des Posaunisten Jack Teagarden für seine All Stars im Jahr 1947.
In seinem privaten Umfeld soll Satchmo bezüglich der ›race issue‹ nie ein Blatt vor den Mund genommen haben. Öffentlich hielt er sich meist mit politischen Kommentaren zurück, gab allerdings dem Pittsburgh Courier im Juli 1956 ein bemerkenswertes Interview, in dem er seine Position zur Frage von ›race justice‹ umreißt:
Ich habe meine eigenen Ideen zur Rassentrennung und mein halbes Leben damit zugebracht, die Barrieren niederzureißen, durch positive Taten und nicht durch viele Worte. […] Ich biedere mich nach einem Konzert nie den lokalen Würdenträgern an. Selbst wenn ich eingeladen bin, gehe ich nicht hin. Denn diese Leute aus den sogenannten besseren Kreisen könnten genauso gut um die Ecke gehen und einen Schwarzen lynchen. Doch während sie unserer Musik lauschen, denken sie nicht an solche schlimmen Sachen. Sie sehen vielmehr, wie schwarze und weiße Musiker Seite an Seite spielen. Und wir machen sie zufrieden und froh. Ich sage immer: »Schau dir an, was wir Gutes zurücklassen, das muss doch etwas bedeuten.«7
In den Jahren 1956/57 erreichte Satchmos Popularität einen neuen Höhepunkt. In der Presse sprach man voller Bewunderung vom »Ambassador Satch«. Mit seiner Version von »Mack the Knife« landete er einen Hit, und das Album Ella and Louis dokumentierte, wie perfekt er zusammen mit Ella Fitzgerald die hohe Kunst des Balladen-Gesangs beherrschte – die Platte galt fortan als Prüfstein für alle Jazz-Gesangsduette.
Armstrongs Auftritte in dem Film-Musical High Society (Die oberen Zehntausend) hätten seine Kunst eigentlich mit eben dieser »Society« versöhnen müssen. Doch der Rassismus wirkte noch immer wie schleichendes Gift in der amerikanischen Gesellschaft und suchte sich stets überraschende Anlässe, an denen er hervorbrach.
Am 20. Februar 1957 traten die All Stars in Knoxville, Tennessee, vor einem gemischtrassischen Publikum auf: ›separate but equal‹. Auf der einen Seite saßen rund 2000 weiße Besucher, während auf der anderen Seite des Auditoriums 1000 Schwarze Platz gefunden hatten. Das ging dem örtlichen White Citizens Council entschieden zu weit: Auf der Bühne eine »integrierte« Band und im Saal eine riesige Menge Afroamerikaner. Gegen so viel »Integration« protestierte ein vorbeifahrender Mann, der aus seinem Wagen eine Dynamitstange auf die Konzerthalle warf, die mit ohrenbetäubendem Knall vor dem Gebäude explodierte, aber glücklicherweise niemanden verletzte. Armstrong, der gerade seinen »Back O’ Town Blues« sang, war wie alle Anwesenden schockiert, beruhigte das Publikum jedoch schlagfertig: »Alles klar, Leute, das war nur das Telefon.« Als man ihn später auf den Zwischenfall ansprach, antwortete er lapidar: »Mensch, die Trompete weiß darüber überhaupt nichts.« Und auf die Nachfrage, ob er denn nach dieser Erfahrung beabsichtige, seine Tour durch den Süden fortzusetzen, entgegnete er störrisch: »Ich spiele überall, wo man mir zuhört.«8
Natürlich nahm ihm die schwarze Presse solcherlei Nonchalance übel. Die Zeitung Baltimore Afro-American hielt ihm vor: Er sichere seinen Platz in der Welt nicht dadurch, dass er »ein paar verwirrte Dixie-Fanatiker unterhalte.« Auch Dizzy Gillespie erneuerte einmal mehr seinen Onkel-Tom-Vorwurf.
Der Skandal von Little Rock
All die vehementen Satchmo-Kritiker sollten durch die folgenden Ereignisse eines Besseren belehrt werden. Im September 1957 wollten neun afroamerikanische Schüler die bis dato rein weiße Central High School in Little Rock besuchen. Ihre Eltern glaubten, der Urteilsspruch im Verfahren »Brown v. Board of Education« vom Obersten Gerichtshof, der drei Jahre zuvor die Rassentrennung an öffentlichen Schulen aufgehoben hatte, würde auch in der Praxis bedeuten, was er auf dem Papier besagte. Doch anstatt den afroamerikanischen Kindern zu erlauben, die Schule zu betreten, rief Gouverneur Orval E. Faubus von Arkansas die Nationalgarde nach Little Rock, um »den Frieden und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.«1 Jeden Morgen, wenn die schwarzen Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen wollten, sorgte ein Mob weißer Rassisten im Verein mit der Nationalgarde dafür, dass die Jugendlichen abgewiesen wurden. Ein Mädchen der »Little Rock Nine« erinnert sich später:
Ich versuchte, in der Menge ein freundliches Gesicht zu erkennen, jemanden, der uns vielleicht helfen könnte. Ich blickte in das Gesicht einer alten Frau und sie schien uns freundlich gesinnt. Doch als ich sie erneut ansah, spuckte sie mich an.2
Als die Krise sich weiter zuspitzte, rückte Faubus immer mehr ins Zentrum nationaler Aufmerksamkeit – im Konflikt eines einzelnen Staates mit der US-Bundesregierung. Ein Treffen mit Präsident Eisenhower am 14. September blieb zunächst ergebnislos: Der Gouverneur unternahm noch immer nichts, um die schwarzen Jugendlichen bei ihrem Schulbesuch zu schützen. Die entschlossen sich, zunächst einmal zu Hause abzuwarten, während die Nation in banger Erwartung die Ereignisse in Little Rock verfolgte.
Am 17. September, zwei Wochen nach Beginn der Auseinandersetzungen in Arkansas, machte Louis Armstrong mit seinen All Stars in dem Universitäts-Städtchen Grand Forks in North Dakota Station. Dort lebte der 21-jährige Student Larry Lubenow, der sich gerade beim Grand Fork Herald als Journalist seine ersten Sporen verdiente. Als Jazzfan bat er seinen Herausgeber, ein Interview mit Louis Armstrong für die Zeitung machen zu dürfen. Der stimmte unter der Bedingung »No Politics!« zu. Diese Ermahnung schien eigentlich überflüssig, denn Satchmo war dafür bekannt, sich aus der Politik herauszuhalten: »I just blow my horn.«3 Gleichwohl schrieb er gerade in Grand Forks Geschichte, weil er der erste Schwarze überhaupt war, der im Dakota Hotel, dem ersten Haus am Platze, übernachtete. Lubenow, der mit dem Empfangschef bekannt war, überredete ihn, Armstrong sein Abendessen, ein »Lobster Dinner«, aufs Zimmer bringen zu dürfen, um ihm bei dieser Gelegenheit ein paar Fragen zu stellen.
Der Trompeter erwartete ihn in Shorts und Hawaiihemd und erklärte sich gleich zu einem Interview bereit. Auf die erste Frage, wer denn aktuell sein Lieblingsmusiker sei, nannte Sachtmo den weißen Bassbariton Bing Crosby.
Doch dann brachte Lubenow die Sprache auf die Ereignisse in Little Rock und Armstrong explodierte: »Es ist fast so schlimm geworden, dass ein Schwarzer kein Heimatland mehr hat.«4 Präsident Eisenhower sei »ein falscher Fuffziger« und besäße »keinen Mumm«. Gouverneur Faubus bezeichnete Armstrong als »no-good motherfucker.« Doch damit nicht genug: Während Lubenow eifrig die Antworten auf seinen Block kritzelte, begann Armstrong eine Parodie auf die Nationalhymne »Star Spangled Banner« zu singen: »Oh say, can you motherfucking see / By the motherfunckin’ dawn’s early light.«5 Dann erklärte er dem leicht schockierten Nachwuchs-Journalisten noch, er verspüre überhaupt keine Lust mehr, für das Außenministerium auf Tournee durch die Sowjetunion zu gehen, um für die amerikanische Demokratie zu werben: »So, wie sie meine Leute im Süden behandeln – die Regierung kann von mir aus zur Hölle fahren.«6 Außenminister Jon Foster Dulles beschimpfte er in diesem Kontext als »another motherfucker«. Denn die Russen würden ihn garantiert fragen, was denn nur mit seinem Land los sei: »Was soll ich denen dann sagen?«7
Ein Interview polarisiert die Nation
Lubenow, der wusste, dass er gerade die Story seines Lebens ergattert hatte, seine Zeitung Armstrongs Schimpfwort »motherfucker« aber niemals drucken würde, handelte mit dem Trompeter noch den harmloseren Begriff »uneducated plowboy« (›ungebildeter Bauerntrampel‹) für Gouverneur Faubus aus. Als er seine Story fertiggeschrieben hatte – das Konzert mit den All Stars musste Lubenow ohnehin sausen lassen – war es für die aktuelle Printausgabe schon zu spät. Auch der zuständige Redakteur der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) in Minnesota weigerte sich zunächst, die Geschichte zu bringen: Er konnte einfach nicht glauben, dass Armstrong den amerikanischen Präsidenten als »feige« bezeichnet hatte. Also machte Lubenow sich am nächsten Morgen erneut auf den Weg ins Dakota Hotel, zeigte Armstrong seinen Text und bat ihn, die Story abzusegnen. »Du musst nichts aus der Geschichte rausnehmen. Das ist das, was ich gesagt habe und immer noch sage.« Dann unterzeichnete Satchmo das Typoskript mit »solid« und seiner Unterschrift.1
Das reichte Associated Press, und sie verbreitete die provokanten Aussagen noch am selben Morgen per Fernschreiber im ganzen Land. Auf Nachfrage des Washingtoner AP-Büros erklärte das Außenministerium, man wolle Armstrongs Statement nicht kommentieren, hatte er dem State Departement bisher doch als der effektivste »Goodwill«-Botschafter des Landes gegolten. Gleichwohl befürchtete man, die sowjetische Propaganda-Maschinerie werde sich auf Armstrongs Kommentar stürzen und für ihre Zwecke im Kalten Krieg nutzen.
Der Medien-Aufruhr in den USA war gewaltig. Jede größere Zeitung brachte die Story auf der Titelseite, in den News-Sendungen von CBS und NBC war sie der Aufmacher. Eine Radio-Station in Hattiesburg, Mississippi, nahm sofort alle Armstrong-Titel aus dem Programm. Veranstalter riefen zum Boykott seiner Konzerte auf.
Armstrongs Roadmanager Pierre ›Frenchy‹ Tallerie versuchte vergeblich, die Wogen zu glätten, indem er Armstrong ›zitierte‹, der sich natürlich längst von dem Artikel distanziert habe. Lubenow habe ihn so sehr belästigt, »dass ich großen Mist über alles erzählt habe, den Präsidenten eingeschlossen.«2
Armstrong war über diese Initiative ausgesprochen wütend. Was Tallerie behauptet habe, sei nicht wahr. Am nächsten Morgen bekräftigte er in der Kleinstadt Montevideo, Minnesota, wo er am Abend auftreten sollte: »Ich habe nur das gesagt, was schon längst mal jemand hätte sagen sollen.«3
Die weiße Presse war außer sich. Im Editorial des Muncie Star vom 21. September war zu lesen:
Louis Armstrong ist auf der Trompete besser als in Soziologie. […] Er ist einfach nicht in der Lage, die Komplexität von ›racial injustice‹ zu durchschauen, weil er kein Politiker ist. Wie die meisten Durchschnittsamerikaner sagt er, was er fühlt, ohne viel darüber nachzudenken, was jemand in Moskau mit seinen Aussagen anfangen könnte.4
Die Zeitungen wurden landesweit mit wütenden Briefen überschüttet, die dem »großmäuligen Negro, bekannt als (Satchmo) Louis Armstrong, dessen Vorfahren aus den Dschungeln von Afrika in dieses Land kamen«, jegliche Intelligenz absprachen. Ein Leser beschwerte sich beim Herald Journal of Spartanburg, South Carolina:
Diese Bewohner besitzen allenfalls eine Denkfähigkeit, wie man sie in Regionen findet, in denen Primitive und Wilde leben. Er ist vielmehr der ›white race‹ zu Dank verpflichtet, für das Privileg, in Amerika an Freiheit und Erfolg teilhaben zu dürfen.5
Der Leserbriefschreiber empfahl darüber hinaus, Armstrong mit einem One-Way-Ticket zurück nach Afrika zu schicken, »wo er hingehört«.
Ein von einem gewissen »Doleful« unterschriebener Brief an das Lincoln Star Journal ist es wert, vollständig zitiert zu werden, weil er in infamer Verdrehung Ansichten vertritt, die im heutigen Amerika noch immer lebendig sind:
Da sagt also Louis Armstrong, der alte Satchmo, »zur Hölle mit der Regierung«. Oder zur Hölle mit den Vereinigten Staaten. Nach all dem, was die USA ihm gegeben haben – Wohlstand, Erfolg, die Chance, als Unsterblicher in die Ruhmeshalle der Musik einzugehen. So jemand sagt »zur Hölle mit der Regierung« und belegt den Präsidenten mit Schimpfwörtern. Weil jetzt klar ist, dass derjenige weder die Vereinigten Staaten, ihre Menschen, noch ihre Regierung liebt, schlage ich vor, wir geben ihm einen Pass und eine einfache Fahrkarte nach Russland, wo er glücklich werden kann. Old Satchmo legt jetzt exakt jenes Verhalten an den Tag, welches die Südstaatler veranlasst, gegen Rassen-Integration zu sein. Er ist von den Weißen so lange als gleichwertig behandelt worden, dass er die anmaßende Haltung von Überlegenheit angenommen hat, gegen die sich die Menschen im Süden wenden.6
Und noch ein letztes Beispiel für den Hass, der Armstrong seitens der weißen Presse entgegenschlug. Am 26. September veröffentlichte The Tampa Tribune einen Leserbrief, der Armstrongs aufrührerisches Verhalten attackierte:
Mit seiner verleumderischen Attacke hat er sich selbst mehr als allen anderen geschadet. Damit hat er jeden Respekt verloren, den amerikanische Bürger ihm einst entgegengebracht haben. Man sollte ihm nicht länger erlauben, sich als »Louis Armstrong, Amerikaner« zu bezeichnen. Nur noch als »Louis Armstrong, Aufwiegler und Idiot«.7
Viele schwarze Prominente wie der Baseballstar Jackie Robertson, der Boxweltmeister Sugar Ray Robinson, die Sängerinnen Lena Horne, Eartha Kitt oder die Opern-Diva Marian Anderson erklärten sich dagegen sofort mit Armstrong solidarisch und lobten ihn für seine Offenherzigkeit und seinen Mut. Eartha Kitt legte noch nach und nannte Eisenhower »einen Menschen ohne Seele. Wie kann er nur dasitzen und keinerlei Regung zeigen angesichts dessen, was vor seiner Nase passiert?«8 Auch die Gazette and Daily of York in Pennsylvania stellte sich mit ihrer Headline auf Satchmos Seite: »Armstrong is Right«. Man finde es geradezu erfrischend, dass jemand in alter amerikanischer Manier hergehe und sich ohne Wenn und Aber die Regierung und den Präsidenten vornehme:
Die Lähmung der Exekutive in dieser Situation ist weder für Little Rock noch für die gesamten Vereinigten Staaten gut. […] Junge Amerikaner wurden von der Schule ferngehalten und der Präsident befindet sich auf dem Golfplatz. Dem Himmel sei Dank für Louis Armstrong.9
In der schwarzen Presse kochte die Geschichte richtig hoch: Die Sprengkraft von Armstrongs Aussagen sei gewaltig. Das Jet-Magazin, das Armstrong wiederholt als »Uncle Tom« diskreditiert hatte, bemerkte: »Genauso gut hätte Außenminister Dulles in den Vereinten Nationen aufstehen und die russische Nationalhymne anstimmen können.« Armstrong habe lange versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass es den Schwarzen in Amerika ganz gut gehe. Doch nun sei es ihm mit einem kühnen Federstrich gelungen, »die fast 15 Millionen Afroamerikaner an seine Brust zu drücken«. Alle, die sich durch die freundlichen Reden von Dr. Martin Luther King Jr. verwirrt fühlten, sollten sich jetzt einmal Armstrong anhören. Die Amsterdam News verstieg sich gar zu der Behauptung, Armstrongs Aussagen seien »so explosiv wie die Wasserstoffbombe.«10
Allein der schwarze Entertainer Sammy Davis Jr. stellte sich gegen Satchmo und nannte ihn scheinheilig. Er habe jahrelang ohne Probleme vor segregiertem Publikum gespielt, die öffentliche Aufmerksamkeit bisher nie für irgendwelche ernsthaften Statements über die Rassenfrage genutzt und sich stattdessen lieber den Weißen angedient. Er halte ihn deshalb nicht für besonders ehrlich.
Armstrongs Manager Joe Glaser reagierte gelassen: »Wen interessiert schon Sammy Davis Jr.?«Glaser war viel wichtiger, dass sein Mandant jetzt endlich das Onkel-Tom-Image abstreifen und nicht zuletzt der schwarzen Öffentlichkeit beweisen konnte, dass er ein »echter, wahrhaftiger Mensch« ist.11
Sieg des musikalischen Krisenmanagements?
Der Direktor des Louis Armstrong House Museum, Ricky Riccardi, hat erst jüngst Tonbandaufzeichnungen ausgegraben, die dokumentieren, dass der Jazzstar bereits am 8. und 10. September, also eine Woche vor seinem Publicity-trächtigen Ausbruch in Grand Forks, in Bezug auf die Situation in Little Rock kein Blatt vor den Mund genommen hatte.
Meiner Meinung nach ist es eine verfluchte Schande für die Leute, wenn jemand so hinterlistig und doppelzüngig ist. Ich meine natürlich den Gouverneur. Sie wissen so gut wie ich, dass er wahrscheinlich eine kleine schwarze Mammy hatte, die sein Baby gestillt hat. Sie wissen, was ich meine? Warum macht er so etwas – manche Menschen würden ihren rechten Arm für Publicity hergeben und genau das ist es, was er meiner Meinung nach macht.1
Und doch schaffte es keine dieser Aussagen in die Schlagzeilen – bis Armstrong den amerikanischen Präsidenten selbst ins Visier nahm.
Mittlerweile hatte Eisenhower seine Einstellung geändert. Er wollte sich auf keinen Fall von einem unbedeutenden Provinz-Gouverneur in der Rassenfrage vorführen lassen. Ursprünglich hatte er dem Obersten Bundesrichter Earl Warren, der das bahnbrechende Urteil im Fall »Brown v. Board of Education« mit gefällt hatte, noch versichert, die weißen Prozessgegner wollten nur verhindern, »dass ihre süßen kleinen Mädchen gezwungen wären, in der Schule neben irgendwelchen riesenhaften Schwarzen zu sitzen.« Jetzt sah sich »Ike« – wie Eisenhowers kumpelhafter Spitzname lautete – in der Klemme und erklärte am 24. September, »das geltende Recht kann weder durch ein Individuum noch durch einen Mob von Extremisten beleidigt werden, indem ihnen Straffreiheit gewährt wird.«2
Eisenhower ließ seinen Worten Taten folgen, stellte die zehntausend Mitglieder der Nationalgarde von Arkansas unter sein persönliches Kommando und schickte gleichzeitig die 101. Luftlandedivision nach Little Rock. Es war das erste Mal, dass das Militär seit den Tagen der ›Reconstruction‹ in eine Stadt der Südstaaten einmarschierte. Am nächsten Tag wurden die neun Schülerinnen und Schüler von Soldaten in die Central High School eskortiert. Die Krise war zunächst vorüber.
Armstrong schickte sofort ein Telegramm an Eisenhower, um ihm zu gratulieren: »Daddy, wenn du jemals entscheiden solltest, diese kleinen schwarzen Kinder persönlich in ihre Highschool zu geleiten, nimm mich mit.« Und er beendete sein Anschreiben mit den Worten: »Möge Gott dich schützen, Mr Präsident, du hast ein gutes Herz.«3
Kann Armstrongs heftige Attacke im Grand Forks HeraldEisenhower beeinflusst haben? Satchmos Zeitgenosse, der weiße Dixieland-Trompeter Max Kaminsky, erklärte jedenfalls dem englischen Melody Maker: »Meiner Meinung nach hat erst das, was Louis sagte, Ike in der Little-Rock-Sache Beine gemacht.«4
Wie dem auch sei: Armstrong bereute nichts und erklärte dem Pittsburgh Courier, einer der wichtigsten afroamerikanischen Zeitungen des Landes, drei Tage nach dem Sieg des Rechts in Little Rock:
Ich nehme kein Wort von dem zurück, was ich gesagt habe. Ich habe 40 Jahre lang ein wundervolles Leben mit der Musik gehabt, aber ich spüre die Unterdrückungssituation so wie jeder andere Schwarze. Meine Eltern und meine Familie haben zeitlebens unter dem alten Süden gelitten, […] und als ich im Fernsehen sah und las, ein kleines schwarzes Mädchen sei angespuckt und verflucht worden, da hatte ich alles Recht der Welt, sauer zu werden und etwas dazu zu sagen.5
Man erinnere sich, dass Armstrong seine Verletztheit und Wut lange mit sich herumtrug, bevor er sie endlich artikulierte. 1956 hatte der Staat Louisiana ein Gesetz verabschiedet, das es weißen und schwarzen Musikern untersagte, gemeinsam in Bars und Clubs aufzutreten. Schon damals war Louis aufgebracht.
Man behandelt mich überall auf der Welt besser als in meiner Heimatstadt, das betrifft ganz Mississippi. Ich werde nicht nach New Orleans zurückkehren und mich in meiner eigenen Heimatstadt von Weißen zusammenschlagen oder sogar töten lassen, weil ich ihr Gesetz übertreten habe. Es macht mir nichts aus, wenn ich New Orleans niemals mehr wiedersehe.6
Und in der Tat sollte er mit seinen All Stars, in denen Schwarze neben Weißen spielten, seine Heimat bis ins Jahr 1965, nachdem der Civil Rights Act im Jahr zuvor verabschiedet worden war, nicht mehr besuchen.
Noch zwei Wochen nach seinen Einlassungen zu Little Rock versuchten einflussreiche Medienvertreter, Armstrongs geplanten TV-Auftritt in der »Crescendo«-Ausgabe der DuPont Show of the Week zu verhindern. Er sollte inmitten eines hochkarätigen Star-Ensembles spielen, an seiner Seite: Rex Harrison, Benny Goodman, Peggy Lee, Eddy Arnold, Mahalia Jackson, Dinah Washington und weitere Show-Größen. Doch die Verantwortlichen des CBS-Senders blieben standhaft und weigerten sich, Armstrong auszuladen.
Als die Sendung dann am 30. September abends zur besten Sendezeit in die amerikanischen Haushalte flimmerte, sah man Louis in einem Schaukelstuhl sitzen, wie er einen Chorus des alten Spirituals »Nobody Knows the Trouble I’ve Seen« spielte. Einen treffenderen Kommentar zu den Geschehnissen in Little Rock hätte er sich kaum ausdenken können. Als er dann noch am Ende seines anrührenden Solos »Star Spangled Banner« zitierte, war die Botschaft klar: Hier bekannte sich jemand mit rein musikalischen Mitteln zum uramerikanischen Gerechtigkeitsideal.
Dazu passt auch jene Erklärung, die Armstrong 1965 auf dem Höhepunkt der Civil-Rights-Demonstrationen abgab. Gerade erst hatte er im Fernsehen verfolgt, mit welcher Brutalität die Ordnungsmacht den Marsch von Martin Luther King Jr. nach Selma, Alabama, niederknüppelte – später sollte dieser 7. März 1965 als »Bloody Sunday« in die amerikanische Geschichte eingehen. Als ihn ein Reporter in Dänemark darauf ansprach, erklärte Armstrong, warum er sich nicht an solchen Märschen beteilige:
Ich marschiere nicht mit, aber sage den ›Negro organizations‹ meine Unterstützung zu. Mein Leben besteht aus Musik, lass andere marschieren. Sie würden mir nur ins Gesicht schlagen, wenn ich mitgehen würde, und ich könnte mit meinem Mund keine Trompete mehr blasen.
Als der Journalist nachfragte, ob er wirklich glaube, dass ein Mann seiner Reputation geschlagen würde, antwortete Armstrong: »Sie würden sogar Jesus schlagen, wenn er schwarz wäre und mitmarschieren würde.«7
14 Tage später gab Armstrong mit seinen All Stars ein mittlerweile legendäres Konzert im Ost-Berliner Friedrichstadtpalast. Gerade erst hatte die DDR-Regierung ihre Zensurmaßnahmen gegenüber Kulturschaffenden verschärft, und da kam ihr der Weltstar gerade recht, um den eigenen Staat international aufzuwerten – und sei es durch den vom damaligen Staats- und Parteichef Walter Ulbricht immer wieder als »Affenmusik« geschmähten Jazz, der amerikanischsten aller Musikformen. So war in der Schweriner Volkszeitung zu lesen: Dass Armstrong in die DDR kam, sei »auch mit ein Beweis unseres wachsenden politischen und wirtschaftlichen Ansehens in der Welt.«8
Doch Louis hielt sich mit freundlichen Grußadressen an die DDR zurück und antwortete auch auf die Frage eines Journalisten nach seiner Meinung zur Teilung von Berlin, dass es ihm nicht um die Mauer gehe, sondern allein um seine Musik. Auf die Bürgerrechtsbewegung in seinem Heimatland angesprochen, war er dafür, das Civil Rights Movement mit Spenden zu unterstützen. Er werde das jedenfalls tun.
Und dennoch gab Armstrong im Berliner Konzert ein musikalisches Statement zum Rassismus in den USA ab, als er den Song »(What Did I Do to Be so) Black and Blue?« sang, den er bereits seit 1929 im Repertoire hatte. Er enthält die Textzeilen:
I’m white inside, but that don’t help my case
’Cause I can’t hide what is in my face
How would it end? Ain’t got a friend
My only sin is in my skin
What did I do to be so black and blue?
Sätze wie »I’m white inside« oder »My only sin is my skin« sollten natürlich nicht wörtlich genommen, sondern müssen als sarkastischer Kommentar zur Segregation und dem damit verbundenen Anpassungsdruck verstanden werden – so wie es der Erzähler in Ralph Ellisons Schlüsselroman The Invisible Man auch tut. Als Armstrong diese Strophe in Berlin sang, wurde sein ansonsten lächelndes Gesicht plötzlich ernst und ein Anflug unbestimmter Trauer schlich sich in seine Mimik ein.
Ein Bopper leistet Abbitte
In der Folgezeit sollte Armstrong immer wieder seine Solidarität mit der Bürgerrechtsbewegung unter Beweis stellen. Nicht zuletzt seine Aufnahme von »We Shall Overcome« vom Mai 1970, ein Jahr vor seinem Tod,– der Hymne des Civil Rights Movement –, dokumentiert seine Verbundenheit mit der afroamerikanischen Emanzipationsbewegung. Bob Thiele, vormals Produzent von Impulse! Records und Förderer von aufstörenden Free-Jazz-Propheten wie dem späten John Coltrane, Albert Ayler, Archie Shepp oder Pharoah Sanders, erinnert sich:
Ich besuchte Armstrong zu Hause und schlug ihm vor, »We Shall Overcome« aufzunehmen. Louis’ Augen leuchteten auf und er holte ein Tonband mit der Aufzeichnung von Martin Luther Kings Begräbnis hervor. Wir hörten es uns an, und Louis sagte, er finde es großartig, wie der Chor das Stück während des Gottesdienstes gesungen habe.1
Also entschloss Armstrong sich, das Stück in einem Arrangement von Oliver Nelson mit Unterstützung einer Bigband und eines Chors einzuspielen. Nach Augenzeugenberichten soll er Tränen in den Augen gehabt haben, als er den ikonischen Protestsong sang.
Selbst sein langjähriger Antipode Dizzy Gillespie musste später in seinen Lebenserinnerungen To be or not … to Bop zugeben: »Weil ich aus einer jüngeren Generation stammte, habe ich ihn [Armstrong] falsch eingeschätzt.« Inzwischen wusste Dizzy, was es heißt, wenn man wegen eines strahlend breiten Lächelns und modischer Kostümierung als »Clown of Bebop« verspottet wird. Seinem Trompetenkollegen Satchmo erteilte er volle Absolution:
Ich begann zu begreifen, dass Pops’ Grinsen angesichts des Rassismus seine absolute Weigerung darstellte, sich durch irgendetwas – und sei es durch den Zorn über Rassismus – die Lebensfreude nehmen und sein fantastisches Lächeln auslöschen zu lassen.2
II. Stil und Eleganz: Duke Ellingtons emanzipatorische Maskerade
Am 12. Juni 1967 verlieh die renommierte Yale University in New Haven Duke Ellington als erstem Jazzmusiker überhaupt die Ehrendoktorwürde. Und Präsident Kingman Brewster, Jurist und späterer US-Botschafter, hielt seine bis dato launigste Laudatio:
Wir sind Ihnen zu außerordentlichem Dank verpflichtet für Ihre grundlegende Erkenntnis »It Don’t Mean a Thing if it Ain’t Got That Swing«. Ihre musikalischen Kompositionen haben unser Herz zum Singen, unseren Geist zum Schwingen und unsere Füße zum Wippen gebracht. Wir hoffen, heute keine »Mood Indigo«-Stimmung aufkommen zu lassen. Möge unsere »Caravan« weiterhin »Take the A-Train« beherzigen, um weitere »Sentimental Moods« zu erleben. Man könnte einfach sagen: »You’ve Got it Good and That Ain’t Bad«. Es ist Yale eine besondere Freude, Ihnen den akademischen Grad eines Doctor of Music zu verleihen.1
Fünf Jahre später setzte sich im Oktober 1972 die Würdigung des »bedeutendsten Jazzkomponisten des 20. Jahrhunderts« und einer beispielhaften »Integrationsfigur weit über die stilistischen Gräben hinweg«2 mit der Verleihung der Ellington Medal fort. Als Teil von Yales jüngst etabliertem Ellington Fellowship Program mit einem Etat von einer Million Dollar sollte eine Wochenendveranstaltung unter dem Titel The Conservatory Without Wall zugleich genug Spenden generieren, um zu Ehren Ellingtons den neuen Studiengang African American Music einrichten zu können. Man hatte 40 Jazzgrößen eingeladen, um sie mit der Medaille für ihr Lebenswerk auszuzeichnen und ihnen drei Tage lang Gelegenheit zu geben, in Workshops, Jam-Sessions und bisher nie gehörten Band-Konstellationen aufzutreten. Neben dem Ellington Orchestra konnten die mehr als 2500 Besucher in der altehrwürdigen Woolsey Hall Auftritte von Willie (The Lion) Smith, Odetta, Dizzy Gillespie, Max Roach, Sonny Stitt, Clark Terry, Mary Lou Williams oder Charles Mingus erleben.
Während eines Konzerts des Dizzy Gillespie Sextetts am Abend des 8. Oktober erhielt die Polizei von New Haven plötzlich eine anonyme Bombendrohung: Im Konzertsaal befinde sich ein Sprengkörper. Gillespie musste sein Trompeten-Solo in »I’ll Remember April« abrupt abbrechen, die Polizei ließ das Gebäude räumen, Band wie Besucher wurden auf die Straße geleitet, um dort abzuwarten, bis der Bombenalarm vorbei sei.
Doch einer weigerte sich standhaft, den Raum zu verlassen, stieg stattdessen auf die Bühne und begann dort, Bass zu spielen: Charles Mingus bat zwar die Sicherheitskräfte inständig, alle Besucher zu evakuieren, er selbst aber werde das Feld auf keinen Fall räumen:
Wenn ich sterben sollte, dann bin ich dazu bereit. Aber ich werde auf jeden Fall »Sophisticated Lady« zu Ende spielen. Rassismus ist für diese Bombe verantwortlich, aber Rassismus wird nie stark genug sein, um diese Musik zu töten.3
Die verträumte Komposition von 1932 handelt von einer Dame von Welt, die sich melancholischen Erinnerungen an die unerfüllte Liebe ihrer Jugend hingibt und sich fragen lassen muss: »Diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant / Is that all you really want?« Dieser Signature-Tune Ellingtons hätte in seiner Symbolwirkung für diesen Zwischenfall treffender nicht ausgewählt werden können. Denn es war wohl kein Zufall, dass erst vier Monate zuvor, im Juni 1972, mit der Verabschiedung des »Title IX« des Civil Rights Acts of 1964 die Frauenbewegung in den USA einen wichtigen Etappensieg errungen hatte. Der Paragraph lautet:
Nach dem Gesetz darf keine Person in den USA aufgrund ihres Geschlechts von der Teilnahme an Erziehungsprogrammen ausgeschlossen werden bzw. die Vorteile solcher Programme vorenthalten bekommen, sofern das Programm finanziell von der Bundesregierung unterstützt wird.4
Charles Mingus ließ sich jedenfalls nicht davon abbringen, »Sophisticated Lady«, eines seiner Lieblingsstücke für Solo-Bass, in Yale zu spielen, während draußen vor der Halle Gillespie seinen Auftritt akustisch fortzusetzen versuchte. Aus dem Innern des Gebäudes drang diese gewaltige Bass-Stimme und transformierte die Ellington-Ballade in einen Protestsong. Der Komponist selbst war derweil gezwungen, inmitten der Menge auf der Straße zu warten. Als Mingus’ Bass-Solo zunehmend an Intensität gewann, konnte Ellington nicht umhin, voller Genugtuung in sich hineinzulächeln. Denn für sein ausdrückliches Engagement in der Bürgerrechtsbewegung war er bis dato nicht berühmt geworden.
Ellingtons komplizierte Auffassung von »racial identity« reicht bis in die 1920er Jahre zurück und hat ihren Grund darin, dass sich der Duke einerseits im Rahmen der ›Harlem Renaissance‹ bemühte, ›schwarzes Selbstbewusstsein‹ und ›schwarzen Stolz‹ in den Künsten zu fördern, aber andererseits durch seine ›Jungle Music‹ im Cotton Club rassistische Vorurteile bediente.
Klänge des Dschungels
Mitte der 1920er Jahre strömten immer mehr Weiße auf der Suche nach der ursprünglichen Primitivität der afroamerikanischen Kultur nach Harlem. Der vermeintliche ›wilde‹ Lebensstil der Schwarzen erschien ihnen wie eine sündige Verlockung aus ihrer Mittelklasse-Saturiertheit. Viele New Yorker wollten jetzt die verbotenen Früchte kosten. »Harlem hatte damals einen unglaublichen Ruf, jedermann erwartete schmetternde Trompeten, sich windende Mädchen, jede Nacht war Samstagnacht und jeder hatte Rhythmus in den Knochen«, beschrieb Ellington später die fiebrige Atmosphäre.1 Die Clubs warben mit verführerischen dunkelhäutigen Chorus-Girls, mit schwarzen Tänzern wie Earl ›Snake Hips‹ Tucker und Comedians wie Butterbeans and Susie und mit authentischer Dschungel-Musik.
In seiner Erzählung Nigger Heaven zeichnete Carl Van Vechten