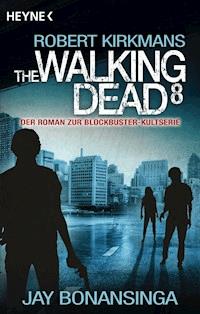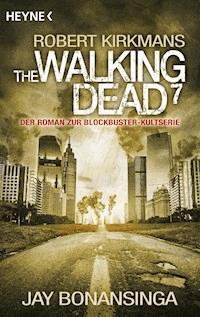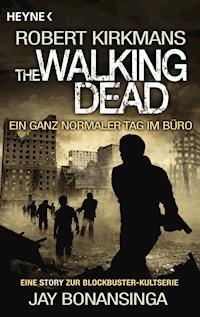9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: The Walking Dead-Romane
- Sprache: Deutsch
Die erfolgreichste Apokalypse unserer Zeit geht weiter
Nachdem der Governor in einem blutigen Aufstand zu Fall gebracht wurde, herrscht nun endlich Frieden in Woodbury, der letzten Stadt der Lebenden in einer Welt der Toten. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Zombie- Plage können die Bewohner Woodburys sich wieder sicher fühlen. Doch dann taucht eines Tages der geheimnisvolle Sektenführer Jeremiah mit seinen Anhängern auf, und zunächst werden die Neuankömmlinge auch mit offenen Armen empfangen, denn die Menschen in der Stadt ahnen nicht, dass Jeremiah ein Geheimnis hat, so dunkel und abgründig wie die Seelen der Untoten selbst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Der düstere Schatten von Philip Blake, dem Governor, liegt über jeder Gasse und jedem Winkel von Woodbury, Georgia. Nach dem blutigen Aufstand und dem Tod des tyrannischen Anführers versuchen Lilly Caul und ihre Mitstreiter, die Ordnung in der kleinen Ortschaft wiederherzustellen. Eine überlebensnotwenige Aufgabe, denn am Horizont kommt eine gewaltige Horde von Untoten auf Woodbury zugewankt. Die einzige Chance der Überlebenden scheint darin zu liegen, sich mit der gerade erst Gruppe des charismatischen, rätselhaften Predigers Jeremiah zu verbünden, die neu in Woodbury angekommen ist. Doch schon bald beginnt Lilly zu zweifeln, ob Jeremiah und seine Gemeinde wirklich ein Segen für Woodbury sind – oder ob sie stattdessen eine dunkle Saat des Hasses in den Herzen der Bewohner säen. Zweifel, denen Lilly und ihre Verbündeten schon bald nicht mehr aus dem Weg gehen können …
Die Autoren
Robert Kirkman ist der Schöpfer der mehrfach preisgekrönten und international erfolgreichen Comicserie The Walking Dead. Die gleichnamige TV-Serie wurde von ihm mit entwickelt und feierte weltweit Erfolge bei Kritikern und Genrefans gleichermaßen. Zusammen mit dem Krimiautor Jay Bonansinga hat er nun die Romanreihe aus der Welt von The Walking Dead veröffentlicht.
Mehr zu The Walking Dead und den Autoren auf:
diezukunft.de
Jay Bonansinga
Robert Kirkman’s
The Walking Dead 5
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe
ROBERT KIRKMAN’STHE WALKING DEAD – DESCENT
Deutsche Übersetzung von Wally Anker
Verlagsgruppe Random House FSC® N001967Deutsche Erstausgabe 09/2015
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2014 by Robert Kirkman LLC, Jay Bonansinga
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Animagic, Bielefeld
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN: 978-3-641-15344-1
diezukunft.de
In memoriam Jane Catherine Parrick
3. Dezember 1928 – 21. März 2014
Teil 1
Feuersee
Die Zeit der Heimsuchung ist gekommen, die Zeit der Vergeltung; dessen wird Israel innewerden. »Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes!« Ja, um deiner großen Schuld und um der großen Anfeindung willen!
– Hosea 9,7
Eins
An jenem Morgen brauen sich zwei voneinander unabhängige und durchaus besorgniserregende Ereignisse unter der Oberfläche des alltäglichen Lebens in der abgebrannten Ortschaft zusammen – beides Probleme, die zumindest anfangs von den Einwohnern völlig unbeachtet bleiben.
Anhaltendes Hämmern und das Rattern von Motorsägen erfüllen die Luft. Stimmen erheben sich in einem geschäftigen Hin und Her über dem Wind. Die vertrauten Gerüche von brennendem Holz, Teerpech und Kompost werden auf der warmen Brise durch die Gassen getragen. Ein Gefühl der Erneuerung – vielleicht sogar der Hoffnung – klingt bei jeder Tätigkeit, bei jeder Handlung mit. Die drückende Sommerhitze wird erst in ein oder zwei Monaten über sie hereinbrechen, und die wilden Cherokee-Rosen stehen in voller Blüte in dichten Reihen entlang der stillgelegten Bahngleise. Der Himmel besitzt die ungeheuer klare HD-Qualität, die so typisch für die letzten Wochen des Frühlings hierzulande ist.
Ausgelöst durch den turbulenten Regimewechsel und der damit verbundenen Möglichkeit, eine demokratische Lebensweise inmitten dieser Trümmer zu führen, die die Seuche hinterlassen hat, haben sich die Überlebenden aus Woodbury, Georgia neu strukturiert – wie DNA, die sich zu einem robusteren, gesünderen Organismus vereint. Das kleine Städtchen, eine ehemalige Eisenbahnerstadt achtzig Kilometer südlich von Atlanta, wurde erst vor Kurzem zu ausgebrannten Häusern und heruntergekommenen, mit Müll übersäten Straßen reduziert. Lilly Caul ist einer der Hauptgründe dieser Renaissance. Die dünne, des Kämpfens müde, aber dennoch anmutige junge Frau mit ihren goldbraunen Haaren, deren Look an den eines Straßenköters erinnerte, und einem Gesicht in Form eines Herzens ist widerwillig zur Anführerin von Woodbury geworden.
Jetzt ist ihre Stimme in jedem Winkel des kleinen Städtchens zu hören, ihre Autorität wird vom Wind durch die Straßen und über die Wipfel von Eichen und Pappeln getragen, die die Promenade westlich der Rennbahn säumen. An jedem offenen Fenster, in jeder Gasse und in jeder Ecke der Arena ertönt sie. Lilly preist Woodbury mit dem Eifer einer Immobilienmaklerin an, die ein Haus in Florida mit eigenem Strandabschnitt an den Mann bringen will.
»Noch ist unsere sichere Zone klein, das will ich gar nicht abstreiten«, gibt sie gegenüber einem unbekannten Zuhörer zu. »Aber wir werden die Barrikade einen Häuserblock weiter nach Norden erweitern. Und die hier vielleicht zwei oder drei Häuserblöcke nach Süden, sodass wir irgendwann mit einer Stadt in einer Stadt enden, einem sicheren Ort, an dem die Kinder auf der Straße spielen können – einem Ort, der, wenn alles gut geht, eines Tages völlig autark ist und nachhaltig bewirtschaftet wird.«
Während Lillys Monolog durch sämtliche Winkel der Arena hallt – der Ort, an dem früher noch Wahnsinn in Form von blutigen Kämpfen auf Leben und Tod vorgeherrscht hat –, zuckt das verbrannte Gesicht einer dunklen Gestalt, die unter einem Gulli steckt, unkontrolliert vor sich hin. Es bewegt sich ruckartig in Richtung der Stimme – wie eine Satellitenschüssel, die sich auf ein Signal aus dem All ausrichtet.
Früher einmal war er ein schlaksiger Tagelöhner auf einem Bauernhof gewesen, durchtrainiert und schlank, mit strohblondem Schopf. Vor Kurzem aber, als Woodbury noch im Chaos versunken war und Feuer das Städtchen verwüsteten, fiel dieser verbrannte, reanimierte Leichnam durch einen kaputten Gulli, wo er unbemerkt eine ganze Woche verbracht und sich in der sauerstoffarmen, stinkenden Finsternis gesuhlt hat. Hundertfüßer, Käfer und Asseln krabbeln hektisch über sein fahles, totes Gesicht und seine zerfetzte, von der Sonne gebleichte Jeans – der Stoff ist schon so alt und abgewetzt, dass man ihn kaum von dem toten Fleisch der Kreatur unterscheiden kann.
Dieser verirrte Beißer, früher ein eingekerkerter unmenschlicher Gladiator, der sein Unwesen in der Arena trieb, wird die erste von zwei Entwicklungen sein, die Anlass zu ernsthafter Sorge geben sollten, von jedem Bewohner des Städtchens aber übersehen wurden – auch von Lilly, deren Stimme jetzt mit jedem Schritt, mit dem sie sich der Rennbahn nähert, lauter wird. Eine Gruppe Menschen schlurft ihr hinterher.
»Jetzt könnte man sich natürlich fragen: ›Stelle ich mir das nur vor, oder ist ein gigantisches UFO mitten in Woodbury gelandet, als niemand aufgepasst hat?‹ Aber nein, das ist die Arena des Woodbury Veterans Speedway – ich nehme an, man könnte es ein Überbleibsel aus besseren Zeiten nennen. Aus Zeiten, in denen die Menschen nichts weiter wollten, als sich Freitagabend ein Hähnchen zu holen und Männern in tollkühnen Kisten zuzuschauen, die einander über den Haufen fuhren und die Luft verpesteten. Wir wissen immer noch nicht, wozu wir sie jetzt benutzen können … Aber auch wenn uns nichts anderes einfällt, einen tollen Park können wir immer noch aus ihr machen.«
Inmitten der Enge des faulenden Abwasserkanals läuft dem toten Landarbeiter bereits bei dem Gedanken an das sich nähernde Frischfleisch das Wasser im Mund zusammen. Sein Kiefer beginnt zu arbeiten, knirscht und knarzt, als er auf die Wand zukrabbelt und blindlings nach oben an den Gulli greift, durch den das Tageslicht in seine Welt einfällt. Durch die schmalen Eisenstäbe kann er die Schatten von sieben Lebenden sehen, die sich ihm nähern.
Durch Zufall findet die Kreatur mit einem Fuß Halt im maroden Mauerwerk.
Beißer können nicht klettern. Ihre einzige Fähigkeit besteht darin zu fressen. Sie besitzen kein Bewusstsein, verspüren nichts außer Hunger. Jetzt aber dient der unerwartete Halt dazu, dass die Kreatur sich beinahe unfreiwillig aufrichtet und den Gullideckel erreicht, durch dessen Schacht sie vor einer Woche gefallen ist. Als ihre weißen Knopfaugen den Rand des Kanalschachts erreichen, fokussiert sie ihren animalischen Blick auf das erste Stück Menschenfleisch in der Nähe. Es ist ein kleines Mädchen von acht oder neun Jahren, das mit ernster Miene in ihrem dreckigen Gesicht neben Lilly herstapft.
Für einen Augenblick duckt sich der Beißer im Kanalschacht wie eine metallene Feder und stößt dann ein Knurren wie ein Motor im Leerlauf aus. Seine toten Muskeln werden durch angeborene Signale zum Zucken gebracht, die von einem reanimierten Nervensystem geschickt werden. Sein schwarzer lippenloser Schlund entblößt jetzt seine moosgrünen Zähne, seine milchig weißen Augen öffnen sich und verschlingen seine Beute förmlich mit einem stechenden und gleichzeitig unheimlich anmutenden, diffusen Blick.
»Ihnen werden früher oder später sicherlich die Gerüchte zu Ohren kommen«, vertraut Lilly ihren unterernährten Zuhörern an, als sie nur wenige Zentimeter am Kanaldeckel vorbeigeht. Die Gruppe setzt sich aus einer einzigen Familie zusammen, den Duprees, bestehend aus einem ausgemergelten Vater um die vierzig, der auf den Namen Calvin hört, seiner heruntergekommenen Frau Meredith und ihren drei Schmuddelkindern Tommy, Bethany und Lucas, die zwölf, neun und fünf Jahre alt sind. Die Duprees sind vorige Nacht in ihrem abgewrackten Ford-LTD-Kombi in Woodbury angekommen. Nicht nur ihr Wagen, auch sie selbst befanden sich in einem völlig desolaten Zustand. Man könnte beinahe sagen, sie waren fast psychotisch vor Hunger. Lilly hat sie unter ihre Fittiche genommen. Woodbury braucht neue Leute – neue Bewohner, frische Geister, die der Stadt helfen, sich selbst neu zu erfinden, und die die schwere Arbeit der Gemeinschaftsbildung nicht scheuen. »Insofern hören Sie es am besten von uns«, fährt Lilly fort. Sie hält in ihrem Georgia-Tech-Kapuzenpullover und ihrer kaputten Jeans inne und legt die Hand auf ihren Sam-Browne-Waffengürtel. Sie ist noch Anfang dreißig, aber ihre Miene verrät, dass sie bereits viel zu viel für ein solch zartes Alter mitgemacht hat. Sie trägt ihr rotbraunes Haar in einem Pferdeschwanz, und ihre haselnussbraunen Augen leuchten auf – der Funke in ihren Pupillen ist teils ihrer Intelligenz, teils aber auch dem durchdringenden Starren eines erfahrenen Kriegers geschuldet. Sie wirft einen Blick über die Schulter und sieht den Siebten in der Runde fragend an. »Möchtest du ihnen nicht vom Governor erzählen, Bob?«
»Mach du ruhig«, erwidert der ältere Mann, während ein Lächeln sein wettergegerbtes, ledriges Gesicht umspielt, das ahnen lässt, wie müde er der Seuche ist. Seine dunklen Haare sind mit Pomade über seine mit tiefen Furchen versehene Stirn geklebt, und er trägt einen Patronengurt über einem mit Schweißflecken übersäten Chambray-T-Shirt. Bob Stookey misst mitsamt Socken einen Meter achtzig, ist aber von der immerwährenden Erschöpfung, die sich bei trockenen Alkoholikern wie ihm oft findet, vornübergebeugt. »Nein, Lilly, Kleines, du bist gerade in Fahrt.«
»Okay … Also … Beinahe ein ganzes Jahr lang«, fängt Lilly an und starrt jedem einzelnen Familienmitglied der Duprees in die Augen, um den Ernst ihrer Worte zu unterstreichen, »stand Woodbury unter dem Joch eines sehr gefährlichen Mannes namens Philip Blake – auch bekannt als der Governor.« Sie atmet halb glucksend, halb vor Abscheu stöhnend aus. »Ich weiß … Die Ironie haben sogar wir begriffen.« Sie holt Luft. »Wie auch immer … Er war nichts weiter als ein Soziopath. Paranoid. Wahnhaft. Aber er war ein Mann der Tat, hat die Sachen angepackt. Ich gebe es zwar ungern zu, aber … für die meisten von uns, zumindest für eine Weile, schien er ein notwendiges Übel.«
»Entschuldigen Sie … Äh … Lilly, nicht wahr?« Calvin Dupree tritt einen Schritt vor. Er ist ein kompakter, hellhäutiger Mann mit den drahtigen Muskeln eines Tagelöhners. Sein Anorak ist so verschmutzt, dass er den Eindruck erweckt, er hätte ihn als Metzgerschürze zweckentfremdet. Seine Augen sind klar, warm und offen – und das trotz der Zurückhaltung und der seelischen Belastung, die er dort draußen in der Wildnis für wer weiß wie lange mitgemacht hat. »Aber ich weiß nicht genau, worauf Sie hinauswollen. Was hat das alles mit uns zu tun?« Er schenkt seiner Frau einen Blick. »Ich meine … Wir sind sehr dankbar für Ihre Gastfreundschaft und so, aber wohin führt das Ganze jetzt genau?«
Die Frau, Meredith, starrt auf den Bürgersteig und kaut auf ihrer Lippe. Sie ist eine unscheinbare kleine Frau in einem kaputten Sommerkleid und hat außer »Hmm« oder »Aha« seit der Ankunft der Duprees nicht mehr als drei Worte von sich gegeben. In der vorigen Nacht hat man sie erst einmal mit etwas Nahrung versorgt, ehe Bob sie medizinisch untersuchte. Danach konnte sie sich endlich ausruhen. Jetzt aber zappelt sie förmlich herum, während sie darauf wartet, dass Calvin mit seinen patriarchalischen Pflichten fertig ist. Hinter ihr schauen die Kinder erwartungsvoll drein. Ein jedes scheint wie gelähmt, verwirrt, zaghaft. Das kleine Mädchen, Bethany, steht nur Zentimeter von dem kaputten Gullideckel entfernt und saugt an ihrem Daumen. In ihren winzigen Armen hält sie eine abgegriffene Puppe, ohne den dunklen Schatten wahrzunehmen, der sich unter ihren Füßen rührt.
Seit Tagen schon glauben die Bewohner Woodburys, dass der Gestank aus der Kanalisation – der verräterische Mief eines Beißers nach verdorbenem Fleisch – von alter Jauche stammt und das schwache Brummen von dem Generator tief im Bauch der Arena kommt. Jetzt aber schafft der Leichnam es, eine krallenartige Hand aus dem Gulli zu strecken. Seine verfaulten Fingernägel schnappen nach dem Saum von Bethanys Kleid.
»Ich verstehe Ihre Frage«, antwortet Lilly und schaut Calvin direkt in die Augen. »Sie haben keine Ahnung, wer wir sind. Aber ich dachte nur … Sie wissen schon. Ich möchte mit offenen Karten spielen. Der Governor hat diese Arena für … für schlimme Sachen benutzt. Gladiatorenkämpfe mit Beißern. Fürchterliche Sachen im Namen der Unterhaltung. Einige der Einwohner sind deswegen noch immer etwas nervös. Aber wir haben Woodbury zurückerobert und möchten Ihnen einen Ort der Zuflucht anbieten – einen Ort, der sicher ist. Wir möchten, dass Sie bei uns bleiben. Für immer.«
Calvin und Meredith Dupree tauschen einen weiteren Blick aus, und Meredith schluckt, ehe sie den Kopf wieder zu Boden senkt. Calvins Miene macht einen merkwürdigen Eindruck – er blickt beinahe wehmütig drein. Er dreht sich zu Lilly um und meint: »Das ist ein großzügiges Angebot, Lilly. Aber ich will auch ehrlich sein …«
Plötzlich wird er von dem rostigen Quietschen des kaputten Gullideckels unterbrochen. Dann ertönt der angsterfüllte Schrei des kleinen Mädchens, und alle drehen sich hastig zu ihr um.
Bob greift nach seiner .357 Magnum.
Lilly sprintet auf Bethany zu, hat bereits die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht.
Die Zeit scheint stehenzubleiben.
Seit dem Ausbruch der Seuche vor knapp zwei Jahren hat sich das Verhalten der Überlebenden ganz langsam, ja fast unmerklich verändert. Das Blutbad, das anfangs noch so neu und nur vorübergehend schien, diente solch reißerischen Schlagzeilen wie DIE TOTEN SIND UNTERWEGS, NIEMAND IST SICHER und IST DAS DAS ENDE? Langsam, aber sicher wurde es zu einer Routine, fand statt, ohne dass jemand auch nur einen Gedanken darüber verlor. Die Überlebenden perfektionierten ihre Tötungskünste, stachen die sprichwörtlichen Furunkel der Apokalypse ohne große Planung oder Zeremonie auf, indem sie das Gehirn eines wütenden Kadavers mit allem zerstörten, was ihnen gerade in die Hände kam – einer Schrotflinte, einem Werkzeug, einer Stricknadel, einem kaputten Weinglas, einem Erbstück vom Kaminsims –, bis selbst der grausamste Akt zur Alltäglichkeit wurde. Trauma verliert sämtliche Bedeutung, Kummer, Leid und Verlust werden allesamt in den hintersten Gehirnfalten versteckt, bis eine kollektive geistige Taubheit einsetzt. Soldaten auf Einsätzen kennen die Wahrheit hinter dieser Lüge. Polizisten bei der Mordkommission ebenso. Krankenschwestern in der Notaufnahme und Rettungssanitäter – sie alle kennen dieses schmutzige kleine Geheimnis: Es wird nicht leichter. Vielmehr lebt es in einem weiter. Jedes Trauma, jede widerwärtige Szene, jeder sinnlose Tod, jeder animalische Akt blutgetränkter Gewalt im Namen der Selbsterhaltung sammelt sich tief im Herzen, bis ihr Gewicht untragbar wird.
Lilly Caul hat diese Grenze der Belastbarkeit noch nicht erreicht – was sie der Dupree-Familie innerhalb der nächsten paar Sekunden beweisen wird –, aber sie rückt immer näher. Denn auch ihre Seele steht lediglich einige Flaschen billigen Fusels und ein paar schlaflose Nächte entfernt vor der völligen Zerstörung. Und genau deswegen braucht sie neues Leben in Woodbury. Es mangelt ihr an menschlichem Kontakt, an einer Gemeinschaft, an Wärme und Liebe und Hoffnung und Gnade – sie muss sie haben, ganz gleich wie. Und deswegen stürzt sie sich auf den stinkenden Leichnam des Landarbeiters, der sich jetzt aus seiner Höhle erhebt und nach dem Saum des kleinen Dupree-Mädchens schnappt, mit einer schier unmenschlichen Entschlossenheit.
Lilly überwindet die fünf Meter zwischen ihr und dem kleinen Mädchen in zwei großen Sätzen. Gleichzeitig zückt sie ihre .22er Kaliber Ruger SR aus dem Miniholster auf ihrem Rücken. Die Waffe ist mit einem Rückstoßlader ausgestattet, und Lilly trägt sie stets ungesichert bei sich. Das Magazin ist mit acht Kugeln im Magazin und einer im Lauf immer voll geladen, um stets einsatzbereit zu sein. Die Ruger ist zwar nicht eine der leistungsfähigsten Waffen, aber groß genug, um jeden Beißer ins Jenseits zu blasen. Jetzt zielt sie mitten im Satz auf den Kadaver, ihre Sicht zum Tunnelblick reduziert, während sie auf das kreischende Mädchen zuprescht.
Die Kreatur aus dem Abwasserkanal hat eine knöcherne Hand in den Saum des Kleids gesteckt und zerrt nun daran, bis die Kleine ihr Gleichgewicht verliert und der Länge nach zu Boden fällt. Sie brüllt und schreit, versucht davonzukrabbeln, aber das Monster zerrt an ihrem Kleid und beißt knapp an ihren Turnschuhen vorbei. Seine schleimigen Schneidezähne klappern wie Kastagnetten und nähern sich beharrlich dem zarten Fleisch von Bethanys linker Ferse.
In dem panischen Moment, ehe Lilly ein Höllenfeuer loslässt – einem traumartigen Stehenbleiben der Zeit, an das sich die Leute im Laufe der Seuche beinahe gewöhnten –, zucken die restlichen Erwachsenen zusammen und ringen gemeinsam nach Atem. Calvin tastet panisch nach seinem Klappmesser, Bob greift nach seiner .357-Kaliber-Pistole, Meredith hält sich zu Tode erschrocken die Hand über den Mund, und die anderen zwei Kinder springen mit weit aufgerissenen Augen zurück.
Lilly steht jetzt kurz vor dem Beißer, hat die Ruger hochgerissen und zielt auf den Kadaver, während sie gleichzeitig das kleine Mädchen mit ihrer Stiefelspitze zur Seite in Sicherheit schiebt und den Lauf wenige Zentimeter vor dem Schädel des Beißers in Position bringt. Die Hand des Monsters krallt sich unaufhörlich am Saum des Kleids fest, sodass der Stoff reißt, als das kleine Mädchen über den Boden kullert.
Vier rasche Schüsse explodieren wie platzende Ballons, und die Kugeln vergraben sich im Kopf des Beißers.
Eine Nebelwolke aus Blut breitet sich um den Kadaver aus, und keksgroße Teile von Gewebe und Hirnknochen schießen aus seinem Schädel. Der ehemalige Landarbeiter sinkt zu Boden. Unter dem zerfetzten Kopf breitet sich eine schwarze Blutlache in alle Richtungen aus, und Lilly weicht zurück, blinzelt, ringt nach Luft und versucht, nicht in die sich stetig ausbreitende Pfütze verseuchten Blutes zu treten. Sie nimmt den Finger vom Hahn und sichert die Waffe.
Bethany schreit noch immer wie am Spieß. Lilly sieht, wie sich die Hand des Beißers nach wie vor krampfhaft am Saum ihres Baumwollkleids festhält – die Totenstarre hat bereits eingesetzt. Die Kleine dreht und windet sich, schnappt nach Luft, als ob sie nach so vielen Monaten des Schreckens nicht mehr zu weinen in der Lage ist. Lilly beugt sich über sie und flüstert: »Ist schon gut, Kleines. Schau nicht hin.« Lilly legt die Ruger zu Boden und nimmt Bethanys Kopf in die Arme. Die anderen scharen sich um sie. Meredith kniet sich hin, während Lilly mit dem Stiefel auf die tote Hand stampft. »Nicht hinschauen.« Sie reißt den Saum frei. »Nicht hinschauen, Kleines.« Endlich beginnen die Tränen über Bethanys Wangen zu kullern.
»Du darfst nicht hinschauen«, wiederholt Lilly flüsternd, als ob sie zu sich selbst spricht.
Meredith zieht ihre Tochter an sich, umarmt sie und flüstert ihr dann ins Ohr: »Ist schon gut, Bethany. Ich bin da … Ich bin da.«
»Es ist vorbei.« Lilly spricht ganz leise, als ob die Worte eher für sie selbst als für die anderen bestimmt sind. Sie stößt einen gequälten Seufzer aus. »Nicht hinschauen«, wiederholt sie erneut.
Aber Lilly schaut hin.
Eigentlich sollte sie die Beißer, die sie ins Jenseits geschickt hat, nicht mehr anblicken, aber sie kann der Versuchung einfach nicht widerstehen. Wenn das Gehirn endlich seinen Geist aufgibt und das Düstere aus ihren Gesichtern verschwindet und dem leeren Schlaf des Todes Platz macht, kann Lilly erst erahnen, wen sie da vor sich hatte. Jetzt sieht sie einen Landarbeiter mit ehrgeizigen Träumen, der vielleicht die Hauptschule besucht hatte, um dann den Bauernhof seines kränkelnden Vaters übernehmen zu müssen. Sie sieht Polizisten, Krankenschwestern, Briefträger, Verkäufer und Mechaniker. Sie sieht ihren Vater, Everett Caul, wie er zwischen dem Seidenstoff in seinem Sarg liegt und auf die Beerdigung wartet – friedlich und gleichmütig. Sie sieht all ihre Freunde und Bekannten, die seit Anbeginn der Seuche gestorben waren: Alice Warren, Doc Stevens, Scott Moon, Megan Lafferty und Josh Hamilton. Sie kann nicht umhin, an ein weiteres Opfer zu denken, als eine raue Stimme sie aus ihren Gedanken reißt.
»Lilly, Kleines?«, erkundigt sich Bob. Seine Stimme ist schwach, als ob er aus großer Entfernung mit ihr spricht. »Alles klar bei dir?«
Für einen letzten Augenblick – sie starrt noch immer den Landarbeiter an – taucht Austin Ballard vor ihrem inneren Auge auf – dieser androgyne junge Mann mit dem Aussehen eines Rockstars und seinen langen Wimpern, wie er sich auf dem Schlachtfeld opfert, um Lilly und der halben Bevölkerung Woodburys das Leben zu retten. War Austin Ballard der einzige Mann, den Lilly wirklich geliebt hat?
»Lilly?«, fragt Bob etwas lauter, und die Sorge klingt in seiner Stimme mit. »Alles klar?«
Lilly atmet gequält aus. »Es geht mir gut … Wirklich.« Plötzlich richtet sie sich auf, nickt Bob zu und liest ihre Waffe vom Boden auf, um sie wieder im Holster verschwinden zu lassen. Sie fährt sich mit der Zunge über die Lippen und richtet das Wort an die Duprees: »Ist bei Ihnen alles okay? Bei euch, Kinder?«
Die zwei Dupree-Nachkömmlinge nicken langsam und starren Lilly an, als ob sie gerade den Mond mit einem Lasso eingefangen hätte. Calvin steckt sein Messer wieder in die Scheide, kniet sich dann hin und streichelt Bethanys Haare. »Geht es ihr gut?«, fragt er seine Frau.
Meredith nickt ihm kurz zu, sagt aber kein Wort. Ihre Augen wirken glasig.
Calvin seufzt, richtet sich wieder auf und geht dann zu Lilly, die bereits den Kadaver zusammen mit Bob unter einen Überbau zerrt, damit er später entsorgt werden kann. Dann wischt sie sich die Hände an der Hose ab und richtet sich an den Familienvater. »Es tut mir leid, dass Sie das mitansehen mussten«, entschuldigt sie sich bei ihm. »Wie geht es dem Mädchen?«
»Die erholt sich schon wieder. Sie ist sehr willensstark«, erklärt Calvin und starrt Lilly an. »Und wie geht es Ihnen?«
»Wie es mir geht?« Lilly stöhnt. »Äh, gut. Danke.« Erneut atmet sie gequält aus. »Aber ich habe die Nase voll davon.«
»Verstehe ich gut«, stimmt er ein und neigt den Kopf zur Seite. »Trotzdem, Sie können ziemlich gut mit der Waffe umgehen.«
Lilly zuckt mit den Schultern. »Nun, so gut nun auch wieder nicht«, erwidert sie und schaut über das Städtchen. »Man muss immer die Augen offen halten. Wir haben während der letzten Wochen recht viel mitgemacht, eine ganze Seite der Barrikade verloren. Und dann gibt es immer diese Nachzügler; aber keine Angst, wir kriegen das schon wieder unter Kontrolle.«
Calvin lächelt sie müde an. »Das glaube ich Ihnen aufs Wort.«
Lilly bemerkt etwas Glänzendes, das um Calvins Hals hängt – ein kleines goldenes Kreuz. »Also, was halten Sie davon?«, fordert sie ihn unverblümt auf.
»Wovon?«
»Hierzubleiben und Ihrer Familie ein Zuhause zu geben. Was halten Sie davon?«
Calvin Dupree holt tief Luft und lässt seinen Blick von seiner Frau zu seinen Kindern schweifen. »Ich will Sie nicht anlügen … Die Idee gefällt mir.« Nachdenklich fährt er mit der Zunge über die Lippen. »Wir sind schon viel zu lange unterwegs, ohne einen festen Wohnsitz. Die Kinder haben sehr viel durchmachen müssen.«
Lilly schaut ihm in die Augen. »Hier in Woodbury sind sie sicher, können ein glückliches, normales Leben führen … Mehr oder weniger.«
»Ich sage ja gar nicht Nein.« Calvin erwidert ihren Blick. »Ich will doch nur … Geben Sie uns etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Wir müssen beten.«
Lilly nickt. »Selbstverständlich.« Kurz murmelt sie den letzten Satz leise vor sich hin: ›Wir müssen beten‹, und fragt sich, wie es wohl wäre, einen Bibeltreuen unter ihnen zu haben. Ein paar Lakaien vom Governor haben so getan, als ob sie Gott auf ihrer Seite hätten, haben immer gefragt, was Jesus jetzt wohl tun würde, und von verschiedenen Fernseh-Priestern geschwärmt. Lilly hat noch nie viel für Religion übriggehabt. Klar, seit Ausbruch der Seuche hat es auch Momente gegeben, in denen sie still und leise vor sich hin betete, aber das zählt für sie nicht wirklich. Wie lautet der Spruch noch mal? »Im Schützengraben gibt es keine Atheisten.« Sie blickt in Calvins graugrüne Augen. »Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.« Sie lächelt. »Schauen Sie sich um, lernen Sie unser Städtchen kennen …«
»Das wird nicht notwendig sein«, unterbricht eine Stimme sie, und alle drehen die Köpfe zu der unscheinbaren Frau, die neben dem noch immer bebenden Kind kniet. Meredith Dupree fährt mit der Hand über Bethanys Haare und starrt weiterhin auf ihre Tochter, während sie fortfährt: »Wir möchten uns für Ihre Gastfreundschaft bedanken, aber wir brechen heute Nachmittag wieder auf.«
Calvin senkt den Blick. »Aber Schatz, wir haben doch noch nicht einmal besprochen, was wir als Nächstes …«
»Da gibt es nichts zu besprechen.« Die Frau schaut auf, und ihre Augen funkeln vor Entrüstung. Ihre aufgeplatzten Lippen beben, und ihre blasse Haut ist errötet. Sie gleicht einer zerbrechlichen Porzellanpuppe mit einem feinen Haarriss. »Wir machen uns wieder auf den Weg.«
»Liebling …«
»Die Sache ist beschlossen.«
Die darauffolgende Stille lässt den peinlichen Moment beinahe surreal erscheinen. Der Wind streicht über die Baumwipfel und pfeift durch die Gerüste und Tribünen der Arena, während der tote Landarbeiter still und leise wenige Meter von ihnen entfernt vor sich hin rottet. Jeder in Merediths unmittelbarer Nähe, also auch Bob und Lilly, haben den Kopf vor stillschweigender Verlegenheit gesenkt, bis Lilly die Stille unterbricht: »Nun, sollten Sie es sich dennoch anders überlegen, können Sie trotzdem gerne hierbleiben.« Sie wartet vergeblich auf eine Antwort und setzt dann ein schiefes Lächeln auf. »Mit anderen Worten, ich ziehe mein Angebot nicht zurück.«
Lilly und Calvin tauschen eine Sekunde lang einen verstohlenen Blick aus, und zwischen ihnen fließen unzählige Informationen – manche gewollt, andere ungewollt –, ohne dass sie auch nur ein einziges Wort in den Mund nehmen. Aus Respekt bewahrt Lilly Ruhe, denn sie weiß, dass dieses Thema zwischen den beiden Neuankömmlingen noch lange nicht ausdiskutiert ist. Calvin dreht sich zu seiner hibbeligen Frau um, die sich noch immer um ihr Kind kümmert.
Meredith Dupree gleicht einem Phantom. Ihr vor Schmerz geplagtes Gesicht ist so fahl und abgespannt, dass man den Eindruck gewinnt, sie verschwinde langsam, aber sicher von der Erdoberfläche.
Zu diesem Zeitpunkt kann niemand es ahnen, aber diese altmodische, winzige Hausfrau – völlig unscheinbar in jeder nur erdenklichen Hinsicht – wird sich als zweite und viel tiefgreifendere Auslöserin eines Ereignisses entpuppen, mit dem Lilly und die Leute aus Woodbury früher oder später fertigwerden müssen.
Zwei
Gegen Mittag haben die Temperaturen bereits zwanzig Grad überschritten, und die inzwischen hochstehende, gnadenlose Sonne bleicht die Farben des Ackerbodens Zentral-Georgias. Die Tabak- und Bohnenfelder südlich von Atlanta sind bereits entweder verwahrlost oder zu Dschungeln aus Rutenhirse oder Rohrkolben verkommen. Inmitten der Vegetation stehen alte Traktoren und sonstige landwirtschaftliche Gerätschaften herum, voller Rost und so weit geplündert, bis es nichts mehr zu holen gab – marode und nutzlos wie die Knochen alter Dinosaurier. Und genau deswegen bemerken Speed Wilkins und Matthew Hennesey den Kornkreis östlich von Woodbury erst am Nachmittag.
Die beiden jungen Männer – Bob hatte sie am frühen Morgen losgeschickt, um in erster Linie nach Benzin in verlassenen Autos oder leerstehenden Tankstellen zu suchen – sind mit Bobs Pick-up-Truck losgefahren, haben jetzt aber die Straße verlassen und sich zu Fuß aufgemacht, nachdem der Wagen im Schlamm stecken geblieben war.
Sie bahnen sich ihren Weg über fünf Kilometer matschigen Landwirtschaftspfad, ehe sie zu einer Anhöhe kommen, von der aus sie riesige Wiesen voller Riedgräser, umgefallener Bäume und Unmengen an Präriegras überschauen. Matthew erkennt als Erster den dunkleren grünen Kreis in der Ferne, der zwischen dem ledrigen Dschungel vernachlässigter Tabakpflanzen eingebettet ist.
»Sag meiner Sekretärin, dass ich heute keine Anrufe entgegennehmen kann«, murmelt er, hält eine Hand in die Höhe und erstarrt auf dem Kamm der Anhöhe. Er glotzt auf die entfernten Tabakfelder, die in der sengenden Hitze hin und her wiegen, und hält sich die Hand schützend über die Augen. Der schlaksige Arbeiter aus Valdosta mit dem Tattoo eines Ankers auf dem drahtigen Oberarm trägt Maurerklamotten – ein mit Schweißflecken übersätes Unterhemd, eine graue Arbeitshose und Springerstiefel voller Mörtelstaub. »Hast du das Fernglas parat?«
»Hier«, sagt Speed, kramt den Feldstecher aus seinem Rucksack hervor und reicht ihn an Matthew weiter. »Was ist denn? Was siehst du?«
»Bin mir nicht sicher«, murmelt Matthew und fummelt am Rädchen herum, um das Fernglas scharfzustellen, während er den Horizont absucht.
Speed wartet und kratzt sich den muskulösen Arm wegen der Reihe an Mückenstichen, die soeben zu jucken beginnen. Sein REM-T-Shirt klebt auf der Haut seiner breiten Brust. Der stämmige Zwanzigjährige ist ein wenig unter sein Kampfgewicht von über hundert Kilogramm gefallen – Schuld ist wahrscheinlich die einseitige Ernährung aus zusammengeklaubtem Dosenfutter und Haseneintopf –, aber sein Stiernacken weist noch immer die Breite und Kraft eines Defensive End im American Football auf.
»Whoa!« Matthew starrt weiterhin durch das Fernglas. »Was zum Teufel soll …?«
»Was denn?«
Matthew klebt wie gebannt am Feldstecher und leckt sich mit der Zunge bedächtig die Lippen. »Wenn ich mich nicht irre, haben wir soeben im Lotto gewonnen.«
»Benzin?«
»Nicht ganz«, antwortet Matthew und reicht seinem Kameraden das Fernglas zurück. »Ich habe schon viele Namen dafür gehört, aber noch nie ›Benzin‹.«
Sie laufen den steinigen Hang hinab, springen über ein ausgetrocknetes Bachbett und tauchen in die See aus Tabakpflanzen ein. Der Geruch von Dünger und Humus umgibt sie, er liegt so schwer in der Luft wie im Inneren eines Gewächshauses. Die Luft ist so schwül, dass sie wie ein Schleier auf ihrer Haut zu liegen scheint und sich in ihren Nasenlöchern staut. Die Pflanzen um sie herum blühen, sind mindestens eineinhalb Meter groß und ragen über die Büschel wilden Grases hinaus, sodass die beiden auf Zehenspitzen laufen müssen, um den Überblick zu bewahren. Sie ziehen ihre Pistolen und entsichern sie – nur für den Fall des Falles –, obwohl Matthew außer dem Wehen der Pflanzen im Wind keinerlei Bewegung auffällt.
Die geheime Ernte wartet auf sie in circa zweihundert Metern Entfernung hinter einem Hain knorriger Virginia-Eichen, der aus den Tabakpflanzen wie eine tönerne Garde ragt. Durch die Vegetation kann Matthew sogar den Sicherheitszaun ausmachen, der die illegalen Pflanzen umgibt. Er kann nicht anders, als kurz heiter zu kichern, und meint: »Kannst du das fassen? Das ist doch kaum zu glauben …«
»Ist es das, was ich denke?«, staunt Speed, als sie sich dem Sicherheitszaun nähern.
Sie kommen auf eine kleine Lichtung und bleiben wie angewurzelt stehen, starren auf die langen, üppigen Blätter, die sich um mit Moos bewachsene hölzerne Kletterhilfen und rostigen Maschendrahtzaun winden. Ein schmaler Pfad erstreckt sich östlich der Lichtung, ist aber von Unkraut überwuchert und kaum breiter als dreißig Zentimeter – wahrscheinlich diente er früher als Pfad für Minibikes oder Geländefahrzeuge. »Krass.« Mehr fällt Matthew nicht ein.
»Heiliger Bimbam, das wird eine heiße Nacht in Woodbury.« Speed läuft die Reihe von Pflanzen entlang und mustert sie genauestens. »Das reicht bis zur nächsten Eiszeit und zurück!«
»Und geiles Kraut«, fügt Matthew hinzu, nachdem er an einem Blatt gerochen hat. Er reibt es zwischen Daumen und Zeigefinger und saugt den zitrusartigen Salbeiduft gierig in die Lungen. »Verdammt, kuck dir die Blütenstände an!«
»Brutal, Eins-a-Qualität, Bubba. Wir haben echt im Lotto gewonnen.«
»Wo du recht hast, hast du recht.« Matthew klopft auf seine Taschen und nimmt den Rucksack ab. Sein Herz pocht vor Vorfreude wie wild. »Komm, ich will irgendetwas basteln, das wir als Pfeife benutzen können.«
Calvin Dupree hält das winzige silberne Kruzifix in seiner Handfläche, während er im vollgestellten Lager im hinteren Teil von Woodburys Gerichtsgebäude auf und ab geht. Er hinkt ein wenig und ist so abgemagert, dass er in seiner viel zu weiten Chinohose einer Vogelscheuche gleicht. Er ist wie benommen vor Nervosität. Durch die dreckige Fensterscheibe kann er seine drei Kinder auf dem kleinen Spielplatz spielen sehen – sie schieben sich abwechselnd auf der rostigen alten Schaukel an. »Ich will damit doch nur sagen …« Er reibt sich den Mund und stöhnt frustriert auf. »Ich will damit doch nur sagen, dass wir an die Kinder denken müssen – daran, was am besten für sie ist.«
»Und genau daran denke ich, Cal«, schießt Meredith Dupree von der anderen Seite des Raums zurück, die Stimme vor nervöser Anspannung ganz dünn. Sie hat auf einem Klappstuhl Platz genommen, nippt an einer Wasserflasche und hat den Blick zu Boden gesenkt.
Vorige Nacht hatten sie beide je eine Flasche Nahrungsergänzungsmittel in Bobs Krankenstation gegen ihre Unterernährung verabreicht bekommen, und als Frühstück gab es eine Schale Müsli mit Trockenmilch, gefolgt von Erdnussbutter und Keksen. Die Nahrung hat ihnen zwar körperlich geholfen, aber sie haben weiterhin alle Hände voll zu tun, mit dem seelischen Trauma des drohenden Verhungerns zu kämpfen. Lilly hat ihnen vor wenigen Minuten ein eigenes Zimmer zur Verfügung gestellt und ihnen mehr Wasser und zu essen gegeben und ihnen gesagt, dass sie so viel Zeit haben, wie sie brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. »Das Beste für uns«, murmelt Meredith weiter, »ist auch das Beste für sie.«
»Wie kommst du denn darauf?«
Sie blickt zu ihm auf, die Augen ganz rot und feucht, und ihre Lippen sind so aufgesprungen, dass sie den Anschein erwecken, jeden Augenblick zu bluten. »Du kennst doch diese Sicherheitsvideos in Flugzeugen?«
»Klar, na und?«
»Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich heran, und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie mitreisenden Kindern.«
»Das soll einer verstehen! Wovor hast du Angst, wenn wir hierbleiben?«
Sie wirft ihm einen harten Blick zu. »Ach, Cal … Du weißt doch ganz genau, was passiert, wenn sie etwas über mich … etwas über meinen Zustand erfahren. Erinnerst du dich noch an das KOA-Camp?«
»Die Leute dort waren paranoid und ignorant.« Er geht zu ihr, kniet sich vor ihren Stuhl und legt sanft eine Hand auf ihr Knie. »Gott hat uns doch hierhergeführt, Meredith.«
»Calvin …«
»Ernsthaft. Hör mir doch bitte zu. Dieser Ort hier ist ein Geschenk. Gott hat uns hierhergeführt und will, dass wir bleiben. Vielleicht hat der ältere Herr – Bob, glaube ich, war sein Name – Medikamente für dich. Schließlich sind wir hier nicht mehr im Mittelalter.«
Meredith blickt ihn an. »Doch, Cal … Genau da sind wir, im Mittelalter.«
»Liebling, ich bitte dich.«
»Damals haben sie noch Löcher in die Köpfe von psychisch Kranken gebohrt. Heutzutage aber ist es viel schlimmer.«
»Diese Leute hier werden dich nicht verfolgen. Denen geht es genauso wie uns. Sie haben genauso viel Angst. Die wollen doch nur das bewahren, was sie haben, und einen sicheren Ort schaffen, in dem es sich leben lässt.«
Meredith schüttelt sich. »Genau, Cal … Und deswegen werden sie genau das tun, was ich tun würde, wenn ich erfahren würde, dass ein Irrer in meiner Gemeinde wohnt.«
»Jetzt hör endlich auf! So darfst du nicht reden. Du bist keine Irre. Gott hat uns bis hierher geholfen und wird auch weiterhin seine schützende …«
»Calvin, bitte.«
»Bete mit mir, Meredith.« Er nimmt ihre Hand in seine wettergegerbten Finger und senkt den Kopf. Seine Stimme wird weicher. »Lieber Gott, wir bitten Dich um Rat in diesen schwierigen Zeiten. Herr, wir vertrauen Dir … Du bist unser Fels in der Brandung, unser Schutz. Führe und leite uns.«
Meredith blickt zu Boden, die Stirn vor Schmerz gerunzelt. Tränen steigen ihr in die Augen.
Sie bewegt ihre Lippen, aber Calvin ist sich nicht sicher, ob sie betet oder etwas viel Persönlicheres, Tiefsinnigeres murmelt.
Speed Wilkins setzt sich ruckartig auf. Der überwältigende Gestank von Beißern hat ihn aus dem Schlaf gerissen. Er reibt sich die blutunterlaufenen Augen und versucht sich zu orientieren. Er grübelt darüber nach, wie es ihm passieren konnte, mitten im Nirgendwo einzuschlummern – am Arsch der Welt und ohne Wache. Die Sonne brennt so heiß wie ein Hochofen auf ihn hinab. Er muss Stunden geschlafen haben und ist in Schweiß gebadet. Die Mücken schwirren um seine Ohren. Er schüttelt sich und fuchtelt mit den Händen in der Luft herum, um die Plagegeister zu verjagen.
Er blickt sich um und sieht, dass er anscheinend am Rand eines überwucherten Tabakfelds eingenickt ist. Seine Gelenke schmerzen, insbesondere seine Knie, die noch immer schwach und gezeichnet von seinen alten American-Football-Verletzungen sind. Eigentlich war er nie ein großer Sportler gewesen. Sein erstes Jahr in der dritten Liga für die Piedmont College Lions war in die Hose gegangen, aber er hatte sich schon auf das zweite Jahr gefreut – dann jedoch kam die Seuche, und all seine Träume sind in Rauch aufgegangen.
Rauch!
Auf einmal erinnert er sich an alles, was dazu geführt hatte, dass er hier eingenickt war, und er verspürt gleichzeitig eine ganze Reihe von teils widersprüchlichen Emotionen: Er empfindet Scham, es ist ihm peinlich, er findet es gleichzeitig aber auch ungeheuer witzig – wie so oft, wenn er von einem unglaublichen High wieder runterkommt. Er erinnert sich an das Marihuanafeld etwas nördlich von ihm, eine Fundgrube bestehend aus klebrigen, wohlduftenden Pflanzen mitten im Tabakfeld, eine botanische Matrjoschka, von einem einfallsreichen Kiffer-Gärtner genial vor der Außenwelt versteckt (kurz bevor die Seuche das Highgefühl um einige Stufen heruntergesetzt hatte).
Er senkt den Blick und sieht die behelfsmäßige Pfeife, die sie aus einem Füller gebastelt haben. Daneben liegen die Streichhölzer und kleine Häufchen Asche.
Speed lacht ein paarmal trocken auf – das nervöse Gackern eines Kiffers – und bereut sofort, dass er so viel Lärm gemacht hat. Erneut steigt ihm der Gestank der Beißer in die Nase, die sich ganz in der Nähe aufhalten müssen. Wo zum Teufel ist eigentlich Matthew? Er sucht die Lichtung ab und zuckt zusammen, als seine Kopfschmerzen drohen, seinen Schädel zerplatzen zu lassen.
Er rafft sich auf und erliegt sofort einem Schwindelanfall. Zudem ist er paranoid. Sein Bushmaster-Maschinengewehr hängt noch immer über seiner Schulter. Noch sind keine Beißer zu sehen, aber der Gestank scheint überall zu sein, aus allen Himmelsrichtungen zu ihm zu wehen.
Der fürchterliche düstere Geruch der Untoten dient eigentlich als Indikator für bevorstehende Angriffe – je schlimmer es stinkt, desto größer ist die Horde. Ein schwacher Hauch von verwesendem Fleisch und Fäkalien lässt auf einen einzelnen Beißer schließen, garantiert nicht mehr als zwei oder drei, aber die unendlichen Variationen, die eine größere Gruppe ankündigen, sind genauso katalogisiert und bedienen sich der gleichen Sprache wie eine gute Weinkarte. Eine Ladung voll Kuhdung mariniert in Teichschlamm und Ammoniak ist ein Vorbote von Dutzenden von Beißern. Ein Meer verdorbenen Limburgers, von Maden befallenem Müll, Schwarzschimmel und Eiter heißt so viel wie Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Untoten. Speed schnüffelt noch einmal und schätzt, dass sich mindestens fünfzig oder sechzig Beißer in unmittelbarer Nähe befinden.
Er schnappt sich sein Maschinengewehr und geht am Rand des Tabakfelds entlang. Die ganze Zeit flüstert er laut: »Matt! Hey, Hennesey – wo zum Teufel steckst du?«
Keine Antwort, nur entferntes Rascheln zu seiner Linken – hinter der grünen Wand, wo die verwahrlosten Kulturpflanzen, Scheinastern und wildes Gebüsch zwischen einem Meter fünfzig und einem Meter achtzig hoch stehen. Die riesigen faltigen Blätter verursachen in der Brise unheimliche Geräusche wie das Flüstern von aneinanderreibenden Papierfetzen oder das Anzünden von Streichhölzern. Plötzlich bemerkt er eine Bewegung in dem Meer aus Grün.
Speed dreht sich blitzartig um. Irgendetwas kommt langsam auf ihn zu, vertrocknete Stängel und Schoten brechen unter unbeholfenen, arrhythmisch aufeinanderfolgenden Schritten. Speed hebt die Waffe in den Anschlag, zielt und nimmt die dunkle Gestalt ins Visier, die sich durch die Pflanzen kämpft. Er atmet ein. Die Kreatur ist keine acht Meter entfernt.
Er krümmt schon den Abzugsfinger, als ihn eine Stimme in unmittelbarer Nähe erstarren lässt.
»Yo!«
Speed zuckt zusammen, dreht sich zu der Stimme um und sieht Matthew vor sich stehen, völlig außer Atem und mit seiner Glock 23 samt Schalldämpfer in der Hand. Matthew ist nur wenige Jahre älter als er selbst, größer und schlaksiger und mit einer Haut so wettergegerbt und vom Wind gekennzeichnet, dass er in seinen ausgewaschenen Jeans wie ein Stück wandelndes Trockenfleisch aussieht.
»Mann!«, stammelt Speed und lässt von seinem Maschinengewehr ab. »Wehe, du schleichst dich noch einmal so heran – ich habe mir beinahe in die Hose gemacht.«
»Runter mit dir«, befiehlt Matthew ihm mit sanfter, aber doch bestimmter Stimme. »Jetzt. Speed, mach schon.«
»Hä?« Speeds Schädel ist noch immer benebelt von dem Gras. »Was soll ich?«
»Dich ducken, Mann! Ducken!«
Speed blinzelt, schluckt und tut dann wie ihm geheißen, denn er merkt erst jetzt, dass jemand direkt hinter ihm steht.
Er wirft einen Blick über die Schulter, und für einen kurzen Moment, bevor die Glock explodiert, sieht er, wie sich der Beißer auf ihn stürzt. Es ist eine alte Frau in zerrissener Kleidung mit silberblau getöntem Haar, einem Atem, der nach Krypta stinkt, und Zähnen wie eine Kettensäge. Im Nu geht Speed in die Hocke. Der gedämpfte Schuss trifft sein Ziel, und der Schädel der älteren Dame explodiert in einem Springbrunnen aus schwarzer Rückenmarksflüssigkeit und Gehirnfetzen, ehe sie wie ein Sack zu Boden geht. »Fuck!« Speed richtet sich wieder auf. »Fuck!« Er sucht das restliche Tabakfeld ab und sieht mindestens ein weiteres halbes Dutzend zerlumpte Kreaturen, die auf sie zustolpern. »FUCK! FUCK! FUCK!«
»Mach schon, Kumpel!« Matthew packt ihn am T-Shirt und zieht ihn Richtung Trampelpfad. »Da gibt es noch etwas, das ich dir zeigen will, ehe wir abhauen.«
Der höchste Punkt Meriwether Countys liegt im Hinterland, nicht unweit der Kreuzung von Highway 85 und Millard Drive außerhalb einer verlassenen Ortschaft namens Yarlsburg. Millard Drive führt einen steilen Hügel hinauf, bahnt sich den Weg durch einen dichten Pinienwald und führt dann über ein eineinhalb Kilometer langes Plateau, von dem aus man das Flickwerk der umliegenden Felder überschauen kann.
Entlang dieser schlecht erhaltenen Straße, ganz in der Nähe einer breiten Stelle in der Fahrbahn zum Anhalten im Fall einer Panne oder für eine Toilettenpause, steht ein rostiges, von Kugeln durchsiebtes Schild, das ohne jede Ironie die SCHÖNE AUSSICHT verkündet, als ob es sich bei diesem verarmten Stück Landschaft voller Hinterwäldler um einen exotischen Nationalpark handelt (und nicht um das letzte Kaff in der Mitte von Nirgendwo).
Matthew und Speed brauchen eine halbe Stunde, um zur Kreuzung zu gelangen.
Zuerst müssen sie zurück zu Bobs Pick-up, der noch immer im Schlamm am Highway 85 steckt. Sie befreien ihn, indem sie herumliegende Kartons unter die Reifen stecken, um ihnen mehr Griff zu geben. Sobald der Wagen wieder einsatzbereit ist, fahren sie die acht Kilometer bis zum Millard Drive, wobei sie einer schier endlosen Zahl an ausgebrannten Wracks und verlassenen Autos ausweichen müssen. Auf dem Weg sehen sie kleine Gruppen Beißer. Einige von ihnen stolpern ihnen direkt vor den Wagen. Matthew macht sich einen Spaß daraus, auf sie zuzusteuern und sie wie blutige Kegel ins Jenseits zu befördern. So kommen sie zwar nicht schneller voran, aber schon bald taucht die langersehnte Kreuzung durch die flimmernde Luft über dem Asphalt vor ihnen auf.
Sie biegen nach Norden in die Hügel von Yarlsburg ab.
Speed will von Matthew wissen, was zum Teufel so wichtig sein könnte, dass sie einen Umweg von knapp fünfzig Kilometern auf sich nehmen, doch der hält sich bedeckt und teilt ihm lediglich mit, dass er es schon verstehen wird, sobald er es sieht. Das gefällt Speed überhaupt nicht. Warum zum Henker kann Matthew ihm nicht einfach sagen, was das soll? Was kann es schon sein, das so wichtig ist? Vielleicht ein Tanker voll Benzin, von dem er nichts weiß? Oder ein Einkaufszentrum? Noch ein Walmart, den sie übersehen haben? Warum diese Geheimniskrämerei? Aber Matthew kaut einfach nur nervös auf der Backe herum, fährt weiter gen Norden und gibt kaum einen Ton von sich.
Als sie zur Anhöhe kommen, fällt bei Speed endlich der Groschen. Er kennt dieses Stück Land, und jetzt zieht sich ihm der Magen zusammen. Hier war es. Hier hatte der Governor sein Lager aufgeschlagen, bevor sie das Gefängnis stürmten. Er blickt über die Wälder, begreift, dass sie sich keine zwei Kilometer entfernt von dem riesigen Komplex aus grauem Stein, der als Meriwether County Correctional Facility bekannt war, befinden, und er muss sich vor Grauen schütteln.
Posttraumatische Belastungsstörungen haben eine ganze Reihe verschiedener Auswirkungen. Sie können einem den Schlaf rauben und Halluzinationen hervorrufen. Oder das Opfer entwickelt selbstzerstörerische Tendenzen wie Drogenmissbrauch, Alkoholismus oder Sexsucht. Bei anderen wiederum kann es den Alltag auf eine subtile, hinterhältige Weise in Form von chronischen Angstanfällen oder zuckenden Nerven um den Solarplexus zu den merkwürdigsten Zeiten zum Erliegen bringen. Speed verspürt jetzt, wie sich eine vage, undefinierbare Angst in seinen Gedärmen ausbreitet, als Matthew den Wagen auf dem staubigen Grund neben der Straße parkt und den Motor abschaltet.
Die Gegend hier hat absolutes Chaos erlebt – so viele Tote, darunter auch Speeds engste Freunde aus Woodbury –, und die fürchterlichen Erinnerungen schwirren noch immer in der Luft umher. Das Gefängnis war der Ort des letzten Gefechts und bereitete dem Governor ein psychotisches, größenwahnsinniges Ende. Hier war es auch, wo Speed Wilkins zum ersten Mal Lilly Cauls angeborene Führungsqualitäten zu schätzen lernte.
Matthew schnappt sich das Fernglas und steigt aus.
Speed tritt gegen die Beifahrertür, die sich mit einem rostigen Quietschen öffnet, und folgt Matthews Beispiel. Der überwältigende Gestank verwesenden Fleisches, vermischt mit dem beißenden Geruch von Rauch, schlägt ihm als Erstes ins Gesicht. Er folgt Matthew über die Straße Richtung Wald. Die Reifenspuren vom Konvoi, mit dem der Governor das Gefängnis stürmen wollte, sind noch immer zu sehen – selbst die Kettenabdrücke des Abrams-Panzers. Speed wendet den Blick absichtlich von der Fahrbahn ab, ehe er zu Matthew am Waldrand aufschließt.
»Hier, wirf mal einen Blick über die Felder«, meint Matthew und deutet durch eine Lücke in den dichten Baumwipfeln und dem wilden Gestrüpp, ehe er Speed den Feldstecher reicht. »Sag mir, was du dort unten siehst.«
Speed geht bis zum Rand des Plateaus und wirft einen Blick auf das Gefängnis in der Ferne.
Ein Nebel umhüllt das circa zweihundert Morgen große Stück Land. Aus einigen der eingestürzten Gebäude steigt noch immer Rauch auf – was sich aber voraussichtlich auch während der kommenden Wochen nicht ändern wird. Der Komplex gleicht den Ruinen eines Maya-Tempels. Der grässliche Gestank wird immer stärker, und Speeds Magen droht sich zu verknoten.
Er kann den umgestürzten Maschendrahtzaun, der sich wie ein kaputtes Band um die Gebäude gelegt hat, mit bloßem Auge ausmachen. Dahinter stehen die ausgebrannten Wachtürme, flankiert von schwarzen Kratern, die Handgranaten in den Beton geschlagen haben. Verlassene Autos befinden sich auf den Parkplätzen, umgeben von unzähligen Glasscherben. Beißer straucheln wie zerlumpte Phantome in einer Geisterstadt ohne jegliches Ziel umher. Speed hebt das Fernglas an die Augen. »Nach was soll ich denn Ausschau halten?«, fragt er, während er das Gefängnis absucht.
»Siehst du den Wald im Süden?«
Speed dreht sich nach links und sieht eine unklare grüne Grenze – das ist der Pinienwaldrand an der südlichen Grenze des Gefängnisses. Er ringt nach Luft. Der unglaubliche Gestank von mit Maden befallenem Fleisch und menschlichen Exkrementen lässt ihm die Galle hochkommen. Die Spucke in seinem Mund schmeckt auf einmal widerlich. »Heilige Scheiße«, stammelt er, als die unzähligen Beißer in sein Blickfeld geraten. »Was zum Teufel?«
»Genau«, stöhnt Matthew. »Der Aufruhr der Schlacht muss sie aus der gesamten Umgebung angelockt haben – mehr, als wir je zuvor gesehen haben. Und das hier ist erst der Anfang. Wer weiß schon, wie viele es noch sind.«
»Ich kann mich noch gut an die Meute erinnern«, erwidert Speed und fährt sich mit der Zunge über die Lippen. »Aber so etwas habe ich noch nie gesehen.«
Erst jetzt begreift Speed, welche Konsequenzen das Gesehene für sie haben könnte. Im gleichen Augenblick wird er vom ranzigen Gestank übermannt, hält sich den Bauch und fällt auf die Knie. Bei ihm fällt der Groschen in genau dem Moment, als der heiße, brennende Gallensaft seine Speiseröhre hochschnellt. Plötzlich wird ihm klar, was das alles bedeutet. Er ist noch immer ein wenig high von all dem Gras, und er kotzt in hohem Bogen über den steinigen Boden den Abhang hinunter. Er hat den ganzen Tag kaum etwas zu sich genommen, und es kommt wenig mehr als gelbe, scharfe Gallenflüssigkeit aus ihm heraus, das aber mit ungeheurer Geschwindigkeit.
Matthew beobachtet ihn aus sicherer Entfernung und starrt seinen kotzenden Kumpel mit mildem Interesse an. Nach einigen Minuten ist es offensichtlich, dass Speed seinen Magen bis auf den letzten Tropfen geleert hat. In der rechten Hand hält er noch immer den Feldstecher und setzt sich jetzt keuchend auf den Boden. Mit dem Ärmel wischt er sich den kalten Schweiß von der Stirn. Matthew wartet noch eine Weile, bis der jüngere Mann sich wieder etwas erholt hat. Endlich stöhnt er auf und erkundigt sich: »Bist du jetzt fertig?«
Speed nickt und holt einige Male tief Luft, sagt aber kein Wort.
»Gut.« Matthew beugt sich zu ihm hinab und reißt ihm das Fernglas aus der Hand. »Denn wir müssen so schnell wie möglich zurück und etwas dagegen unternehmen.«
Drei
Lilly Caul überquert den Marktplatz in ihrer geflickten Jeans und einem schäbigen Sweatshirt mit einer Rolle Plänen unter dem Arm, als sie das Zuschlagen der Türen des Dodge Rams hört. Die Sonne hat ihren Zenit bereits überschritten und macht sich auf den langen Weg hinab Richtung Wipfel der Virginia-Eichen hinter den stillgelegten Gleisen. Die Schatten werden schon länger, und das Licht wird sanfter, verwandelt sich in goldene Strahlen, die auf Mückenschwärme treffen. Das Hämmern und Sägen der Arbeiten am Verteidigungswall hat endlich aufgehört, und die Gerüche aus den Campingkochern – Töpfe voller Wurzelgemüse, Grünzeug und Fond – liegen über der sicheren Zone Woodburys in der Luft und vermischen sich mit dem grasigen Duft, der so typisch für späte Frühlingsabende in dieser Gegend ist.
Lilly geht schnellen Schrittes direkt auf David und Barbara Sterns Wohnung am Ende der Hauptstraße zu, als sie das nervöse Stapfen von Füßen hinter dem gewaltigen Sattelschlepper vernimmt, der den Zugang zur Außenwelt versperrt. Durch die Fenster der Fahrerkabine sieht sie Bobs Pick-up-Truck, gefolgt von zwei Gestalten, die gerade um den Sattelschlepper eilen, um die Kette dahinter zu öffnen. Lilly weiß, wer da kommt, und ihr ist klar, dass die Pläne erst einmal auf Eis gelegt werden müssen.
Den gesamten Nachmittag hat sie damit verbracht, ihre Ideen für den Arena-Garten zu Papier zu bringen – ihr klägliches Wissen von Landschaftsgärtnerei kompensiert durch schieren Enthusiasmus und Energie –, und jetzt wollte Lilly die Pläne unbedingt den Sterns vorlegen und Feedback erhalten. Plötzlich aber interessiert sie der Ausgang von Speeds und Matthews Suche nach Sprit mehr, denn die Generatoren und mit Propan gespeisten Motoren der Stadt verbrennen die letzten Tropfen ihrer Vorräte. Die Tanks müssen bald wieder aufgefüllt werden, ehe die schnell verderblichen Lebensmittel verschimmeln, die Elektrowerkzeuge aufhören zu funktionieren, die Kerzen ausgehen und die Straßen während der Nacht in Finsternis liegen.
Sie überquert die Straße, als die beiden jungen Männer sich durch das Tor zwängen. Lilly stellt enttäuscht fest, dass keiner von beiden einen Kanister trägt. »Sieht ganz so aus, als ob ihr leer ausgegangen seid«, ruft sie und geht direkt auf sie zu.
Speed wirft einen Blick auf den Marktplatz, um sicherzugehen, dass sich auch niemand in Hörweite befindet. »Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber wir haben ein weitaus größeres Problem als zu wenig Sprit.«
»Was soll das denn heißen?«
»Wir haben gerade …«
»Speed!« Matthew stellt sich zwischen Lilly und Speed auf und legt eine Hand auf die Schulter des jüngeren Mannes. »Nicht hier.«
Die düsteren Korridore im Gerichtsgebäude riechen nach Schimmel und Mäusekot, während dämmerige Lichtkegel Kakerlaken zurück in ihre Löcher in den Wänden schicken. Am Ende des Flurs liegt der Gemeinschaftsaal – ein verdreckter, rechteckig angelegter Raum mit Parkettboden, zugenagelten Fenstern und Klappstühlen.
Als sie eintreten, stellt Lilly die Laterne auf einen langen Tisch, legt ihre Papiere daneben und sagt: »Dann schießt mal los.«
In dem schwachen, flackernden Licht erscheint Matthews jungenhaftes Gesicht beinahe eulenhaft. Missmutig verschränkt er die Arme vor der breiten Brust, und sein behaartes Gesicht und der Blick in seinen Augen lassen ihn um einiges älter aussehen, als er tatsächlich ist. »Es formiert sich eine neue Horde. Wir haben sie in der Nähe des Gefängnisses gesehen.« Er schluckt. »Die ist groß – die größte bisher –, zumindest die größte, die mir je unter die Augen gekommen ist.«
»Okay. So, so.« Sie starrt ihn an. »Und was soll ich dagegen unternehmen?«
»Du scheinst nicht zu verstehen«, meldet Speed sich zu Wort und blickt ihr in die Augen. »Sie kommen direkt auf uns zu.«
»Was willst du damit sagen? Das Gefängnis ist doch – wie viel? – mindestens dreißig Kilometer von Woodbury entfernt!«
»Fünfunddreißig Kilometer«, verbessert Matthew sie. »Er hat recht, Lilly. Die bewegen sich nach Nordwesten, direkt auf uns zu.«
Sie zuckt mit den Achseln. »Okay, so schnell, wie die sich bewegen, und wenn man noch Wälder und sonstige Hindernisse auf dem Weg einrechnet, brauchen sie Tage, ehe sie hier auftauchen.«
Die beiden Männer tauschen einen Blick aus, und Matthew holt tief Luft. »Zwei Tage vielleicht.«
Lilly schaut ihn herausfordernd an. »Aber nur, wenn sie schnurstracks auf uns zukommen und nicht die Richtung ändern.«
Er nickt zustimmend. »Natürlich, aber was willst du damit sagen?«
»Beißer gehen nicht in einer geraden Linie. Die haben doch keine Ahnung, sondern wandern ziellos umher.«
»Normalerweise würde ich dir zustimmen, aber eine Meute dieser Größe, das ist wie …«
Er hält inne. Er wirft Speed einen Blick zu, der ihn hilflos erwidert, und sucht nach den richtigen Worten. Lilly beobachtet Matthew eine Weile und meint dann: »Wie eine Naturgewalt?«
»Nein … Das trifft es nicht.«
»Ein Massenansturm?«
»Auch nicht.«
»Eine Überflutung? Ein Buschfeuer? Was denn nun?«
»Unveränderlich«, kommt es endlich aus Matthew heraus. »Das ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt.«
»Unveränderlich? Was soll das denn heißen?«
Matthew schaut Speed erneut an, ehe er sich wieder an Lilly richtet. »Das kann ich gar nicht so genau sagen, aber die Horde ist so riesig – so verdammt gewaltig –, dass sie immer mehr an Schwung gewinnt. Wenn du es gesehen hättest, wüsstest du, was ich meine. Die Richtung ist unveränderlich, wie bei einem Fluss. Bis irgendetwas oder irgendjemand sie ändert.«
Lilly starrt ihn an und denkt einen Augenblick nach. Sie kaut auf einem Fingernagel und grübelt weiter. Ihr Blick schweift hinüber zu den verbarrikadierten Fenstern. Sie bringt sich sämtliche Horden in Erinnerung, mit denen sie es zu tun gehabt hat – da gab es diese Woge von Beißern, die bei der letzten Schlacht des Governors das Gefängnis stürmte. Sie versucht, sich noch mehr von ihnen vorzustellen, ein gigantischer Mob, bestehend aus vielen kleineren Horden, bis sie Kopfschmerzen kriegt. Sie ballt eine Faust und vergräbt die Fingernägel in ihren Handflächen, bis der Schmerz ihre Gedanken festigt. »Okay. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir …«
Bereits eine Stunde später legt sich die Abenddämmerung über Woodbury, und Lilly trommelt ihren gerade neu ernannten Ältestenrat zusammen – die meisten von ihnen sind tatsächlich älter. Sie versammeln sich in dem Gemeinschaftssaal. Lilly hat auch Calvin Dupree in der Hoffnung eingeladen, dass die Nachricht einer gigantischen Meute von Beißern ihn zum Bleiben bewegt – schließlich ist es nicht gerade weise, sich angesichts einer solchen Übermacht mit Sack und Pack und drei Kindern auf die Straße zu wagen. Außerdem braucht Lilly so viele kampftaugliche Leute wie möglich, um dem drohenden Ansturm standzuhalten.
Um halb acht sitzen sämtliche Ältere um den heruntergekommenen Konferenztisch, und Lilly holt aus zum Paukenschlag, versucht aber, ihn so sanft wie möglich an den Mann zu bringen.
Die meiste Zeit über sitzen ihre Zuhörer still und stumm auf ihren Klappstühlen und sind damit beschäftigt, die schlechten Nachrichten zu verarbeiten. Alle paar Sätze bittet Lilly Matthew oder Speed, den Sachverhalt genauer zu beschreiben. Die anderen saugen das Gehörte in sich auf, die Gesichter ernst. Finster. Niedergeschlagen. Das unausgesprochene Gefühl, das im Gemeinschaftssaal vorherrscht, lautet: Warum wir? Warum jetzt? Nach all den dunklen Tagen unter der Herrschaft des Governors, nach all dem Tumult und der Gewalt, dem Tod und den Verlusten müssen sie jetzt auch noch damit fertigwerden?
Endlich erhebt David Stern das Wort.
»Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist das eine große Horde.« Er lehnt sich auf seinem Klappstuhl zurück und macht mit seinen sechzig Jahren, den kurzen Haaren, seinem eisengrauen Ziegenbart und der seidenen Roadie-Jacke den Eindruck eines knallharten Profis, der kurz vor der Rente steht – ein Road Manager für eine Band, die auf ihre letzte Tournee geht. Unter der harten Oberfläche aber ist er ein Softie. »Klar, es wird hart, sie zu stoppen … So viel verstehe ich auch … Was ich mich aber frage, ist …«
»Vielen Dank, Meister der Untertreibung«, unterbricht ihn eine Frau mittleren Alters in einem mit Blumenmuster bedruckten Zeltkleid neben ihm. Ihre wilden grauen Locken und ihre weiche, runde, üppige Figur verschaffen ihr die Aura einer Erdmutter. Auf den ersten Blick scheint Barbara Stern verschroben, aber genau wie bei ihrem Mann liegt unter dem groben Äußeren ein weicher Kern. Die beiden bilden ein effizientes, wenn auch recht schrulliges Team.
»Oh, entschuldigen Sie bitte«, sagt David mit gespielter Höflichkeit. »Ich frage mich, ob es möglich ist, meine Gedanken zu formulieren, ohne ständig unterbrochen zu werden?«
»Wer hält dich denn davon ab?«
»Lilly, ich verstehe, was ihr über die Horde sagt, aber woher wollt ihr wissen, dass sie sich nicht einfach wieder auflöst?«
Lilly stößt einen Seufzer aus. »Natürlich können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen, wie genau sie sich verhalten wird. Ich hoffe ja auch, dass sie sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Aber für den Augenblick sollten wir davon ausgehen, dass sie uns in ein oder zwei Tagen überrollt.«
David kratzt sich am Ziegenbart. »Vielleicht ist es keine schlechte Idee, Späher auszusenden, um sie nicht aus den Augen zu verlieren.«
»Darauf sind wir auch schon gekommen«, verkündet Matthew Hennesey vom Podium. »Speed und ich machen uns gleich morgen früh auf die Socken.« Er nickt David kurz zu. Die ganze Zeit über hat er erstarrt wie eine Säule aus Salz hinter Lilly gestanden, aber auf einmal lebt er auf, und seine breiten Arbeiterschultern tanzen auf und ab, während er die Stirnwand des Saals mit ihren kaputten und anachronistischen Porträts des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Governor von Georgia entlangläuft. »Wir werden herausfinden, wie schnell sie sich nähert, ob sie die Richtung ändert, et cetera, et cetera. Außerdem nehmen wir die Handsprechfunkgeräte mit, um euch Bericht erstatten zu können.«
Lillys Blick fällt auf Hap Abernathy, den fünfundsiebzigjährigen Busfahrer aus Atlanta, der auf der anderen Seite des Gemeinschaftssaals neben einem verbarrikadierten Fenster auf seinem Gehstock gelehnt steht und aussieht, als ob er jeden Augenblick einschlafen und zu schnarchen anfangen würde. Lilly will gerade etwas sagen, als er die Stimme erhebt.
»Wie sieht es eigentlich mit unseren Waffen aus, Lilly?« Ben Buchholz sitzt neben Lilly und hat seine knochigen Hände zusammengefaltet, als ob er betet. Er ist ein gebrochener Mann von gut fünfzig Jahren, hat dunkle Säcke unter den Augen und trägt ein ausgefranstes Golfhemd. Er hat sich nie von dem Verlust seiner gesamten Familie letztes Jahr erholt, sodass seine Augen selbst jetzt noch wässrig und feucht sind. »Wenn ich mich nicht völlig irre, sind ein Haufen Waffen bei der Schlacht ums Gefängnis draufgegangen. Wie also ist es jetzt um uns bestellt?«
Lilly starrt auf den zerkratzten Tisch. »Wir haben jedes einzelne 50-Kaliber-Geschütz und den Großteil unserer Munition verloren. Da haben wir schlicht und ergreifend Scheiße gebaut.« Ein lautes, beinahe rhetorisches Stöhnen erfüllt den Gemeinschaftssaal, während Lilly ihr Bestes versucht, um die Stimmung wieder ins Positive zu lenken. »Das sind die schlechten Nachrichten, aber wir haben noch immer genügend Sprengstoff und Brandkörper, die das Feuer überlebt haben. Außerdem haben wir die ganzen Gerätschaften von dem National-Guard-Depot, die der Governor im Lager unter Verschluss gehalten hat.«
»Das dürfte nicht reichen, Lilly«, murmelt Ben und schüttelt verzweifelt den Kopf. »Dynamit taugt nur etwas, wenn man es gezielt einsetzt. Aus der Ferne kann man es vergessen. Was wir brauchen, sind Maschinen- und Schnellfeuergewehre.«
»Entschuldigung«, fährt Bob Stookey dazwischen, der auf Lillys anderer Seite sitzt und seine Caterpillar-Baseballmütze tief in seine gefurchte Stirn gezogen hat. »Aber können wir zumindest versuchen, das Ganze positiv anzugehen? Vielleicht sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, anstatt dem hinterherzuheulen, was wir nicht haben.«
»Jeder hat noch seine eigene Pistole, oder?«, will Barbara wissen.
»Na, das ist doch schon mal ein Anfang«, ermutigt Bob sie. »Außerdem haben wir alle sicherlich noch etwas Munition zuhause herumliegen, die wir zusammentragen können.«