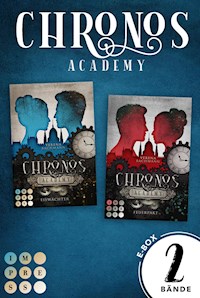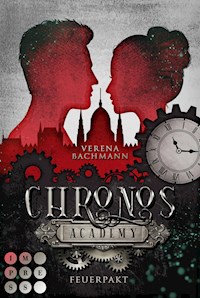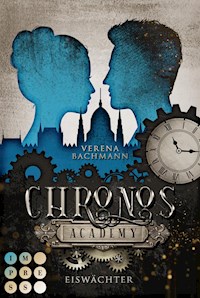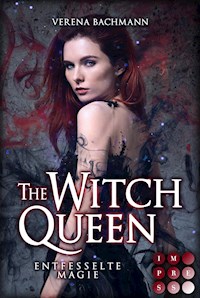
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Eine Königin, die keine sein möchte** Die Hexe Enju will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer Tante nur eins: endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, in das sie normalerweise niemals einen Fuß setzen würde. In Lapislazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders seltsam an. Dort muss etwas Grausames geschehen sein, für das Enju plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beasts zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen ... Wenn Magie die Seiten zum Knistern bringt … Ein Roman über eine Hexe, in der mehr steckt als auf den ersten Blick erkennbar, und einen Gestaltwandler, der mehr verbirgt, als es scheint. Eine Geschichte voller Magie, Herzklopfen und Frauenpower! //Dies ist der erste Band der Reihe. Alle Romane der knisternden Fantasy-Liebesgeschichte: -- Band 1: The Witch Queen. Entfesselte Magie -- Band 2: Rise of the Witch Queen. Beraubte Magie -- Band 3: Fate of the Witch Queen. Verschollene Magie//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Verena Bachmann
The Witch Queen. Entfesselte Magie
**Eine Königin, die keine sein möchte**Die Hexe Enju will nach einem langen Arbeitstag in der Bar ihrer Tante nur eins: endlich in ihr Bett. Doch durch eine Verschiebung der Magie landet sie in einem Viertel der Stadt, in das sie normalerweise niemals einen Fuß setzen würde. In Lapislazuli spielt die Magie schon seit geraumer Zeit verrückt. Doch vor dem Club der Totenbeschwörer fühlt sie sich besonders seltsam an. Dort muss etwas Grausames geschehen sein, für das Enju plötzlich verantwortlich gemacht wird. Um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie mit dem attraktiven Anführer der Beasts zusammenarbeiten, der eine ungeahnte Anziehung auf sie ausübt. Aber je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto näher kommt er dem Geheimnis um die wahre Königin der Hexen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Danksagung
© privat
Verena Bachmann, geb.1987 in Aschaffenburg, lebt mit Hund und Katzen in einem kleinen Dorf im schönen Spessart. Nach einem freiwilligen ökologischen Jahr absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau und arbeitet heute in einem Unternehmen für Modeaccessoires. Die Liebe zu Büchern weckte im Grundschulalter Enid Blyton und inzwischen stapeln sich die vielseitigsten Romane in ihren Regalen. Doch trotz bunter Auswahl reichte lesen allein irgendwann nicht mehr aus und so beschloss sie ihre eigenen Gedanken ebenfalls einmal zu Papier zu bringen.
Für meine Familie.
Egal wie viel einfacher die Namen auch auszusprechen wären, ich werde meine Charaktere trotzdem nicht Karl-Gustav, Elfriede oder Kunigunde nennen.
KAPITEL 1
ROT WIE BLUT
Wenn es nach mir ginge, würde ich meinen Samstagabend wie folgt verbringen:
Zuerst würde ich ein langes entspannendes Schaumbad nehmen und mich danach mit einer großen Tasse heißer Schokolade und einem Buch gemütlich auf mein Sofa lümmeln.
Leider war das Leben ja bekanntlich kein Wunschkonzert und meins verlief definitiv nicht nach meinen Wünschen.
Daher stand ich wie üblich am Samstagabend hinter der Theke der Bar meiner Tante und sah gelangweilt der Stripperin dabei zu, wie sie einer Horde Bürohengste in ihren Vierzigern den Schweiß auf die hochrote Stirn trieb.
Da der Bräutigam in spe wirkte, als würde er keine Sekunde länger ohne Herztabletten überstehen, beobachtete ich mit wachsendem Unbehagen, wie sich die Stripperin auf seinem Schoß niederließ und die Hüften rhythmisch vor und zurück bewegte. Wenigstens hatte ich die Nummer des Rettungsdienstes auf Kurzwahl.
Unter dem Gejohle seiner Freunde erhob sich die Tänzerin und ließ einen dümmlich grinsenden Leopold mit einer sichtbaren Beule im Schritt sitzen.
Ach, wie nett. Da konnte sich seine Zukünftige ja auf die Hochzeitsnacht freuen.
Mit einem tiefen Seufzen stützte ich mich auf der Theke ab und ließ den Kopf hängen. Ich wollte nach Hause.
Die laute Musik, das Gejohle und diese unangenehme Duftmischung von Alkohol und Männerschweiß gingen mir tierisch auf die Nerven. Schlimmer wurde es eigentlich nur noch dadurch, dass Leopold zu den Männern gehörte, die sich von recht netten, etwas schüchternen Versicherungsangestellten zu aufdringlichen Typen wandelten, die ihre Hände nicht bei sich behalten konnten, sobald sie Alkohol getrunken hatten. Als würde ihnen das einen Freifahrtschein fürs Grapschen verschaffen.
Tat es bei mir in jedem Fall nicht und dies hatte Leopold auch bereits mehrfach deutlich zu spüren bekommen. Allerdings schwand seine Gedächtnisleistung grundsätzlich mit der steigenden Anzahl von Drinks.
So auch am heutigen Abend. Denn den so wachsamen, fast schon ängstlichen Blick, welchen er sonst in meiner Gegenwart zur Schau trug, ließ er jetzt missen, als er auf die Theke und damit auf mich zuwankte.
»Hey, Mäuschen, gib mir noch einen Doppelten. Und schenk dir doch auch gleich einen ein. Du weißt doch, bei Feuer auf dem Dach musst du den Keller schön feucht halten.«
Sein Blick wanderte vielsagend von meinem Gesicht nach unten und verharrte dabei deutlich zu lange auf meinem Busen.
Zählte »etwas Blaues« auf der Hochzeit eigentlich auch, wenn es sich dabei um das Auge des zukünftigen Bräutigams handelte?
»Danke. Verzichte«, antwortete ich und zwang mich, einen neutralen Ton beizubehalten. Was mir alles andere als leichtfiel.
Zur Unterstützung meiner schwächlichen inneren Ruhe schloss ich die Augen und ließ meinen Nacken ein paarmal knacken, während ich unter der Theke eine weitere Flasche Korn hervorzog.
»Ach, sei doch nicht immer so eine Spaßbremse, Enju. So wird dir hier nie jemand den Hof machen.«
In Anbetracht meines Klientels ein Umstand, der mir keine schlaflosen Nächte bereiten würde. Außerdem … den Hof machen? Der noch netteste Anmachspruch, den ich hier je gehört hatte, war: »Siehst ’n bisschen zerknittert aus. Soll ich mal über dich drüber-bügeln?«
Schon an guten Tagen ging es mir tierisch auf die Nerven, von den Typen hier auf solch billige Art und Weise angemacht zu werden. Gefolgt von ach so gut gemeinten Ratschlägen, damit ich mein Leben nicht im Single-Dasein vergeudete. Denn jeder wusste ja, eine Frau ohne einen Mann an ihrer Seite hatte ihr Lebensziel eindeutig verfehlt. Schließlich gab es für das weibliche Geschlecht keinen besseren Lebenssinn, als Kinder zu werfen und den Ehemann treu zu umsorgen. Wie gesagt, es überspannte meinen Geduldsfaden schon an guten Tagen. Heute war keiner der guten Tage.
Daher spürte ich schon ein Zucken in meiner Wange, noch bevor Leopold die Hand ausstreckte.
»Und bei so einem leckeren Ding wie dir wäre es so eine Verschwendung, Mäuschen …«, hauchte Leopold mit einem verklärten Grinsen, während seine Hand sich auf die meine zuschlich. An seinem Ziel angekommen, begann er, meinen Unterarm zu streicheln, was mir, aufgrund des Ekels, der in mir aufstieg, eine Gänsehaut verursachte.
»Mit einer gebrochenen Hand ist es sehr umständlich, in seine Anzugjacke zu kommen. Lass deine Finger also besser bei dir«, drohte ich und zog in derselben Bewegung meine Hand zurück, wie ich ihm mit der anderen seinen Drink entgegenschob.
Leopold verzog aufgrund der ruppigen Geste trotzig den Mund. Dabei schob er sein Kinn so weit zurück, dass er nicht einfach nur ein Doppelkinn hatte, sondern eher schon ein dreifaches.
»Immer so abweisend. Weißt du, frigide kommt bei Männern auch nicht gut an, Mäuschen.«
Ruhig, schön ruhig bleiben. Nüchtern war er ja tatsächlich ein recht netter Kerl. Seine Verlobte hatte ich auch schon mal gesehen und musste sagen, die beiden hatten sich zwar spät gefunden, aber sie passten ausgesprochen gut zusammen. Sie verdienten eine schöne Hochzeit, bei der man Leopolds Gesicht auch noch als solches erkennen konnte.
Ich atmete erneut schwer aus und rief mir in Erinnerung, dass Gewalt keine Lösung war. Die kleine Stimme in meinem Kopf, die allerdings »aber eine gute Alternative« hinzufügte, ignorierte ich.
Doch offensichtlich ermutigt dadurch, dass ich ihm bis jetzt noch keine geknallt hatte, schnappte sich Leopold das Schnapsglas, verschüttet dabei die Hälfte auf der Theke und leerte den Rest in einem Zug, ehe er weitersprach.
»Wirklich, Füchsin. Wie lange sehe ich dich jetzt schon hier? Drei Jahre? Und weder mit deinen neunzehn noch jetzt mit … zweiundzwanzig …«
Hatte er jetzt ernsthaft rechnen müssen?
»… habe ich jemals einen Mann hier gesehen, der was mit dir anfangen wollte. Du gehörst doch nicht etwa zu diesen … die Frauen bevorzugen, oder?«
Er schaute mich an, als hätte er soeben erfahren, dass ich in meinem Keller kleine Hundewelpen quälte.
Es war doch immer wieder drollig, homophobe Aussagen von jemandem zu hören, der sich etwa zweimal die Woche während eines Lesbenpornos einen runterholte.
Woher ich das wusste? Leopold hatte es volltrunken schon hier auf der Toilette versucht.
Wenn ich so darüber nachdachte, war ich die letzten drei Jahre seinem betrunkenen Ich gegenüber wirklich sehr tolerant gewesen. Das würde jetzt ein Ende haben, und damit hatte ich auch das perfekte Hochzeitsgeschenk für ihn und seine Zukünftige.
Er konnte gar nicht so schnell reagieren, wie ich seinen Unterarm packte und meine Fingernägel in das weiche Fleisch bohrte. Leopold gab einen Schmerzenslaut von sich, den ich aber im Keim erstickte.
Seine vor Schreck geweiteten Augen offenbarten mir, dass er es deutlich spürte. Fühlte, wie ich in sein Innerstes vordrang, mich in seinen Verstand wühlte, um mich seines Geistes zu bemächtigen.
Ja, ganz recht, Leopold. Das war nicht normal. Das war keine Fähigkeit, über die ein normaler Mensch verfügte.
Überraschung! Ich war auch kein gewöhnlicher Mensch!
»Erstens: Ich kann es überhaupt nicht leiden, Füchsin oder Mäuschen oder sonst wie genannt zu werden. Zweitens: Ja, was gerade passiert, ist alles andere als normal. Ich bin nicht normal. Was ich eigentlich nicht öffentlich zeige. Zumindest nicht hier. Aber in deinem Fall mache ich eine Ausnahme. Weil ich so ein liebreizendes Schätzchen bin … Schätzchen mag ich übrigens auch nicht.«
Ich zwang Leopold, sich nach vorne zu beugen, damit ich noch leiser sprechen konnte und er mit seiner zentnerschweren Gestalt die Blicke der anderen abschirmte, denen eventuell die Stripperin zu langweilig wurde.
Seine Augen verrieten, dass er nichts lieber als einen ganzen Ozean zwischen uns bringen würde, aber ich verhinderte seinen Fluchtreflex. Genauso wie das unkontrollierte Wasserlassen. Ich wollte nachher schließlich keine Sauerei aufwischen müssen, nur weil er gerade Todesängste ausstand.
Meine Augen bohrten sich in seine kleinen schwarzen Knopfaugen und ich spürte das Zittern seines massigen Körpers. Wie Wackelpudding.
Ich wusste, was er sah. Was ihm, abgesehen davon, dass ich sein Gehirn gerade wie in einem Schraubstock hielt, solche Angst machte. Meine sonst karamellfarbenen Augen hatten sich eisblau verfärbt und ein purpurfarbener dünner Ring drehte sich unaufhörlich um meine schwarzen Pupillen.
Was ihn nun noch zusätzlich in Panik versetzte, war das Gefühl, das ich in ihm auslöste. Meine Hand um sein Gehirn, mit der Macht, es zu Brei zu zerquetschen und ihn als sabberndes kleines Häuflein Elend sein restliches Dasein fristen zu lassen.
Zu seinem Glück hatte ich das gar nicht vor, aber es schadete nicht, ihn wissen zu lassen, dass ich das jederzeit tun konnte.
»Du wirst mir jetzt sehr gut zuhören!«
Ein Nicken. Er war ganz aufmerksam trotz seines vorherigen Alkoholkonsums. Aber gut. Ich ließ ihm gerade auch nicht wirklich eine andere Wahl, beziehungsweise hatte ich ihn in Rekordgeschwindigkeit nüchtern werden lassen.
»Ich weiß, dass du eigentlich ein recht netter Kerl bist. Das ist nebenbei bemerkt der einzige Grund, warum ich dir in den letzten drei Jahren noch kein Hausverbot erteilt habe. Das, und weil ich wusste, dass du etwas einsam warst. Aber das bist du jetzt nicht mehr. Du hast jetzt eine nette Frau, die ihr restliches Leben mit dir verbringen möchte. Daraus kann wirklich etwas Gutes werden. Aber mein Lieber, du hast ein echtes Alkoholproblem.«
Ich wartete und verstärkte den Druck auf seinen Geist, um meine Worte tief in sein Bewusstsein sacken zu lassen.
»Daher mein Hochzeitsgeschenk an dich und deine Frau:
Ab dem heutigen Tag rührst du keinen Tropfen Alkohol mehr an. Du brauchst ihn nicht mehr. Du hast kein Verlangen mehr danach. Du willst deine Abende nie mehr hier in dieser Bar verbringen. Du bist von nun an fest entschlossen, deine Probleme auf anderem Wege zu lösen statt mit Alkohol.«
Er nickte langsam, aber ich brauchte keine Bestätigung.
Es waren keine gut gemeinten Ratschläge, die ich ihm gab. Ich manipulierte ihn. Zwang Leopold meinen Willen auf und würde ihn hier herausschicken mit meinen Gedanken, in dem Glauben, es wären seine eigenen.
»Und damit das dann auch in Zukunft so bleibt, besuchst du regelmäßig die Treffen der Anonymen Alkoholiker. Geh am besten gleich noch in dich und überleg dir, weitere Hilfe in Anspruch zu nehmen, um etwaige ungelöste Probleme aufzuarbeiten«, fügte ich nach kurzer Überlegung hinzu, denn diese Charakterwandlung, die er durch das Trinken herbeiführte, musste ja irgendeinen Ursprung haben.
»Und bevor ich es vergesse … Was mein Leben betrifft: Das geht dich einen Scheiß an! Sobald du heute Abend diese Bar verlässt, werde ich und alles, was mit mir zu tun hat, aus deinem Gedächtnis gelöscht sein. Du wirst dich nicht einmal mehr an meinen Namen erinnern. Geschweige denn an das, was hier gerade passiert ist.«
Wieder ein Nicken. Damit zog ich meine Hand zurück und löste die Verbindung.
Leopold blieb noch eine Weile mit verwaschen wirkendem Blick sitzen. Ich wusste, dass er die Nachwirkung meiner Gedankenkontrolle verarbeiten musste. Ein schwacher Geist wie Leopolds war leicht zu manipulieren. Aber die Nachwirkungen waren für die Betroffenen dann doppelt so schlimm, gerade weil sie so schwach waren.
Ich konnte förmlich sehen, wie sich sein Gehirn in neue Bahnen lenkte. Nachdem es sich gefestigt hatte, erhob sich Leopold und verschwand auf Nimmerwiedersehen aus der Bar.
Seine alkoholisierten Freunde bemerkten seinen Abgang nicht einmal.
Ich jedoch blickte noch eine Weile auf die Tür. Und ich fragte mich, warum ich diese gute Tat nicht schon vor drei Jahren geleistet hatte.
Gute Tat natürlich auf mich bezogen. Ich war schließlich nicht Jesus.
Um halb drei war auch endlich der letzte Gast verschwunden und ich konnte Feierabend machen. Während ich die letzten Barhocker auf den Tresen verfrachtete, schwang erneut die schwere Eingangstür auf.
»Wir haben geschlossen«, verkündete ich, ohne aufzusehen.
Ich musste mir unbedingt angewöhnen, gleich abzuschließen, sobald ich den letzten Säufer vor die Tür gesetzt hatte.
»Süße, ich bin jetzt seit gut zwölf Stunden ununterbrochen unterwegs. Wenn du mir meinen wohlverdienten Gute-Nacht-Drink verwehrst, muss ich leider den nächsten Schnapsladen ausrauben. Dann musst du mich zur Strafe jeden Tag im Gefängnis besuchen, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen.«
Ich schaute noch immer nicht zur Tür, konnte aber das Grinsen nicht unterdrücken, das sich auf mein Gesicht schlich.
»Du glaubst wirklich, ich könnte ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich mich zwischen deinem Seelenheil und meinem Bett entscheiden muss? Dann unterschätzt du maßlos, wie sehr mein Bett und ich uns lieben, James.«
»Dann appelliere ich an dein gutes Herz.«
Damit trat der gut zwei Meter große Hüne näher, zog einen der Hocker wieder vom Tresen und ließ seinen massigen Körper darauf nieder. Mit einer Bewegung, die mir verriet, dass James offensichtlich Schmerzen hatte, hob er den Arm und ließ einen dunkelgrauen Leinensack auf den Tresen knallen.
»Ich weiß nicht, was es ist, aber es blutet mir den Tresen voll«, kommentierte ich, während ich diesen umrundete.
»Tut mir leid. Ich mach es nachher sauber«, antwortete James und klang dabei so müde, dass ich daran zweifelte.
Während ich ihm das Bourbon-Whiskey-Gesöff vor die Nase stellte, das er so liebte, sanken seine breiten Schultern stetig nach unten. Er wirkte, als hielten ihn einzig und allein seine verschränkten Arme, die er auf dem Tresen abgestützt hatte, noch an Ort und Stelle.
»Harter Auftrag?«, fragte ich und hoffte inständig, dass James mir nicht noch vom Hocker fiel.
Ich war zwar alles andere als schwächlich, aber James würde ich keinen Millimeter bewegen können. Zumindest nicht auf normalem Wege.
Er war nicht nur sehr groß, sondern auch extrem breit gebaut. Die massige Gestalt, genauer definiert, die 2,16 Meter große und 179 Kilogramm schwere Gestalt – ich hatte ihn einmal danach gefragt –, bestand einzig und allein aus Muskeln.
»Ja. Sehr hart. Aber es war leider notwendig«, antwortete er und rieb sich über das müde Gesicht.
»Möchtest du darüber reden, mein Großer?«
Er antwortete mit einem Kopfschütteln.
»Rudel-Angelegenheiten.«
Ah, verstanden. Das hieß so viel wie: Kümmere dich um deinen eigenen Kram! Das Rudel war in solchen Punkten sehr streng und seine Mitglieder hielten sich an die Regeln. James als eines der höher gestuften Mitglieder sowieso.
Das Rudel, oder vielmehr die Beasts genannt, war eine Gruppe magischer Geschöpfe, die man vereinfacht ausgedrückt wohl als Gestaltwandler bezeichnen konnte. Das Beast, das in ihrer Seele mitschwang, konnte zur Gattung bekannter Säugetiere, wie beispielsweise Wölfen gehören, aber auch etwas ganz Mystisches sein. Wie eine Hydra, ein Minotaurus, Greifen oder auch ein Drache.
Gewandelt nahm ihre Gestalt dann eine Art Zwischenform zwischen Mensch und Tier an. Furchterregend, stark und einzig und allein geschaffen für den Kampf.
Welches Wesen in James’ Seele mitschwang, wusste ich nicht. Ich hatte ihn nie danach gefragt.
Auf den ersten Blick wirkte er einfach nur wie ein langsam in die Jahre gekommener Rocker mit seinen langen, erdbeerblonden Haaren, die er stets zum Pferdeschwanz gebunden hatte. Sein Dreitagebart, die buschigen Brauen über seinen hellblauen Augen und die dunklen Lederklamotten rundeten die ganze Sache ab.
»Darfst du mir dann zumindest sagen, was in dem Sack ist?«
»Willst du nicht wissen.«
Oha. James musste wirklich müde sein. Er wirkte zwar nicht so, aber normalerweise war er eine ziemliche Labertasche. Einsilbige Antworten waren eher ungewöhnlich.
»Offen gestanden doch. Denn das Blut beginnt gerade kleine Löcher ins Holz zu brennen.«
»Ach verdammt!«
Mit einer Bewegung, beinah zu schnell für das menschliche Auge, schoss seine Hand hervor und riss den Beutel nach oben.
Dass James trotz der offensichtlich schmerzenden Muskeln noch so schnell war, wirkte auf mich wirklich beängstigend.
Das Blut seines Beutels tropfte inzwischen auf den Boden und hinterließ auch dort kleine Löcher. Keine wirkliche Verbesserung.
Stirnrunzelnd erwiderte ich James’ entschuldigenden Blick.
»Eine Medusa … beziehungsweise der Kopf. Diese verdammten Schlangen leben auch noch weiter und produzieren Gift, nachdem man den Kopf abgeschlagen hat«, gab er dann letztendlich zu.
»Interessant. Wie Haare und Nägel, die nach dem Tod auch noch weiterwachsen?«
»So in etwa.«
James senkte den Arm und ließ den Sack neben seinem Barhocker zu Boden gleiten.
»Und du trägst den Kopf mit dir rum, weil …? Deiner Frau Blumen als Mitbringsel zu langweilig geworden sind?«
James’ blaue Augen verengten sich und ein Lächeln zuckte um seine Mundwinkel.
»Auftrag des Rudels«, erwiderte er im abschließenden Tonfall.
»Also keine weiteren Morde …«
James ließ sich nachschenken und genehmigte sich einen Schluck, ehe seine Augen mich aufmerksam und wieder deutlich wacher musterten.
»Du bist manchmal cleverer, als gut für dich ist, Enju.«
Ich lächelte ihn vergnügt an.
»Ich bin nicht einfach nur clever. Ich bin genial!«
Ich hatte also recht. Wobei es mir auch nicht schwerfiel, in diesem Fall zwei und zwei zusammenzuzählen. Von fünf Morden an jungen Männern hatten die Zeitungen in den letzten Wochen berichtet. Einer grauenhafter zugerichtet als der andere. Die Worte zerfetzt und Einzelteile fanden sich mehr als einmal in den jeweiligen Artikeln wieder, doch mehr zu berichten gab es nicht. Denn die Morde stellten die Polizei vor ein Rätsel. Es fehlten jegliche Hinweise auf einen Täter und die Polizei konnte auch keine brauchbaren DNA-Spuren sicherstellen. Einzig Sand und kleine Gesteinsbrocken waren zwischen den verstreuten Körperteilen und den Blutlachen zu finden gewesen.
Für Leute wie mich, die wussten, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gab, waren es jedoch sehr eindeutige Hinweise. Ich hatte bereits nach dem zweiten Mord eine Medusa vermutet. Eine sehr wütende ihrer Art. Denn es hatte ihr offensichtlich nicht ausgereicht, ihre Opfer zu versteinern. Sie hatte die steinernen Körper auch noch zerschlagen. Was letztendlich die verstreuten Körperteile erklärte. Denn mit dem Zerstören der Statue erlosch der Fluch und Stein verwandelte sich zurück in weiches Fleisch. Und hinterließ, wie berichtet, eine ziemliche Sauerei.
»Es wundert mich nur, dass ihr erst so spät eingegriffen habt«, fuhr ich fort und schenkte James noch einmal nach.
Normalerweise ließ das Rudel keine Morde dieser Art zu. Jede Gefahr, die zur Entdeckung der magischen Gesellschaft führen könnte, musste im Keim erstickt werden.
James leerte sein Glas erneut in einem Zug.
»Sie haben ihr Gewalt angetan. Drei dieser Männer …«, antwortete James und seine Augen blickten müde und glanzlos ins Leere.
Ich verstand. Auch wenn Morde im Allgemeinen nicht geduldet wurden, sah es im Falle von Selbstjustiz doch anders aus. Diese wurde, in gewissem Rahmen, durchaus toleriert und war gang und gäbe bei den Beasts.
»Drei. Aber es waren fünf Opfer«, stellte ich klar.
»Richtig. Sie hat Gefallen gefunden am Morden. Aus diesem Grund musste ich mich um sie kümmern«, antwortete James und sein Blick verdunkelte sich.
Kommentarlos schenkte ich ihm nach. James hatte mir noch nie genau erzählt, was seine Aufgabe im Rudel war, aber inzwischen konnte ich es mir zusammenreimen.
Ihm fiel es wohl zu, gewisse Dinge zu … bereinigen. Kein Job, um den ich ihn beneidete. Er musste sich sicherlich oft die Hände schmutzig machen.
»Wie alt war sie?«, fragte ich.
Obwohl ich es nicht für möglich gehalten hatte, verdüsterte sich James’ Miene noch mehr.
»Fünfzehn«, antwortete er widerwillig.
»Scheiße …«, war der einzige Kommentar, der mir dazu einfiel.
James nickte und rieb sich wieder über das Gesicht, ehe er einen weiteren Schluck nahm.
»Und was wird jetzt passieren?«
»Den Befehl zur Eliminierung hat der Alpha gegeben. Ihre Eltern haben jetzt also noch die Möglichkeit, ihn herauszufordern, um Rache zu nehmen.«
»Werden sie das denn tun?«
»Eher unwahrscheinlich. Sie hatten die Möglichkeit, sich selbst darum zu kümmern, ihre Tochter zur Vernunft zu bringen, bevor wir zum letzten Mittel greifen mussten. Aber sie haben es nicht geschafft. Sind nicht zu ihr durchgedrungen. Sie konnte am Ende nicht einmal mehr in ihre menschliche Form zurück. Und als sie, verwandelt und nur noch darauf aus zu töten, auf ihre jüngeren Geschwister losgehen wollte … Nun, ihr Vater wusste, wie ich handeln würde, als er mich anrief … wie die Entscheidung des Alpha ausfallen würde. Ich schätze, er wollte es nur nicht selbst tun müssen.«
Wow. Ich hatte schon davon gehört, dass das Beast unter gewissen Umständen die menschliche Seite komplett verdrängen konnte. Aber dass dies so schlimm sein würde, dass nur noch die Option blieb, denjenigen zu liquidieren? Und dass Eltern diese Entscheidung mitunter für ihre Kindern treffen mussten?
Mir lagen dazu noch einige weitere Fragen auf der Zunge, aber ich wusste, dass James sie mir nicht beantworten würde, weil sie sich ja letzten Endes doch auf das Rudel beziehen würden. Und in diesem Punkt war er verschlossener als jede Auster. Er hatte jetzt schon überraschend viel offenbart.
»Noch einen?«, fragte ich, als James sein Glas endgültig geleert hatte.
Er hielt seine massige Pranke über das Glas und schüttelte den Kopf.
»Nein danke«, antwortete er und erhob sich schwerfällig.
»Lass stecken …«, sagte ich, als James Anstalten machte, sein Portemonnaie aus seiner Hosentasche zu ziehen. »… geht heute aufs Haus.«
»Hast was gut bei mir Kleine.«
Damit beugte sich James nach vorne und griff sich seinen Sack.
Ein Blick über den Tresen offenbarte mir noch mehr Brandlöcher auf dem Boden. Na prima. James entgingen sie ebenfalls nicht.
»Schick mir die Rechnung …«, begann er bereitwillig, aber ich winkte ab.
»Die paar Löcher fallen hier auch nicht weiter auf.«
Meinen Worten folgend schweifte sein Blick durch die düstere Bar.
»Ich frage mich schon lange, warum du hier …«
James’ Blick ging zurück zu meinem Gesicht und er brach mitten im Satz ab. Wir wussten beide, dass ich darüber genauso wenig reden würde wie er über Rudel-Angelegenheiten.
»Und was wirst du jetzt noch tun?«, fragte ich, um das Thema zu wechseln.
»Zum Schloss und Bescheid geben, dass der Auftrag erledigt ist …« Der Sack schwang leicht hin und her, als James unbewusst sein Handgelenk drehte. »… und danach gehe ich nach Hause, gebe meiner Frau einen Kuss und setze mich noch ein paar Minuten zu meiner Tochter ans Bett. Lausche ihren gleichmäßigen Atemzügen und streichle ihr übers Haar. Mit dem Wissen, dass es ihr gut geht und dass sie glücklich ist.«
»Klingt nach einem guten Plan«, antwortete ich und lächelte leicht. Wie gesagt schätzte ich James’ Position im Rudel als eine Art Vollstrecker ein. Und allein aus der Tatsache, dass er bisher überlebt hatte, schloss ich, dass er mit Sicherheit auch gut in seinem Job war. Aber ich glaubte nicht, dass ihn jeder Auftrag kaltließ. Denn er war ebenfalls Ehemann und Vater und in diesen Punkten hatte ich ihn schon äußerst liebe- und aufopferungsvoll erlebt.
James nickte zum Abschied und war kurz darauf an der Tür. Doch nachdem er sie geöffnet hatte, hielt er inne.
»Eine Frage noch, Enju: Hast du … ist dir in letzter Zeit etwas … Ungewöhnliches aufgefallen?«
»Definiere ungewöhnlich«, antwortete ich.
Ungewöhnlich traf schließlich auf fast alles zu, wenn man sich in unseren Kreisen bewegte.
James wich meinem Blick aus und schien angestrengt nachzudenken. Es verstrichen mehrere Sekunden des Schweigens, ehe er sich mit einem Kopfschütteln abwandte.
»Nicht so wichtig. Vergiss es einfach. Pass auf dich auf, Enju.«
Damit hatte er seine massige Gestalt auch schon durch die Tür geschoben und war verschwunden.
Nach James’ Abgang hatte ich keine Zeit mehr verloren, sondern sofort abgeschlossen und mich direkt auf den Weg nach Hause gemacht.
Ich wollte nichts sehnlicher, als endlich in mein Bett zu fallen. Aber das plötzlich auftretende Pochen in meinen Schläfen und das schmerzhafte Zusammenziehen meines Magens sagten mir, dass es heute nicht so einfach werden würde, nach Hause zu kommen.
Diese Symptome waren bei mir Vorboten, die eine Zerrissenheit der Magie ankündigten, wie ich sie über die letzten Wochen hinweg immer mal wieder gespürt hatte.
Mein Zuhause lag, wie das von fast allen Mitgliedern der in irgendeiner Form magisch begabten Gesellschaft, in Lapislazuli. Der Stadt, die überall und doch nirgendwo existierte. Obwohl ich zu einer der Gruppen gehörte, denen Magie schon von Bluts wegen innelag, war es mir nach all den Jahren immer noch nicht möglich, zu erkennen, welche alte Magie sich in Lapislazuli bewegte und die Stadt am Leben hielt. Ich wusste nur, dass sie uralt und mächtig war, denn sie erlaubte es dieser riesengroßen Stadt, sich fast uneingeschränkt zwischen Orten auf der ganzen Welt zu bewegen.
Was übrigens wörtlich zu nehmen war. Lapislazuli hatte keinen festen Standort. Es war eine Stadt, die außerhalb der gewöhnlichen Welt existierte und in irgendeiner Form doch an alle anderen Orte dieser Welt angrenzte.
Es war daher kein Problem, morgens durch Paris zu schlendern, den Nachmittag in London zu verbringen, danach noch einen Abstecher nach München zu unternehmen und die Nacht in Las Vegas ausklingen zu lassen. Man musste nur das richtige Portal in Lapislazuli benutzen. Was die Stadt zu einem perfekten Wohnort für alle magischen Geschöpfe machte. Lapislazuli bildete wohl die größte der magischen Städte, weil sich die Stadt ihren Einwohnern anpasste. Wenn der Platz knapp wurde, vergrößerte sich die Stadt selbst und schuf neue Flächen. Meines Wissens gab es neben Lapislazuli noch zwei, drei andere Städte, die sich ebenfalls frei in der Welt bewegten.
Dennoch wohnte nicht jedes magische Wesen in Lapislazuli oder einer der anderen magischen Städte. Manche bevorzugten es auch, in der normalen Welt zu leben und zu arbeiten.
Was gut war, damit sich die verschiedenen magischen Völker auch aus dem Weg gehen konnten. Denn bei so vielen verschiedenen Wesen, blieben Reibereien und offene Feindschaft nun mal nicht aus. Es wäre wahrscheinlich sogar noch schlimmer, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, aus der Stadt und in die gewöhnliche Welt zu gelangen. Ganz zu schweigen von dem möglichen Aussterben der magischen Wesen, wenn sie sich nicht mit normalen Menschen fortpflanzen könnten. Oder dem Mangel an Arbeit und Geld. Oder, um es im kleineren Rahmen zu sagen, wie nervig es wäre, nichts im Internet bestellen zu können, weil man keine Lieferadresse hinterlegen konnte.
Nein, Lapislazuli war wirklich beinah perfekt. Daher wunderte es mich auch, dass die Magie der Stadt in letzter Zeit so seltsam rumorte. Als ob sie zwischenzeitlich verkrampfte und dann auseinanderriss.
Ich konnte mich nicht erinnern, dass so etwas in den letzten Jahren schon mal aufgetreten war. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast behaupten, die Stadt leide seit ein paar Wochen unter heftigen Magenschmerzen.
Diese schienen auch wieder einzusetzen, als ich hinter der Bar den Eintrittspunkt nach Lapislazuli zu durchqueren versuchte. Denn genau in dem Moment, als ich hindurchtrat, verschob sich der Durchgang. So stellte ich mit einem Stöhnen fest, dass er mich nicht wie sonst an die Kreuzung gegenüber meiner Wohnung gebracht hatte, sondern gut fünfzehn Kilometer davon entfernt. Ins Clubviertel der Nekromanten. Na wunderbar!
Das hieß jetzt also laufen. Denn erstens hatte ich kein Geld für ein Taxi dabei und zweitens, selbst wenn ich das hätte, würde ich mir in diesem Viertel gar keines leisten können. Denn wenn etwas einem Leitspruch unter den Totenbeschwörern gleichkam, dann dieser: Wenn du nach dem Preis fragen musst, kannst du es dir ohnehin nicht leisten.
Es gab kein anderes Volk in Lapislazuli, das so reich war. Die Beasts waren nah dran, konnten es aber dennoch nicht mit den Nekromanten aufnehmen. Denn von dem widerlichen Umstand einmal abgesehen, dass ihr Hauptmerk bei Magie auf der Totenbeschwörung lag, hatten sie ein unglaublich gutes Händchen, was lukrative Immobilien betraf. Den Nekromanten gehörten die exklusivsten und angesagtesten Klubs in der Stadt, das Casino, die Luxushotels und das komplette Rotlichtmilieu. Und das waren nur ihre bekannten Investitionen. Sie hatten mit Sicherheit in noch viel mehr Bereichen ihre Finger im Spiel.
Ich vergrub die Hände tiefer in den Taschen meiner Lederjacke und zog sie enger um mich. Es war inzwischen halb vier am Morgen und merklich abgekühlt, sodass ich mir wünschte, mehr am Leib zu tragen als eine hüfthohe Jeans, die in kniehohen schwarzen Schnürstiefeln endete, und ein einfaches Top unter der Jacke.
Ich beschleunigte meine Schritte und bewunderte unwillkürlich, wie gut es die Nekromanten doch beherrschten, ihr Viertel sauber zu halten. Wortwörtlich sauber. Auf dem Gehsteig fanden sich weder festgetretene Kaugummis noch Zigarettenkippen. Kein bisschen Abfall weit und breit.
Ganz anders als das heruntergekommene Viertel in der anderen Welt, das ich jeden Abend aufsuchte, um dort zu arbeiten. Hier war alles so makellos, dass das dünne rote Rinnsal, welches meinen Weg kreuzte, im schummrigen Licht der Straßenlaterne aufleuchtete wie eine Neonreklame.
Rot wie Blut, schoss es mir durch den Kopf, während ich den dünnen roten Pfad betrachtete, der sich über den Gehsteig zog und mit stetigen leisen Tröpfchen auf der Straße endete. Ich blickte in die entgegengesetzte Richtung, auf der Suche nach dem Ursprung des Rinnsals.
Es war nicht sonderlich schwer, die Quelle auszumachen. Von meiner Position aus führte eine gepflasterte Auffahrt zu einer einzelnen breiten Treppenstufe, die mit rotem Samt ausgelegt zu einer gläsernen Flügeltür führte. Die komplette Einfahrt war mit der blutroten Flüssigkeit durchzogen wie ein Geflecht aus Adern.
Da ich stark bezweifelte, dass der rote Teppich gerade seine Farbe einbüßte, steuerte ich die Flügeltür an, um herauszufinden, was den Teppich so durchtränkt hatte.
Hier stimmte etwas nicht.
Es war fast vier Uhr morgens, die Clubs hier schlossen spätestens um drei, ausnahmslos. Dennoch waren alle Fenster dieses Clubs, wenn auch nur diffus, erleuchtet.
Jedes, mit Ausnahme der Lichtquelle hinter der Eingangstür, war von einem tiefen, dunklen Bordeauxrot erhellt.
Die gleiche Farbe, die mir jeden Tag im Spiegel entgegenstrahlte, da meine Haare genau denselben Farbton hatten.
Aber diese Gemeinsamkeit war hier ganz sicher kein gutes Omen. Ich bezweifelte sogar stark, dass die Lampen in diesem Club immer in diesem Farbton leuchteten. Es wirkte viel zu düster für einen dieser Nobelschuppen der Nekromanten.
Meine Füße trafen auf den Samtteppich und verursachten dort ein lautes Schmatzen. Der Teppich war nicht nur feucht, er war klitschnass.
Obwohl jeder Schritt auf dem Teppich ein ekliges Geräusch nach sich zog, bewegte ich mich langsam vorwärts. Hier stimmte etwas nicht und ich musste herausfinden, was es war. Je näher ich der Tür kam, desto stärker spürte ich eine fremde Magie aus dem Gebäude strömen, die ich nicht zuordnen konnte. Ich fühlte nur, dass sie ganz und gar nicht hierher gehörte.
Als ich meine Finger vorsichtig nach der Tür ausstreckte und sie sacht gegen das kühle Glas drückte, überraschte es mich nicht, dass sie ohne Probleme nach innen aufschwang. Trotzdem beunruhigte mich die Tatsache, keinen Türsteher vorzufinden. Oder sonst einen Menschen. Im ganzen Eingangsbereich war kein Lebewesen weit und breit, obwohl er wirklich genug Platz dafür bot, da er die Größe einer Hotellobby hatte.
Ich trat ein paar Schritte weiter hinein und betrachtete mit wachsendem Argwohn den teuer aussehenden grau-weiß gekachelten Marmorboden. Er sah schick aus und ausgesprochen sauber. Wieso war es hier drin so sauber, wenn direkt vor der Tür das verdammte Gebäude ausblutete?
Ich machte einen weiteren Schritt in den Raum, in dem es nicht viel zu sehen gab. In der Mitte stand ein großes, kreisrundes Ledersofa, an den Wänden konnte ich vereinzelte Gemälde ausmachen, die bestimmt von sehr berühmten, toten Typen stammten. Von der Decke hingen drei Kristalllüster, bei denen wahrscheinlich schon eine einzelne Glühbirne ein Vermögen kostete.
Dafür, dass es sich hier um einen der Partyclubs der Nekromanten handelte, wirkte es mehr wie eines ihrer Luxusbordelle. Oder Luxushotels. Wahrscheinlich hatten sie für alles denselben Innenarchitekten.
Aber das konnte mir ja egal sein. Viel interessanter war der Bereich am Ende des Raums, wo sich die Garderobe befand, die voller Jacken und Mäntel war – an jedem Haken hing ein Kleidungsstück.
Vielleicht kam es vor, dass ein Gast einmal seine Jacke vergaß, aber mit Sicherheit doch nicht alle.
Der Club war also voll besucht, aber es herrschte Totenstille. Kein Stimmengewirr, keine Musik. Mein Blick glitt nach rechts und ich entdeckte, dass neben der Garderobe eine breite Treppe halbkreisförmig in die obere Etage führte.
Gefeiert wurde also ein Stockwerk höher, aber so gut konnte der obere Bereich doch nicht schallisoliert sein, oder?
Bevor ich die erste Stufe in Angriff nahm, drehte ich mich vorsichtshalber noch mal um und machte vor Schreck einen Schritt nach hinten, woraufhin ich gegen das Holz des Garderobentresens knallte.
Jetzt sah ich, warum das Gebäude quasi nur vor der geschlossenen Tür ausblutete. Wobei ich das mit dem Ausbluten langsam wortwörtlich nahm. Denn die rote Flüssigkeit, die vom Rand der Decke aus die Wand hinunterfloss und sich um den Türrahmen herum sammelte, sah wirklich sehr verdächtig nach Blut aus.
Die Tür lenkte das wachsende Rinnsal um ihren eigenen Rahmen herum zum Boden, wo es stetig fließend den Teppich tränkte.
Ich fragte mich, welche Menge an Blut und welcher Zeitraum nötig waren, um den Teppich so zu durchweichen, wie er jetzt war.
Ich ließ meinen Blick wieder zur Treppe schweifen.
Oben würde ich wohl meine Antwort bekommen. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich sie wirklich haben wollte.
Die Treppe endete in einem kreisrunden Gang, aus dem fünf identisch aussehende Türen führten. Zumindest beinah identisch. Höhe, Breite und Verzierungen waren gleich, nur in den Farben unterschieden sie sich. Wahrscheinlich um die unterschiedlichen Bereiche voneinander abzutrennen.
Ich blieb unschlüssig auf der obersten Treppenstufe stehen. So gesehen schien es vollkommen egal zu sein, für welche Tür ich mich entschied. Unter jeder sickerte Blut hervor und überzog den Boden mit einer tiefroten Spur.
Wunderbar! Meine Stiefel konnte ich dann definitiv wegschmeißen. Die Flecken würde ich nie wieder rausbekommen.
Ich atmete einmal tief durch, hob eine Hand und deutete auf die einzelnen Türen zum Abzählen.
»Ene, mene, muh … und raus bist …«
Es war natürlich nur Zeitschinderei. Ich hatte schon genau im Blick, welche der Türen ich als erste öffnen würde. Die, deren Raum sich meiner Einschätzung nach über dem Eingangsbereich befand.
Unter jeder der Tür floss Blut hervor, dennoch war es unten nur an einer Wand heruntergeflossen. Dafür gab es ganz sicher einen Grund.
Meinen wachsenden Widerwillen ignorierend setzte ich mich in Bewegung und tauchte mit meinem Stiefel viel tiefer in die Blutlache ein, als ich erwartet hatte.
Anscheinend senkte sich der Boden hier oben ein paar Zentimeter ab, was zumindest erklärte, warum das Blut noch nicht die Treppe nach unten geflossen war.
Die Treppenstufe lag höher. Wenn diese jetzt allerdings nahtlos mit der Blutlache abschloss … Der Gedanke ließ mich schwer schlucken.
Das war viel Blut, wirklich verdammt viel Blut.
Ich stoppte noch einmal vor der Tür und ließ meine Hand unschlüssig davor in der Luft schweben. Hier war dieser unbekannte Hauch von Magie am stärksten.
Noch einmal einen tiefen Atemzug nehmend drückte ich meine Fingerspitzen gegen die Tür, die ohne großen Widerstand aufschwang. Man hatte die Tür also offensichtlich nur angelehnt, nicht verschlossen. Dennoch empfand ich es neben allem anderen hier schon als sehr merkwürdig, dass jede der Türen zumindest so weit geschlossen worden war, dass man nicht so schnell einen Blick in die Räume dahinter werfen konnte. Was allerdings, bei dem Anblick, der sich mir nun bot, wohl von Vorteil war.
Obwohl ich bereits mit etwas Schrecklichem gerechnet hatte, presste ich dennoch vor Entsetzen beide Hände auf meinen Mund und taumelte einige Schritte nach hinten.
Das Blut spritzte an meinen Beinen hinauf und ich spürte, wie es meine Jeans tränkte.
Ich gehörte wirklich nicht zu den Zartbesaiteten. Aber das Bild, das sich mir bot, war einfach grausam und unfassbar grotesk. Die gegenüberliegende Wand war gepflastert mit Menschen. Leichen, wenn man es genauer definieren wollte. Leichenteile, wenn man es noch genauer nahm.
Ich hatte mich gefragt, wie diese Unmengen an Blut zustande gekommen waren. Jetzt wusste ich es. Wenn man etwa hundert Menschen in ihre Einzelteile zerlegte, verursachte das eine ganze Menge Blut.
Es kostete mich erneut einiges an Überwindung, aber letztendlich schaffte ich es, die Hände zu senken, meinen rebellierenden Magen zur Ruhe zu zwingen und einen weiteren tiefen Atemzug nehmend die Tür zu durchschreiten.
Meine Augen scannten den Raum und ich bemühte mich um eine schnelle Bestandsaufnahme. Etwas Heftiges hatte hier drin gewütet, und das bezog ich nicht auf die zerteilten Leiber. Die Bar, das Mischpult, die Boxen … alles war zu Kleinholz verarbeitet worden.
Dass aber die Fenster noch intakt waren, stellte mich vor ein Rätsel. Allerdings begriff ich nun, warum sie von außen dunkelrot leuchteten. Sie waren komplett mit Blut überzogen, ebenso wie jede Lampe in dieser Räumlichkeit.
Ich machte ein paar vorsichtige Schritte weiter in den Raum und gab mir dabei große Mühe, nicht auf irgendwelche Leichenteile zu treten. Was sich als gar nicht so einfach erwies. Zwar hafteten Unmengen an Körperteilen an der Wand, aber nicht viel weniger lagen zerstreut auf dem Boden herum.
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Wand. Wie hatte man sie dort befestigt? Und vor allem warum?
Ich starrte die Wand lange an, kam aber zu keiner Erkenntnis. Was ich stattdessen bekam, war ein sehr heftiges Magengrummeln, das mich zwang, den Blick wieder abzuwenden, meine Augen zu schließen und ein paarmal tief durchzuatmen – in der Hoffnung, mir nicht jeden Moment meinen kompletten Mageninhalt auf die Füße zu kotzen.
Eine Hoffnung, die unerfüllt blieb, allein schon aus dem einfachen Grund, dass die Luft in diesem Raum alles andere als wohltuend war. Denn sobald ich die Augen geschlossen hatte, nahm ich neben dem Geruch des Blutes auch die anderen beißenden Gerüche deutlicher wahr. Eingeweide, Urin, Fäkalien … ich machte auf dem Absatz kehrt, erreichte den Türrahmen und erbrach mich.
Ich brauchte mehrere Minuten, um wieder zu Atem zu kommen und mich aufzurichten.
Dann stellte ich mich erneut »Carries Abschlussball« in meinem Rücken und hielt überrascht inne. Die Körperteile waren gar nicht willkürlich an der Wand angeordnet, sie ergaben ein Muster.
Ich machte wieder einen Schritt nach vorne, kniff etwas die Augen zusammen und betrachtete die Anordnung der Körperteile noch mal genauer. Ringe!
Ein größerer Ring in der Mitte, acht etwas kleinere darum herum angeordnet. Sie fielen nur nicht sofort ins Auge wegen der anderen Körperteile, die mandelförmig um jeden Ring herum angebracht waren.
Aber vielleicht sollten sie das auch gar nicht. Es war sicher als Gesamtbild zu betrachten.
Ich neigte meinen Kopf so weit zur Seite, dass mein Ohr beinah meine Schulter berührte, und verkniff es mir im nächsten Moment, meine Hand gegen die Stirn zu klatschen.
Augen! Die Kreise und das Drumherum stellten Augen dar. Wieso war mir das nicht sofort aufgefallen?
Ich trat noch tiefer in den Raum, doch obwohl ich die Augen jetzt ganz deutlich erkennen konnte, blieb die große Erkenntnis aus. Mir fiel keine Magie ein, bei der ein Symbol mit neun Augen zum Tragen kam. War das überhaupt ein Symbol irgendeiner Magie?
Vielleicht hatte auch irgendein Irrer sich zu oft die Serie Hannibal angesehen und hatte hier seine eigene Version davon Realität werden lassen.
Ich konnte zwar die seltsame Nachwirkung von Magie fühlen, aber ich befand mich ja auch in Lapislazuli und das hier war das Gebiet der Nekromanten. Die Magie konnte also vorher schon hier existiert haben und war einfach extrem zerrüttet worden.
Meine Grübelei wurde jäh unterbrochen, als ich ein Knarzen über mir vernahm.
Mein Puls beschleunigte sich, während ich den Kopf in den Nacken legte und zur Decke starrte. Wieder ein Knarzen, und noch eins. Das waren Schritte. Irgendjemand bewegte sich dort oben.
KAPITEL 2
DER RAT
Wieder wurde ein Schritt gemacht. Langsam, mit Bedacht.
Jemand durchquerte sehr vorsichtig den Raum über mir. Ich lauschte weiter den Schritten, bis sie sich veränderten. Eine andere Art des Auftretens. Nein, ein anderer Untergrund. Treppenstufen.
Eine der Türen auf meiner Etage führte offensichtlich nicht in einen anderen Clubraum, sondern zu einer Treppe, und diese zu einer weiteren Ebene.
Innerlich fluchte ich über meine Nachlässigkeit. Ich hatte nicht in Betracht gezogen, dass die Person, die dieses Massaker angerichtet hatte, eventuell noch hier sein könnte. Und einen Überlebenden dieses Schlachthofs schloss ich aus. Dazu waren die Schritte zu vorsichtig. Viel zu sehr darauf aus, nicht wahrgenommen zu werden.
Ich richtete meinen Blick auf die geöffnete Tür, zählte mit jedem weiteren Schritt die Treppenstufen, dann folgte das Knarzen der Tür. Wer auch immer das war, er würde jeden Moment in meinem Sichtfeld auftauchen.
Ich verwarf jeden Gedanken daran, mich irgendwo zu verstecken. Allein schon, weil mir das kurze Innehalten des Fremden verriet, dass er mich wahrgenommen hatte.
Ich bemerkte erst, dass ich den Atem angehalten hatte, als sich die große Gestalt in mein Blickfeld schob, und atmete leise wieder aus.
Meine Vermutung, auf einen Mann zu treffen, wurde bestätigt. Dennoch ließ mich sein Anblick schwer schlucken.
Aus Anspannung und Überraschung gleichermaßen. Überraschung, weil er attraktiv war. Richtig attraktiv, und das hatte ich wirklich nicht erwartet.
James’ Körpergröße und massige Gestalt hatte er nicht. Aber ich schätzte ihn trotzdem auf gute 1,90 Meter, und die Muskeln, die sich unter dem schwarzen T-Shirt spannten, verrieten regelmäßiges Training. Seine Haare waren an den Seiten kürzer, oben länger, und ihre Farbe wirkte, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie dunkelblond oder braun sein wollte. Die Augenfarbe dagegen ließ sich klar definieren: ein sattes Grün. Und das in einem Gesicht mit auffallend symmetrischen Gesichtszügen. Würde man da Vincis Raster des perfekten Gesichts darüberlegen, würde es mit Sicherheit eine hundertprozentige Übereinstimmung finden.
Ich hatte eher jemanden wie John Wayne Gacy im Clownskostüm erwartet. Daher brachte mich dieser Anblick wirklich kurz aus dem Konzept – denn einen so heißen Typen hätte ich erwartet auf einem GQ-Cover vorzufinden, statt in einem blutdurchtränkten Club inmitten eines Massakers.
Denn wie schon erwähnt, ließ mich auch die Anspannung schwer schlucken. Und die Anspannung war auf seine blutbesudelten Hände zurückzuführen. Er war bis zu den Ellenbogen dunkelrot verschmiert, und was das schwarze T-Shirt verbarg, war auf der blauen Jeans deutlich zu erkennen: Unmengen kleiner Blutspritzer.
Tja, wenn das mal nicht wieder typisch war. Da lief einem ein attraktiver, gut gebauter Kerl über den Weg und war entweder vergeben, schwul, vergeben und schwul oder ein psychopathischer Massenmörder. Irgendwas war halt immer.
»Wer bist du?«, meldete er sich erstmals zu Wort und die tiefe Stimme jagte mir einen Schauer durch den Körper. Allerdings von der angenehmen Sorte. Er mochte ein irrer Killer sein, aber die Stimme passte zum Gesamtpaket. Dunkel und attraktiv. Auch der intensive Blick, mit dem er mich musterte, verursachte ein Kribbeln in meinem Inneren.
Ich musste jedoch leider davon ausgehen, dass dieser Blick nicht andeutete, dass ihm gefiel, was er sah, sondern dass er gezielt nach einer Schwachstelle suchte, die er nutzen konnte, um mich ebenfalls in meine Einzelteile zu zerlegen.
Dieser Gedanke und ein Blick zurück auf seine Hände erinnerten mich wieder daran, dass man es mit dem Bad Boy auch übertreiben konnte. Und Hunderte von Menschen abzuschlachten war nun wirklich sehr, sehr bad. Er musste ja nicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Ladykiller sein.
»Rotkäppchen, das sich verlaufen hat?«, antwortete ich auf seine Frage, wer ich war, und erntete dafür einen skeptischen Blick.
Moment, die wurde doch am Ende von dem Wolf gefressen, oder? Mmh, ich hatte eindeutig schon bessere Vergleiche gezogen.
Er machte langsam ein paar Schritte nach vorne, wie ein Raubtier, das sich an seine Beute anschlich, und befand sich dann nur noch knapp zwei Meter von mir entfernt.
»Ich stelle die Frage noch mal: Wer bist du? Wie heißt du? Und seit wann bist du hier?«
»Das sind genau genommen drei Fragen«, stellte ich, hilfsbereit wie ich war, fest.
Sah er wohl anders, denn meine Bemerkung schien ihn nicht glücklich zu stimmen. Seine Miene wurde ärgerlicher und er machte einen weiteren bedrohlichen Schritt auf mich zu.
»Du wirst mich begleiten!«, kommandierte er plötzlich, was ihm nun ein Stirnrunzeln von mir einbrachte. Der glaubte doch nicht ernsthaft, dass ich mit ihm gehen würde?!
»Danke für diese bestimmt von Herzen kommende Einladung. Aber ich muss sie leider ausschlagen. Meine Mama hat mir nämlich beigebracht, dass ich nicht mit Fremden mitgehen darf. Außerdem hast du mir nicht mal Süßigkeiten angeboten.«
Für diese Worte erntete ich ein spöttisches Schnauben.
»Ich hatte nicht den Eindruck, eine Fünfjährige vor mir zu haben.«
»Und das enttäuscht dich?«
Seine Augen wurden gefährlich schmal.
Ernsthaft? Ein Massenmörder, dem es gegen den Stich ging, auch noch für einen Kindermörder gehalten zu werden?
»Nein. Ich bevorzuge die Richtung, was du zu bieten hast«, antwortete er und wies mit seinen Augen unmissverständlich auf meine weiblichen Reize.
Oha. Also gefiel ihm doch, was er sah. Warum stimmte mich das bloß in keinster Weise zuversichtlicher?
»Ach so, also war das eher als Date-Einladung aufzufassen?« Ich schnipste mit den Fingern, als wäre mir etwas Tolles durch die Lappen gegangen.
»Wie ärgerlich. Ich habe heute leider schon Jack the Ripper fest zugesagt. Der hat mir nämlich eine romantische Stadtführung durch London angeboten.«
»Nein. Ich bevorzuge es, wenn meine Dates wissen, wann es an der Zeit ist, die Klappe zu halten.«
»Ah, ich wusste es. Unsere Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt«, entgegnete ich mit gespielter Enttäuschung.
Er machte einen weiteren Schritt auf mich zu und versuchte dann nach mir zu greifen. Okay. Das war nun wirklich nah genug.
Ich wich ihm aus, hob die Hand und bewegte sie in einer kreisenden Bewegung von meinem Körper weg. Ich nutzte eine meiner liebsten Fähigkeiten, Telekinese.
Blut und vereinzelte Extremitäten schwappten in einer hohen Welle gegen die Wand und durch die Tür. Mein Gegenüber rutschte gut einen Meter nach hinten, blieb aber ansonsten aufrecht stehen. Das brachte mich ins Stocken. Er hätte in hohem Bogen nach hinten geschleudert werden müssen! Warum lag er also nicht außerhalb des Raums? Oder klebte an einer Wand? Oder rutschte zumindest unter Schmerzen an einer herunter, verdammt noch mal?
Sein Blick glitt sehr langsam an sich herunter. Meine Attacke hatte das Blut auch gegen ihn geschleudert und seine Kleidung noch mehr eingesaut. Er hob die Hand und wischte mit den Fingerknöcheln einen Tropfen Blut ab, der ihn an der Wange getroffen hatte. Eine sehr sinnfreie Aktion. Durch seine blutverschmierten Hände schmutzte er sein Gesicht damit nämlich nur noch mehr ein.
Seine Augen bohrten sich in meine und er registrierte sehr aufmerksam die eisblaue Verfärbung meiner Iriden.
»Eine Hexe!«, schnaubte er. »Ich hasse Hexen!«
Mit diesen Worten war er schneller bei mir, als ich blinzeln konnte. Seine Hand schloss sich um meine Kehle, dann hob er mich hoch, bis meine Füße den Kontakt zum Boden verloren und ich nur hilflos in der Luft zappelnd ein paar klägliche Versuche unternehmen konnte, an seinem Arm zu ziehen.
Meine Fingernägel bohrten sich in seinen Handrücken, aber er zuckte nicht einmal mit der Wimper. Die fehlende körperliche Reaktion kümmerte mich weniger als die Tatsache, dass ich es trotz direktem Körperkontakt nicht schaffte, in seinen Geist einzudringen. Ich prallte ab wie an einer Steinmauer.
Wer zum Teufel besaß eine so ausgeprägte Resistenz gegen Magie?
Er ließ mich ein Stück herunter und hob mein Gesicht so nah vor das seine, dass mich für einen kurzen Moment der irrationale Gedanke durchzuckte, ob er vorhatte mich zu küssen. Als ich jedoch erkannte, was seine Bewegung tatsächlich bedeutete, verhinderte nur meine eingeschränkte Luftzufuhr den Fluch, der mir auf den Lippen lag. In der nächsten Sekunde schleuderte er mich mit unmenschlicher Stärke von sich.
Nachdem ich durch den Raum geflogen war und mein Rücken schmerzhaft Bekanntschaft mit dem Fenster machte, kam ich zu einigen Erkenntnissen.
Punkt eins: Die Fenster waren aus einem einfachen Grund – im Gegensatz zum Rest des Raumes – nicht zerstört worden: weil jemand offensichtlich einen Bannkreis um das Gebäude gezogen hatte. Wenn ich Vermutungen anstellen musste, dann wohl um eine Flucht der Clubbesucher zu verhindern.