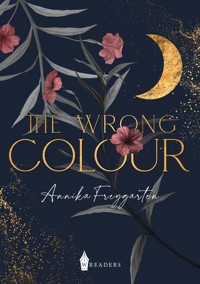
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihre Persönlichkeitstheorie hat Marcia zu einer anonymen Berühmtheit auf Instagram gemacht. Menschen aus ganz Deutschland fragen sie täglich um Rat. Eines Tages bemerkt sie, dass ihr Bekannte aus dem Alltag folgen, darunter jemand aus ihrer Uni – Gerrit Tahden. Zunächst denkt sich Marcia nichts dabei. Nach einer Weile stellt sie jedoch fest, dass Gerrit basierend auf ihrer Theorie Gedichte veröffentlicht, die beweisen sollen, dass alle Menschen dasselbe fühlen und ihre Idee Blödsinn ist. Das passt ihr gar nicht, da hinter der Instagramseite mehr steckt als ein bloßes Hirngespinst. Mit der Zeit fällt es Marcia immer schwerer, gegenüber Gerrit das Gesicht zu wahren und ihre anonyme Identität nicht preiszugeben. Das erste Mal in ihrem Leben lernt sie, was es heißt, wenn Gefühle verrücktspielen. An all die gelben Menschen da draußen: Was möchtet ihr wissen? ColourMind via Instagram Storys 03:11 Uhr Warum haben die dunkelgrauen Menschen in deinen Beiträgen das Symbol des Mondes? Für mich ist der Mond gelb. Gerrit_Tahden 03:21 Uhr
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Annika Freygarten wurde 1995 in einem kleinen Dorf in Niedersachsen geboren. Sie unterrichtet Deutsch an einer Grundschule. Wenn sie in ihrer Freizeit nicht gerade Bücher schreibt oder liest, testet sie zum hundertsten Mal, ob sie wirklich zum Persönlichkeitstyp INFJ gehört, nur um sicherzugehen. Außerdem interessiert sie sich für das Theater. Mit dem Schreiben hat sie schon in ihrer Kindheit angefangen und seitdem nicht damit aufgehört. Angefangen, ihre Geschichten zu teilen, hat sie auf einer Schreibplattform. Mittlerweile nutzt sie auch Instagram und TikTok, um auf ihre Schreibprojekte aufmerksam zu machen.
WREADERS E-BOOK
Band 234
Dieser Titel ist auch als Taschenbuch erschienen
Vollständige E-Book-Ausgabe
Copyright © 2024 by Wreaders Verlag, Sassenberg
Verlagsleitung: Lena Weinert
Druck: : epubli – Neopubli GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Emily Bähr
Lektorat: Anna Zauner, Alina Lindecke
Satz: Elci J. Sagittarius
Illustrationen: Jessica Rose
www.wreaders.de
Für alle Menschen dort draußen,
die ständig das Gefühl haben, irgendwo hineinpassen zu müssen und sich fragen: In welcher Farbe leuchte ich? Hoffentlich wird euch die Frage am Ende des Buchs beantwortet werden. Ihr strahlt, selbst wenn es die falsche Farbe ist.
Und für meinen Opa,
weil die Menschen immer annahmen, dass wir dieselbe Farbe tragen. Trotz aller Zweifel hoffe ich, dass es stimmt.
Tom Odell – True Colours
The Script – Science & Faith
Imagine Dragons – Dream
Emma Steinbakken – Not Gonna Cry
Tristan Prettyman – Who We Are
Gin Wigmore – Black Sheep
Coldplay – Twisted Logic
Camila Cabello – Never Be the Same
Halestorm – I Miss the Misery
Keane – A Bad Dream
flora cash – You’re Somebody Else
Jaymes Young – Moondust – Stripped
AViVA – GRRRLS
Halsey – Colors
Sofia Karlberg – Lonely Together
The Unlikely Candidates – Your Love Could Start a War
AJR – Come Hang Out
dodie – Sick of Losing Soulmates
Welshly Arms – save me from the monster in my head
Grace VanderWaal – Moonlight
Taylor Swift – I Can See You
Bei Verstand
Wie ein einzelner Baum
schwankend im Wind
verschlucken ihn Wälder
Hin und her, ohne Antrieb
wird ihm langsam kälter
Trägt er einen Namen –
verloren im Gehölz?
- Hellgrau
vor 13 Jahren
Ich kann nicht mehr. Meine Beine tun weh. Tröte baumelt mit jedem Schritt gegen meinen Schenkel. Er hat noch schlimmeren Hunger als ich. Das hat er mir im Auto anvertraut. Ich sollte es niemandem verraten, doch sein Appetit ist mittlerweile nicht zu übersehen. Seine große Zunge hängt ihm seitlich aus dem Mund. Ein Schlabbermaul, das fast genau so lang wie ein Rüssel ist, gibt es in Wirklichkeit nicht. Bei dem Elefanten im Zoo sah man keines. Witzig schaut er trotzdem aus.
Warum werden wir denn immer schneller? Mama zieht fest an meinen Armen. Aua! Die Steine unter meinen Füßen drücken in die Schuhsohlen. Ist Mama wütend? Ich glaube schon. Wütend oder traurig. Ihre Hand zittert so. Das gefällt mir gar nicht.
Als der Schotter endet, laufen wir auf großen Quadraten. Ich überlege kurz. Nein, es sind Rechtecke. Am besten frage ich Frau Hübner in der Schule. Die Seiten dürfen nicht berührt werden, sonst tritt man in die Lava. Balancierend tipple ich über die Felder. Dass ich nicht vernünftig gehe, lässt Mama an meinem Arm ziehen. Sie sollte mich mal in der Schule sehen. Da mache ich bei solch einem Quatsch auch nicht mit. Tim meint, mit meinen Quadratlatschen passe ich nicht auf das Feld. Er geht schon in die vierte Klasse. Ich wünschte, er würde mich jetzt sehen!
Ich greife fester in Trötes Arm. Zum Glück tue ich ihm nicht weh. Tröte hat keine echten Gefühle. Sonst würde er so schön leuchten wie Mama und Papa. Sie finden es nicht gut, wenn ich das sage. Manchmal wünsche ich mir, dass Tröte auch leuchten würde. Er versteht mich. Tröte ist mein Freund, aber er hat noch nie getrötet. Das macht jedoch nichts. Ich habe ihn trotzdem lieb.
Mama lässt mich los, weil da ein großes Haus ist. Es sieht nicht so schön aus wie unser Haus. Weit und breit keine Blumen mit Bienchen – und vor den Fenstern sind Stäbe. Nicht wie in einem richtigen Gefängnis, aber es kommt mir vor, als wäre auch dieser Ort böse. Hier leben bestimmt viele Menschen. Es gibt zwei Stockwerke – wie in der Schule. Dort sind mir auch zu viele Menschen, aber das verrate ich niemandem.
So sieht auch das Krankenhaus aus – glaube ich. War das Geländer dort nicht auch grün? Ich schaue nach oben, wo eine riesige Laterne nachts den Weg beleuchtet. Jetzt ist sie aus. Die Ziegelsteine an der Hauswand erkenne ich trotzdem. Entlang der Fenster zieht sich eine grüne Linie. Das Krankenhaus ist weiß gestrichen. Der letzte Besuch … Ich mag nicht daran denken. Uropa ist so lieb zu mir gewesen. Er hat immer Kekse mit Schoko und Rosinen gebacken. Stirbt noch jemand? Ist Mama deshalb so? Ich reiße mich los, um Tröte ganz fest an mich zu drücken. Ich will nicht weinen. Wenn ich traurig bin, ist Mama traurig.
Sie hockt sich zu mir hinunter. Die eine Hand legt sie auf meine Schulter. Mit der anderen streicht sie über meine Wange. Mist! Ich habe doch geweint. Sie atmet tief ein und aus. Sonst ist sie immer ehrlich – genau wie bei Uropas Tod. Bislang hat sie noch nichts gesagt. Komisch.
»Hör mir zu, Liebes. Ich möchte, dass du dem Doktor da drinnen gleich erzählst, was du auch Papa und mir erzählt hast.« Was meint Mama? Ich erzähle sehr viel. Zuhause jedenfalls. Frau Hübner sagt immer, ich solle mich melden, aber ich traue mich nicht. Meint Mama vielleicht, dass ich schon den Buchstaben R gelernt habe? Frau Hübner findet, ich könne mehr als die anderen Kinder und müsse das zeigen. »Das mit den Farben«, erklärt sie mir dann.
Achso! Die schönen Farben. Jeder Mensch leuchtet in seiner eigenen. Mamas Farbnebel ist dunkelblau. Er tanzt immer so schön im Wind – ein Stück Regenbogen zum Anfassen. Naja, fast. Leider läuft er vor mir weg. Manchmal ist der Nebel nah beieinander, meistens breitet er sich weit aus. Alle vergessen beim Menschenmalen die Farben. Mama sagt, sie sehe keine. Immer wenn ich davon anfange, zieht sie eine Schnute. Bin ich krank, weil ich Farben sehe? Muss ich sterben?
Ich drücke Mamas Unterbeine nah an mich. Sie soll bei mir bleiben. Unter die Erde will ich nicht. Mama hat gesagt, dass Uropa jetzt dort ist. Das finde ich komisch. Und traurig. Da gibt es sicher keinen Spielplatz. Warum muss er dorthin? Mir wäre es lieber, er würde bei mir bleiben oder in den Himmel zu Mias Opa fahren. »Ich will nicht sterben!«, schreie ich in Mamas Wärme hinein.
Sie streicht mir durchs Haar. Strähne für Strähne. Mein Herzschlag verlangsamt sich. »Alles wird gut. Du wirst nicht sterben. Der Doktor macht dich gesund.«
Dann steht sie auf und greift wieder nach meiner Hand. Wir müssen weiter. Zum Eingang mit dem blauen Schild. Das wäre bestimmt auch ein Quadrat, wenn es nicht so runde Ecken hätte. Ich wünschte, ich könnte alle Buchstaben. Auf dem Schild erkenne ich nur das I, das E, das … Mama zieht mich weiter. Ich kann nicht mehr zu Ende lesen.
Kaum sind wir drinnen, will ich wieder raus. Die Wände sind leer. Ich bin nicht gerne in der Schule, weil Mama und Papa da nicht sind. Frau Hübner beachtet immer nur die anderen Kinder. Die sind nämlich lauter. Unsere Klasse ist aber hübscher als hier. Da hängen Bilder von uns und vorne sitzt der Kasper. Den mag ich. Er kann immer nichts. Ich aber schon.
Hier ist alles leer. Hinter einer Scheibe steht eine Frau und guckt mich ganz groß an. Ich schaue woanders hin. »Zielke, ich habe einen Termin.« Warum sagen Erwachsene immer ihren Nachnamen? Das finde ich blöd. In der Schule bin ich auch immer die Letzte, weil Frau Hübner eine Liste mit Nachnamen hat. Zum Glück nennt sie mich aber bei meinem echten Namen. Ich glaube, die Frau am Schalter zeigt irgendwohin. Weil sie mir Angst macht, gucke ich nur Tröte an. Er sieht auch ganz ängstlich aus mit seinen großen Glubschaugen und den wackelnden Pupillen. Böse, alte Frau! Mama zieht mich weiter den Gang hinunter. Auch hier sind die Wände leer.
Eine Tür steht offen. Auch wenn es nicht erlaubt ist, schaue ich hinein. Ich bin einfach neugierig. Als Erstes sehe ich gelben Nebel. Da stehen ein kleines Holzbett, ein runder Couchtisch und ein farblich dazu passender Stuhl. Auf der Bettdecke sitzt ein Junge. Wir sehen uns an. Seine Mundwinkel hängen herab. Ist er krank? Oder vermisst er seine Eltern? Warum ist er ganz allein? Wird Mama mich auch hierlassen?
Wir müssen weiter. Aber der Junge war traurig. Das habe ich ganz genau gesehen. Ich drücke Mamas Hand fester. Sie soll mich nicht verlassen. Erst als sie laut »Aua!« schreit, merke ich, dass ich zu fest mit den Nägeln zugedrückt habe.
Ich muss wieder weinen. Dieses Mal lauter, damit Mama merkt, dass ich nicht will. Selbst wenn der Ort mich gesund macht. Ich bleibe nur, wenn Mama auch hier ist. Immer wieder höre ich: »Alles wird gut«. Glauben kann ich das nicht. Niemand hört die Zweifel in mir.
Richtige Worte kann ich nicht sagen, nur noch schreien. Bestimmt sind wir bald da. Also wehre ich mich, schmeiße mich auf den Boden und ziehe Mama damit auch ein bisschen mit hinunter. Sie bleibt stehen. Mit verklebten Wimpern schaut sie zu mir. Meine Hände stützen sich auf den kalten Fußboden. Es drückt im Rücken ein wenig, weil ich keine weiche Unterlage habe. Tröte sitzt neben mir. Ihm ist auch kalt. Das weiß ich.
Mama ist mir jetzt so nah. Ihre Stirn berührt meine. Der dunkelblaue Nebel umhüllt mich ganz. Dunkelblau ist meine Lieblingsfarbe. Sie soll nicht verschwinden. »Vertraust du mir?«, fragt sie mich. Ich nicke sofort. Die Frage ist einfach. Noch einfacher als Frau Hübners Fragen.
»Wir schaffen das. Du und ich. Dir wird es besser gehen.«
Es fällt mir schwer zu reden. Vom vielen Weinen kann ich kaum noch atmen. Schluchzend bringe ich hervor: »Ich will aber nicht hierbleiben! Versprich mir, mich mit nach Hause zu nehmen.«
Sie antwortet nicht sofort. Das mag ich nicht. Sie ist sich unsicher. »Wir müssen sehen, was der Doktor sagt. Aber ich verspreche dir, dass wir immer zusammenbleiben.« Sie drückt mich fest an sich. Ich glaube ihr. Mama hat mich noch nie angelogen. Dazu ist sie nicht fähig, glaube ich.
Ich hebe Tröte auf, damit er nicht mehr frieren muss. Wenn wir immer zusammenbleiben, bleibt Mama dann auch wirklich bei mir? Das hoffe ich. Ich stehe also doch wieder auf. Mama zeigt auf eine Tür. Der Weg ist nicht mehr weit. Auch dort stehen wieder Buchstaben. Das R kann ich schon.
Mama klopft an. Ihre Hände zittern ein bisschen. Ich greife nach ihnen, damit es ihr besser geht. Sie lächelt mir zu, aber das Zittern ist immer noch da. Das spüre ich beim Händchenhalten.
Es öffnet uns ein Mann, der mich ein bisschen an Großonkel Diether erinnert. Nicht von der Farbe her. Großonkel Diether leuchtet in Braun, aber das Orange dieses Mannes gefällt mir genau so gut. Es passt zu seinem orange-grünen Karohemd. Witzig, normalerweise achten die Menschen nicht auf so etwas. Es ist bestimmt nur Zufall.
Er hat jedenfalls dieselbe krumme Nase wie Großonkel Diether. Auch sein Haar färbt sich langsam grau. Das verbindet die beiden miteinander. Vielleicht sollte ich mir einfach vorstellen, der Fremde sei mein Großonkel Diether.
»Hallo, Verena.« Er gibt Mama die Hand, als würden sie sich schon kennen. Bei mir versucht er es auch, aber ich will sie nicht nehmen. Er lächelt und geht beiseite. So können wir reingehen.
Über dem Tisch hängt ein Bild mit Fingerabdrücken. Bestimmt haben das seine Kinder für ihn gemacht. Hier gefällt es mir etwas besser. Das Bild mag ich, aber der Rest ist langweilig: Tisch, Stuhl und Computer. Wie bei Papa im Büro. Spielsachen gibt es auch hier nicht.
Mama nimmt mich auf den Schoß, weil der zweite Stuhl auch für Erwachsene gedacht ist. Ich schaue zu Tröte. Es fällt mir nämlich doch schwer, mir Großonkel Diether vorzustellen. Gut, dass Mama mir so nahe ist. Bei ihr fühle ich mich sicher.
Der Doktor kann ganz schön schnell schreiben. Ob ich das später auch mal können werde? Leicht beuge ich mich über den Tisch. Vielleicht kann ich ja ein paar Buchstaben erkennen. Er schreibt komisch. Solche Buchstaben lernen wir in der Schule nicht. Ob das erst später drankommt?
»Am besten schilderst du mir nochmal, was deine Tochter zu dir gesagt hat.« Er schaut über seine Brille hinweg zu mir. Mir bleibt die Luft weg. »Du darfst natürlich auch gerne was sagen, wenn deine Mama etwas falsch verstanden hat.« Ich nicke. Hoffentlich schafft Mama das alleine. Ich will nicht mit ihm reden.
Mama reibt sich die Hände. Sie will bestimmt alles richtig machen. So geht’s mir auch, wenn Frau Hübner eine Frage stellt. Ich kenne die Antwort, aber meistens traue ich mich trotzdem nicht.
»Schon seit … ungefähr drei Jahren, seitdem sie sprechen kann, erzählt meine Tochter immer von irgendwelchen Farbwolken, die um den Körper einer Person herumschweben. Anfangs dachten wir uns nichts dabei. Kinder haben eben manchmal eine große Fantasie. Inzwischen geht sie aber bereits in die erste Klasse und langsam mache ich mir Sorgen.« Mama redet ziemlich schnell. Das macht sie auch immer, wenn ich böse gewesen bin.
Der Onkeldoktor schreibt wieder. Sein Stift ist schöner als der Bleistift, mit dem ich immer schreiben muss. Später will ich mir auch so einen kaufen. Schwarze Farbe sieht schöner aus als graue. Er räuspert sich. »Bist du verheiratet? Entschuldige bitte, wenn dir die Frage zu persönlich ist.« Ich glaube, er wird rot. Bei Mama kann ich es nicht sagen, weil sie wegguckt.
Mama schüttelt schnell den Kopf. »Nein, keineswegs. Ja, ich bin verheiratet. Und … ich will nicht behaupten, dass mein Mann und ich uns nie streiten, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass wir ihr ein Umfeld bieten, das …«
Der Doktor fällt Mama ins Wort. »Verena, allein die Tatsache, dass du zu mir gekommen bist, beweist, wie gut es deine Tochter bei dir hat. Gab es bei ihrer Geburt Komplikationen?«
Tränen laufen ihr über das Gesicht. Eigentlich weint Mama nie. Ich habe sie noch nie so gesehen. Ich mache meine Beine auseinander, damit Tröte auf Mamas Schoß sitzen kann. Tröte kann nämlich gut trösten. Mama hat sich ganz schnell wieder alle Tränen weggewischt. Ich habe sie nur gesehen, weil ich kurz zu ihr hochgeschaut habe.
»Nein, auch nicht«, bringt sie hervor. Ganz leise nur. »Woran kann es noch liegen?«
Er kaut auf seiner Unterlippe und dreht sich dann zu mir um. Ich schrecke zurück. »Ist es schon einmal vorgekommen, dass du Töne gesehen hast?«
Ich verstehe die Frage nicht. Wie kann man denn Töne sehen? Statt zu antworten, drücke ich mich gegen Mamas Brust, damit sie für mich einspringt. »Davon hat sie zumindest noch nichts erzählt«, murmelt sie leise.
Er schlägt auf einmal seine dicke Mappe mit der Schrift zu. Hat er jetzt Feierabend? Ich mache das Gleiche auch in der Schule, wenn es klingelt. Dann atmet er tief durch, so wie Frau Hübner, wenn sie uns endlich los ist. Das ist bestimmt gut. Wir können gehen.
»Es könnte eine Synästhesie sein, aber in diesem jungen Alter halte ich es durchaus für möglich, dass sie einfach eine blühende Fantasie besitzt und sich diese Farben ausdenkt. Bedenklich ist beides keineswegs. Ich würde vorschlagen, wir beobachten Marcia und schauen, wie sich das mit dem Alter entwickelt.«
Das Wort mit S verstehe ich nicht. Ausdenken? Was redet der Arzt da nur? Sollte er als Doktor nicht wissen, was los ist? Die Farben sind da! Vielleicht ist das das Problem. Ich glaube, er will mich nur entlassen, weil er denkt, ich würde fantasieren. Ich täusche keine Krankheit vor. Das ist nur ein einziges Mal passiert, weil ich an dem Tag wirklich nicht in den Kindergarten wollte.
Plötzlich wird mir eines klar: Wenn ich niemals hierhin will, dann muss ich so tun, als wäre ich wie durch ein Wunder geheilt worden. Ich muss vorspielen, gesund zu sein, obwohl ich krank bin – und nur Tröte darf jemals die Wahrheit wissen.
Loslassen
Freak, Psycho, Nerd
3 Worte – mehr bin ich nicht wert
Niemand kennt mein wahres Ich
Bereits angekommen im Licht
Stark, selbstbewusst, fair
3 Worte – die geb’ ich nicht her
- Dunkelgrau
Heute
Alle zusammen reihen sie sich hintereinander auf und warten auf irgendein Zeichen, um gemeinsam mit ihrem Partner, den nur die wenigsten von ihnen wahrhaftig kennen, die Treppe runtermarschieren zu können. Dann tanzen sie für zwei Minuten Wiener Walzer, weil das hier heute ihr Abschlussball ist. Man kann Wilma die Begeisterung förmlich ansehen, die sich neben ihrem zugeteilten Ballpartner befindet. Ihr Blick schweift über ihre Schulter und sucht den meinen, stumm das Wort Hilfe mit dem Mund formend.
Selbst wenn sie gelächelt hätte, würde ich ihr das nicht abkaufen. Mir zu zeigen, was sie wirklich fühlt, das übernimmt der blaue Nebel für mich. Den letzten Tanz zu vollziehen, bevor man in getrennte Richtungen an irgendwelche Universitäten verschwindet, hat Tradition, die Wilma nicht einfach so brechen kann. Mit der Aufmerksamkeit kommt sie genauso wenig zurecht wie viele andere in der Schlange auch, einschließlich mir.
Trotzdem bin ich die Einzige, die etwas abseits zwischen den Treppengeländern hindurch gafft, um mitanzusehen, wie sich meine Mitschüler gleich zum Affen machen werden. Mich hat niemand nach einem Date gefragt. Ich bleibe über. Und selbst wenn es nicht so wäre, würde mich meine Ehre auf keinen Fall dort hinunter scheuchen. Deshalb habe ich auch dem heulenden Jungen eine Klasse unter mir mitgeteilt, er würde schon noch früh genug die besten zwei Minuten seines Lebens erleben.
Immer dann, wenn Menschen so dicht aufeinanderhocken, vermischen sich die Farben ihres Nebels und es erscheint beinahe unmöglich, die richtige Zuordnung auf die Kette zu kriegen. Einer der vielen weiteren Gründe, warum ich mich lieber mit wenigen Menschen in einem Raum aufhalte.
Die Musik setzt ein – ein rhythmischer Walzer, zu dem ältere Menschen bei runden Geburtstagen gerne in einer Reihe schunkeln, wenn sie zum Tanzen zu träge sind. Die Lichterkette, die der Schulleiter wohl seinem Weihnachtsbaum vom letzten Jahr entwendet hat, wurde so an der Decke festmontiert, als wäre unsere Schule unbedacht. Ein Blick auf das Himmelszelt, an dem mir tausende Sterne entgegenfunkeln, verursacht bei mir kein Freiheitsgefühl. Die Beklemmung und der Ekel erreichen ihr Ultimatum beim Anblick der Litfaßsäulen. Welcher Verbrecher war der Ansicht, die Säulen mit lilanem Licht zu erleuchten, verleihe der Schule eine ästhetische Atmosphäre? Die große Lichtkugel, scheinbar die Sonne repräsentierend, verursacht in mir eher einen kosmischen Brechreiz. Ich sehne mich nach dämmrigem Mondlicht.
Ich schleiche mich unauffällig zur hinteren Seite der Treppe. Achtsam streifen meine Hände das Geländer entlang, darauf bedacht, das angeknotete weiße Samttuch mit den selbstgebastelten Masken der Siebtklässler nicht zu demolieren. Viele stolze Eltern sind erwartungsvoll aufgestanden, um ihr Kind zwei Minuten lang tanzen zu sehen. Obwohl ich meine Mutter gebeten habe, arbeiten zu gehen, steht sie jetzt trotzdem jubelnd in der ersten Reihe. Sie arbeitet mindestens genauso gern wie ich und dafür liebe ich sie. Warum sollte es an diesem Tag anders sein?
Warum tut sie sich das an, mehrere Stunden gemeinsam mit Papa an einem Tisch zu sitzen? Dieser Abend ist wie jeder andere auch. Wie stolz sie auf meine Leistungen sind, bekomme ich ohnehin fast jeden zweiten Tag zu hören. Zum Glück besitze ich Eltern, die mir keine elendig lange Rede darüber halten, wie wichtig der heutige Tag für mich und meine Zukunft sei. Das übernimmt schon Herr Behn für sie.
Mama ist allenfalls stolz, wie standhaft ich für meine Meinung einstehe. Manchmal spiele ich mit dem Gedanken, ihr von meiner Instagram-Seite zu erzählen, weil ich genau weiß, wie sehr sie mein Erfolg freuen würde. Der Inhalt würde sie allerdings beunruhigen, deshalb habe ich es bislang immer gelassen.
Während die anderen tanzen, halte ich nach einem ruhigen Plätzchen Ausschau. Es gibt noch so viel zu tun, bevor ich nach Berlin aufbreche. Ich weiß, dass Papa sich fragt, warum ich gerade nach Berlin will. Kann es nicht eine Universität hier in der Nähe sein? Da er zu den Rosanen gehört, glaubt er vermutlich sogar, es wäre seine Schuld. Manchmal beschleicht mich zwar das Gefühl, Papa wäre durch Mama etwas rationaler geworden, doch wem mache ich was vor? Tief in seinem Herzen wird er immer rosa bleiben.
Mich durchbohren die abschätzigen Blicke einiger Eltern, an denen ich mich vorbeidrängle. Die verzogenen Münder summen die Melodie des Lieds nach. Schwielige Handflächen prallen im Takt gegeneinander. Der unzureichend gelüftete Raum treibt den Anwesenden Schweißperlen auf die Stirn. Ich rümpfe die Nase und erkämpfe mir den Weg Richtung Garderobe.
Endlich finde ich eine freie Bank, da wo normalerweise der Kiosk ist. Die Rollos sind heruntergefahren. Erschöpft und ausgelaugt von der Reizüberflutung lasse ich mich fallen. Lediglich vereinzelte Luftballons deuten auf das Event des heutigen Abends hin. Ich krame mein Handy aus der hässlichen Handtasche. Wenigstens dafür ist sie zu gebrauchen. Da ich selbst nicht eine einzige davon im Schrank besitze, hat Mama mir ihre geliehen. An den Seiten ist sie schon ziemlich abgenutzt und hellbraune Fäden gucken hervor. Zumindest passt das Weiß zu meinem schwarzen Hosenanzug.
Den habe ich mir aus Protest gekauft. Sonst trage ich nie Kleider. Warum sollte ich das für diesen einen Abend ändern, zu dem ich nicht einmal erscheinen wollte? Hätte Herr Behn mir nicht damit gedroht, mir dann kein Zeugnis auszustellen, wäre ich sowas von zu Hause geblieben.
Im Internet Explorer ist noch das Fenster mit dem Lageplan meiner neuen Uni geöffnet. Ich schließe es und klicke stattdessen auf die Notizenapp, die ich immer zum Verfassen meiner Beiträge benutze, wenn es längere sind, die ich nicht direkt in Instagram abtippen möchte.
Unvollendet ist immer noch der Beitrag, den ich dann posten will, wenn ich eine Million Follower erreicht habe. Es fehlen dreißigtausend, aber so rasant wie die Anzahl meiner Abonnenten in letzter Zeit gestiegen ist, glaube ich fast, es könnte schon bald so weit sein.
Ich überfliege den Text, den ich bereits abgetippt habe:
Eine Million, Leute! Eine Million! Ich kann es immer noch nicht fassen. Damit ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin, soll dieser Beitrag etwas ganz Besonderes werden. Ich erhalte so viele Fragen von euch zu meiner Identität, die ich bislang alle ignoriert habe, weil ich die Frage belanglos fand. Darum geht es bei ColourMind nicht. Trotzdem weiß ich natürlich, wie sehr ihr für diese Frage brennt, deshalb möchte ich versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten.
Mehr habe ich nicht geschrieben, weil jetzt der komplizierte Teil anfängt. Ich rede nicht gerne über mich. Andere zu ergründen, fällt mir leicht. Ihre Farbe kann ich zumindest sehen.
Die Musik wechselt. Das ist das Zeichen, dass der Ehrentanz vorbei ist und jetzt jeder tanzen darf. Ein modernes Lied aus dem Elektropop-Genre dröhnt mir entgegen. Die Melodie ist mir nur flüchtig aus dem Radio vertraut. Meine Eltern werden nicht tanzen, jedenfalls nicht miteinander. Als einzelne Individuen mögen sie zu denen gehören, die ab und an das Tanzbein schwingen, aber nicht miteinander. Auch wenn Mama und ich generell viel gemeinsam haben, eines unterscheidet uns voneinander: Sie geht gerne unter Leute und falls sie nicht arbeiten darf, dann auch feiern.
Vermutlich ist es angebracht, jetzt wieder zu ihnen zurückzugehen. Irgendwie kann ich mich trotzdem nicht von der Stelle bewegen und starre aus dem Fenster, in der Hoffnung, so die richtigen Worte zu finden. Der verregnete Tag spiegelt mein Innerstes hervorragend wider. Mich zu konzentrieren, misslingt mir. Vielleicht liegt es an dem Schüler ein paar Jahrgänge unter mir, den sie zum Gläserpolieren verdonnert haben. Er beobachtet mich schon die ganze Zeit, als wäre ich ein Tier in einem Zoo.
Schließlich kann ich gar nicht anders und gaffe zurück. Daraufhin blickt er schnell auf das Glas in seinen Händen und murmelt etwas, das für mich eindeutig nach »Freak« klingt.
In meinem Kopf beginnt es zu brodeln. Mir liegen so viele Worte auf den Lippen, doch anstatt sie laut auszusprechen, tippe ich sie in mein Handy. Dem Jungen zeige ich nur einen Stinkefinger, woraufhin sich seine Augen weiten.
Ich gehöre zu den Dunkelgrauen. Wenn du mich irgendwo persönlich träfest, würde ich dir vermutlich gar nicht auffallen. Höchstens, wenn gerade mein Abschlussball ist und ich abseits in einer Ecke sitze. Du würdest von mir denken, ich wäre schüchtern und stände mir nur selbst im Weg, weil ich einen solch wichtigen Abend am Handy verbringe.
Was du nicht weißt: Ich schreibe gerade meinen eine Million Abonnenten auf Instagram. Ja, vielleicht bin ich ein Freak, weil ich eine so große Leidenschaft besitze und deshalb gerne mal Dinge vergesse, die andere als wichtig ansehen. Aber fuck, ich bin der Freak, an den du dich noch Jahre später erinnern wirst, während mir jetzt schon entfallen ist, wie du überhaupt ausgesehen hast.
Viel mehr darf ich jetzt nicht schreiben, sonst bekomme ich wieder Probleme mit der Anzahl an Zeichen. Ich schalte den Bildschirm aus, stecke das Handy zurück und mache mich langsam auf den Weg zu meinen Eltern. Hoffentlich haben sie sich in meiner Abwesenheit noch keine Haare ausgerissen.
Wie zu erwarten, entdecke ich Mama auf der Tanzfläche. Sie kann nie lange unbeschäftigt bleiben, egal in welchen Situationen und schon gar nicht gemeinsam mit Papa. Mir ist es fast ein bisschen peinlich, sie jetzt mit Wilmas Mutter tanzen zu sehen. Wilmas Mutter ist schon viel länger Single, was sie durch ihre Körpersprache definitiv durchblicken lässt. Die beiden grooven zur Musik und kreisen dabei lasziv die Hüften. Wilmas Mutter spielt sogar Luftgitarre, obwohl im Song keine zu hören ist. Einen Beat kann man zwar raushören, aber … Was soll ich sagen? Wilmas Mutter gehört zu den Roten, da ist das kein Wunder.
Mit denen gebe ich mich nur ungern ab, genauso wie mit den Gelben. Am schlimmsten aber sind die Pinken. Unter denen habe ich echt noch niemanden getroffen, der mir sympathisch ist. Gut, Franziska ist eine Ausnahme, aber nur wenn sie ihre Tage hat. In Französisch hat sie mir eine Binde geliehen, als ich das erste Mal in Not war. Ansonsten zeigt sie mir im Unterricht allerdings die kalte Schulter. Die Stimmungsschwankung der Regelblutung hat wohl keine Auswirkung auf die Farben.
Das Schlimme daran: Man trifft die Pinken wie Sand am Meer. Warum existieren auf dieser Welt so wenige Menschen wie ich? Und wenn es sie doch gibt, machen sie einen großen Bogen um alle, wie es sich für richtige Dunkelgraue gehört.
Mama fuchtelt wild mit ihren Händen, als wolle sie mir ein Zeichen geben, mich zu ihr zu gesellen. Über ihrem Kopf deuten ihre Finger nach rechts, wo ich Wilma entdecke, die lieblos mit ihren Hüften wackelt. Hauptsächlich beobachtet sie aber beschämt ihre Mutter beim Tanzen.
Ich schüttle nur den Kopf. Bevor mich jemand auf die Tanzfläche schleift, wird 2012 die Welt untergehen, dabei haben wir inzwischen 2018. Also setze ich mich zu Papa an den Tisch, an dem wir beim Essen gesessen haben. Er stützt sein Kinn auf die Handflächen. Weil er so hypnotisiert von der Kerze in der Mitte des Tisches ist, bemerkt er mich erst gar nicht. Normalerweise tanzt er auf Feiern immer ausgiebig.
Ich räuspere mich und schiebe den Stuhl zurück. Er blickt auf, dann streifen seine Augen wieder die Kerze. Manchmal glaube ich, er ist immer noch nicht über Mama hinweg. »In drei Wochen ziehe ich übrigens nach Berlin.« Er nickt schwach und wenig überrascht, vermutlich weil die Neuigkeit bereits zu ihm vorgedrungen ist. Nicht das beste Thema, das ich hier angeschnitten habe.
»Ich hätte nie gedacht, dass du Psychologie studieren wirst. Mir kam es immer so vor, als würdest du Anwältin werden, so wie deine Mutter. Ihr habt sonst auch so viel gemeinsam.«
Schnell nimmt er einen Schluck von seinem Bier, fast als könne er nicht lange über Mama sprechen. Seine Haare sind leicht lockig, obwohl sie das sonst eigentlich nicht sind. Die Schweißperlen am Haaransatz kräuseln sein Haar.
»Im Gerichtssaal vor all den Leuten würde ich keinen Ton herausbekommen. Ich schätze, das habe ich von dir.« Mein Versuch, ihn aufzumuntern, scheitert. Er seufzt nur ausgiebig und lehnt sich weiter in die Lehne seines Stuhls. »Ich werde dich vermissen.«
So wie er Mama vermisst? Es bricht mir das Herz, ihn so leiden zu sehen, aber irgendwie hat er es auch selbst zu verantworten. Von vornherein wusste er, was Mama für ein Mensch ist. Ihr dann an den Kopf zu werfen, sie würde ihre Arbeit mehr lieben als ihn, finde ich verwerflich.
Plötzlich steht Wilma neben mir. Sie wirkt ein wenig angepisst. Ihre Stirn kräuselt sich. Beim Verschränken ihrer Hände wirft ihr grünes Kleid leichte Falten. »Dafür, dass das unser letzter Abend zusammen ist … dafür, dass wir bald unzählige Kilometer voneinander entfernt leben werden, sehe ich dich heute extrem wenig.« Tut Wilma gerade so, als wäre sie eine Pinke? Ich verdrehe die Augen. Wir können uns schreiben. Außerdem … so nahe stehen wir uns nun auch wieder nicht. Das Einzige, was uns miteinander verbindet, ist doch, dass sich sonst niemand mit uns abgeben will.
»Dann setze dich zu mir. Ich weiß, dass du auch nicht tanzen willst.« Ich deute auf den Platz neben mir, der noch frei ist.
Zögernd schaut sie sich im Raum um. »Aber … alle tanzen.« Sie hat recht. Außer uns sitzen nur ein paar Lehrer und Eltern an den Tischen. Der Rest der Schüler tanzt gerade oder schießt alberne Toilettenselfies.
»Ja, weil die meisten hier das vermutlich auch wirklich wollen, aber wir sind nicht wie die anderen«, erinnere ich sie. Eigentlich stimmt das nicht so ganz. Blaue Menschen wie Wilma gibt es tatsächlich recht häufig. Was witzig ist, weil wir uns in sehr vielen Punkten ähneln. Aber Wilma denkt nicht weiter darüber nach, warum alle Menschen gleich und doch so anders sind. Sie macht sich nicht täglich Notizen über ihr Umfeld, um eine Theorie aufzustellen, die sie dann auf Instagram postet. Und genau deshalb sind wir letztendlich doch so verschieden.
»Ich glaube, darauf freue ich mich am Unileben am meisten. Endlich werde ich Leute treffen, die dieselben Interessen wie ich haben und die mich verstehen«, überlege ich laut. Zum einen, um Papa zu zeigen, wie wichtig mir das ist und zum anderen, um Wilma meinen Standpunkt klarzumachen.
»Danke, ich mag dich auch nicht«, brummt sie verstimmt wie eh und je – eine unserer vielen Gemeinsamkeiten. Wilma wird nach der Schule BWL studieren. Als ich das gehört habe, hätte ich fast laut losgelacht bei all der Ironie. Die Menschen sind so durchschaubar. Ich brauche sie nicht zu fragen, um zu wissen, dass sie ganz nah bei Mami und Papi bleiben wird.
Ich muss hier weg – aus vielerlei Gründen. Mein ganzes Leben lang habe ich schon einen Plan, der mich irgendwann ans Ziel meiner Träume bringen wird. Immer wieder habe ich diese verworfen, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber nicht dieses Mal. Ich werde nach Berlin an meine Traumuni gehen und mein großes Idol treffen: Prof. Dr. Strobel. Als ich erfahren habe, dass er dieses Semester den Einführungskurs in Persönlichkeitspsychologie geben wird, wäre ich fast an die Decke gesprungen.
Nur die wenigsten Menschen können sich vorstellen, wie satt ich dieses Leben habe. Hier habe ich eine Familie, die mich liebt, aber leider ist mir das nie genug gewesen. Das Loslassen fällt mir leichter, als es vermutlich sollte. Die Abenteuer, die in Berlin auf mich warten werden, lassen mich innerlich vergnügt aufkreischen.
WG-Chaos
Triefender Schmerz
In meiner Vene wie Gift
Siehst du, wie mich
jeder einzelne Stein
in die Magengegend trifft?
Unsere Trennung –
kann sie nicht begreifen.
Wo ist die Lösung,
weniger zu streiten?
- Dunkellila
Drei Wochen später
Erleichtert stelle ich den zentnerschweren Koffer vor meine Haustür. Ja, meine. Nur meine. Streng genommen wohnen hier noch acht weitere Studenten, weil ich mir von meinem Ersparten nur das Wohnheim leisten kann und will. Mama hat mir zwar angeboten, einen Teil beizusteuern, doch ich habe freundlich abgelehnt. Dank Instagram stehe ich auf eigenen Beinen und bin stolz darauf.
Dass sich sieben weitere Studenten mit mir ein Haus teilen, ist zwar ärgerlich, aber ein Übel, das ich ertragen kann, wenn man bedenkt, dass ich trotzdem mein eigenes Reich besitzen werde. So glücklich wie am heutigen Tag habe ich mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefühlt. Mein Leben, auf das ich so lange hingearbeitet habe, kann endlich beginnen.
Gemächlich wandern meine Finger über das Metall der Balustrade. Unvorstellbar, dass all das mir gehört. Die Hauswand schießt zwei Stockwerke in die Höhe. Vorne sind mehrere Briefkästen angebaut, von denen einer bereits für mich vorgesehen ist: Marcia Zielke. Ich atme tief die nach Abgasen riechende Stadtluft in meine Lungen ein. Ein glückliches Seufzen entfährt mir. Das ist der Ort, an den ich gehöre.
Hupende Autos, jeden Tag fremde Gesichter – der perfekte Ort, um unauffällig in der Masse zu verschwinden. Die Jalousien meines zukünftigen Hauses versperren die Sicht zur Hälfte. Die Matrjoschka am Fenstersims erkenne ich dennoch wieder – ein eindeutiges Indiz für die Küche.
Papa ist der Erste, der mich zum Abschied ganz fest in den Arm nimmt. Unter seiner Liebkosung verliere ich fast die Luft zum Atmen. Während der Autofahrt hat er sich freiwillig nach hinten gesetzt, aber jetzt scheut er keinerlei Berührung. »Ruf so oft an, wie du kannst.«
Bevor ich wieder genügend Sauerstoff zum Antworten aufbringen kann, fällt Mama ihm hitzig ins Wort. »Philipp! Deine Tochter wird jede Menge zu tun haben und keine Zeit dafür haben, dich jede freie Minute anzurufen.« Korrekt. Dankbar schenke ich Mama mein bestes Lächeln. Wenn ich es wirklich zu etwas bringen will, muss ich meinen Terminplan zeitlich takten.
»Dachte ich mir«, murmelt Papa nur. Mama verdreht kurz die Augen, aber so, dass Papa es nicht sieht.
Dann zieht sie mich auch kurz in eine Umarmung. Es verstreichen wenige Sekunden, dann tätschelt sie mir die Schulter. Ihr Mundwinkel zuckt. »Du weißt, ich war anfangs skeptisch, ob Psychologie wirklich das richtige Fach für dich ist. Vergiss das wieder. Ich bin mir sicher, dass du es weit bringst.« Dass Mama anfangs skeptisch gewesen ist, kann ich nur verstehen. Sie hat sich irgendeine Psychiatrie vorgestellt, in der ich Menschen therapiere. Dort sehe ich mich auch nicht. Mein Plan ist ein ganz anderer: Ich will in Professor Strobels Fußstapfen treten und promovieren. Die passende Theorie dazu habe ich bereits.
»Wir könnten noch mit reinkommen …«, setzt Papa an, doch ich unterbreche ihn. Die Fahrt hat mich ausgelaugt. Aber selbst wenn meine Knochen nicht schmerzen und sich nach Schlaf sehnen würden, ertrüge ich es nicht, länger als eine Stunde mit beiden Elternteilen ein Kaffeekränzchen zu halten – weder die peinliche Stille noch die ungeklärten Spannungen.
»Nichts für ungut, aber das Auspacken würde ich gerne alleine machen. Außerdem muss ich noch was für die Uni am Montag vorbereiten«, rede ich mich raus.
Mama nickt verständnisvoll, Papa ist einfach nur enttäuscht. Bei dem Gedanken, dass die beiden allein im Auto zurückfahren werden, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Hoffentlich kommt niemand zu Schaden.
Ich nehme den Schlüssel aus meiner Hosentasche, den ich vor einer Woche vom Vormieter erhalten habe. Im Gegensatz zu unserem Haustürschlüssel daheim ist dieser kleiner und ohne ein eingraviertes Logo im Messing. Während das Schloss entriegelt wird, kramt Mama ebenfalls nach ihrem Autoschlüssel. Sie winkt noch kurz, wohingegen Papa fast so aussieht, als wolle er mich nochmal an sich ziehen. Letztendlich lässt er es.
Ich wende mich von ihnen ab. Dass sich ein winziges Schmunzeln über meine Lippen schleicht, kann ich nicht verhindern. Mit den beiden habe ich es echt nicht schlecht getroffen. Manchmal wünsche ich mir, sie würden ihre Differenzen einfach klären, denn man merkt definitiv, dass sie sich einmal geliebt haben. Meine Vorfreude liegt nicht in ihrer Abwesenheit, sondern in der Stadt selbst begründet.
Die WG sieht genau so aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Hinter der Tür gelangt man direkt in den Aufenthaltsraum, der für alle von uns da ist. Der Raum ist so groß, dass hier sowohl Küche als auch Wohnzimmer auf einmal vorzufinden sind. Das, was mir jedoch sofort auffällt, ist, dass es beim letzten Mal sauberer war. Auf der Küchenzeile stapelt sich das dreckige Geschirr. Der Eimer mit Kompost scheint befüllt, da Obstfliegen darüber kreisen.
Man merkt, dass die Bewohner aus ihren Semesterferien zurückgekehrt sind. Am besten, wir legen sofort einen Haushaltsplan fest, bevor das hier noch weiter ausartet.
An der Vorderfront des Kühlschranks hängen Fotos und Postkarten an Magneten befestigt. Mir lächeln Gesichter vor einer idyllischen Strandatmosphäre entgegen. In einer golden eingestanzten Schrift überbringt mir eine Karte die Botschaft: Ich hatte heute viel zu erledigen. Jetzt habe ich morgen viel zu erledigen. Diese Einstellung merkt man der WG an.
Ich öffne die Tür, woraufhin der Kompressor anspringt und laut brummt. Meine Getränke habe ich bereits seitlich zu den anderen gestellt. Das untere Fach, das noch für mich frei ist, besetze ich mit Brot und Aufstrichen für den Morgen. Danach werde ich einkaufen, um es mit weiteren Lebensmitteln aufzustocken. Ich schließe den Schrank wieder.
Zimmerpflanzen verleihen dem Wohnzimmer einen heimischen Touch. Eine Grünlilie hat es sich auf dem Couchtisch bequem gemacht. Ich ziehe den Koffer an dem großen Plasmafernseher vorbei über das Laminat. Da mein linker Arm kaum noch im Stande ist, die Tasche zu tragen, kicke ich diese mit dem Fuß mit mir mit. Sie schrammt dabei die Ecke der Vitrine. Seufzend angle ich sie mir zurück. Mir springt eine unglaublich große DVD-Sammlung ins Auge. Entzückt stelle ich fest, dass darunter einige Meisterwerke zu finden sind. Die Bandbreite reicht von Herr der Ringe bis Psycho.
Endlich bewerkstellige ich es, die Tasche zurück ins Treppenhaus zu treten. Entkräftet schaue ich mir die Stufen an, die vor mir liegen. Um mein Zimmer zu erreichen, ist es erforderlich, den Brocken ein Stockwerk höher zu tragen. Diesen die Stufen hochzuhieven, ist in meinem Gemütszustand ein ziemlicher Akt. Ich sollte zweimal gehen.
Man hat mir mitgeteilt, dass ich mir das Badezimmer mit drei weiteren Hausbewohnern teile. Hoffentlich gibt es einen Schlüssel.
In meinem Zimmer angekommen bemerke ich, wie leer es hier ist. Wir haben alle Möbel außer den Schreibtisch neu gekauft – hier in Berlin. Das ist am einfachsten gewesen. Mehr als ein Bett, zwei Schränke, der Schreibtisch und ein Sofa existiert hier noch nicht. Das stört mich nicht weiter. Eigentlich brauche ich nicht viel, aber ein bisschen möchte ich trotzdem in den nächsten Tagen einkaufen. Bücher fürs Bücherregal wären nicht schlecht.
Wobei ich damit vielleicht auch erst noch warten könnte, in der Hoffnung, gute Angebote für Werbung von Instagram zu erhalten. Ein bisschen erschöpft vom Treppensteigen lasse ich mich auf mein Sofa fallen. Ich habe es gebraucht erstanden. Auf der rechten Seite hat es einen undefinierbaren schwarzen Fleck, der aber nicht länger abfärbt.
Ich ziehe den Reißverschluss meines Koffers auf, um mich ans Auspacken zu machen. Zuerst krame ich die Hosen heraus, um sie in den Schrank zu legen. Die meisten von ihnen besitzen einen geraden Schnitt. In meinem gesamten Repertoire befindet sich nur eine blaue Röhrenjeans. Ich trage sie ungern, weil sie an meinen Schenkeln spannt. Kaum habe ich zwei der Hosen zusammengefaltet, klopft es an der Tür. Kurz fluche ich, weil ich gehofft hatte, meine Mitbewohner würden mir ein bisschen Privatsphäre gönnen.
Wohl nicht. »Herein!«, rufe ich notgedrungen. Die Tür wird geöffnet und ein lila Nebel umhüllt den Bereich davor. Seufzend lasse ich das Kleidungsstück in meinen Händen fallen und schließe den Schrank. Augen zu und durch. Es gibt noch andere Bewohner in dieser WG.
Vor mir steht ein Junge ungefähr im selben Alter. Er trägt ein rotes Karohemd, dazu natürlich ein zweitausend-Watt-Lächeln. Ich glaube, selbst wenn es ihm im Moment schlecht gehen würde, täte er so, als wäre alles okay – nur mir zuliebe. »Hey, ich bin Tomke, dein neuer Mitbewohner.« Tomke … da klingelt was bei mir. Ich glaube, er zählt zu den Leuten, mit denen ich mir das Bad teile.
»Marcia«, antworte ich kurz angebunden, mit weniger Euphorie als er, dafür aber ehrlich. Damit er nicht lange bleibt und sieht, dass ich beschäftigt bin, beginne ich wieder, meinen Koffer auszupacken.
Erfolglos. »Kommst du aus Berlin?« Er setzt sich virtuos auf mein Sofa, als hätte ich ihm irgendeine Einladung gegeben. Dabei spannt sich der Stoff seiner dunklen Jeans an den Waden.
Ich schüttle den Kopf. »Nein, aus einem Kuhkaff in Bayern.«
Er lacht über meinen Ausdruck für Buxheim. »Warum bist du nicht nach München gezogen? Studierst du etwas, das man kaum aussprechen kann?«
Meine Oberteile haben ihren Platz im Schrank gefunden. Ernüchtert blicke ich in den Schrank, der nicht mal zur Hälfte gefüllt ist. Die Unterwäsche fehlt noch, aber die wird ganz sicher im Koffer bleiben, solange mir Tomke auf die Pelle rückt.
»Nein, ich musste einfach nur so weit wie möglich von zuhause weg«, meine ich schulterzuckend.
Da es ohnehin aussichtslos erscheint, dass er in nächster Zeit mein Zimmer verlassen wird, lasse ich mich neben ihm aufs Sofa nieder. Der Abstand reicht aus, um seine lila Zuckerwatte in einem natürlichen Radius um ihn wabern zu sehen.
Er grinst mich an. »Das gefällt mir. Was studierst du?«
»Psychologie.« Mein Blick schweift aus dem Fenster. Wir wohnen direkt neben der Uni. Man kann sie von hier sogar sehen. Irgendwo da sitzt mein großes Idol und wartet nur darauf, mich kennenzulernen – die nächste Professorin mit bahnbrechenden Ideen.
»Spannend! Brendan studiert dasselbe wie du. Also Brendan, unser Mitbewohner«, erklärt er sich dann.
Gelangweilt blicke ich wieder zu ihm. Er wartet darauf, dass ich ihn etwas frage, was sich im Nachhinein als vorhersehbar entpuppt. Ich seufze. »Und du? Was studierst du? Lass mich raten … Lehramt?« Bei all den lila Lehrkräften, die mich in der Vergangenheit unterrichtet haben, wäre das nicht verwunderlich.
Er schüttelt belustigt den Kopf. »Sehe ich etwa wie ein Lehramtsstudent aus?« Er mustert sein Hemd eingehend und schiebt die Ärmel ein Stückchen nach oben, um lockerer zu wirken. Mit den Fingern strapaziert er sein schwarzes Haar, sodass es igelhaft in alle Richtungen absteht. »Ehrlich gesagt liegst du damit aber gar nicht so verkehrt. Das wäre auch eine Option für mich gewesen, aber letztendlich habe ich mich für Gerontologie entschieden.« Vielleicht hätte ich Berufsberaterin werden sollen.
»Willst du mit runterkommen und die anderen kennenlernen?«, erkundigt er sich. Will ich? Dann hätte ich das Schlimmste zumindest hinter mich gebracht.
»Klar, wenn du mich danach weiter auspacken lässt.«
Mein loses Mundwerk bringt ihn für eine Sekunde aus dem Konzept. Dann hebt er nur abwehrend die Hände. »Natürlich, natürlich! Auspacken ist wichtig. Erst danach ist man richtig angekommen.«
Er hält mir die Tür zu meinem Zimmer auf. Während ich an ihm vorbeigehe, denke ich mir, dass ich es mit einem Lilanen im Bad eigentlich gut getroffen habe. Sauberkeit wird er nicht völlig abwegig finden und das Wort Putzmittel zumindest schon mal gehört haben.
Ich halte kurz inne, um ihm dankend entgegenzulächeln. Wir werden die nächsten Jahre zusammenleben. Verscherzen will ich es mir mit meinen Mitbewohnern nicht.
Erst jetzt fällt mir das Knarren einer Stufe im oberen Bereich der Treppe auf. Vorhin bin ich wohl so mit meinen Koffern am Hantieren gewesen, dass ich das gar nicht bemerkt habe. Ich unterdrücke den Drang, der Sache auf den Grund zu gehen. Eins nach dem anderen.
Im Wohnzimmer warten alle meine neuen Mitbewohner auf mich. Es sind ziemlich viele Farben auf einmal, die auf mich einströmen. Das wilde Wolkengemisch aus unterschiedlichsten Farbnuancen reicht bis an die Decke. Wie der Dunst am Himmelszelt verharrt er nicht auf einer Stelle. Gemächlich wiegt er sich in seinem Umkreis umher, selbst wenn es windstill ist. Zunächst analysiere ich die Leute, die unter sich sind und nicht gerade in eine Unterhaltung vertieft.
Die ausgebleichte Couch nimmt ein oranges Mädchen in Anspruch. Mit Orangen verstehe ich mich für gewöhnlich ausgezeichnet. An der Küchenzeile steht ein beiger Junge, der damit beschäftigt ist, Wasser zu trinken. Auch gegen beige Menschen habe ich generell nichts einzuwenden, aber trotz des Farbchaos wird mir eines schnell klar: In dieser WG gibt es ziemlich viele Persönlichkeiten, die allesamt nicht viel Wert auf Ordnung legen.
Ich wende mich zu dem Mischmasch aus Pink und Helllila. Deren Aura harmoniert von innen und außen so herzig miteinander, dass man die Farbe für eine Einladungskarte zum Geburtstag einer Prinzessin verwenden könnte. Augenblicklich wird mir ganz anders zumute. Dort unterhalten sich ein Mädchen und ein Junge. Wenn mich meine Augen nicht täuschen, gehört das Pink zu dem Mädchen. Ich will keine Vorurteile haben, aber durch vergangene Geschehnisse an meiner Schule weiß ich, wie gerne die Pinken zum Lästern bereit sind – gemeinsam mit ihren mintgrünen Freundinnen. Den Gedanken verdränge ich.
Die letzten, die hier im Raum übrigbleiben, sind zwei Mädchen, beide braun – deshalb verstehen sie sich vermutlich so gut. Erleichtert atme ich aus. Sie werden hier schon für Ordnung sorgen, selbst wenn ich das mal aufgrund von Unistress vergesse.
»Hi, Leute. Das ist Marcia, unsere neue Mitbewohnerin«, stellt Tomke mich vor.
Unterhaltungen stellen sich ein, jeder hat ein Lächeln aufgesetzt. Das orange Mädchen, das vorher noch ausgebreitet auf dem Sofa gelegen hat, richtet sich nun auf. Ihre schwarzen Haare stehen wild in alle Richtungen ab, weil sie sich ungünstig hingelegt hat. Es stört sie überhaupt nicht. »Hi, ich bin Alexia, aber die meisten nennen mich einfach Alex.« Die meisten? Heißt das jetzt, ich soll sie Alex nennen? Oder signalisiert meine Präsenz ihr, wie wenig ich zu den anderen passe?
In meinem Kopf habe ich mir schon zurechtgelegt, mit welchen Menschen ich zuerst Kontakt knüpfen werde. Alex gehört definitiv dazu, deshalb lächle ich ihr warm zu – samt eines kurzen: »Freut mich.«
Als nächstes nähert sich mir der helllilane Junge. Er ist so höflich, mir sogar die Hand zu geben. »Brendan.« Dann ist das also derjenige, der ebenfalls Psychologie studiert. Tomke hat ihn erwähnt. Er hat sich auf jeden Fall für den richtigen Studiengang entschieden. Es passt zu ihm. Wahrscheinlich werde ich an der Uni nun mehr Helllilane treffen, als es sonst der Fall gewesen ist.
Für gewöhnlich sind mir Helllilane zu gefühlsduselig und sentimental, aber ich beabsichtige, mich an sie zu gewöhnen. Die richtigen Gedankengänge durchkreuzen sie meistens.
»Marcia studiert auch Psychologie«, offenbart Tomke sofort, bevor ich dazu in der Lage bin.
Brendans Mundwinkel heben sich. »Wirklich? Dann könnte es sogar sein, dass wir ein paar Kurse gemeinsam haben. Ich habe letztes Semester nicht alle belegt, die eigentlich fürs erste Semester vorgesehen sind.«
Ich kann mir vorstellen, dass er es stumpf verplant oder seine Kurse nicht rechtzeitig gewählt hat und deshalb auf der Warteliste gelandet ist. Typisch Helllila!
»Super, dann kenne ich zumindest schon mal einen Menschen«, sage ich und meine es auch so. Neue Leute kennenzulernen ist für mich die Hölle.
Apropos … Der schöne Moment wird in dem Augenblick zerstört, als sich das blonde Mädchen mit Pferdeschwanz an Brendan vorbeidrängt. Sie kommt direkt auf mich zu. So viel Pink auf einmal ertrage ich nicht. Ich drehe mich zur Seite, zu dem Jungen an der Küchenzeile, und spiele vor, darauf zu warten, dass er sich vorstellt.
Als er jedoch nicht reagiert, muss ich mich zwangsläufig wieder zu dem grellen, pinken Nebel drehen. Auch sie gibt mir die Hand, die ich zögernd ergreife. »Ich bin Loreen.«
Loreen, die Tratschtante, das passt gut. Mir wird schon wieder übel bei dem Gedanken an vergangene Ereignisse. Marcia ist bestimmt total in Luca verschossen, so wie sie den immer anguckt. Unwahrheiten verbreiten können sie. Loreen stellt sich zu Tomke und legt ihren Ellenbogen auf seine Schulter. »Wir studieren auch dasselbe. Das ist echt cool, dann kann man gut zusammen lernen.« Er lächelt schwach und senkt den Blick.
Der Junge an der Küchenzeile nimmt sich einen Apfel aus der Obstschale und dreht sich zu mir. »Ich bin Henri. Sorry, aber ich habe es wirklich eilig. Bestimmt sieht man sich später.« Er beißt in den saftigen Apfel. Kaum hat er das gesagt, ist er schon zur Tür raus.
Das Mädchen, das sich mir noch nicht vorgestellt hat, eine der Braunen, die mit dem kurzen Bob, erklärt mir: »Liegt nicht an dir. Der gute Henri glaubt, einen Studienverlaufsplan, der eigentlich für zwei Semester gedacht ist, auch in einem zu schaffen.«
»Was? Warum?«, frage ich verdutzt. Wenn sie mir das gesagt hätte, als Braune, dann würde es mich nicht weiter wundern. Beige Menschen sind eigentlich nicht für ihre Arbeitsmoral bekannt.
Sie lacht. »Keine Ahnung, das versteht keiner so richtig. Wenn ihr mich fragt, dann will er Geld sparen. Ich bin übrigens Nora«, stellt sie sich vor.
Die andere Braune, die Kleine mit den blonden Strähnen, stellt sich mir jetzt als Paola vor. Anschließend beteiligt sie sich an der Diskussion über Henri. »Aber dann sollte er sich doch besser einen Nebenjob suchen.«
Ich schaue mich im Raum um. Das sind alle. Jetzt habe ich sie kennengelernt und der schlimmste Teil liegt hinter mir. Fazit: Alexia und Brendan. Mit denen kann ich mir eine WG-Freundschaft vorstellen.
»Und wie läuft das jetzt genau mit dem Badezimmer? Und gibt es sowas wie einen Haushaltsplan?«, will ich wissen.
Alexia streckt sich wieder ausgiebig auf dem Sofa. »Immer mit der Ruhe. Du bist gerade erst angekommen. Die Badezimmer haben wir eigentlich nach Geschlecht sortiert, aber da wir nun mehr Mädchen sind und sich immer zu viert ein Badezimmer geteilt wird, hast du leider den Kürzeren gezogen. Sorry.«
Tomke nimmt ein Kissen vom Sofa, um es Alexia gegen den Kopf zu werfen. Es trifft dumpf auf ihren Schädel. »Hey!«, beschwert er sich. »Wir sind ganz bezaubernde Badkollegen. Außerdem gibt es einen Schlüssel.« Die letzten Worte richtet er schelmisch grinsend direkt an mich.
»Und gibt es nun sowas wie einen …«, will ich es wieder versuchen, doch Paola fällt mir ins Wort.
»Wir hatten mal einen, aber wir haben festgestellt, dass es weniger Streit gibt, wenn einfach jeder dann sauber macht, wenn er es für nötig hält. Eine WG-Kasse gibt es wiederum – für Sachen wie Milch und so.«
Na klasse! Sie brauchen vielleicht keinen Putzplan, aber ich werde ganz sicher nicht alles freiwillig saubermachen, wenn ich nebenbei für die Uni lernen muss. Trotzdem will ich nicht bestreiten … Mit Ordnung lebt es sich leichter. Dass diese WG ins Chaos zu versinken droht, passt mir so gar nicht.
Zwei Stunden
Der Himmel ergraut
Getränkt in Langeweile
Müdigkeit durchtrennt mich
Nirgendwo Licht
Nichts bleibt zu tun
Was ist Leben,
wenn alle ruhen?
- Rot
Völlig fertig von der Reizüberflutung des Kennenlernens meiner neuen Mitbewohner lasse ich mich auf das Bett fallen. Der Lattenrost quietscht ein wenig unter meinem Gewicht. Wir haben dann doch länger zusammengesessen, als ich beabsichtigt hatte. Eine Flucht ist aussichtslos gewesen. Am besten, ich räume den Rest morgen nach der Uni in den Schrank. Jetzt brauche ich den nötigen Schlaf, um in der Vorlesung zu glänzen.
Vorher muss ich aber unbedingt ein Q&A mit meinen Followern starten. Das letzte liegt nun schon Ewigkeiten zurück. Ich überfliege die Liste auf meinem Handy, in der ich festhalte, wer in letzter Zeit ein Q&A bekommen hat. Ich stelle fest, dass die Grünen schon eine ganze Weile leer ausgegangen sind. Oje, und die Pinken. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Also gut, ich muss zwar schlafen, aber ein paar Fragen kann ich euch noch beantworten. Heute seid ihr dran, liebe Grünen.
ColourMind via Instagram Storys
21:08 Uhr
Ich suche einen hübschen Hintergrund aus, füge den Text ein und stelle ihn dann in meine Story. Das Bild zeigt eine Frühlingswiese mit Kornblumen. Die grünen Farbtöne passen natürlich ausgezeichnet. Wie zu erwarten treffen sofort die ersten Anfragen ein. Manchmal wundere ich mich, wie schnell Leute tippen.
Häufig wenden sich die Leute an mich, wenn sie wissen wollen, ob eine Beziehung mit Person XY eine gute Idee ist. Diese Fragen beantworte ich zwar, aber nur ungern, weil ich da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Endlich sehe ich eine, die sich nicht um die Liebe dreht.
Ich bin mir unsicher, ob ich zu den Grünen oder den Dunkellilanen zähle. Du hast mal in einem Beitrag gesagt, auch Grüne könnten gut vor Publikum reden. Vielleicht bin ich ja doch nicht dunkellila. Wo ist da der Unterschied?
Freya_loved
21:10 Uhr
Die Welche Farbe bin ich?-Fragen sind fast genau so beliebt wie die Beziehungsfragen.
Hallo Freya, ich kann dein Problem verstehen, aber der Unterschied ist dennoch einfach: In einem Raum voller Menschen erzählt dir jemand von seinen Problemen. Hörst du aufmerksam zu? Bekommst du jedes Wort mit? Hast du sofort den richtigen Ratschlag auf den Lippen? Dann gehörst du zu den Lilanen. Wenn du dir jedoch später denkst: ›Mist! Hätte ich doch was anderes geantwortet‹, dann Willkommen im Club der Grünen!
ColourMind
21:13 Uhr
Die nächsten Fragen beantworte ich nur kurz und knapp. Meine Augen werden dabei immer schwerer. Die letzte Frage wähle ich quasi blind aus, weil mir das Handy vor Müdigkeit aus der Hand gleitet. Es ist, als würde ein Stein gegen den gebrechlichen Knorpel meiner Nase prallen. Oftmals ist das Zufallsprinzip gar nicht so schlecht, denn die Frage ist erfrischend.
Manchmal habe ich das Gefühl, niemand versteht mich. Mein Verhalten ist oft widersprüchlich. Ich passe nirgends hinein.
ZackdieBohne
21:33 Uhr
So geht es mir auch oft. So geht es generell vielen Leuten mit einer seltenen Farbe. Aber vertrau mir, jeder Mensch hat ein Zuhause – auch du. Es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass du deshalb zu den Grünen gehörst. Ich habe in meinen Beiträgen oft erwähnt, dass sich missverstanden zu fühlen ein wichtiges Anzeichen für grüne Menschen ist. Trotzdem solltest du zusätzlich folgende Farben in Betracht ziehen: Dunkelgrau, Rosa, Dunkellila, Helllila, Hellgrau (und eventuell Hellblau).
ColourMind
21:43 Uhr
Erschöpft lasse ich mich ins Kissen fallen und erkläre das heutige Q&A für beendet.
Von weitem höre ich eine mir vertraute Stimme: Brendan. Durch den knisternden Wind der Zweige trifft sie leicht gedämpft an mein Ohr. Ich habe schon zwei Veranstaltungen hinter mich gebracht. Schade, dass sie immer so schnell vorbei sind. Sie sind genauso lehrreich und fabelhaft verlaufen, wie ich sie mir in meiner Fantasie ausgemalt hatte. Erwartet hätte ich lediglich, dass mehr Randgruppen anwesend wären. Klar, ich habe sowohl Grüne, Helllilane als auch Dunkelgraue gesehen, aber letztendlich dominierten trotzdem die Persönlichkeiten, die es sonst auch so häufig anzutreffen gibt.
Trotzdem bin ich glücklich. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen drehe ich mich in Richtung meines Mitbewohners. Mit den Händen an den Schnallen seines Rucksacks kommt er auf mich zu. Die Haare liegen kreuz und quer auf seinem Kopf, als hätte er einen Marathon zurückgelegt.
Unter schweren Atemzügen japst er: »Hi, hast du jetzt auch PP-1 bei Professor Strobel?« Kurz schaue ich ihn ein wenig verwirrt an – wegen der Abkürzung. Die Bezeichnungen habe ich nicht ganz verinnerlicht, doch dass die nächste Vorlesung bei Professor Strobel ist – das weiß ich im Schlaf. Darauf freue ich mich schließlich schon die ganze Zeit. Demnach muss PP-1 für die Einführungsveranstaltung in Persönlichkeitspsychologie stehen.
Ich nicke. Die Vorfreude kann mir vermutlich jeder ansehen. Zwar hüpfe ich nicht wie ein Flummi auf der Stelle, aber meine Hände gleiten im Wechsel zwischen der Brusttasche meiner Sweatshirtjacke und der Hintertasche meiner Jeans hin und her. Unentschlossener über deren Verbleib als der auf Wanderschaft gehende Rasensprenger unserer Nachbarn zuhause in Bayern.
»Cool, ich auch. Ich muss gestehen, ihn letztes Semester nicht gewählt zu haben, weil ich von so vielen Leuten gehört habe, dass sie bei ihm durchgefallen sind.« Nervös spielt er mit den Schnallen seines Rucksacks. Im Gegensatz zu mir hat er vermutlich Angst, den Vorlesungssaal zu betreten. »Aber ich will dir keine Angst machen. Immerhin fünfzig Prozent der Studenten bestehen beim ersten Versuch und viele haben einfach nur nicht gelernt.«
Seine Worte verunsichern mich nicht. Dass Professor Strobels Klausuren so schwer sind, spricht nur noch mehr für ihn. Heutzutage studiert fast jeder Mensch, weil vielen das Abitur in den Arsch geschoben wird. Immer öfter beschleicht mich das Gefühl, gute Noten seien gar nichts mehr wert. Bei Professor Strobel muss man für seinen Erfolg etwas leisten.
Ich zucke unbekümmert die Schultern und setze mich dann wieder in Bewegung. Brendan folgt mir Richtung Hörsaal. »Wir schaffen das schon«, meine ich trocken.
Vielleicht täuscht es, aber ein bisschen bekomme ich tatsächlich das Gefühl, er würde sich entspannen. »Ja, du hast recht.«
Zum Haupthaus führt es uns am Unigarten entlang. Kleine Kieselsteine rascheln unter meinen Fußsohlen. Die schmale Wegführung verwehrt es uns, nebeneinanderzulaufen. Fahnenkraut streift meine Beine und ich weiche den Blättern eines Apfelbaums aus.
Wir erreichen den Eingang des Gebäudes, welcher uns unmittelbar Richtung Hörsaal führt. Der in Marmor gegossene Kopf von Burrhus Frederick Skinner empfängt uns auf eine lernanreizstiftende Weise. Die Säulen, die in die Luft schießen, nehmen einen in die Arme und ziehen mich magnetisierend zu sich, denn dies ist der Ort, an dem ich etwas lernen darf. Auf dem Fußboden klebt ein nach rechts zeigender Pfeil und bestätigt meine Onlinerecherche. Hier geht es geradewegs zu Raum G0661. Über die Wegführung bin ich dankbar. So groß wie der Campus der Skinner University of Berlin ist, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis man sich hier verläuft. Überall Gedränge, überall Farben – eine Warnung mit Erstickungsgefahr wäre angebracht.
»Ich habe auch gehört, dass Professor Strobel einen einfach so drannimmt«, äußert Brendan seine nächsten Bedenken. Ich kann nicht anders, als darüber die Augen zu verdrehen. Er soll sich nicht so anstellen. So rafft er sich zumindest dazu auf, etwas für die Uni zu tun, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Man wählt einen Studiengang schließlich nicht ohne Grund.
»Dann sollten wir uns wohl auf den Arsch setzen und was tun.«
Die Wortwahl belächelt er, nickt dann aber. Psychologie hat einen hohen Numerus clausus. Mir ist bewusst, dass meine Mitstudenten nicht allesamt dumm oder faul sind. Trotzdem vergessen viele immer wieder, dass wir nicht mehr in der Schule sind und Fleiß jetzt cool sein darf.
Noch bevor wir das Schild mit der entsprechenden Raumnummer ausmachen, wird mir klar, dass wir hier richtig sind. Der Hörsaal liegt hinter einer kleinen Treppenerhöhung. Am Geländer verharren vereinzelte Studenten auf den Stufen, den Rücken gegen Stahl gepresst, die Augen vom Licht des Bildschirms angezogen. Dahinter ist das Farbchaos umso explosiver. Unzählige Menschen sammeln sich vor der Tür und warten auf einen Freund oder eine Freundin. Mit Menschenansammlungen werde ich wohl nie zurechtkommen. Der Nebel leuchtet zu grell. So viele Eindrücke auf einmal kann mein dunkelgraues Gehirn nur schwer verarbeiten.
Daher bemerke ich etwas spät, dass Brendan anhält, um mit einem Kommilitonen zu quatschen, den er wahrscheinlich aus seinem ersten Semester kennt. Fluchend schlage ich wieder die Richtung ein, aus der ich gekommen bin.
Er steht neben einem Studenten, der ähnlich lockige Haare wie Brendan besitzt, auch wenn Brendans Braunton um einige Nuancen dunkler ist. Der Junge mit dem hellgrauen Nebel, der sich angeregt mit Brendan unterhält, hat für die heutige Vorlesung extra ein weißes Hemd angezogen. Wie ernst er die erste Uniwoche nimmt, im Zusammenspiel mit seiner hellgrauen Farbe, macht ihn mir sofort sympathisch.
Gerne hätte ich mich ihm vorgestellt, doch ich beabsichtige, einen Platz weit vorne im Hörsaal zu erwischen. »Ich geh schon mal rein. Soll ich dir einen Platz freihalten?«, frage ich Brendan.
Er blickt kurz auf die Uhr an seinem Handgelenk. »Ja, das wäre nett. Bin gleich da.«
Beim Betreten des Raums stelle ich schnell fest, dass ich mich gar nicht beeilen hätte müssen. Die Studenten, die schon da sind, nehmen die Reihen ganz weit hinten in Anspruch, damit sie ja nicht von dem bösen, bösen Professor Strobel entdeckt werden.
Mir ist das egal. Ich setze mich trotzdem direkt in die zweite Reihe. Die erste lasse ich aus Höflichkeit frei, falls irgendwelche wichtigen Leute seinem Vortrag folgen. Ein bisschen bin ich enttäuscht, dass Professor Strobel noch nicht da ist. Vielleicht hätte ich ihn vor der Veranstaltung ansprechen können. Es ist jedenfalls meine volle Absicht, ihn bei Gelegenheit bezüglich meiner Theorie zu befragen. Insbesondere, ob sie ein geeignetes Thema für eine Doktorarbeit wäre.
Ich klappe einen Stuhl in der Mitte der Reihe um, lasse den Rucksack über die Schultern gleiten und setze mich auf meine Jeansjacke. Während ich meinen Notizblock mit Überschrift und Datum versehe und eine zusätzliche Spalte für Fragen anfertige, merke ich aus dem Augenwinkel, wie der Saal immer voller wird.





























