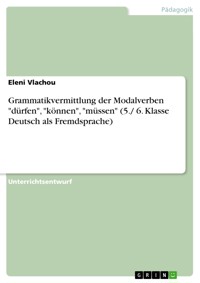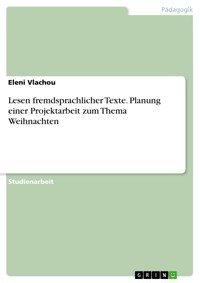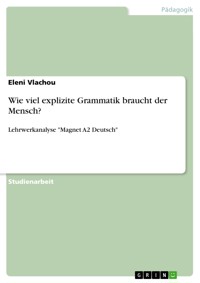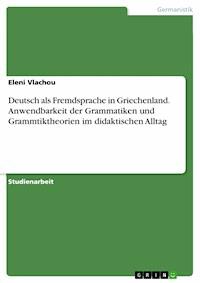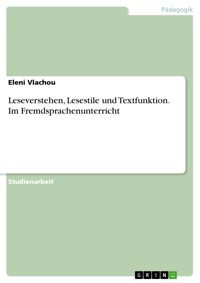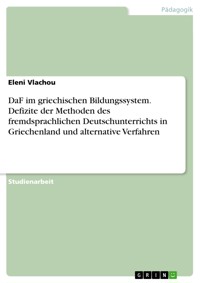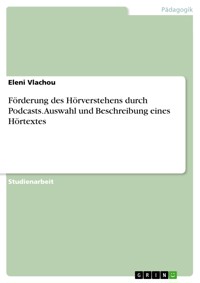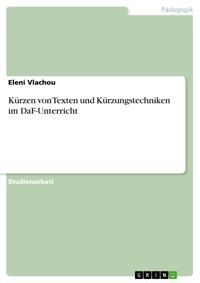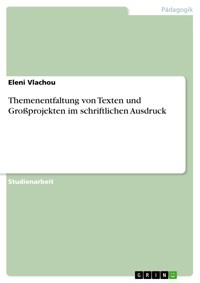
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Deutsch als Fremdsprache, DaF, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Fernuniversität Patras), Sprache: Deutsch, Abstract: Schreiben ist ein Prozess, der stark von kognitiven Aktivitäten wie dem Nachdenken über den Inhalt des Ausdrucks, die sprachliche Form etc. begleitet wird. Es ist eine mitteilungsbezogene und produktionsorientierte Tätigkeit zum schrittweisen entstehen von Texten. Pragmatisch gesehen gilt Schreiben als Verfahren der Informationsvermittlung. Die folgende in mehreren Kapiteln strukturierte Arbeit, befasst sich mit der produktiven Fertigkeit Schreiben. Ziel der Arbeit ist es die Themenentfaltung schriftlicher Texte im Allgemeinen aber auch in Anlehnung auf den Bericht mit dem Titel „Digitales Klassenzimmer steckt noch in den Kinderschuhen“ zu beschreiben und die Durchführung eines Großprojekts, in dem die Schüler den schriftlichen Ausdruck anhand von Übungen trainieren, darzustellen. Die Arbeit beginnt mit der Definition bzw. Beschreibung des Terminus Themenentfaltung. Im weiteren Verlauf wird die Themenentfaltung, des im Anhang beigefügten Textes bestimmt und die Durchführung eines Großprojekts beschrieben. Es folgen die Beschreibung der Lernergruppe und der Lehrinstitution, die Darstellung des Phasenplans, der Vorbereitung und des Projektprozesses. Gegen Ende der Arbeit wird eine Prozess- und Produktevaluation durchgeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Themenentfaltung schriftlicher Texte
1.1. Bestimmung der Themenentfaltung des beigefügten Textes
1.2. Vorteil der narrativen Themenentfaltung im Fremdsprachenunterricht
2. Durchführung eines Großprojekts im schriftlichen Ausdruck
2.1. Beschreibung der Lernergruppe
2.2. Darstellung des Phasenplans
2.3. Vorbereitung und Projektprozess
2.4. Prozess- und Produktevaluation
3. Zusammenfassung
4. Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang
0. Einleitung
Schreiben ist ein Prozess der stark von kognitiven Aktivitäten wie dem Nachdenken über
den Inhalt des Ausdrucks, die sprachliche Form etc. begleitet wird. (Vgl. Storch 1999: 248) Es ist eine mitteilungsbezogene und produktionsorientierte Tätigkeit zum schrittweisen entstehen von Texten. Pragmatisch gesehen gilt Schreiben als Verfahren der Informations-vermittlung. (Vgl. Kast 1999:22)
Die folgende in mehreren Kapiteln strukturierte Arbeit, befasst sich mit der produktiven Fertigkeit Schreiben.
Ziel der Arbeit ist es die Themenentfaltung schriftlicher Texte im Allgemeinen aber auch in Anlehnung auf den Bericht mit dem Titel „Digitales Klassenzimmer steckt noch in den Kinderschuhen“ zu beschreiben und die Durchführung eines Großprojekts, in dem die Schüler den schriftlichen Ausdruck anhand von Übungen trainieren, darzustellen.
Die Arbeit beginnt mit der Definition bzw. Beschreibung des Terminus Themenentfaltung. Im weiteren Verlauf wird die Themenentfaltung, des im Anhang beigefügten Textes bestimmt und die Durchführung eines Großprojekts beschrieben.
Es folgen die Beschreibung der Lernergruppe und der Lehrinstitution, die Darstellung des Phasenplans, der Vorbereitung und des Projektprozesses.
1. Themenentfaltung schriftlicher Texte
Ein Text ist eine komplex strukturierte, thematisch wie konzeptuell zusammenhängende sprachliche Einheit, mit der ein Sprecher eine sprachliche Handlung mit erkennbarem kommunikativem Sinn vollzieht. (Vgl. Linke/Nussbaumer/Portmann 1991:275)
Als Thema eines Textes kann die komprimierteste Fassung des Schriftstücks angesehen werden. In einem Text werden zentrale Textgegenstände immer wieder aufgenommen. Dadurch kann der Leser das Thema erschließen. Jeder Text hat ein Hauptthema, aus dem wiederum Nebenthemen ableitbar sind.
Das Thema kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden. Man kann etwas beschreiben, man kann etwas erklären, man kann Argumente vorbringen, man kann etwas erzählen. Die Ausführung des Themas wird thematische Entfaltung bezeichnet.
Die thematischen Kategorien sind also: 1. die deskriptive Themenentfaltung 2. die explika-tive Themenentfaltung 3. die argumentative Themenentfaltung 4. die narrative Themenentfaltung.(http://www.slm.unihamburg.de/ifg1/Personal/Schroeder/Seminarmaterial/WS-06-07/Sem_II/II_Textlinguistik.pdf)
Theisen (Theisen 1999:22ff) spricht ebenfalls von den vier verschiedenen Themenentfaltungen. Bei der deskriptiven Themenentfaltung wird ein Thema in seinen Komponenten dargestellt und in Raum und Zeit eingeordnet.
Bei der explikativen Themenentfaltung wird ein Sachverhalt (Explanandum) aus einem bestimmten anderen Sachverhalt (Explanans) logisch abgeleitet. Das Explanans besteht aus Anfangs-/Randbedingungen und allgemeinen Gesetzesmäßigkeiten. Eine expilkative Themenentfaltung liegt immer vor, wenn die Einteilung in Explanandum (das, was erklärt werden soll) und Explanans (das, was erklärend ist) erkennbar/rekonstruierbar ist. (http://www.slm.uni-hamburg.de/ifg1/Personal/Schroeder/Seminarmaterial/WS-06-07/Sem_II/II_Textlinguistik.pdf)
Theisen (Theisen 1999:27) differenziert bei der explikativen Themenentfaltung zwischen zwei Aussagearten; den allgemein gültigen und den singulären Aussagen.
Bei der argumentativen Themenentfaltung werden Thesen (Behauptungen) aufgestellt, die durch Argumente (Begründungen) gestützt werden. Diese „Behauptungen“ repräsentieren das Textthema. Die Begründungen werden durch Aussagen gestützt. Ausnahmebedingungen für die Begründungen werden ebenfalls angegeben d.h. die Vor- und Nachteile bzw. Pro und Contras zu einem Thema, werden schriftlich dargestellt. (http://www.kripahle-online.de/unterricht/?page_id=648)
Bei der vierten Art der Themenentfaltung, der narrativen Themenentfaltung, wird ein Thema durch ein abgeschlossenes singuläres Ereignis repräsentiert. (http://www.slm.uni-hamburg.de/ifg1/Personal/Schroeder/Seminarmaterial/WS-06-07/Sem_II/II_Textlinguistik.pdf)
Theisen (Theisen 1999: 41) meint, dass das primäre Interesse von Erzählungen darin besteht, den Leser zu unterhalten und nicht zu belehren, zu informieren oder zu unterrichten.
1.1. Bestimmung der Themenentfaltung des beigefügten Textes
Wie auch in Kapitel 1. schon erwähnt wurde, spricht Theisen von vier verschiedenen thematischen Entfaltungen; die Rede ist von der deskriptiven, der explikativen, der argumentativen und der narrativen Textentfaltung.
Deskribieren bedeutet beschreiben, mit explizieren ist das „Erklären“ gemeint. Argumentieren steht für begründen und belegen, mit Narration ist die Erzählung gemeint.
Bei dem Text mit dem Titel „Digitales Klassenzimmer steckt noch in den Kinderschuhen“, handelt es sich um einen deskriptiven Text.
Im Bericht wird die Durchführung eines Mathematikkurses mit technischer Ausstattung, beschrieben. Die Aussagen des Lehrers Andreas Pallack und der Professorin Kerstin Mayberg, werden vom Autor, dem Leser überliefert.
In den Zeilen 4-6 z.B. wird der Unterricht mit Tablet-Computern, so wie ihn der Lehrer Andreas Pallack schildert, wiedergegeben. [1] In den Zeilen 14-16 und 25-31, wird die Ansicht der Professorin Mayberg, dargelegt.[2]
Durch die Nennung der konkreten Quellen (hier nicht einfach „ein Lehrer“ und „eine Professorin“ sondern „Andreas Pallack“ und „Kerstin Mayberg“), wird der genaue Stellenwert der Information mitgeliefert. Voriges ist ein Merkmal deskriptiver Texte.
Auch die Konjuktive, die herauszulesen sind, geben zu verstehen, dass es sich um einen beschreibenden Text handelt.
In der Zeile 12 „Der Mehrwert sei beachtlich…werde aktiver und selbstständiger.“[3] und 31 „Das könne unabhängig… .“[4], gibt der Autor die Aussagen seiner Quellen, distanziert wieder.
Das ist laut Theisen (Theisen 1999: 24) ein weiteres Merkmal deskriptiver Texte.
Die deskriptive Themenentfaltung des Textes kommt hier mit der argumentativen Textentfaltung in Verbindung; Voriges lässt sich aus der folgenden Tatsache folgern: im Schriftstück sind die Vorteile des Lernens mit digitalen Mitteln, herauszulesen. Ausnahmebedingungen werden ebenfalls repräsentiert.
In den Zeilen 4-6 z.B. „Die Schüler haben….flexibel gestaltet.“ und 8-10 „Der Kurs hat jederzeit Zugriff auf… .“[5], werden einige Vorteile beschrieben. In den letzten Zeilen des Berichts, wird die erwähnte „Ausnahmebedingung“, dargelegt; „Andere arbeiten allerdings zu Hause lieber mit handfestem Buch. Manche fühlen sich von sozialen Netzwerken abgelenkt“.[6]
Alles in allem: Der Text ist deskriptiv, beinhaltet aber auch argumentative Elemente.
1.2. Vorteil der narrativen Themenentfaltung im Fremdsprachenunterricht
Folgende Fragestellung sollte von uns bearbeitet werden: „Welchen Vorteil hat das Schreiben narrativer Texte im Fremdsprachenunterricht?“
Narrative Texte repräsentieren eine Abfolge von Handlungen oder allgemein von Ereignissen, die auf verschiedene inhaltliche Weise miteinander verknüpft sind.
Erzählende Texte können andere Textformen enthalten (z.B. argumentative, deskriptive), wie auch deskriptive und argumentative Texte, erzählende Einschübe enthalten können. (http://amor.cms.hu-berlin.de/~h2816i3x/Lehre/2006_VL_Text/VL_Text_06_Narration.pdf)
Das Schreiben von Texten mit einer narrativen Themenentfaltung im Fremdsprachenunterricht ist vorteilhaft, weil das Verfassen solcher Texte die inhaltliche und sprachliche Phantasie anregt und die Phantasie herausfordert.
Darüber hinaus verzeihen spannend erzählte Geschichten, sprachliche Fehler und motivieren den einen, diese zu beheben. (Vgl. Theisen 1999:51f)
2. Durchführung eines Großprojekts im schriftlichen Ausdruck
Als Projektunterricht oder auch Projektarbeit, wird die Lern- bzw. Unterrichtsform bezeichnet, bei der praktisches Tun und Lernen miteinander verknüpft werden. Die Lernenden bearbeiten bei einem Projekt selbstständig, in Kooperation mit anderen Lernenden ein Thema, das sie gemeinsam mit dem Lehrenden bestimmt und ausgewählt haben. Erworbene Kenntnisse werden dabei aktiviert und erweitert. Hinzukommend lernen die Sprachkursteilnehmer Hilfsmittel richtig ein zu setzten, autonom zu arbeiten, Dinge selbstständig zusammen zu stellen und diese als Ganzes Ergebnis zu präsentieren. (http://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Projektunterricht)
Differenziert wird zwischen dem Mini- und dem Großprojekt. Ein Miniprojekt kann in einer oder auch mehreren Stunden durchgeführt werden. Ein „Großprojekt“ hingegen, wird in einem größeren Zeitraum durchgeführt. Die Dauer wird meistens vom Lehrenden oder der Lehrinstitution bestimmt.
(http://class.eap.gr/LotusQuickr/ger51/PageLibraryC2256E84004300AE.nsf/0/DA0B0699B959C0ACC2257ABC00345769/$file/Vom%20Text%20zum%20Projekt.pdf)
Das Großprojekt das hier beschrieben wird, hat als Schwerpunkt den schriftlichen
Ausdruck und wird in einem Zeitraum von zwei Wochen durchgeführt. In jeder Woche findet zwei Mal ein zweistündiger Unterricht in DaF statt d.h. es handelt sich um ein Großprojekt mit einer Laufzeit von acht Unterrichtsstunden.
2.1. Beschreibung der Lernergruppe
Bei der Lernergruppe handelt es sich um sechs Erwachsene im Alter von 22-27 Jahren. Vier davon sind weiblich, zwei männlich. Die Teilnehmer sind alle griechischer Herkunft, das Sprachniveau ist C1. Sie haben Lernerfahrung aus dem Kindergarten, dem muttersprachlichen Unterricht in der Grundschule, dem Gymnasium, dem Lyzeum und der Universität. Sie haben Englisch als erste Fremdsprache und mehrere Jahre DaF- Erfahrung. Bei der Institution handelt es sich um ein Sprachenzentrum in Thessaloniki. Das Sprachenzentrum bietet das Erlernen von Deutsch, Englisch und Französisch an (je nach Sprache Niveau A1-C1/C2- Teilnahme gegen Gebühr). Im Sprachenzentrum sind insgesamt sechs Fremdsprachenlehrer bzw. Kursleiter eingestellt und 65 Lernende eingeschrieben. Folgende Medien sind vorhanden: Beamer, Interaktiver Whiteboard, Laptop, CD-Player, OHP, Fernseher. Die curricularen Vorgaben schreiben vor, dass am Ende des Jahres C1+ erreicht werden muss.
Zum Lernerprofil: Die Teilnehmer sind Deutschland, der deutschen Kultur und der deutschen Sprache gegenüber positiv gestimmt. Sie möchten die Sprache so gut wie möglich beherrschen. Drei Teilnehmer möchten als Erasmus-Studenten nach Deutschland gehen, zwei weitere möchten ein Postgraduiertenstudium in Deutschland absolvieren. Der sechste Teilnehmer will das C1-Sprachdiplom als Zusatzqualifikation für seine Arbeitsstelle erwerben.
Zu der Gruppendynamik ist folgendes festzuhalten: Es gibt ein gutes Verhältnis zwischen den Kursteilnehmern und es herrscht eine angenehme Atmosphäre.
2.2. Darstellung des Phasenplans
Neben dem Unterrichten selbst, ist die Vorbereitung und Planung des Unterrichts eine der
Haupttätigkeiten Lehrenden. Didaktiker haben als Hilfsmittel unterschiedliche
Unterrichtsmodelle entwickelt. Diese bestehen aus mehreren Phasen. Das Modell das hier
beschrieben wird ist das von Marianne Lehker. (http://www.iudicium.de/InfoDaF/contents/InfoDaF_2003_Heft_6.htm)
Das Modell besteht aus folgenden Phasen: 1. Projektplanung 2. Projektdurchführung 3. Projektpräsentation 4. Projekt reflektieren.
Bei der ersten Phase wird das Projekt geplant und vorbereitet. Die Teilnehmer werden in Gruppeneingeteilt, die Aufgaben und die Darstellungsform der Präsentation, werden bestimmt. Bei Phase zwei wird das Material gesammelt, ausgewertet und zusammengestellt.